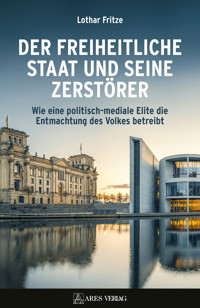
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ares Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der deutsche Staat wird seit vielen Jahren in einer Weise tätig, die einer repräsentativen Demokratie nicht angemessen ist. Ein demokratischer Staat legitimiert sich allein durch die Zustimmung seiner Staatsbürger. Die Staatsbürger stimmen den Regeln zu, nach denen allgemeinverbindliche Entscheidungen von auf Zeit gewählten Repräsentanten getroffen werden. Diese Ermächtigung der Repräsentanten umfasst allerdings nicht Entscheidungen, die zwangsläufig zu einer grundlegenden Umgestaltung der Lebensweise oder zu einer Neuzusammensetzung des Volkes führen müssen, ohne dass eine qualifizierte Mehrheit des Volkes dem ausdrücklich zugestimmt hätte. Ein Souverän, der die Befugnisse für Entscheidungen einer solchen Tragweite delegierte, beispielsweise an die Europäische Union, hätte seine Souveränität damit selbst aufgegeben. In seiner ausgewogenen, sachlich genau fundierten Analyse begründet der Autor diesen demokratietheoretischen Ansatz und arbeitet die Grenzen, die einer legitimen Tätigkeit eines demokratischen Staates gezogen sind, allgemeinverständlich heraus. An einer Reihe von Beispielen demonstriert er, wie der deutsche Staat – und Ähnliches ließe sich für andere westliche Demokratien zeigen – diese Grenzen laufend überschreitet und durch seine Übergriffigkeit seine eigene Legitimation zerstört.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 456
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lothar Fritze
DER FREIHEITLICHE STAAT UND SEINE ZERSTÖRER
Lothar Fritze
DER FREIHEITLICHESTAAT UND SEINEZERSTÖRER
Wie eine politisch-mediale Elitedie Entmachtung des Volkes betreibt
Umschlaggestaltung: Werbeagentur Rypka, A-8143 Dobl
Umschlagabb. Vorderseite: iStock.com / frankpeters
Umschlagabb. Rückseite: Archiv des Autors
Wir haben uns bemüht, bei den hier verwendeten Bildern die Rechteinhaber ausfindig zu machen. Falls es dessen ungeachtet Bildrechte geben sollte, die wir nicht recherchieren konnten, bitten wir um Nachricht an den Verlag. Berechtigte Ansprüche werden im Rahmen der üblichen Vereinbarungen abgegolten.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter https://www.dnb.de abrufbar.
Hinweis: Dieses Buch wurde auf chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt. Die zum Schutz vor Verschmutzung verwendete Einschweißfolie ist aus Polyethylen chlor- und schwefelfrei hergestellt. Diese umweltfreundliche Folie verhält sich grundwasserneutral, ist voll recyclingfähig und verbrennt in Müllverbrennungsanlagen völlig ungiftig.
Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne kostenlos unser Verlagsverzeichnis zu:
Ares Verlag GmbH
Hofgasse 5 / Postfach 438
A-8011 Graz
Tel.: +43 (0)316/82 16 36
Fax: +43 (0)316/83 56 12
E-Mail: [email protected]
www.ares-verlag.com
ISBN 978-3-99081-144-3 eISBN 978-3-99081-146-7
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger jeder Art, auszugsweisen Nachdruck oder Einspeicherung und Rückgewinnung in Datenverarbeitungsanlagen aller Art, sind vorbehalten.
© Copyright by Ares Verlag, Graz 2025
Layout: Werbeagentur Rypka, A-8143 Dobl
Inhalt
Vorwort
Einleitung
I. Die Idee des freiheitlichen Staates
1. Selbstbestimmung
2. Freiheit und Gleichheit
II. Die Legitimität des freiheitlichen Staates
1. Legitimität und Stabilität
2. Anerkennungswürdigkeit
3. Legitimitätsglaube und Anerkennung
4. Legitimitätsansprüche
5. Die Legitimitätsidee demokratischer Staaten
III. Legitimationsvoraussetzungen des freiheitlichen Staates
1. Legitimation erzeugende Zustimmung
2. Bedingungen einer Herrschaft legitimierenden Zustimmung
3. Kognitive Selbstbestimmung
4. Zur Praxis einer rationalen Urteils- und Willensbildung
5. Legitimationsbedarf
IV. Der freiheitliche Staat als Staatsform des gelebten Skeptizismus
1. Manipulationsverbot
2. Missionierungsverbot
V. Bedingungen der Möglichkeit eines freiheitlichen Staates
1. Das Recht auf Privilegierung des Eigenen
2. Kulturelle Evolution
3. Koexistenzfähigkeit und sozialer Zusammenhalt
4. Legitimitätsgrenzen staatlichen Handelns122
5. Demokratiefeindliche Grenzüberschreitungen
6. Ein liberalistisches Missverständnis
7. Die Gefahr der totalitären Entartung
VI. Der Kampf gegen den freiheitlichen Staat
1. Okkupation des Staates und Spaltung der Gesellschaft
2. Propaganda
3. Themensetzung, ”Moralisierung“ und Einschüchterung
4. Moralische Ächtung politischer Gegner
5. Erzwingung von Unterordnung
6. ”Methodischer Stalinismus“
VII. Die Zerstörung des freiheitlichen Staates
1. Streben nach ideologischer Hegemonie
2. Noch einmal: Die Gefahr des Abgleitens in totalitäre Verhältnisse
3. Angriff auf die Bedingungen einer rationalen Überzeugungsbildung
4. Funktioniert der freiheitliche Staat auch in Gefahrensituationen?
5. Untergrabung der Funktionsbedingungen der Demokratie
6. Zersetzung der institutionellen Grundstruktur der Demokratie
VIII. Die Selbstfesselung des freiheitlichen Staates
1. Geistige Selbstkastration
2. Wachsende Irrationalität
3. Ideologische Unterwanderung von Staat und Gesellschaft
4. Missbrauch des Staates im Kampf um ideologische Hegemonie
5. Auf einer schiefen Bahn
6. Bürokratisches Eigenleben
7. Mangel an Realismus
IX. Fazit
1. Der Wille zur gesellschaftlichen Transformation
2. Zerstörung der demokratischen Legitimationsbasis
3. Am Scheideweg
4. Was bleibt?
Statt eines Nachwortes
Endnoten
Literaturverzeichnis
Personenverzeichnis
Sachverzeichnis
Vorwort
Unbekümmert in den Tag zu leben wird immer schwieriger. Diese Feststellung, so scheint mir, gilt altersunabhängig. Nur Ignoranz kann den Glauben unangetastet lassen, dass mit Deutschland alles zum Besten stehe und fähige Politiker das Land in eine gute Zukunft führten. Allenthalben sind Verunsicherung, Unbehagen und Missmut zu beobachten. Es sind die Menge und Größe der gleichzeitigen Krisen sowie der eklatante Unwille und die fehlende Kraft des politischmedialen Komplexes, sich den gesellschaftlichen Verwerfungen mit der gebotenen Ernsthaftigkeit zu stellen, die im Volk Zweifel und Verzweiflung aufkommen lassen.
In Deutschland und vermutlich in allen Staaten des demokratischen Westens sind Formen politischer Machtausübung entstanden, die – gemessen an den Prinzipien eines freiheitlichen Staates – als illegitim zu gelten haben. Die Bürger dieser Länder leben in Staaten, die in dem Sinne übergriffig geworden sind, als sie Mittel der Herrschaftssicherung einsetzen, die die unverzichtbaren Bedingungen einer freien Selbstbestimmung der Menschen zerstören. Die westlichen Demokratien sind dergestalt in einen Funktionsmodus geraten, der sie auf einer schiefen Ebene in eine Staatsform abgleiten lässt, die mit den herkömmlichen politikwissenschaftlichen Begriffen nicht mehr adäquat fassbar ist. Sie stehen heute vor der existenziellen Herausforderung, diesen Weg in die Selbstzerstörung zu verlassen. Dies heißt, dass die Voraussetzungen wiederherzustellen sind, unter denen freiheitliche demokratische Staaten Legitimation gewinnen können.
Lothar Fritze
Juli 2024
Chemnitz
Einleitung
Was eigentlich geschieht derzeit im Westen? Von welchem Furor befallen sind seine Eliten? Von welchen Ideen werden die Mächtigen und Einflussreichen geleitet? Welche Interessen verfolgen sie? Und wohin wird uns dies führen?
Wer die offene Gesellschaft und den freiheitlichen Staat schätzt, vermag eine Reihe von Vorgängen in unserem Land nur noch mit ungläubigem Staunen zur Kenntnis zu nehmen. Eine politisch-mediale Elite zieht derzeit alle Register, um ihre ideologische Vorherrschaft zu zementieren, eine von ihr favorisierte Werteordnung zu etablieren und tiefgreifende gesellschaftliche Umgestaltungen auf den Weg zu bringen.
Ihr Minimalziel ist eine multikulturelle Einwanderungsgesellschaft, in der Aspekte der gemeinsamen Abstammung, Traditionen sowie nationale Interessen und kulturelle Eigenheiten eine immer geringere Rolle spielen. Kosmopolitisch eingestellte Denker und Politiker betrachten die Idee des Nationalismus – das ist die Auffassung, dass die Welt vorzugsweise in Gestalt souveräner Nationalstaaten politisch geordnet sein sollte – als historisch überlebt und moralisch defizitär. Sie glauben, dass vom Nationalismus jeder Form, also auch von einem nicht chauvinistischen und nicht imperialistischen Nationalismus, überwiegend negative, insbesondere friedensgefährdende Wirkungen ausgingen. Ihr langfristig zu realisierendes politisches Ideal ist der demokratische Weltstaat. Dass sich ein solcher auch als Despotie erweisen könnte, wird nicht angemessen reflektiert.
Mit wachsendem Stoff- und Energieumsatz des wirtschaftlichen Handelns der Menschheit und der daraus resultierenden Notwendigkeit, auch ökologische Gesichtspunkte in den Blick zu nehmen, stehen Umstrukturierungsprozesse an, die von dieser Elite genutzt werden, um eigene Vorstellungen von einer „gesellschaftlichen Modernisierung“, von einem „Aufbrechen von Macht- und Gewaltverhältnissen“ sowie von einer „Überwindung der herkömmlichen Lebensweise“ notfalls auch gegen den Willen der Mehrheit durchzusetzen.
Vertreter dieses Ideensystems finden sich in allen „staatstragenden“ Parteien, in den Leitmedien sowie insbesondere in den Bereichen der Wissenschaft, der Kultur und der Kirchen. Insoweit sie einflussreiche Positionen in Staat und Gesellschaft bekleiden oder als Wissenschaftler, Künstler, Pädagogen oder Theologen geistigen Einfluss ausüben, bilden sie eine Gruppe Gleichgesinnter, die als eine die Politik und die Medien dominierende Elite die Geschicke des Landes maßgeblich bestimmt.
Jener Komplex von Politikern, Journalisten, Intellektuellen und Akademikern mit weitgehend übereinstimmenden politischen und moralischen Grundüberzeugungen hat sich aufgemacht, nicht nur das Volk zu regieren, sondern große Teile des Volkes in ihrem Willen zu brechen. Diese Elite kämpft um die Kommandohöhen von Staat und Gesellschaft; sie kämpft darum, ihre bereits errungene kulturelle Hegemonie institutionell abzusichern und ihre Auffassungen und Interessen mithilfe des Staates und dessen machttechnischen sowie finanziellen Ressourcen durchzusetzen. Sie ist auf dem Weg, staatliche Institutionen, Sicherheitsapparate, Wissenschaft, Bildung sowie insbesondere die öffentlich-rechtlichen Medien inhaltlich zu dominieren, Grund- und Freiheitsrechte einzuschränken und eine ideologisch geschlossene Gesellschaft herzustellen. Der Staat ist ihr Instrument; weltweit operierende Konzerne, Banken und Vermögensverwalter sind – solange sie sich als Profiteure der Transformationsprozesse begreifen – ihre Mitstreiter; milliardenschwere Stiftungen und mit Steuergeldern finanzierte Nichtregierungsorganisationen fungieren als Unterstützer.
Die Angehörigen dieser einflussreichen, überwiegend politisch linksorientierten Minderheit, insbesondere aber ihre intellektuellen Führer sind in der Regel akademisch gebildet und stammen wohl mehrheitlich aus gut situierten Kreisen. Sie halten sich für aufgeklärt, progressiv, gerechtigkeitssensibel und moralisch überlegen. Ihre Lebensstile sind auf individuelle Selbstverwirklichung gerichtet; sie schätzen Diversität, geben sich weltoffen und äußern sich politisch korrekt. Zugleich wird ihr missionarischer Eifer, der mit einer autoritären Besserwisser- und Erziehungsattitüde korreliert, von der Mehrheit als abstoßend und undemokratisch empfunden.
Bei allen Meinungsunterschieden im Konkreten lassen sich grundsätzliche Auffassungen identifizieren, die innerhalb dieser Elite tendenziell vertreten werden. Charakteristisch sind moralisch-universalistische Grundüberzeugungen: Die Interessen aller Menschen, egal wie nah oder fern sie uns in emotionaler oder räumlicher Hinsicht stehen, sollen in unsere moralischen Überlegungen einbezogen und letztlich gleich behandelt werden; der Einzelne soll sich verpflichtet fühlen, gleiche Interessen gleichermaßen zu berücksichtigen, unabhängig davon, wer diese Interessen hat. Das heißt, die bislang als selbstverständlich geltende bevorzugte Verwirklichung eigener Interessen, einschließlich der Interessen von Kindern, Eltern, Verwandten, Freunden und von Angehörigen des eigenen Volkes, soll er als moralisch problematisch erkennen und unterlassen – auch wenn sich die allermeisten in aller Welt anders verhalten. Ein gleiches Existenzrecht und ein gleicher Anspruch auf Berücksichtigung ihrer Interessen wird auch (allen) potenziell zukünftigen Generationen zugesprochen; zugleich dürfte noch nicht geborenen, aber bereits gezeugten menschlichen Wesen das elementarste Recht, nämlich das Recht auf Leben, von den meisten von ihnen abgesprochen werden.
Ein Kennzeichen vieler der dem Volk nahegebrachten moralischen Forderungen ist eine spezifische Maßlosigkeit. Diese Forderungen leiten sich aus den Grundsätzen idealer Moraltheorien ab, in denen die Akzeptanz des moralisch-universalistischen Standpunktes schon immer unterstellt ist. Ideale Moraltheorien formulieren unter bewusster Ausblendung von Realisierungsbeschränkungen ethisch wünschenswerte Weltzustände. Als solche haben sie eine Orientierungs- und Maßstabsfunktion. Werden jedoch die in einer idealen (beziehungsweise in der von Teilen der herrschenden Elite für ideal gehaltenen) Welt geltenden Verhaltensgrundsätze als moralische Forderungen im Hier und Jetzt postuliert, erwartet man von den Menschen, dass sie sich lebensuntüchtig verhalten. Wer Menschen zumutet, sich weltweit geltenden Gerechtigkeitsgrundsätzen zu unterwerfen, denen man – wenn überhaupt – nur dann zustimmen würde, wenn man das, was man zum einen über sich selbst und seine eigene Lage, seine Familie und sein Land sowie zum anderen über den Zustand der Welt und das strategische Handeln maßgeblicher Akteure weiß, alles nicht wüsste, überfordert sie. Wird gar ein Verhalten, das solchen Verhaltensgrundsätzen entspricht, gesetzlich vorgeschrieben, können die Menschen (insbesondere dann, wenn Kosten-Nutzen-Betrachtungen unterbleiben) gezwungen werden, ihre legitimen Interessen zu missachten.
Zudem neigen viele Vertreter dieser Elite dazu, ohne Berücksichtigung der realen anthropologischen und sozialen Gegebenheiten Programme zur Erschaffung dieser imaginierten idealen Welt zu entwerfen. Die mögliche Überforderung der Adressaten sowie Fragen der Durchsetzbarkeit angesichts der faktischen Machtverhältnisse werden dabei regelmäßig unterschätzt oder bleiben ebenso unberücksichtigt wie die erwartbaren Konsequenzen für die eigene Selbstbehauptung sowie das eigene Wohlergehen. Und selbst dann, wenn mit Problemen der praktischen Umsetzung gerechnet wird, ist man der (durchaus angreifbaren) Meinung, dass das Leben in einer Welt des praktizierten moralischen Universalismus – in einer Welt, in der uns jeder Mensch gleich viel bedeutete und in der wir uns jedem Menschen gegenüber in gleicher Weise verpflichtet fühlten – vorzugswürdig wäre.
Moralisch-universalistische Überzeugungen stehen mit einer kosmopolitischen Orientierung in Verbindung und haben demokratietheoretische Konsequenzen. Solche Auffassungen sind: Die Organisation des menschlichen Zusammenlebens in Nationalstaaten gehöre der Vergangenheit an und habe keine Zukunft; jeder Mensch solle staatsübergreifend eine freie Wahl seines Wohnsitzes haben, weshalb das unerlaubte Überschreiten von Staatsgrenzen entkriminalisiert und illegale Migration in legale verwandelt werden müsse; wer in Deutschland lebt und arbeitet, solle das Wahlrecht erhalten, da nur so dem demokratischen Grundsatz Genüge getan werden könne, dass die von politischen Entscheidungen Betroffenen auch auf deren Zustandekommen Einfluss nehmen können sollten; die vom deutschen Staat den deutschen Staatsbürgern garantierten Menschenrechte sollten vom deutschen Staat allen Menschen auf der Welt garantiert werden.
Zu den weitverbreiteten Überzeugungen gehören auch diese: Niemand sei für seine Lage wirklich selbst verantwortlich, denn in letzter Instanz seien es die Umstände, die ihn werden ließen, was er ist; ungleiche Lebensverhältnisse seien daher Ausdruck sozialer Ungerechtigkeit, und dies zu leugnen hieße zu bestreiten, dass alle Menschen gleich sind; Menschen hätten nicht nur die gleichen Menschenrechte, sondern verdienten generell auch den gleichen Respekt; wer nicht arbeiten will, habe – und zwar aufgrund seiner menschlichen Würde – Anspruch darauf, dass andere ihm ein Grundeinkommen verschafften; Solidaritätspflichten seien keineswegs an objektive Bedürftigkeit, das heißt: eine Unfähigkeit zur Selbsthilfe gebunden; da ungleiche Lebenslagen der Mitglieder verschiedener (sozialer, religiöser, rassischer oder ethnischer) Gruppen als Resultat systembedingter struktureller Diskriminierung betrachtet werden müssten, habe der Staat durch antirassistische Maßnahmen dafür zu sorgen, dass sich Chancengleichheit auch in Ergebnisgleichheit niederschlägt.
Für jenen Teil der herrschenden Elite, der marxistischen Prägungen unterliegt, ist ein Denken in Kategorien der Umverteilung auch in internationalen Beziehungen charakteristisch. Weil Unterschiede bezüglich des Reichtums nahezu gänzlich auf Ausbeutungsverhältnisse zurückgeführt werden, glaubt man, umfassende Hilfspflichten für die reichen zugunsten der armen Länder begründen zu können, denen erst beim Erreichen von Gleichverteilung Genüge getan sei. „Eigenverantwortung“ hält man für einen leeren Begriff – für eine von den Ausbeutern lancierte Chimäre zur Rechtfertigung ihrer Ausbeutung. In dem Glauben, dass externe Effekte der modernen kapitalistischen Produktions- und Lebensweise das Überleben der gesamten Menschheit gefährdeten, beanspruchen Aktivisten ein (moralisches) Widerstandsrecht und finden dafür sowie für ihre rechtswidrigen Aktionen Beifall und Unterstützung.
Teile der linken Elite stützen sich auf ein postmodernistisch geprägtes sozialtheoretisches Denken, das auf die Entlarvung von (angeblichen) Unterdrückungs- und Ausgrenzungslogiken der demokratisch-kapitalistischen Herrschaftssysteme des Westens gerichtet ist. Solche Überzeugungen sind: Das Geschlecht eines Menschen lasse sich durch äußere Betrachtung seines Körpers nicht bestimmen; ein mit männlichen Geschlechtsteilen geborener Mensch werde zu einer Frau (und umgekehrt), wenn sich diese Person dahingehend erkläre; jeder habe das Recht, sein Geschlecht ohne Bezug auf biologische Gegebenheiten selbst zu deklarieren, und damit gegebenenfalls den rechtlichen Anspruch, von der Gesellschaft als ein gebärender Mann oder eine zeugende Frau anerkannt und mit den entsprechenden Rechten ausgestattet zu werden; Kinder hätten keineswegs zwingend eine Mutter und einen Vater als Eltern, vielmehr müsse das Abstammungsrecht auch Familienkonstellationen Rechnung tragen, in denen die Elternteile eines Kindes zwei Personen des gleichen Geschlechtes seien; die Wahrnehmung von Menschen als behindert oder übergewichtig sei ausschließlich ein Produkt sozialer Konstruktion und die entsprechende Zuschreibung eine Form der Diskriminierung; jeder Körper könne unabhängig von seinem (Über-)Gewicht gesund sein, denn auch der Begriff der Gesundheit sei sozial konstruiert.
Neben der traditionellen Linken, die vornehmlich an Fragen der sozialen Gerechtigkeit und der Gleichheit interessiert und insofern egalitär orientiert ist, ist in den letzten Jahren eine Linke entstanden, die sich auf Identitätsfragen konzentriert. Diese identitäre Linke sorgt sich im Unterschied zur egalitären Linken um den Schutz und die Anerkennung bedrohter und unterdrückter Völker sowie diskriminierter Minderheiten. Ob von identitären Linken auch andere philosophisch-weltanschauliche, nämlich partikularistische, Grundpositionen vertreten werden, wie man zunächst durchaus annehmen kann, oder ob es sich bei deren Fixierung auf Interessen von Gruppen (statt von Individuen) nur um eine Methode der Realisierung des linken Projektes handelt, die nach der erstrebten Transformation der Gesellschaft aufgegeben werden kann, lässt sich derzeit nicht sagen (und ist im vorliegenden Zusammenhang nicht von Bedeutung). Einschlägige Überzeugungen sind etwa: Weiße seien allein aufgrund ihres Weißseins und der damit verbundenen Sozialisation unausweichlich rassistisch, und nur Weiße könnten rassistisch sein; da niemand sonst die spezifische Lebenssituation und Diskriminierungserfahrung eines, sagen wir: Transgendermannes nachempfinden könne, dürfe auch die literarische Figur einer solchen Person nur von einem Transgendermann als Schauspieler dargestellt werden; das Buch einer, zum Beispiel, schwarzen Autorin könne nur von einer schwarzen Frau übersetzt werden, denn nur eine Frau, die zudem schwarz ist, verfüge über das dafür erforderliche erfahrungsgestützte Einfühlungsvermögen. Zum identitären Überzeugungspool gehören auch die Behauptung, ausschließlich Männer könnten sich sexistisch verhalten, oder die normative Festsetzung, die kulturelle Aneignung von Praktiken, Gepflogenheiten oder äußerlichen Kennzeichen unterdrückter Völker oder Minderheiten durch die Nachfahren der Unterdrücker sei verwerflich, weshalb Weiße beispielsweise nicht die gleichen Frisuren wie die Unterdrückten tragen oder weiße Kinder sich nicht als Indianer verkleiden dürften.
Dies sind nur einige Ideen, Behauptungen und Forderungen, mit denen der staunende „Normalbürger“ konfrontiert wird. Von ihm, der täglich seiner Arbeit nachgeht und sich um seine Kinder kümmert, werden seltsam erscheinende Anerkennungsleistungen und Verhaltensänderungen erwartet; er soll sich an der Lösung von „Problemen“ beteiligen, die ihm womöglich noch vor Kurzem gänzlich unbekannt waren und deren gesellschaftliche Relevanz zu begreifen ihm nicht gelingen will. Gefühle und Einbildungen von – zum Teil selbst definierten – Minderheiten soll er als Ausdruck von zu behebenden sozialen Ungerechtigkeiten erkennen und sein Denken und Sprechen den Wünschen dieser Minderheiten anpassen – und zwar auch dann, wenn er deren Vorstellungen weder folgen noch für berechtigt halten kann. Er soll glauben, dass nur ein Angehöriger einer benachteiligten oder sich für benachteiligt haltenden Gruppe die betreffende Form der Benachteiligung zu identifizieren und zu registrieren vermöge und daher die Kompetenz habe, Verhaltensänderungen bei anderen einzufordern, und er soll darüber hinaus akzeptieren, dass ein solcher Geschädigter zugleich berechtigt sei, Schadensersatzleistungen bei der Gesellschaft einzuklagen; er soll also zugestehen, dass nur diejenigen, die ihren Opferstatus selbst definieren, auch darüber bestimmen, wie mit Opfern dieser Art umzugehen sei und wie sie zu entschädigen seien.
Es ist zu vermuten, dass kein einzelner Mensch alle diese Positionen und alle diese Positionen in der angeführten idealtypischen Form oder auch extremen Ausprägung vertritt. Viele dieser Positionen sind voneinander logisch unabhängig und zum Teil in sich widersprüchlich. Sie beruhen auf einer Reihe von Postulaten und Grundannahmen, die zu akzeptieren man rational nicht gezwungen ist. In der Regel dürften jeweils nur einzelne dieser Positionen vertreten werden, und diese wiederum in einer abgeschwächten, weniger absolutistischen Form. Es mag zum Beispiel sein, dass es derzeit nur wenige gibt, die für die Abschaffung aller Grenzen tatsächlich eintreten, und doch handelt es sich bei dieser Forderung um die zu Ende gedachte Idee einer anzustrebenden weltweiten Niederlassungsfreiheit für alle Menschen.
Nicht alle Angehörigen der tonangebenden elitären Schicht aus den Bereichen der Politik, der Medien, der Wirtschaft, der Wissenschaft und Kunst, nicht alle Funktionäre in den Parteizentralen und Ministerien, nicht alle Mitstreiter in den Redaktionen, den Universitäten und den Chefetagen der Konzerne, nicht alle Aktivisten der Nichtregierungsorganisationen sowie der Unterhaltungsbranche haben dieselben Überzeugungen und präferieren dieselben gesellschaftlichen Zielvorstellungen. Allerdings teilt diese aktivistische Minderheit, die sich informell – teilweise aber auch durch personelle Wechsel von einem Bereich in den anderen – zu einer politischen und medialen Elite verbunden hat, bestimmte Ideen und Interessen: Sie alle halten die Zeit für gekommen, die westliche Lebensweise und generell das menschliche Zusammenleben in dieser oder jener Form neu zu ordnen – und zwar gemäß ihren Vorstellungen von einer besseren Welt und von zivilisatorischem Fortschritt. Insoweit auch Akteure aus der Wirtschaft als Vertreter derselben oder ähnlicher Ideen auftreten, dürften vor allem Interessen an der Erschließung neuer Möglichkeiten der Kapitalakkumulation ausschlaggebend sein. Diese Motivlage macht es verständlich, wenn einflussreiche Protagonisten der marktwirtschaftlich und weltumspannend orientierten Wirtschafts- und Finanzwelten nach einer kulturell einheitlichen, alle Grenzen niederreißenden Weltgesellschaft streben. Dabei werden die Inkompatibilitäten, die im Hinblick auf die Gesellschaftsvorstellungen der globalen Wirtschaftselite und der kulturellen Linken bestehen, vorerst ausgeblendet.
Diese politisch-mediale Elite legt es darauf an, ihre Agenda als verbindliche Ideologie gesellschaftlich und möglichst auch verfassungsrechtlich zu etablieren. Eine in Teilen der Gesellschaft um sich greifende Irrationalität und von apokalyptischen Endzeitbefürchtungen getriggerte Hysterie spielen ihr dabei in die Hände. Dass man mit einem Projekt der zentralen Steuerung der gesellschaftlichen Entwicklung auch die Bedingungen der Möglichkeit eines demokratischen Gemeinwesens unterminieren könnte, kommt vermutlich vielen Verfechtern einer geplanten gesellschaftlichen Umgestaltung nicht einmal in den Sinn; andere scheinen diese Option billigend in Kauf zu nehmen oder sehen gar in autokratischen Problemlösungsformen die Zukunft. Jedenfalls: Diese Elite schreibt sich nicht nur das Verdienst zu, die Notwendigkeit einer Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft erkannt zu haben; auf Basis der (vermeintlichen) „Einsicht“, dass die verbreitete Präferenz der derzeitigen Lebensform das Produkt „struktureller Manipulation“ der zu überwindenden „neoliberalen“ kapitalistischen Wirtschaftsform sei, glaubt man sich legitimiert und nachgerade verpflichtet, die erforderliche Bewusstseinsveränderung der Massen selbst bewirken zu müssen – oder sich über den Willen der Menschen hinwegsetzen zu dürfen.
Das menschliche Leben ist kurz und gefährlich. Orientierung und Halt gibt das Überkommene, das Bekannte. Um das individuelle Dasein bewältigen zu können, muss man sich zunächst an das halten, was erfahrungsgemäß funktioniert. Alles gemeinschaftliche Zusammenleben baut daher auf Traditionen auf. Jede Gesellschaft kennt Üblichkeiten, die weder erklärt noch begründet werden müssen; in jeder Gesellschaft gibt es eingespielte Praktiken, die sich bewährt haben und deshalb als selbstverständlich und rechtfertigungsunbedürftig gelten.
All dies unterliegt dem Wandel – jede Gesellschaft ist unter manchen Gesichtspunkten betrachtet unvollkommen und verbesserungsfähig, jede Üblichkeit ist potenziell der Kritik ausgesetzt, jede Anstandsregel kann unterlaufen, sämtliche Standards, welche Meinungen und welche Verhaltensweisen zu akzeptieren seien, können modifiziert werden. Gesellschaftlicher Fortschritt besteht auch darin, dass Formen ungerechter oder ineffektiver Praxis oder auch Institutionen, die ihren Zweck oder den ihr zugeschriebenen Sinn verloren haben, beseitigt oder reformiert werden.
Die Begründungs- und Rechtfertigungslast für anvisierte Änderungen trägt allerdings der Veränderer. Im Ergebnis von sozialen Revolutionen mag es zu paradigmatischen Neugestaltungen des Zusammenlebens kommen. In normalen Zeiten hingegen müssen sich der Abbau von tradierten Einstellungen, die Infragestellung von Konsumgewohnheiten und Praktiken der Alltagsbewältigung im gesellschaftlichen Leben selbst vollziehen. Die Impulse können von hellsichtigen „Heiligen“, von progressiven Vorreitern oder auch von avantgardistischen Gruppen ausgehen; sie müssen aber in der Gesellschaft aufgegriffen und von einer relevanten Menge ihrer Mitglieder als neue Üblichkeiten akzeptiert werden.
Von großer Bedeutung ist dabei, dass die angestoßenen Veränderungsprozesse in einer sozialverträglichen Geschwindigkeit ablaufen. Werden jedoch fundamentale Veränderungen – etwa im Hinblick auf die bestehende Machtbalance zwischen Nationalstaaten und transnational operierenden Großkonzernen oder im Hinblick auf die ethnische oder rassische Zusammensetzung der auf einem Staatsgebiet lebenden Bevölkerung – von einer Elite gezielt herbeigeführt, werden neue Standards der Kommunikation, des Verhaltens oder des Zusammenlebens von oben verordnet und durchgedrückt, werden der Gesellschaft bisher unbekannte Kriterien der Zumutbarkeit und der gebotenen Zurückhaltung oktroyiert, handelt es sich um eine Revolte gegen das Volk.
Inhalt einer solchen Revolte ist die gezielte Transformation von Staat und Gesellschaft – von Institutionen, von Gerechtigkeitsvorstellungen, von Lebensformen. Werte werden neu interpretiert; die Rangfolge der akzeptierten Werte wird neu konzipiert. Ergebnis einer solchen Transformation können ein verändertes Kräfteverhältnis zwischen Staat und Individuum oder eine andere Auffassung über die Beziehungen zwischen Individuum und Gesellschaft sein. Es können umfassendere Eingriffsrechte des Staates in die Selbstbestimmungsmöglichkeiten des Einzelnen begleitet von einer Neudefinition der individuellen Freiheits- sowie der staatlichen Kontroll- und Überwachungsrechte durchgesetzt werden; zugleich kann man sich um die gesellschaftliche Ingeltungsetzung eines neuartigen Verständnisses der Pflichten bemühen, die der Einzelne im Hinblick auf das Wohl seiner Mitmenschen beziehungsweise der Gemeinschaft zu erfüllen habe. Im Ergebnis könnten das Recht an privatem Eigentum unterhöhlt und der Einzelne zu einer von Grund auf veränderten Lebensweise genötigt werden. Auf dem Spiel stehen die Freiheit des Individuums und dessen Recht, ein selbstbestimmtes Leben zu führen.
Formal betrachtet lässt sich der Inhalt dieser Revolte auf folgenden Nenner bringen: Zum einen werden reale Probleme (zum Beispiel die derzeit stattfindende Erderwärmung) in einer Ängste auslösenden Weise propagandistisch überhöht, sodass eine ergebnisoffene Diskussion darüber, wie ihnen am besten zu begegnen wäre, als überflüssig, kontraproduktiv und unstatthaft erscheint und damit, wie gewünscht, vermieden werden kann. Zum anderen werden auf gesellschaftlich umstrittene als auch auf philosophisch unentscheidbare Fragen ganz bestimmte nicht konsensfähige oder neuartige – mitunter bislang für unpraktikabel gehaltene – Antworten gegeben, die man ebenfalls der Diskussion entzieht. Das Ziel ist es, die Beziehungen zwischen den Menschen und die Koexistenz von Gruppen unter Gerechtigkeits-, Gesundheits- oder Nachhaltigkeitsgesichtspunkten neu zu kalibrieren.
Würde diese Agenda vorbehaltlos und offen ausformuliert, fände sie keine mehrheitliche Zustimmung. Es ist daher zu vermuten, dass ihre Umsetzung staatliche Maßnahmen erfordert, die sich besser und vielleicht überhaupt nur unter den Bedingungen einer Wirtschaftskrise, einer nicht mehr beherrschbaren massenhaften Migration und der daraus resultierenden gesellschaftlichen Verwerfungen politisch rechtfertigen und durchsetzen lassen: Einschränkungen individueller Freiheitsrechte, Enteignungen und Beschlagnahmungen, Beschneidung der Verfügungsgewalt über privates Eigentum, Bevormundung und Verleumdungen, Überwachung und Zensur, Androhung von sozialen Nachteilen. Notstandsähnliche Bedingungen des Mangels können als Vorwand dienen, um, wie es marxistisch orientierte Aktivisten schon immer beabsichtigten, etablierte Selbstverständlichkeiten (Produktions- und Eigentumsverhältnisse, Lebens- und Essgewohnheiten, das Staatsbürgerschafts- und Erbrecht) nicht nur öffentlich zum Thema zu machen, sondern zwangsweise einer staatlich gesteuerten fundamentalen Revision zu unterziehen. Wenn der Dachstuhl des Hauses Feuer gefangen hat, muss gehandelt werden. Es sind dann Dinge durchsetzbar, die im Normalzustand als undenkbar galten. Das Corona-Management der Regierung, das mit unbegründeten und unverhältnismäßigen Freiheitseinschränkungen verbunden war, hat möglicherweise nur für einen Vorgeschmack gesorgt.
Die auch als Great Reset, als großer Neustart, apostrophierte Transformation der Gesellschaften des Westens ist kein Zukunftsprojekt, sondern bereits voll im Gange. Dass dies zu konstatieren immer häufiger als „Verschwörungstheorie“ gegeißelt wird, gehört zum methodischen Rüstzeug jener Protagonisten, die sich sowohl ihrer „historischen Mission“ als auch ihrer Minderheitenposition bewusst sind: Man versucht, die eigentliche Stoßrichtung der gesellschaftlichen Transformation „unter dem Radar“ zu halten und unumstößliche Fakten zu schaffen. Die neugeschaffenen Fakten werden als „Normalität“ verklärt. Bevor der arbeitende Normalbürger die Dinge realisiert, wird er in einem anderen Land leben.
Die durch den Massenzustrom von Migranten bewirkte ethnische Enthomogenisierung des deutschen Staatsvolkes sowie der europäischen Völker generell ist von Teilen der herrschenden Elite beabsichtigt und wird von anderen hingenommen (Angela Merkel: „Nun sind sie halt da.“). Man interessiert sich zwar für den Erhalt der Artenvielfalt, den Mächtigen liegt aber nichts an der Erhaltung der Völker- und Kulturvielfalt. Der eintretende Effekt kommt deren Willen zur Transformation der Gesellschaft entgegen, ja ist geradezu eine Voraussetzung ihrer möglichst reibungslosen Durchführung: Eine in ethnische, soziale oder religiöse Gruppen zerfallene Bevölkerung ohne Zusammengehörigkeitsgefühl wird zum Spielball mächtiger Eliten. Ohne Wir-Bewusstsein, ohne das Wissen, auf der Grundlage einer gemeinsamen Geschichte und gemeinsam praktizierter Lebensformen übereinstimmende Interessen zu verfolgen, formieren sich keine widerständigen Energien.
Wer das vor Kurzem noch als unvorstellbar Geltende ohne Murren hinnimmt, gilt als „entideologisiert“. Zugleich werden staatliche und gesellschaftliche Institutionen unterwandert, und es werden Widerspenstige – all diejenigen, die dem linken und woken Projekt der Gesellschaftsumgestaltung der „Aufgewachten“ die Gefolgschaft verweigern – eingeschüchtert, verunglimpft, ausgegrenzt oder sozial ruiniert. Die von den Theoretikern des Great Reset angedachten fundamentalen Veränderungen des individuellen Lebens und des gesellschaftlichen Zusammenlebens sind ohne staatliche Maßnahmen der Enteignung, Disziplinierung und Repression nicht realisierbar.
Schon heute ist es vernünftigerweise nicht mehr zu bezweifeln, dass die Grenzen des Sagbaren signifikant verschoben worden sind. Die Äußerung von Anschauungen, die noch vor wenigen Jahren Allgemeingut waren und der Rechtslage entsprachen, können mittlerweile jeden rechtschaffenen Bürger zu einem Radikalen machen – und zwar zu einem Radikalen, der, so wird beanstandet, die Grenzen des Sagbaren verschieben will. Und die Taktfrequenz der Veränderungen, der propagandistischen Überwältigungen scheint sich immer weiter zu erhöhen.
Wer nicht die elitären Minderheitenpositionen des ideologischen Mainstreams teilt und auch weiterhin seine Anschauungen für eigentlich „normal“ hält, befindet sich in einer nur schwer fassbaren Situation: Er kennt eigentlich nur Menschen, die so denken wie er, muss sich aber als Konsument insbesondere der öffentlich-rechtlichen Medien – wenigstens subkutan – sagen lassen, dass er im Grunde genommen unanständige, unmoralische, ja vielleicht sogar verfassungsfeindliche Auffassungen vertrete. Staatlich geförderte oder von Mäzenen angeheuerte Ideologen teilen ihm mit, dass er durch sein bloßes Weißsein Gefühle seiner nicht weißen Mitbürger verletze, dass seine Vorfahren – und zwar ganz anders als die Vorfahren der Angehörigen aller anderen Völker – einer nationalen Verbrecherbande angehörten, während er selbst im Reichtum schwelge, der von den Unterdrückten und Ausgebeuteten der Welt geschaffen worden sei. Manche zweifeln an sich selbst und passen sich an; andere unterwerfen sich wider besseres Wissen – in nicht wenigen aber steigt Wut auf, gepaart mit Rat- und Hilflosigkeit.
Immer mehr Menschen fühlen sich von dieser politischen Klasse verraten, die zwar (wenigstens vorgeblich) hehre Auffassungen vertritt, sich aber über die Kollateralschäden ihres Handelns wenig Gedanken macht oder diese bewusst in Kauf nimmt. Sie sehen den Staat nicht mehr als Vertreter ihrer Interessen. Vor allem aber: Sie begreifen die ideologische Dominanz der politischen und medialen Elite als Bevormundung und als eine illegitime Beschneidung ihrer Freiheit. Deren Handeln wird aber nicht nur als totalitär-übergriffig wahrgenommen, sondern zugleich als hochgradig inkompetent. In dem Maß, wie sich dieser Eindruck verfestigt und immer mehr Menschen erfasst, wird sich der freiwillige Gehorsam, den die Bürgerschaft eines funktionierenden Gemeinwesens dem Führungspersonal üblicherweise entgegenbringt, verflüchtigen.
Die Zahl derer, die sich von diesem Staat innerlich verabschiedet haben, wächst. Und obwohl die geistige Spaltung selbst innerhalb der sozialen Milieus selten so tief war und die Grundfesten des freiheitlichen Staates immer mehr ausgehöhlt werden, hält die „Elite“ des Landes, die nicht mit einer Auslese der Besten oder der Tüchtigsten zu verwechseln ist, an ihrem Kurs ungerührt fest. Ihre ideologische Selbstfesselung erschwert nicht nur die Wahrnehmung der Realität – sie macht bereits die Benennung der Tatsachen und das Nachdenken über eine Kurskorrektur zu einem „Verbrechen“, das gruppenintern bestraft wird.
Unter diesen Bedingungen ist eine Wende zum Besseren kaum zu erwarten. Ohnehin sind die Pflöcke, die die zukünftige Entwicklung determinieren, längst eingeschlagen. Man hat das Land auf einen Pfad gesetzt, den zu verlassen nur unter vereinter Kraftanstrengung und nicht ohne Verluste und Entwicklungsverzögerungen möglich wäre. Da man in der Elite glaubt, für das moralisch Gute zu kämpfen, wird man nicht zögern, Widerspenstige in den eigenen Reihen sowie Querulanten aus dem Volk hart zu bestrafen und die Freiheit der Bürger gegebenenfalls einzuschränken. Um die geplanten gesellschaftlichen Transformationen bewerkstelligen zu können, wird man nicht davor zurückschrecken, selbst in Eigentumsrechte einzugreifen. Sollte das eigene politische Handeln nicht die gewünschten Früchte tragen, wird keine andere Idee öffentlich vertretbar sein als die, gerade diese Maßnahmen zu verschärfen. Und wenn das Volk widerspenstig bleibt und unerwünschte Wahlergebnisse drohen, bleibt immer noch die Möglichkeit, rechtliche Grundlagen so „anzupassen“ oder Gesetze so auszulegen, dass sich der Wille des für lenkungsbedürftig gehaltenen Volkes in demokratischen Verfahren nicht „materialisieren“ kann. In der Tat: Der freiheitliche Rechtsstaat, der unser Leben bisher prägte und dessen Lebensvorzüge wir zu schätzen wissen, ist in Gefahr.
Dass nichts für die Annahme spricht, die das Land dominierende politische Elite samt der sie stützenden Bürokratie sei ausschließlich daran interessiert, „Gutes“ zu tun und dem öffentlichen Interesse zu dienen, soll hier nur der Vollständigkeit halber angemerkt werden. Die Angehörigen dieser (funktionalen) Elite, die in ihren Schlüsselpositionen gesellschaftlichen Einfluss ausüben können, kämpfen nicht nur für das „Wohl der Menschheit“, sondern verfolgen auch eigene, partikulare Interessen. Wie wohl die meisten Politiker kümmern sich auch „Weltverbesserer“ und „Weltretter“ um ihre eigene Karriere, die Ausweitung ihrer Entscheidungskompetenzen und ihre finanzielle Sanierung. Sie wollen nicht lediglich ihre politischen Vorstellungen umsetzen, sondern streben auch nach Macht als Selbstzweck.
Wie staatliche Bürokraten und die meisten derjenigen, die von Steuergeldern leben, liebäugeln auch sie mit einer Ausweitung der Staatstätigkeit. Budgetkürzungen halten sie für ein Übel; stattdessen kämpfen sie für eine permanente Erhöhung der Steuereinnahmen. Von Ausgabensteigerungen erhoffen sie sich größere Spielräume, um „für mehr Gerechtigkeit sorgen“ und „die Welt auf den richtigen Pfad setzen“ zu können – vor allem aber profitieren sie selbst durch die Generierung von mehr Macht und mehr Einfluss. Dass sie auf diesem Wege den freiheitlichen Staat in einen Leviathan, einen autoritären Staat verwandeln, der die Souveränitätsrechte der Einzelnen immer mehr beschneidet, wird von ihnen entweder bestritten oder ungerührt zur Kenntnis genommen.
Die folgenden Überlegungen versuchen, die Sorgen eines deutschen Staatsbürgers auf den Begriff zu bringen, der immer weniger weiß, in was für einem Land er eigentlich lebt. Die Zeichen der Zeit „verheißen“ einen immer übergriffiger werdenden Staat und, damit verbunden, Einbußen an Freiheit und Selbstbestimmungsmöglichkeiten. Dieser mittlerweile angetretene Gang in ein neues „finsteres Mittelalter“ sollte nicht unkommentiert gelassen werden.
Man wird diesem Buch vorwerfen, dass es zu „idealistisch“ sei – dass es Maßstäbe an einen der individuellen Freiheit verpflichteten Staat anlege, die in einer Welt, in der Menschen aus Fleisch und Blut um die Realisierung ihrer Ideen und die Durchsetzung ihrer Interessen kämpfen, nicht erfüllbar seien, dass es schlicht und ergreifend unrealistische Anforderungen formuliere. Dieser Vorwurf ist einerseits berechtigt, andererseits nicht berechtigt.
Einerseits ist es richtig, dass idealtypische Kriterien in der realen Welt systematisch und regelmäßig unterlaufen werden. Die Verhaltensforderungen, die aus den Grundsätzen eines freiheitlichen demokratischen Staates abgeleitet werden, richten sich vor allem an gewählte Politiker und Funktionäre des Staates, die sich um ihre Posten beworben haben. Den meisten dieser Forderungen kann man durch Unterlassungen nachkommen, also dadurch, dass man bei der Verfolgung politischer Ziele auf die Anwendung bestimmter Methoden verzichtet. Solche Forderungen stellen keine Überforderung dar. Das Buch misst den Zustand unseres Gemeinwesens an Kriterien, die der Idee eines freiheitlichen Staates denknotwendig entspringen.
Andererseits ist dieser Vorwurf unbegründet, weil die Formulierung idealtypischer Maßstäbe keineswegs mit der Annahme verbunden ist, Institutionen beziehungsweise die handelnden Menschen könnten solchen Maßstäben vollständig genügen. Sinn und Zweck der Begründung idealer Anforderungen ist es vielmehr, über Maßstäbe zu verfügen, an denen sich Veränderungsprozesse messen lassen. Auch wenn man weiß, dass ein in jeder Hinsicht freiheitlicher Staat allein in einer idealen Welt existiert, dienen sie dazu, die Richtung abzuschätzen, in die sich die Dinge entwickeln – entweder zum Besseren oder zum Schlechteren.
Dieses Buch greift Themen auf, mit denen ich mich andernorts, dort aber unter anderen Aspekten, bereits beschäftigt habe. Mit dem Offenhalten der Grenzen im August 2015 und den Folgen der weitgehend unkontrollierten Masseneinwanderung von kulturfremden und überwiegend schlecht ausgebildeten Migranten habe ich mich beschäftigt in: „Der böse gute Wille. Weltrettung und Selbstaufgabe in der Migrationskrise“, Waltrop u. Leipzig22017. Die moralphilosophischen Fragen der Flüchtlingskrise beziehungsweise der Migration habe ich behandelt in: „Kritik des moralischen Universalismus. Über das Recht auf Selbstbehauptung in der Flüchtlingskrise“, Paderborn 2017. Eine Analyse der geistigen Situation des Landes und der Kampfmethoden der herrschenden politisch-medialen Elite findet sich in: „Angriff auf den freiheitlichen Staat. Über Macht und ideologische Vorherrschaft“, Marburg a. d. L. 2020. Eine philosophische und politikwissenschaftliche Deutung des in den aktuellen politischen Auseinandersetzungen ausgetragenen Kulturkampfes bietet: „Kulturkampf. Moralischer Universalismus statt Selbstbehauptung?“, Dresden 2021.
Das vorliegende Buch ist Fragen der demokratischen Legitimation gewidmet. Ausgehend von der Idee des freiheitlichen Staates (Kapitel I), den Legitimitätsideen verschiedener Staatsformen (Kapitel II) sowie den Legitimationsvoraussetzungen eines freiheitlichen demokratischen Staates (Kapitel III) werden Kriterien einer legitimen Tätigkeit eines Staates dieser Staatsform entwickelt (Kapitel IV) sowie Bedingungen der Möglichkeit eines solchen Staates abgeleitet (Kapitel V). Die gewonnenen Kriterien und Prinzipien werden sodann zur Beurteilung der aktuellen Tätigkeit des Staates des Grundgesetzes beziehungsweise der derzeit dominierenden Elite herangezogen (Kapitel VI–VIII). Das Buch schließt mit einem Fazit (Kapitel IX) sowie einem Vorschlag zur institutionellen Ergänzung des demokratischen Gemeinwesens („Statt eines Nachworts“).
Das Manuskript oder auch nur Teile des Textes wurden in verschiedenen Stadien der Ausarbeitung von einer Reihe von Freunden und Kollegen gelesen. Sie alle haben weiterführende Gedanken vorgetragen oder wichtige Anmerkungen gemacht. Ich bedanke mich bei Dr. Gerhard Barkleit, Dr. sc. Wolfgang Bialas, Rechtsanwalt Christian Fritze, Prof. Dr. Eckhard Jesse, Dr. Jürgen Richter und Dr. Manfred Zeidler.
I. Die Idee des freiheitlichen Staates
1. Selbstbestimmung
Die Anhänger eines freiheitlichen Staates sind an einer Gesellschaft interessiert, in der man selbstbestimmt leben kann. Sein Leben selbstbestimmt gestalten zu können ist individuelle Freiheit. Der Staat ist die Form, in der sich historisch entstandene und ökonomisch kooperierende Gemeinschaften rechtlich organisieren und sich auf ihrem Territorium gegen Fremdbestimmung von außen schützen.
Wenn für die Möglichkeit eines selbstbestimmten Lebens der Erhalt der gewachsenen Kultur oder die Bewahrung der nationalen Selbstständigkeit oder einer gewissen ethnischen oder rassischen Identität der Bevölkerung notwendig erscheint, treten sie auch dafür ein, ohne diesen Voraussetzungen einen Eigenwert, der um seiner selbst willen zu verteidigen wäre, zuschreiben zu müssen. Selbst für die Existenz eines Staates würden sie nicht eintreten, wenn sie ihn, weil sie annähmen, dass sich die Freiheit auch in einer reinen Privateigentumsgesellschaft1 gleichermaßen gut sichern ließe, für verzichtbar hielten. Für die Verfechter eines möglichst selbstbestimmten Lebens ist die (unrealisierbare) ideale Gesellschaft eine herrschaftsfreie Gesellschaft – eine Gesellschaft, in der weder einzelne Menschen noch Gruppen von Menschen auf andere Menschen Zwang ausüben.2 Diese Vorstellung einer idealen Gesellschaft gilt ihnen als Richtschnur des politischen Denkens und Handelns – als ein nie erreichbares, aber der Orientierung dienendes Ziel.
Zugleich vertreten die Anhänger eines freiheitlichen Staates ihre politischen Anliegen zwar aus der Sicht von menschlichen Individuen und treten insofern als methodologische Individualisten auf, können aber die Existenz von Gruppen beziehungsweise Gemeinschaften, denen aus der Sicht eines pragmatischen Essenzialismus3 eigene Interessen zugeschrieben werden, anerkennen. Dieser „ontologische Spagat“ wird jedenfalls dann notwendig, wenn man auf die Identifikation und die Beschreibung des Verhaltens von Kollektivwesen mit einer eigenen Identität und Geschichte (etwa Familien, Völkern, Gesellschaften, Staaten etc.) nicht verzichten möchte.
Der Staat – und ebenso der Nationalstaat – hat für die Verteidiger der menschlichen Freiheit eine ausschließlich dienende Funktion; er ist Instrument im Dienste der Daseinsbewältigung und der Gewährleistung der individuellen Rechte des Einzelnen. Zum einen erlassen Staaten Regeln, die ein friedliches Zusammenleben innerhalb der Gemeinschaft ermöglichen, und setzen diese Regelungen durch. Zum anderen vertreten sie die Interessen des Gemeinwesens im Verhältnis zu äußeren Akteuren – gegen andere staatlich organisierte Gemeinwesen, gegen unerwünschte Einwanderung oder feindliche Eindringlinge. Als Inhaber des Gewaltmonopols sorgen Staaten für die rechtsförmige Beilegung von Interessenskonflikten sowie die innere und äußere Sicherheit. Der Vorzug eines freiheitlichen Staates liegt in der Art und Weise, wie er diesen Funktionen gerecht wird und damit dem allgemeinen Wohl dient.
Ein freiheitlicher Staat gewährleistet die Freiheit des Einzelnen, sein Leben nach eigenen Vorstellungen zu gestalten, sowie die Selbstbestimmung des Volkes, einschließlich des Rechtes, sich an der Verabschiedung der Regeln, an die sich jeder zu halten hat, direkt oder indirekt zu beteiligen. Ein auch in dieser Hinsicht selbstbestimmtes Leben können nur demokratische Regierungsformen gewährleisten. Ein freiheitlicher Staat ist ein demokratischer Staat (VII.2). Er kann sich als eine plebiszitäre oder als eine repräsentative Demokratie organisieren. Er ist als konstitutionelle Monarchie denkbar, sofern dem Monarchen nur Repräsentationsfunktionen verbleiben; er wird sich aber, blendet man kontingente historische Umstände seiner Entstehung aus, vorzugsweise als Republik konstituieren.
Der freiheitliche demokratische Staat wacht über die Einhaltung der Regeln, auf die sich die vertragschließenden Mitglieder eines Gemeinwesens freiwillig und selbstbestimmt geeinigt haben. In dieser Schiedsrichterfunktion hat er sich neutral zu verhalten und alle vertragschließenden Parteien gleich zu behandeln. Dieses Gebot staatlicher Fairness ergibt sich zwingend aus dem Umstand, dass der Staat von allen Mitgliedern des Gemeinwesens gemeinsam in seine Schiedsrichterposition eingesetzt und nur unter dieser Bedingung als legitim anerkannt wird.
Ein solcher Staat ist Freiheitsgarant – Garant jener Bedingungen, die es einem vernünftigen und autonomen Wesen ermöglichen, von seinen gattungsspezifischen Fähigkeiten zur Selbstbestimmung einen adäquaten Gebrauch zu machen. Die Möglichkeit zur Selbstbestimmung wird jedem Einzelnen garantiert. Der freiheitlich-demokratische Staat achtet die Einzelnen als Gleiche in ihrer Fähigkeit zur Selbstbestimmung. In diesem dem Menschen als Vernunftwesen eigentümlichen Vermögen wurzelt der Kern der Menschenwürde. Sowohl die gleiche Achtung aller in ihrer menschlichen Würde als auch den Gebrauch der Fähigkeit zur Selbstbestimmung halten die Anhänger des freiheitlichen Staates für intrinsische Werte. Sie halten den freiheitlichen Staat in diesem ethischen Sinne für vorzugswürdig.
Für das Verständnis ist allerdings Folgendes elementar: Der freiheitliche Staat ist keineswegs jene Instanz, die legitimiert ist, die fundamentalen Individualrechte festzulegen. Eine demokratische Verfassung ist – vertragstheoretisch argumentiert – das Ergebnis eines Verfassungsvertrages, der zwischen menschlichen Individuen geschlossen wird, die auf einem räumlich begrenzten Siedlungsgebiet kooperativ zusammenleben. In einer solchen Verfassung werden fundamentale Rechte fixiert, die jedem Staatsbürger zustehen. Die Verfassung „verpflichtet“ den Staat, diese individuellen Rechte zu schützen. Der freiheitliche Staat ist daher „lediglich“ die Instanz, die die Durchsetzung dieser Rechte garantiert – die dafür sorgt, dass jedermann von diesen Rechten in Gestalt seines rechtskonformen Verhaltens „Gebrauch“ machen kann und Behinderungen durch Dritte unterbunden oder bestraft werden. Gesetze, die Umstände definieren, unter denen Rechte staatlicherseits eingeschränkt werden können, sind nur dann legitim, wenn diese Einschränkungen dem Willen der aktuell vertragsfähigen Bürger entsprechen.
Zugleich halten seine Vertreter den freiheitlichen Staat auch in einem epistemischen und pragmatischen Sinne für vorzugswürdig – und zwar deshalb, weil er jene rechtlichen und institutionellen Voraussetzungen bereitstellt, die es in der Tendenz am besten ermöglichen, auf der Basis freier Diskussionen und des öffentlichen Erwägens von Gründen hinreichend gute und zudem allgemein-akzeptable Lösungen für die fundamentalen Probleme der kollektiven Daseinsbewältigung und des menschlichen Zusammenlebens zu finden. Für diese Annahme sprechen sowohl Erfahrungen als auch theoretische Überlegungen.4 Allerdings: Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass sich die Wahrheit im Wettstreit der Meinungen tatsächlich durchsetzt, ist auch eine Funktion der Intensität und Rationalität des Wettstreites – vor allem aber seiner Dauer.5 Die Geschichte der Menschheit kennt viele Diskutanten, die als „Ketzer“ endeten und erst lange nach ihrem Tod rehabilitiert wurden. Ungeachtet dessen schätzen die Anhänger des freiheitlich-demokratischen Staates den instrumentellen Wert der für Demokratien charakteristischen Institutionen und Verfahren.6 Zwar sind auch sie immer unvollkommen, nur fehlt es an einer besseren Lösung.
Dass ein demokratisches Institutionensystem diese Leistungen verspricht, ist der Grund, warum die Demokratie als Staatsform geschätzt wird. Schon Perikles hatte in seiner Lobrede auf die Toten im Winter 431/30 v. u. Z. auf genau diese Vorzüge der demokratischen Verfassung Athens hingewiesen. Neben der Freiheit des Einzelnen in dessen privater Lebensführung, der Gleichheit aller Bürger vor dem Gesetz, dem gleichen Recht auch von Angehörigen ärmerer Schichten, sich durch Leistungen für das Gemeinwesen auszuzeichnen, erwähnt Perikles sowohl den Vorzug der Selbstbestimmung als auch den der epistemischen Überlegenheit der Demokratie im Dienste der Lösung anstehender Probleme. Denn in ihrem Staat, der „nicht auf wenige Bürger, sondern auf eine größere Zahl gestellt“ sei, entschieden die Athener „in den Staatsgeschäften selber oder denken sie doch richtig durch“; „nicht im Wort“ sehe man „eine Gefahr fürs Tun, wohl aber darin, sich nicht durch Reden zuerst zu belehren, ehe man zur nötigen Tat schreitet“.7
Und tatsächlich: Vernunftwesen ziehen es typischerweise vor, in einem Herrschaftssystem zu leben, das zum einen die Freiheit in allen ihren Formen möglichst umfassend schützt und in dem sich jeder Einzelne an der Bestellung der Herrschenden durch Wahlen beteiligen und sich selbst zur Wahl stellen kann, und das zum anderen Entscheidungsverfahren etabliert, die qualitativ hochstehende Entscheidungen ermöglichen und schlechte, geschweige denn desaströse Entscheidungen mit höherer Wahrscheinlichkeit als andere Staatsformen von vornherein vermeiden oder wenigstens deren Korrektur zulassen. Zugleich stellt sich damit die Frage, wie ein solches Institutionensystem konkret beschaffen sein muss, damit es diese Leistungen erbringen kann.
Ein freiheitlicher Staat liegt insoweit im gemeinsamen Interesse aller. Bedürfnisse, die jeder (oder fast jeder) hat, Interessen, die von allen (oder fast allen) geteilt werden, sind grundlegende, allgemeinmenschliche Bedürfnisse und Interessen; es sind Bedürfnisse und Interessen, die jeder realisieren muss, der überhaupt und als dieser Mensch am Leben bleiben will, der er ist. Fundamentale Bedürfnisse sind Bedürfnisse, deren Befriedigung Bedingung der Möglichkeit der Existenz und Weiter-Existenz ist. Sie sind kulturinvariant und können in diesem Sinne als ein absolutes Maß gelten. Mit der Befriedigung seiner fundamentalen Bedürfnisse sichert der Einzelne sein Weiterleben und wahrt zugleich seine fundamentalen Menschenrechte.
Die – wie auch immer begründete – Pflicht, das Interesse an der Befriedigung dieser fundamentalen Bedürfnisse wechselseitig zu achten, formuliert ein kultur- und ideologieneutrales ethisches Minimum – eine Minimalmoral, die mit der verfassungsrechtlichen Fixierung von Grundrechten staatlich in Geltung gesetzt wird. Wie jeder Staat hat auch der freiheitliche Staat die Aufgabe, die Realisierung der elementaren Interessen der menschlichen Daseinsbewältigung zu ermöglichen und zu befördern, und es besteht die Anfangsvermutung, dass er diese Aufgabe in der Regel besser zu erfüllen vermag als Staaten anderer Form.
Indem ein freiheitlicher Staat den fundamentalen Bedürfnissen und Interessen aller dient, ist er auch gerecht. Eine darüber hinausgehende Form von Gerechtigkeit ist nicht das eigentliche und letzte politische Ziel, weshalb ein freiheitlicher Staat bevorzugt wird. Gerechtigkeit in Gestalt gerechter Institutionen ist ein Ergebnis, das sich einstellt, wenn Menschen mit dem gleichen Stimmengewicht sich auf unveräußerliche Rechte sowie die Regeln einigen, nach denen die Regeln des Zusammenlebens erlassen werden sollen. Politische Gerechtigkeit verkörpert genau jenes Rechte- und Regelsystem, das von gleichberechtigten Vertragspartnern – in der stets nicht idealen Welt – akzeptiert wird.
Zudem haben die Bürger eines Staates ein gemeinsames höherstufiges Interesse. Abgesehen von dem allgemeinen Interesse der Selbsterhaltung ist es nicht auf inhaltlich-konkrete Ziele des Lebens gerichtet, sondern auf die Herstellung von Bedingungen, die die Erreichung bestimmter Ziele ermöglichen. Dies sind zum einen die Bedingungen der Möglichkeit einer freien, einer selbstbestimmten Lebensführung der Einzelnen, und es sind zum anderen die Bedingungen der Möglichkeit der Selbstbestimmung des Volkes in Übereinstimmung mit dem jeweiligen Mehrheitswillen, das heißt dem Demokratieprinzip. Menschen möchten also nicht nur überhaupt leben und weiterleben, sondern auch frei sein und ein selbstbestimmtes Leben führen; sie möchten selbst bestimmen, wie sie als Individuum leben, und sie sind als Angehörige einer Gemeinschaft, eines Volkes oder eines Staates daran interessiert, dass dieses Kollektiv seine Angelegenheiten selbst regeln kann und nicht von anderen Kollektiven beherrscht wird.
Die Vertreter des Volkes werden also nicht gewählt, damit sie machen können, wonach ihnen der Sinn steht, sondern damit sie – abgesehen von der Sicherung der Staatsinteressen in den Außenbeziehungen – die Bedingungen schaffen, die es den Bürgern erlauben, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Da aber alle (oder fast alle) Menschen darin übereinstimmen, zunächst einmal ihr Leben reproduzieren zu wollen, haben die Regierenden die eine inhaltliche Aufgabe, für jedermann die Bedingungen der Möglichkeit des Weiterlebens bereitzustellen.
Der freiheitliche Staat verfolgt jedoch kein darüber hinausgehendes Optimierungsziel. Ihm geht es beispielsweise weder darum, die durchschnittliche Lebenserwartung noch das durchschnittliche Glücksempfinden zu maximieren. Ihm geht es – oberhalb des ethischen Minimums – allein darum, die rechtlichen und institutionellen Voraussetzungen für die Möglichkeit einer autonomen Lebensgestaltung für jedermann zu gewährleisten. Ob es auch politisch-konkrete Gemeinschaftsinteressen, also inhaltlich bestimmte Interessen gibt, die über die Reproduktion der Lebensgrundlagen sowie die Gewährleistung der inneren Sicherheit und des äußeren Friedens hinausgehen und alle (oder fast alle) gemeinsam haben, ist eine andere, eine empirische Frage. Der freiheitliche Staat selbst kennt keine „gute Gesellschaft“, die sich unabhängig von den Präferenzen ihrer Mitglieder definieren ließe.8 Die Welt zu verbessern und nach geeigneten Problemlösungen zu suchen ist Angelegenheit der jeweiligen Gemeinschaft freier Menschen.
2. Freiheit und Gleichheit
Der freiheitliche Staat ist – auch in der Ausgestaltung einer repräsentativen Demokratie – die institutionelle Verkörperung der Idee der Selbstregierung des Volkes sowie der (natur- beziehungsweise vernunftrechtlichen) liberalen Idee zu schützender Rechte des Individuums. Er beruht aber auch auf der Anerkennung und Achtung der Gleichheit aller Menschen hinsichtlich ihrer Zugehörigkeit zu ein und derselben Gattung. Als ein Angehöriger der Menschheit und damit als ein Vernunftwesen hat jeder Einzelne die gleichen Menschenrechte – genauer gesagt heißt dies: Jedem Menschen werden, weil er ein Angehöriger der Menschheit ist, die gleichen Menschenrechte zugebilligt.9 Insbesondere hat jeder Einzelne das gleiche Recht, gemäß seinen Wert- und Lebensvorstellungen sowie seinen individuellen Fähigkeiten und materiellen Ressourcen sein Leben autonom zu gestalten. Zu diesem Zweck gewährleistet der freiheitliche demokratische Staat die Sicherheit des privaten Eigentums und eröffnet dem Einzelnen Zonen der staatsfreien privaten Wirtschaftstätigkeit.
Zudem behandelt der freiheitlich-demokratische Staat die Angehörigen der staatsbildenden Gemeinschaft als Gleiche hinsichtlich ihres Status als Bürger. „Alle Menschen sind gleich“ heißt: Der Staat garantiert allen Staatsbürgern die gleichen Bürgerrechte (etwa das Wahlrecht) und allen Menschen in seinem Hoheitsbereich die gleichen Grundrechte, sofern es sich um sogenannte Jedermannsrechte handelt – Rechte, die jeder qua seines Menschseins hat (etwa das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit oder das Recht auf freie Meinungsäußerung). Die politische Gleichheit der Bürger entspringt somit ihrer gemeinsamen Zugehörigkeit zu demselben Staat, also der Staatsbürgerschaft. Die politische Gleichheit aller Bürger, insbesondere ihr gleiches Recht, an der Willensbildung der Gemeinschaft mitzuwirken, ist das Fundament der Idee der Demokratie.
Ein freiheitlicher Staat bietet nicht für jedermann das abstrakt denkbare Höchstmaß an individueller Freiheit. Denn die Freiheit des Einzelnen findet ihre Grenze, wie schon Kant lehrte, an der gleichen Freiheit aller anderen. Die Freiheit, die der freiheitliche Staat für das Individuum sichert, sichert er für jeden Einzelnen gleichermaßen. Neben der Freiheit wird daher auch die Gleichheit im Sinne der Forderung nach einer gleichen Behandlung durch den Staat in einem freiheitlichen Staat als ein intrinsischer Wert betrachtet.
Demokratische Staaten können Minderheiten unterdrücken (man denke zum Beispiel an Formen von Rassendiskriminierung) oder kriminalisieren (man denke an das auch in der Bundesrepublik lange bestehende strafrechtliche Verbot der Ausübung von Homosexualität); sie können als Kolonialmächte auftreten und völkerrechtlich unrechtmäßige Angriffskriege führen. Praktiken dieser Art sind mit dem Selbstverständnis eines freiheitlichen Staates nicht vereinbar. Ungleichbehandlungen müssen entweder allgemein nachvollziehbar begründet oder unterlassen werden.
Der freiheitliche Staat ist der Freiheit und Selbstbestimmung verpflichtet. Er schafft Voraussetzungen für die Betätigung des menschlichen Vermögens zur Selbstbestimmung und legt damit Grundlagen für ein Leben in Freiheit. Zu diesem Zweck schränkt er die Willkürfreiheit jedes Einzelnen in dem Maße gesetzlich ein, wie dies notwendig erscheint, um für alle den gleichen möglichst großen Freiheitsspielraum zu eröffnen. Der freiheitliche Staat ist, indem er gleiches Recht für jede Rechtsperson garantiert, Rechtsstaat und nur als ein solcher denkbar. Die Anerkennung individueller Rechte erzwingt die – verfassungsrechtlich geregelte – Begrenzung staatlicher Macht. Ein freiheitlicher Staat ist daher nur als demokratischer Rechts- und Verfassungsstaat denkbar.
Wie der Einzelne seine Freiheit im Rahmen der gesetzlichen Einschränkungen nutzt, ist allerdings ihm überlassen. Dieses Recht begründet seine individuelle Freiheit. Der Rechtsstaat setzt die für alle verbindlichen Grenzen des nicht verbotenen Handelns und Unterlassens und definiert damit die Spielräume, innerhalb derer der Einzelne mit anderen Einzelnen auf der Grundlage vertraglicher Beziehungen kooperieren und seine Vorstellungen eines guten Lebens verwirklichen kann.
Diese Festlegungen sind zugleich Festlegungen, wozu der Einzelne durch den Staat gezwungen werden darf. Man hat daher auch von einem Vorrang des Rechten vor dem Guten gesprochen.10 Der freiheitliche Staat legt lediglich die Grenzen der Handlungsspielräume fest, verhält sich aber in allen Fragen, die die Nutzung der Spielräume durch die Angehörigen des Staates betreffen, neutral. Ob der Einzelne als Solitär und in der Anonymität sein privates Glück sucht oder sich in Gemeinschaften, Vereinen etc. binden und in der wechselseitigen Verantwortungsübernahme Lebensrisiken minimieren oder seinen psychischen Ausgleich finden will, ist ausschließlich seine Entscheidung. Niemand verfügt in einem freiheitlichen Staat über die Kompetenz, verbindlich vorzuschreiben, wie genau der Einzelne seinen Handlungsspielraum zu nutzen habe. Der freiheitliche Staat trägt der Einsicht Rechnung, dass es weder wissenschaftliche Erkenntnisse noch eine intersubjektiv akzeptierte Expertise darüber gibt, auf welches Ziel hin wir zu leben haben. Und selbst wenn solche Erkenntnisse verfügbar wären, folgte daraus nicht, dass der Staat als „väterlicher Freund“ oder Erzieher auftreten und den Einzelnen gleichsam vor sich selbst schützen dürfte. Zur Idee der individuellen Selbstbestimmung gehört des Weiteren, dass der Staat zum einen niemanden verpflichten kann, sich am politischen Leben zu beteiligen – obwohl eine solche Beteiligung wünschenswert ist –, und zum anderen niemanden (über die gesetzlich vorgeschriebene Steuerzahlung hinaus) zwingen sollte, sein Eigentum mit wirtschaftlich Schlechtergestellten (etwa Wirtschaftsflüchtlingen) zu teilen – auch wenn man einen Ausgleich dieser Art unter moralischen Gesichtspunkten für löblich halten kann.
Unter welchen Voraussetzungen aber ist eine wirkliche Selbstbestimmung des Einzelnen möglich und eine solche des Volkes gewährleistet? Diese Voraussetzungen beziehen sich auf sowohl äußere als auch innere beziehungsweise subjekt-interne Umstände.
Die subjekt-interne Dimension der Selbstbestimmung berührt erstens den Grad der Vernünftigkeit der Urteils- und Willensbildung. Der Mensch ist ein rationales Wesen; er ist Vernunftwesen. Von einer wirklichen „Selbst“-Bestimmung sprechen wir nur dann, wenn der Einzelne von seinem gattungsspezifischen Vermögen der Erkenntnisgewinnung und Weltorientierung einen adäquaten Gebrauch macht.
Die subjekt-interne Dimension der Selbstbestimmung berührt zweitens die Kontrolle der Macht der Triebe. Selbstbestimmung realisiert sich in einem Freisein von unwiderstehlichen Bedürfnissen, deren Befriedigung nicht unmittelbar der Daseinssicherung dient beziehungsweise im Dienste eines gelungenen Lebens steht.11
Demokratietheoretisch interessant sind vor allem die äußeren, die politischen und gesellschaftlichen Umstände, unter denen die Bürger eines Staates ihre Urteile bilden und ihre Entscheidungen treffen. Deshalb ist auch zu fragen, wie ein Staat beschaffen sein muss, um erstens eine Ordnung der Freiheit zu bieten und zweitens kollektive Entscheidungsprozesse zu ermöglichen, die eine epistemische Vorzugswürdigkeit organisieren und sich im Dienste der Daseinsbewältigung als die vergleichsweise besten erweisen.
Davon, dass ein Mensch seinen Willen selbst bestimmt und seine Entscheidungen selbst getroffen hat, reden wir nur dann, wenn er sich eine geistige Unabhängigkeit und ideologische Unbeeinflussbarkeit bewahren und in seiner Meinungs- und Überzeugungsbildung eigenständigen Überlegungen folgen konnte. Ideologisch unbeeinflussbar sein heißt nicht, sich mit keinerlei Einflussnahmen konfrontiert zu sehen; es heißt, um Einflussnahmen zu wissen und ein reflektiertes Verhältnis zu ihnen zu gewinnen. Eigenständigen Überlegungen folgen heißt nicht, gänzlich abgeschirmt zu sein von äußeren Manipulationsversuchen. Es ist keine Gesellschaft vorstellbar, in der es keine Bemühungen gibt, andere geistig zu manipulieren – dafür zu sorgen, dass sie bestimmte Überzeugungen ausbilden, obwohl es dafür keine guten Gründe gibt. Entscheidend ist nicht, ob es überhaupt solche Versuche gibt, sondern ob sich der Staat daran beteiligt oder gar ein staatliches Monopol für Propaganda und alle Formen von Bewusstseinsmanipulation existiert oder angestrebt wird. Staatliche Informations- und Propagandamonopole sind ein Kennzeichen des Totalitarismus.
Ein freiheitlicher Staat hat ausschließlich eine dienende Funktion. Er ist insbesondere eine Antwort auf die Frage, wie die Freiheit des Individuums, das Teil eines staatlich organisierten Gemeinwesens ist, vor staatlicher Macht geschützt werden kann. Die Lösung dieses Problems hat zwei Aspekte. Erstens: Ein freiheitlicher Staat garantiert individuelle Grundrechte, die die Legitimität des staatlichen Handelns beschränken. Als Abwehrrechte gegen den Staat schützen sie den Einzelnen sowohl vor (ungerechtfertigten) staatlichen Eingriffen als auch vor staatlicher Bevormundung, Erziehung und Indoktrination sowie insbesondere vor staatlicher Kontrolle seiner privaten Lebensäußerungen. Zweitens: Ein freiheitlicher Staat ist Rechtsstaat und nur als ein solcher denkbar – das heißt: Alle staatliche Tätigkeit und Gewaltausübung, von der die Bürger des Staates betroffen sind, ist an Recht und Gesetz gebunden. Der freiheitliche Staat garantiert gleiches Recht für jede Rechtsperson.
Ein freiheitlicher Staat ist dem liberalen Freiheitsverständnis verpflichtet, Zwang gegen den Willen eines Menschen nur zu dem einen Zweck anzuwenden, „die Schädigung anderer zu verhüten“12. Ob eine Schädigung vorliegt und wodurch sie verursacht wurde, kann im Einzelfall umstritten sein. Denkbar ist zum Beispiel, dass man durch unvorsichtiges Verhalten – etwa in einer Pandemie – sich oder andere infiziert, diese damit direkt und, indem man für eine vermeidbare Überlastung des solidarisch organisierten Gesundheitssystems sorgt, die Allgemeinheit indirekt schädigt. Diese Möglichkeit allein rechtfertigt zwar noch keine Pflicht, sich durch einen ganz bestimmten medizinischen Eingriff (zum Beispiel durch Impfen) zu schützen, wohl aber die, durch sein Verhalten die Wahrscheinlichkeit einer Schädigung anderer maßgeblich zu reduzieren (etwa durch Kontaktvermeidung). Zwar gilt im Allgemeinen der Grundsatz, dass sich zunächst jeder selbst zu schützen hat, aber auch in einem der individuellen Autonomie verpflichteten Staat kann der Freiheitsgebrauch des Einzelnen die Lebensrisiken für andere nicht unbeschränkt erhöhen. Die Grenzen des jeweils „erlaubten Risikos“13 sind von der Gesellschaft selbst zu bestimmen.
Ein freiheitlicher Staat hat zugleich die weitere Aufgabe, die Bedingungen seines Funktionierens zu schützen. Dazu gehört wesentlich, günstige Voraussetzungen für eine selbstständige und möglichst rationale Urteils- und Willensbildung seiner Bürger zu schaffen – etwa durch die Bereitstellung von Informationen und Wissensbeständen, durch Hilfestellungen bei der Entwicklung von Fertigkeiten. Der Staat hat jedoch keine inhaltlichen Vorgaben zu machen. Er hat der Selbstregierung der Bürger nicht im Wege zu stehen und speziell für junge Menschen Möglichkeiten zu eröffnen, ihre Fähigkeiten zu einer vernünftigen Selbstbestimmung zu entwickeln. Die individuelle Selbstbestimmung ist nicht zuletzt ein Mittel, um reflektierte Vorstellungen über das Verständnis von „Freiheit“ sowie den Gebrauch der eigenen Handlungsfreiheit allererst auszubilden.
Allerdings gehört es auch zur Freiheit, dass man falsche Lebensentscheidungen treffen und sich selbst schädigen darf. Ein freiheitlicher Staat hat nicht die Aufgabe, dies zu verhindern – jedenfalls dann nicht, wenn die Kosten eines Verhaltens von dem Betreffenden selbst getragen werden können, ohne dass er zu einer unangemessenen Gefahr für Mitbürger wird. Ein Staat, der sich anschickte, dergleichen doch verhindern zu wollen, müsste – auf dem jeweiligen Stand seiner Erkenntnisse – eine gesunde Ernährung und Lebensführung verbindlich vorschreiben sowie risikoreiche Verhaltensweisen und gefährliche Freizeitbeschäftigungen verbieten. Ein solcher Staat aber wäre kein freiheitlicher Staat mehr. Er definierte – über die Befriedigung der basalen, der fundamentalen Bedürfnisse der Existenzsicherung hinaus – ein für alle verbindliches Lebensziel, nämlich die Minimierung der Lebensrisiken im Dienste eines möglichst langen Lebens.
Ebenso wenig ist es Aufgabe eines freiheitlichen Staates, die Art des Umgangs der Menschen untereinander im Detail zu regeln. Die Anforderungen an das wechselseitige Verhalten, die sich aus einer von allen akzeptierbaren Minimalmoral ergeben, sind – was die wesentlichsten Verhaltenserwartungen anlangt – ohnehin gesetzlich kodifiziert. Davon nicht berührte Verhaltensweisen liegen im Ermessen des Einzelnen. Ihm ist es beispielsweise nicht untersagt, privat zu diskriminieren – andere Menschen also entsprechend seiner eigenen Vorlieben oder idiosynkratischen Eingebungen gerade nicht gleichzubehandeln und etwa manche zu bevorzugen, andere zu meiden.





























