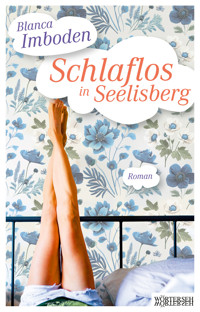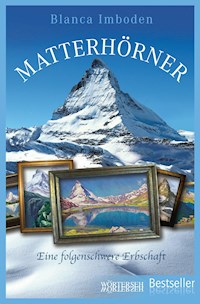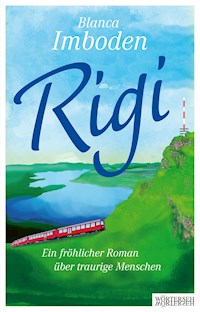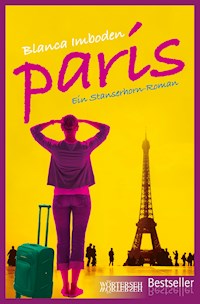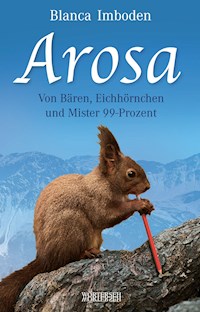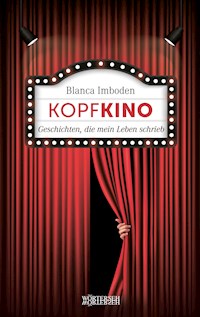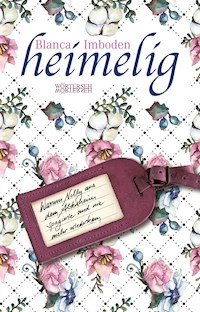21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wörterseh Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Doris führt mit ihrem fünfundachtzigjährigen Vater einen kleinen Souvenirladen in einer der schönsten Städte der Schweiz und ist bekannt dafür, mit wenigen Strichen jedes Gesicht auf eine Christbaumkugel zeichnen zu können – eine Gabe, die aus der Not geboren wurde, als ihr Vater bei einer Bestellung im Onlineformular die Orientierung verloren und statt zehn Packungen gleich zehn Paletten des Weihnachtsschmucks bestellt hatte. Doch das ist nicht die einzige Sorge, die Doris grad umtreibt. Da ist ihre Tochter mit unnatürlich aufgespritzten Lippen, ein Enkel, den sie noch nie zu Gesicht bekommen hat, und ein Ex mit krimineller Energie. Und als ob das alles nicht schon genug wäre, meldet sich auch noch eine ehemalige Mitstudierende aus einem Englischkurs vor vierzig Jahren in London: Sie plant ein Klassentreffen in Luzern. Doris ist unsicher, ob sie wirklich wissen will, wer im Leben Glück gefunden hat und bei wem der Schein trügt. Doch sie hat keine Wahl, lässt sich auf das ein, was der Moment grad von ihr fordert, und erhält schließlich eines der schönsten Geschenke, die sie je bekommen hat – allerdings erst am fünften Advent. Das Leben von Doris, die in Luzern einen kleinen Souvenirladen führt, steht gerade kopf. Eine einst falsch ausgelöste Großbestellung, aufgegeben von ihrem betagten Vater, erfordert viel Improvisationstalent. Zudem bringen allerlei familiäre Unstimmigkeiten und ein Klassentreffen zur Unzeit ihren Alltag ins Wanken. Aber Doris lässt sich davon nicht unterkriegen und findet für jedes Problem eine Lösung. Ein lebensbejahender Roman, der das Herz nicht nur an kalten Wintertagen erwärmt. Blanca Imboden schreibt mit Herz, Humor und Heimat im Gepäck – lebensnah, berührend und unverkennbar schweizerisch.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 258
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Wörterseh wird vom Bundesamt für Kultur für die Jahre 2021 bis 2025 unterstützt.
Alle Rechte vorbehalten, einschließlich derjenigen des auszugsweisen Abdrucks und der elektronischen Wiedergabe.
Angaben zur EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit finden sich auf der letzten Seite dieses Buchs.
© 2025 Wörterseh, Lachen
Lektorat: Andrea Leuthold Korrektorat: Lydia Zeller Umschlaggestaltung: Thomas Jarzina Fotos Umschlag: © Thomas Jarzina (Christbaumkugel); Der externe Link öffnet die Webseite der Stockbilderplattform Shutterstock.© www.shutterstock.com/Boris Stroujko (Spiegelung) Illustration Seite 225Der Link öffnet die Seite 225 mit der Abbildung.: Weihnachtskugel – die Hofkirche St. Leodegar Layout, Satz und Herstellung: Beate Simson Druck und Bindung: CPI Books GmbH
Print ISBN 978-3-03763-166-9 E-Book ISBN 978-3-03763-865-1
Der externe Link öffnet die Webseite des Verlags.www.woerterseh.ch
All den Menschen gewidmet, die keine Freude an den Festtagen haben, weil sie allein sind, weil ihnen jemand fehlt, weil die Familie ein Krisenherd ist – oder weil sie lieber allein wären.
Ich kenne das alles. Leider.
»Die besten Dinge im Leben sind keine Dinge.«
Peggy Anderson, 1938–2016, Autorin
Inhaltsverzeichnis
Über das Buch
Über die Autorin
1 | Die Kugelkönigin
2 | Der Koffer
3 | Das Tagebuch
4 | Die Liegende
5 | Die England-Gruppe
6 | Lotte
7 | Christa
8 | Hackbraten
9 | Der Erzeuger
10 | Käsefondue
11 | Blue Eyes
12 | Himari
13 | Nachdenklich
14 | Ungeschönt
15 | Lektion
16 | Long John
17 | Privatleben
18 | Zimtsterne
19 | Rondomeli
20 | Abendstille
21 | Glückshormone
22 | Die Überraschung
23 | Lady Luzern
24 | Weihnachten
25 | Das Glücksguthaben
26 | Der fünfte Advent
Danke
Quellen
Über das Buch
Doris führt mit ihrem fünfundachtzigjährigen Vater einen kleinen Souvenirladen in einer der schönsten Städte der Schweiz und ist bekannt dafür, mit wenigen Strichen jedes Gesicht auf eine Christbaumkugel zeichnen zu können – eine Gabe, die aus der Not geboren wurde, als ihr Vater bei einer Bestellung im Onlineformular die Orientierung verloren und statt zehn Packungen gleich zehn Paletten des Weihnachtsschmucks bestellt hatte. Doch das ist nicht die einzige Sorge, die Doris grad umtreibt. Da ist ihre Tochter mit unnatürlich aufgespritzten Lippen, ein Enkel, den sie noch nie zu Gesicht bekommen hat, und ein Ex mit krimineller Energie. Und als ob das alles nicht schon genug wäre, meldet sich auch noch eine ehemalige Mitstudierende aus einem Englischkurs vor vierzig Jahren in London: Sie plant ein Klassentreffen in Luzern. Doris ist unsicher, ob sie wirklich wissen will, wer im Leben Glück gefunden hat und bei wem der Schein trügt. Doch sie hat keine Wahl, lässt sich auf das ein, was der Moment grad von ihr fordert, und erhält schließlich eines der schönsten Geschenke, die sie je bekommen hat – allerdings erst am fünften Advent.
Das Leben von Doris, die in Luzern einen kleinen Souvenirladen führt, steht gerade kopf. Eine einst falsch ausgelöste Großbestellung, aufgegeben von ihrem betagten Vater, erfordert viel Improvisationstalent. Zudem bringen allerlei familiäre Unstimmigkeiten und ein Klassentreffen zur Unzeit ihren Alltag ins Wanken. Aber Doris lässt sich davon nich unterkriegen und findet für jedes Problem eine Lösung. Ein lebensbejahender Roman, der das Herz nicht nur an kalten Wintertagen erwärmt.
Blanca Imboden schreibt mit Herz, Humor und Heimat im Gepäck – lebensnah, berührend und unverkennbar schweizerisch.
Über die Autorin
© Monique Wittwer
Blanca Imboden, geb. 1962, liebt die Berge und reist für ihre Lesungen, bei denen sie notabene nicht viel liest, sondern vor allem erzählt, sehr gern kreuz und quer durch die Schweiz.
Für Wörterseh schrieb sie bereits zahlreiche Bestseller. Ihr neuer Roman »Der fünfte Advent« spielt im weihnächtlichen Luzern, ihrer Lieblingsstadt. Die Schriftstellerin lebt dort, wo sie aufgewachsen und tief verwurzelt ist, in Ibach SZ.
Ja, es gibt einen Souvenirladen am Fuß der Treppe zur Luzerner Hofkirche, der ganz früher einmal ein Ziegenstall war. Und das Haus darüber war tatsächlich das Glöcknerhaus. Ansonsten habe ich die ganze Geschichte und alles rund um diesen Laden völlig frei erfunden, natürlich auch die Menschen, die darin arbeiten.
Trotzdem: Wenn Sie mal dort vorbeigehen, grüßen Sie doch die echten Inhaber von mir – und kaufen Sie mindestens einen Kühlschrankmagnet.
1
Die Kugelkönigin
Ich sei die Königin der Kugeln, meint der junge Journalist zum Abschied und schüttelt meine Hand ausgiebig. Seine Augen leuchten dabei, als hätte er gerade den perfekten Titel für seinen Zeitungsartikel über mich gefunden. Dann streicht er sich eine blonde Locke aus dem Gesicht, grüßt noch einmal freundlich und verlässt unseren Laden.
Die Königin der Kugeln?
Dani Schriber wird im Dezember eine Luzerner Weihnachtsserie schreiben. Ich bin nur ein Teil davon. Natürlich nehme ich das bisschen Gratiswerbung dankend an.
Die Königin der Kugeln.
Die Christbaumkugel-Königin.
Was auch immer.
Gut, dass der Journalist nicht weiß, dass ich eine spannende, unterhaltsame Hintergrundgeschichte zum Thema liefern könnte, die seine Story enorm aufwerten würde. Freiwillig bin ich schließlich nicht zur Kugelkönigin geworden. Wirklich nicht. Es gibt Zeiten, da mag ich gar keine Christbaumkugeln mehr sehen. Spätestens im Januar, leider meist schon im November. Obwohl wir inzwischen gutes Geld damit verdienen.
Kugeln sind nun mal nicht besonders aufregend. Sie sind einfach nur rund. Keine Ecken und Kanten. Nur rund. Und bunt. Und wir haben viele davon. Unglaublich viele. Vor allem von den großen, die fast schon den Umfang von Fußbällen haben. Sie sind keine versteckte Leidenschaft von mir, auch wenn ich jetzt vor dem Journalisten ein wenig so getan habe, als ob.
»Es sind nur Kugeln, aber man kann so viel damit machen«, habe ich begeistert in Schribers Diktiergerät gehaucht. »Ich organisiere zum Beispiel immer im Advent einen Bastelsamstag im Pfarreizentrum, wo ich mit Kindern Weihnachtskugeln verziere. Wir bemalen und bekleben sie, besprühen sie mit Glanz und Glitter. Am Ende hat jedes Kind seine persönliche, individuelle Christbaumkugel. Sie sind dann so unterschiedlich, wie die Kinder halt sind, widerspiegeln ihren Charakter oder ihre Hobbys.«
Der Journalist fand das eine wunderprächtige Idee. Ob er wirklich Freude hätte, wenn ihm sein Patenkind eine mit Konfetti beklebte und mit Kunstschnee besprühte Monsterweihnachtskugel schenken würde? Kaum. Ein Mädchen hatte letztes Jahr eine ganze Kugel mit Fotos von Taylor Swift beklebt. »Eine Taylor-Swift-Kugel«, meinte das Girl dann andächtig, und mir war klar, dass es diese Kugel ganz sicher niemandem schenken würde. Außer sich selbst. Immerhin. Und ein Junge hatte den vollständigen FC Luzern auf seiner blauen Weihnachtskugel verewigt. Irgendwie hatte sich allerdings auch noch Ronaldo mit ins Team verirrt. Egal.
Die Freude der Kinder zu sehen, macht mich tatsächlich glücklich. Manchmal ist das Glück wirklich kugelrund. Und das versöhnt mich dann auch eine Weile mit unserem Christbaumkugel-Desaster.
Ich habe uns mit meinem Talent, schnell Gesichter skizzieren zu können, gerettet. Wenn sich ein Kunde darauf einlässt, kann ich innert Minuten sein Gesicht auf eine Kugel zeichnen. Ich zeichne auch Gesichter ab Fotos. Das gefällt den Menschen. Sie schauen mir gern dabei zu. Und im Dezember sind diese Gesichterkugeln unser absoluter Hit. Ein paar ausländische Touristen haben das in den sozialen Netzwerken verbreitet. Ich kann inzwischen auch blind die Kapellbrücke und den Wasserturm dazumalen. Ganz nach Wunsch der Kunden. Wenn es sein muss, male ich auch das Matterhorn dazu. Letztes Jahr habe ich für eine Bank schon im Oktober alle Mitarbeitenden auf Kugeln porträtiert. Ich hatte sehr gute Fotos als Vorlage. Das gab dann einen Überraschungschristbaum in der Eingangshalle, der großen Anklang fand, was uns wiederum sehr viele neue Kunden bescherte.
Ja, wir haben aus der Not eine Tugend gemacht. Wir sind nämlich nicht freiwillig zu all diesen Kugeln gekommen.
Gott bewahre!
Papa hatte leider vor vier Jahren mitten in einem Bestellvorgang die Orientierung im Onlineformular verloren und statt verschiedener Zehnerpacks Christbaumkugeln jeweils eine Palette bestellt. Später hat er das Malheur zwar entdeckt, so gestand er mir irgendwann, doch das war ihm dann derart peinlich, dass er gewissermaßen in eine Schockstarre verfiel und einfach nichts machte. Rein gar nichts. Dabei hätte man ein paar Tage später noch mit dem Grossisten reden können. Als aber Wochen später ein Lastwagen bei unserem Laden vorfuhr und eine unfassbare Zahl von Kugeln ablud – eine wahre Christbaumkugel-Lawine –, war nichts mehr zu machen. Bestellt, geliefert, ja, es war sogar schon alles bezahlt!
Seither habe ich sämtlichen Papierkram für unseren Laden übernommen. Ich mache von den Bestellungen bis zu den Steuern einfach alles. Papa hilft beim Verkaufen mit, wenn es ihm gut geht. Meist geht es ihm zwar gut, aber manchmal hat er schlechte Tage, an denen ich leichte Anzeichen von Demenz zu erkennen glaube. Das würde Papa aber nie zugeben. Er ist fünfundachtzig Jahre alt und bezeichnet seine Aussetzer als kleine Momente der Verwirrung. Wir leben damit – solange es nicht schlimmer wird, sogar recht gut.
Jetzt klettere ich über die steile Steintreppe in unseren Keller hinunter. Jedes Jahr muss ich mich dann doch höchstpersönlich davon überzeugen, dass wir tatsächlich noch Kugeln haben und dass die Bestände mit den aktualisierten Zahlen auf dem Rechner ungefähr übereinstimmen.
Tun sie.
Leider.
Wir haben noch.
Genug.
Ich bin nicht gern im Keller. Das Licht geht immer noch nicht. Ich muss meine Taschenlampe benutzen.
Plötzlich habe ich Angst.
Sie überfällt mich von hinten, unerwartet heftig.
Ich fühle mich in meine Kindheit zurückversetzt, als ich mich immer gefürchtet habe, wenn es dunkel wurde, obwohl ich nicht einmal genau sagen konnte, warum und wovor. Möglicherweise hatte ich einfach zu viel Fantasie und stellte mir diffuse Bedrohungen vor: gefährliche Tiere, blutrünstige Vampire, furchterregende Gespenster, bärtige Räuber … Als Kind hat man oft die Vorstellung, Gefahren würden nur im Dunkeln lauern. Später lernt man: Sie scheuen auch das Licht nicht. Damals schenkte mir mein Vater eine klobige, alte Taschenlampe, und ich leuchtete jeden Abend mehrmals vom Bett aus in mein Schlafzimmer hinein, bevor ich dann endlich einschlafen konnte.
Im Gegensatz dazu bin ich heute schon sehr, sehr mutig. Ich bin allein in unseren riesigen Keller hinuntergestiegen, ein uraltes Gewölbe in einem Haus, das bereits im ersten Drittel des 16. Jahrhunderts gebaut worden ist. Es knistert da und raschelt dort. Wen wunderts. Gerade habe ich mir eine mittelgroße Spinne aus den Haaren geklaubt. Nichts gegen Spinnen – aber doch nicht in meinen Haaren!
Ich sollte hier nicht allein sein.
Ich bin keine Höhlenmenschin.
Aber jetzt …
Da ist doch was?
Wie unheimlich!
Eine Maus wahrscheinlich. Und wenn es eine Ratte war? Oder sonst irgendetwas? Ich leuchte mutig in die Ecke, wo das erneute Rascheln herkommt.
Jööö! Es ist wirklich nur eine Maus. Eine ganz besonders winzige. Eine liebreizende. Sie schaut mich mit ihren Knopfaugen erschrocken an und huscht davon.
Woran hat sie da wohl gerade geknabbert?
Ist das nicht mein kleiner roter Koffer?
Tatsächlich! Ich freue mich.
Ich hatte dieses Köfferchen vermisst und dann irgendwann vergessen. Es enthält meine Vergangenheit, oder jedenfalls Teile davon. Tagebücher, Fotos, Andenken … So genau weiß ich das gar nicht mehr. Ich puste das Gröbste an Staub vom roten Deckel und schiebe mir den winzigen Koffer unter den Arm. Nur noch flüchtig schaue ich die verschiedenen Gestelle durch, lese die Aufschriften von ein paar Kisten und Kartons. Hier unten steht viel zu viel Plunder. Ich beschließe, vor diesem Weihnachtsfest einfach rein gar nichts neu zu bestellen. Die Ware muss raus.
Dann verlasse ich den unwirtlichen Ort und klettere über die schmale Steintreppe wieder ans Tageslicht. Ich merke, dass sich mein Atem erst jetzt wieder normalisiert.
2
Der Koffer
»Doris, wo warst du?«, fragt mein Papa, als ich unseren kleinen Souvenirladen betrete. Den vorwurfsvollen Unterton ignoriere ich großzügig.
»Im Keller«, antworte ich nur und nehme ihm damit jeglichen Wind aus den Segeln. Er ist ja nun mit seinen fünfundachtzig Jahren schon einiges erwachsener als ich, weigert sich jedoch strikte, den Keller auch nur kurz zu betreten. Irgendwann habe ich erfahren, warum: Sein Vater habe ihn da manchmal eingesperrt. Das muss für einen kleinen Jungen schon eine sehr heftige Strafe gewesen sein. Das wäre für mich auch heute noch schlimm. Und Papa ist wohl traumatisiert von den vielen Stunden in Einzelhaft und Dunkelheit.
»Es waren grad zwanzig Japaner da«, erzählt Papa jetzt freundlicher. »Ich war ein wenig gestresst, denn jeder kaufte irgendetwas. Sie waren in Eile. Aber es ging schon. Sie waren lustig. Wir haben uns zwar nicht verstanden, aber viel gelacht.«
Schön, wenn sie kaufen. Oft genug kommen Touristen nur, um zu schauen oder um Fotos von unseren schönen Souvenirs zu machen. Ab und zu essen und trinken sie auch noch dabei und hinterlassen Krümel und Müll. Manchmal fotografieren sie Postkarten ab und verschicken sie dann digital. Es gibt fast nichts, was wir nicht schon erlebt hätten. Einmal haben sich sogar zwei Männer zwischen den Regalen geprügelt, und zwölf Schneekugeln mit der Kapellbrücke gingen zu Bruch. Beim Streit ging es um eine Frau – wie könnte es anders sein. Die beiden Italiener haben die Kugeln dann mit roten Köpfen bezahlt, jeder sechs Stück. Immerhin. Die Schneekugeln verkaufen sich ohnehin nicht mehr besonders gut. Somit könnte man also sagen: Kommt her und prügelt euch – ihr müsst am Ende einfach für den Schaden im Geschäft geradestehen. Möglicherweise könnte man damit den Verkauf ankurbeln. Wir suchen ja immer nach guten Ideen, um unser Geschäft zu beflügeln.
Touristen.
Es geht nicht ohne sie, aber mit ihnen ist es auch nicht immer leicht.
Papa und ich, wir üben uns ständig in Gelassenheit, in Toleranz und überbieten uns gegenseitig darin, zu lächeln, auch wenn wir unser Gegenüber manchmal gern schütteln oder würgen würden. Das klingt vielleicht hart, aber wer das nicht versteht, hat garantiert noch nie im Verkauf gearbeitet und ganz sicher nicht mit internationalen Touristen. Nur ganz, ganz selten erlauben wir uns den Luxus, jemanden aus dem Laden zu werfen. Ja, das können wir. Aber dann findet man bestimmt schon nach einer Stunde eine schlimme Rezension auf irgendeinem Onlineportal, oder man erfährt, dass genau dieser widerliche Kunde ein berühmter Influenceraus Tokio oder Timbuktu war, der nun alle davor warnt, in unseren Laden zu kommen, oder – noch schlimmer – alle dazu aufruft, den Laden zu besuchen, alles anzufassen, alles durcheinanderzubringen und auf keinen Fall etwas zu kaufen.
Aber meist ist es ja lustig mit den Touristen. Wir haben uns einige Sätze in verschiedensten Sprachen angeeignet. Papa behauptet sogar, er könne die Leute in zwanzig Sprachen begrüßen. Wir unterhalten uns gern mit der Kundschaft, wenn sie denn Zeit und Lust hat. Meist sind aber die Menschen aus fernen Ländern nicht wirklich entspannt. Gestern war ein Chinese da, der erzählte, dass er vorgestern noch in München war und morgen Rom besuchen werde. Bevor er in unseren Laden kam, war er am Morgen kurz auf dem Pilatus. Und er kam zu uns auf dem Weg zum Löwendenkmal, war also eigentlich auf der Durchreise.
»Was ist mit diesem roten Koffer, Doris?«, will Papa neugierig wissen. »Ist das dein alter Puppenkoffer?«
Ich nicke.
»Und jetzt fängst du wieder an, mit Puppen zu spielen? Ich wusste ja, dass du dich manchmal einsam fühlst. Aber das ist doch wohl nicht die Lösung?«
Mein Vater lacht mich aus.
Ich wehre mich: »Hier drin sind alte Erinnerungen. Persönliche Erinnerungen, die dich nichts angehen, Papa. Tagebücher und so.«
»Aha. Gut, gut.« Er brummelt in seinen weißen Bart, dass man gewisse Erinnerungen auch einfach ruhen lassen könne. »Vorwärtsschauen, Doris! Zurückschauen bringt nichts Gutes.« Sogar irgendetwas über die Büchse der Pandora murmelt er, während er mit einem Staubwedel über unsere Kuckucksuhren fährt.
Vorwärtsschauen?
Sagt der Mann, der keine Frau mehr richtig angeschaut hat, seit meine Mutter gestorben ist. Sagt der Mann, der sein Schlafzimmer mit Fotos meiner Mutter geradezu tapeziert hat. Sagt der Mann, der sich an diesem Souvenirladen festklammert, obwohl er schon seit zwanzig Jahren pensioniert wäre. Sagt der Mann, der sich seit Jahren gegen jede winzigste Veränderung sträubt, womit auch mein Leben sozusagen programmiert ist, denn allein schafft er eigentlich nichts mehr.
Vorwärtsschauen! Schon klar, dass man in Papas Alter nicht mehr unbedingt nach vorn schauen mag. Wie viel Spannendes gibt es denn da noch zu sehen? Wie viel größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass noch einige weniger schöne Erlebnisse auf einen warten? Krankheiten, Schmerzen, Abschiede, Verluste und so weiter?
Das geht mir ja schon mit meinen sechzig Jahren so. Ich werde in diesem Laden sterben. Wie es schon meine Mutter und meine Großeltern taten.
Das nennt man Tradition.
Oder Sippenhaft.
Vielleicht ist es einfach Schicksal. Oder – und in ganz ehrlichen Momenten sehe ich es genau so – es ist die Strafe für meine Mutlosigkeit. Ich habe mein Schicksal nicht selbst in die Hand genommen, war zu sehr brave, liebende Tochter, als dass ich meine Eltern hätte im Stich lassen können. Ich habe ganz einfach den Abflug verpasst, sicher auch wegen meiner eigenen Bequemlichkeit, wegen zu großer Dankbarkeit, wegen Schuldgefühlen – was weiß ich …
Selber schuld.
Aber hey: Es gibt schlimmere Schicksale. Ich könnte auch im hintersten afrikanischen Hochland geboren sein oder in irgendeinem Kriegsgebiet, dann wäre ich wahrscheinlich längst tot und hätte im Leben davor wenig zu lachen gehabt.
Vorwärtsschauen!
Manchmal langweile ich mich ein wenig in meinem Leben. Es ist so vorhersehbar. Immerhin habe ich eine Tochter, die für Überraschungen sorgt, und einen kleinen Enkel, den ich leider nicht kenne.
Mein Leben hat also noch Potenzial.
Und mit sechzig, da ist wohl für die meisten Menschen das meiste vorhersehbar. Da bin ich in guter Gesellschaft. Kaum einer krempelt sein Leben in diesem Alter noch um und fängt neu an. Die meisten sind im Gegenteil eher dankbar, dass ihr Alltag in geordneten Bahnen fernab von Katastrophen wie Krankheit, Trennung, Tod verläuft.
Ich weiß gar nicht, warum ich so schlecht drauf bin. Es könnte der Anflug einer winzigen Herbstdepression sein. Ich mag es gar nicht, wenn es beim Aufstehen noch dunkel ist. Und wenn wir den Laden schließen, ist es bereits wieder dunkel. Ich brauche Licht und Sonne. Früher habe ich mich darüber geärgert, wenn schon im Oktober die ersten Weihnachtsbeleuchtungen sichtbar wurden. Heute begrüße ich jedes Lichtlein und jedes Funkeln und Flimmern. Nun, die drei Rentiere, die drei Häuser weiter in einem Garten stehen und deren Geweihe blitzende Lichtstrahlen in wechselnden Farben durch die Gegend schicken, die mag ich nicht. Man kann alles übertreiben. Wenn die Lichter zu bunt und zu wild werden, muss ich schon ab und zu mal leer schlucken. Alles Geschmackssache. Mehr ist dazu eigentlich nicht zu sagen. Gewisse Menschen outen sich halt an Weihnachten.
»Träumst du, Mädchen?«
Mädchen … schön wärs … obwohl: Möchte ich wirklich noch einmal ein Mädchen sein? Gewiss nicht.
»Hast du etwas gesagt?«, frage ich zurück.
»Ja, Doris, ich sagte: Geh nur nach oben. Ich schaffe den Rest hier schon. Viel wird jetzt nicht mehr los sein. Sonst rufe ich dich.«
Ich mustere meinen Vater unauffällig.
»Ich bin okay«, murrt er unwillig.
Ich nicke und verlasse mit meinem Köfferchen den Laden.
Es ist praktisch, direkt über dem Laden zu wohnen.
Sehr praktisch.
Wir wohnen im sogenannten Lüterhüsli an der großen Treppe zur Hofkirche, dem Glöcknerhaus also. Der Riegelbau soll um die fünfhundert Jahre alt sein. Früher haben darin die Leute gewohnt, die das riesige Kirchengeläut der Hofkirche bedient haben. Von Hand. Schon eines der ersten Geläute soll über zwölf Tonnen gewogen haben. Da brauchte der Sakristan einige Hilfskräfte. Nach dem Brand von 1633 wogen die neuen Glocken dann mehr als siebzehn Tonnen. Es brauchte mehrere Männer, um sie erklingen zu lassen. Unser Ladenlokal war damals übrigens ein Ziegenstall. Wir machen uns heute ab und zu darüber lustig. Wenn Unordnung herrscht, schimpft Papa: »Hier sieht es aus wie in einem Ziegenstall!« Oder wenn zu viele Leute im Laden sind und ein Durcheinander veranstalten, dann meckert er leise in seinen weißen Bart hinein, um an die Ziegen zu erinnern.
Wir leben gut hier.
Wir haben zwei kleine Wohnungen. Papa wohnt unten, ich oben. Eigentlich benützen wir meist seine Küche, sein Wohnzimmer. Aber ich kann mich nach oben zurückziehen, und dann lässt er mich in Ruhe. Darum funktioniert unser Zusammenleben so gut. Ich habe auch schon davon profitiert, als ich mit knapp zwanzig schwanger wurde und mein Kind ohne einen Partner großziehen musste. Ich habe im Laden mitgeholfen, und wir haben uns alle gemeinsam um meine Tochter Sandra gekümmert. Seit Mama gestorben ist, profitiert nun Papa von meiner Fürsorge.
Das Leben ist ein Geben und Nehmen.
Der Koffer!
Ich gehe hinauf in meine eigene Stube, um den roten Koffer zu öffnen. Ich bin gespannt auf seinen Inhalt. Dabei klingen die Worte meines Vaters in mir nach. Sollte man die Vergangenheit ruhen lassen? Doch sicher nur, wenn es eine schwierige, schwere Vergangenheit war. Meine war natürlich auch nicht immer eine rosarote Wolke, aber im Allgemeinen bin ich ganz gut durchs Leben gekommen.
Der Puppenkoffer ist abgeschlossen.
Ich lache laut auf.
Ich probiere mit diversen improvisierten Werkzeugen, von der Büroklammer bis zur Haarnadel, das winzige Schloss zu knacken. Irgendwann geht es auf. Es ist ja ein Puppenkoffer für Kinder und hat nur ein einfaches Spielzeugschloss. Trotzdem klopfe ich mir kurz auf die Schulter.
Der Inhalt enttäuscht allerdings ein wenig: Ich finde bloß ein Buch mit buntem Umschlag. Mein Tagebuch.
Es ist abgeschlossen.
Meine Güte!
War ich damals irgendwie neurotisch?
Litt ich unter Verfolgungswahn?
Dabei hatte ich doch keine Geheimnisse. Ich kann mich an das Tagebuch erinnern. Ich schrieb damals keine Texte. Ich zeichnete.
Zack.
Auch dieses Schloss ist offen.
Neugierig öffne ich das Buch.
Ein Tagebuch voller Zeichnungen, nur mit Datum versehen, manchmal mit einem einzigen Wort als Untertitel. Ja, das passt zu mir.
Ich blättere interessiert durch meine frühe Vergangenheit.
3
Das Tagebuch
Das Buch beginnt mit Skizzen von Ziegen. Schon als kleines Mädchen habe ich angefangen, Ziegen zu zeichnen, weil Papa und Opa immer betonten, unser Laden sei früher ein Ziegenstall gewesen. Ich war schon im Kindergarten die beste Ziegenzeichnerin weit und breit. Im Ziegenzeichnen hätte ich jeden Wettkampf der Welt gewonnen. Zeichnen und Malen war mir immer etwas vom Liebsten, und wenn im Laden nichts los war, haben Opa und Papa oft mit mir zusammen gemalt und mir Techniken und Tricks gezeigt. Opa war ein richtiger Künstler. Heute bin ich froh um diese Stunden, so konnte sich mein Talent entwickeln. Nun bin ich ja gewissermaßen eine Kugelkönigin geworden, und wir verkaufen dank meinen Skizzen doch noch unseren Überfluss an Christbaumkugeln. Allerdings hatte ich in meiner Jugend schon ambitioniertere Träume. Ich wollte an die Kunstgewerbeschule in Luzern. Heute schreibt sie sich Hochschule Luzern – Design Film Kunst. Aber eben: Mein Leben folgte einem anderen Design. Ich wurde früh schwanger, und in meinem Film hatte Kunst keinen Platz mehr. Allerdings war es auch eine Art Kunst, als alleinerziehende Frau durchs Leben zu gehen. Ich wurde Lebenskünstlerin, Überlebenskünstlerin. Das konnte ich gut. Meine Träume habe ich genauso weggeschlossen und eingesperrt wie dieses Tagebuch, allerdings mit viel komplizierteren Sicherheitsschlössern.
Die letzten Skizzen im Buch habe ich in England gemacht. Drei Monate lang besuchte ich eine Schule in London. Ich lebte in einer Wohnung mit fünf anderen jungen Leuten, vier Frauen und einem Mann. Das war eine wunderschöne, unbeschwerte Zeit. Wir waren voller Pläne und Träume. Wir waren erstmals weg von zu Hause, wollten etwas erleben.
Ich finde Zeichnungen vom Big Ben, Szenen in einem Pub: ein Barmusiker, eine Sängerin. Dann schaue ich mir die Skizzen an, die ich von meinen WG-Freundinnen gemacht habe.
Christa aus Frankfurt.
Die zarte Pariserin Isabelle.
Die lustige Lotte aus Wien.
Stefano, unser Mauerblümchen, von irgendwoher aus der Pampa Italiens. Er war der pickelgesichtige Außenseiter, die Brillenschlange, der Zahnspangengeschädigte. Wir ignorierten ihn meist, was nicht schwierig war, weil er ständig seine Nase in ein Buch steckte und schon einen roten Kopf bekam, wenn er uns nur ansah.
Und dann: Himari aus Japan, genauer aus Tokio.
Von ihr habe ich besonders viele Zeichnungen gemacht. Was für eine schöne junge Frau sie doch war! Mir gefielen ihre filigranen Gesichtszüge. Vor allem aber bezauberte mich ihr Lächeln, denn darin war immer eine gewisse Zurückhaltung, die mich anzog. Himari hatte etwas Unergründliches an sich, etwas Geheimnisvolles. Möglicherweise war sie einfach nur still und scheu, und ich habe da viel zu viel hineininterpretiert. Ich weiß noch heute nicht genau, warum sie mir am meisten bedeutete. Vielleicht war ich damals selber still und scheu? Jedenfalls im Vergleich zu Christa, Isabelle und Lotte, die sich mehr für Partys und Pubs interessierten als für unseren Sprachkurs. »Wir können auch im Nachtleben viel Englisch lernen«, betonten sie immer wieder.
Doch wir hatten auch untereinander viel Spaß, und als unsere gemeinsame Zeit um war, schworen wir einander, uns nicht aus den Augen zu verlieren.
Niemalsnie.
Und was ist passiert? Genau das!
Schade.
Innert kürzester Zeit hatten wir keinen Kontakt mehr, verloren uns aus den Augen, schienen uns vergessen zu haben. Damals gab es ja auch noch keine sozialen Netzwerke, auf denen man sich gegenseitig hätte verfolgen oder finden können. Man hatte irgendeine Adresse, die dann plötzlich nicht mehr aktuell war. Nach ein paar Jahren startete ich zwar eine Suche nach Himari, aber sie hat den häufigsten Nachnamen in Japan: Sato. In der Zeitung »Die Welt« stieß ich einmal auf die Behauptung, dieser Name sei so verbreitet, dass im Jahr 2531 alle Japaner Sato heißen könnten. Keine Ahnung, wer das wie berechnet haben will, und es klingt ja auch ziemlich schräg. Doch zurzeit sind es immerhin zwei Millionen Menschen, die Sato heißen. Als ich bei der Englischschule nach Himari fragte, gab man sich zugeknöpft und wollte weder ihre Adresse noch die meiner anderen alten Freunde herausrücken. Tja, ich gab also die Suche auf.
Außerdem war ich ja selbst schuld, meldete mich fast von Anfang an bei niemandem mehr, hatte ganz andere Dinge im Kopf: Gleich nach meiner Rückkehr aus England war ich schwanger geworden. Von einem Pianisten, der hier in der Bar im »National« spielte und kurz darauf wieder irgendwo im fernen Ausland verschwand. Romica war Rumäne – und er war süß. Er sang und spielte sich mitten in mein Herz hinein. Nicht nur in meines, wie ich bald einmal feststellte. Romica hatte kein Interesse an mir und an einem Baby schon gar nicht. Er träumte von einer Karriere als Musiker, die er nie hatte, wie sich später herausstellte. Er blieb genau das, was er damals war: ein Barpianist. Nur wurde er Jahr für Jahr ein frustrierterer Barpianist, ein verbitterter Barpianist. Er fühlte sich überqualifiziert und unterschätzt.
All das wussten meine Freundinnen aus England nicht. Ich meldete mich nicht mehr bei ihnen, sie sich schon bald auch nicht mehr bei mir. Und dann waren wie gesagt die Adressen nicht mehr gültig.
Ich schaue mir wieder meine Zeichnungen von Himari an und denke, dass sie mir wirklich gut gelungen sind.
Mein Handy klingelt.
Fast will ich wieder auflegen, weil jemand Englisch auf mich einspricht. Diese blöden Fake-Anrufe von irgendwelchen Firmen, die mir angeblich helfen wollen, nerven wirklich.
Aber dann …
Es ist Himari!
Himari aus Japan!
»Himari, wie schön, dich zu hören«, bringe ich gerade noch heraus. Ich kann ihr unmöglich sagen, dass sie genau jetzt anruft, wo ich nach all den Jahren die Zeichnungen betrachte, die ich damals von ihr gemacht habe. Das glaubt mir ja kein Mensch.
Ist das Magie? Zufall? Schicksal?
Meine Mutter sagte immer: »Es gibt keinen Zufall.«
Also doch Magie? Gedankenübertragung?
»Doris? Bist du da?«, fragt Himari in mein Schweigen hinein.
Ich war wohl doch etwas zu lange sprachlos.
»Jaja«, bestätige ich schnell. »Es ist eine große Freude, dass du anrufst. Geht es dir gut?«
»Ja. Es geht mir gut. Und dir?«
»Alles gut bei mir.«
Was soll ich anderes sagen. Da wären vierzig Jahre, die ich erzählen müsste. Vierzig lange Jahre, in denen das Leben die unterschiedlichsten Geschichten schrieb. Gute und schlechte. Und die mich am Ende ganz zufrieden zurückließen.
»Ich rufe nur ganz kurz an, um zu fragen, ob du noch in Luzern bist. Meine Assistentin hat deine Nummer gefunden und sagte, du arbeitest in einem Souvenirladen?«
Es klingt, als wäre das eher etwas Anrüchiges.
Daher sage ich: »Mir gehört ein Souvenirladen. Ja.«
»Ich komme nach Luzern. Im Dezember. Nur kurz.«
»Großartig. Brauchst du eine Unterkunft?« Ich hätte sofort wieder meine Wohnung mit ihr geteilt.
»Nein, nein, ich werde im Hotel Schweizerhof wohnen, am See«, erklärt sie.
»Perfekt!«, sage ich und denke, dass Himari recht gut gebettet sein muss, wenn sie dort absteigen kann. »Das ist ein wunderschönes Hotel. Da wird es dir an nichts fehlen. Ich wohne ganz in der Nähe.«
»Das freut mich.«
Ohne zu überlegen, sage ich dann: »Himari, was meinst du, wenn deine Assistentin mich ausfindig gemacht hat, könnte sie nicht auch etwas über Christa, Isabelle und Lotte erfahren?«
»Du meinst, es gibt so eine Art Klassentreffen?« Himari wirkt nicht gerade begeistert.
»Warum nicht? Wir hatten es doch gut zusammen«, verteidige ich meine Idee.
»Das wäre natürlich möglich. Es ist aber eher unwahrscheinlich, dass alle vor Weihnachten Zeit haben, nach Luzern zu kommen«, gibt Himari zu bedenken.
»Schon gut«, antworte ich schnell. »Es war ja nur so ein spontaner Einfall. Es ist wunderschön, dass wir zwei uns bald treffen. Ich freue mich riesig. Melde dich einfach, sobald du ankommst. Ich habe zwar im Dezember ein paar Termine und muss viel arbeiten. Aber für dich werde ich mir Zeit nehmen, Himari. Und abends habe ich sowieso immer frei.«
»Danke, Doris. Das ist sehr nett von dir.«
»Danke zurück.«
Wir tauschen unsere E-Mail-Adressen aus und verabschieden uns; zwar kurz, aber mehr als höflich. Von meiner Arbeit her kenne ich ja die Japaner inzwischen ein wenig. Die Etikette ist wichtig. Ich verneige mich sogar leicht, obwohl Himari das gar nicht sehen kann.
Himari.
Ihr Name bedeutet Sonnenblume.
In meinem Herzen geht gerade eine besonders schöne Sonnenblume auf.
Ich bleibe eine Weile auf dem Sofa sitzen, muss mich von der Überraschung erholen und auch von dem Umstand, dass Himaris Anruf kam, als ich auf ein Bild von ihr starrte und erstmals seit vielen Jahren wieder so intensiv an sie dachte.
Das ist verrückt.
Darüber muss man schon nachdenken.
Ich ziehe vorsichtig das Tagebuch auf meinen Schoß und versuche ganz fest, mir Christa in Erinnerung zu rufen. Sie war frech, laut, mutig. Eine Anführerin. Sie hatte immer eine Idee, einen Plan, einen Grund zum Feiern. Ich konzentriere mich auf ihre Gesichtszüge.
Wird sie mich jetzt anrufen? Habe ich magische Kräfte?
Kein Anruf!
Nichts.
Ganz ehrlich: Ich bin froh darüber. Das wäre doch wirklich unheimlich gewesen, wenn ich plötzlich übersinnliche Begabungen in mir entdeckt hätte.
Trotzdem schaue ich noch einmal kurz aufs Handy.
Kein Anruf.
Ich atme ein und aus und ein und aus.
Ich bin ganz normal.
Kein Medium. Keine Hexe.
Nichts.
Gut so.
4
Die Liegende
Natürlich schicke ich Himari ein paar Fotos von den Skizzen aus meinem Tagebuch, um die alten Zeiten hochleben zu lassen. Auf einem Bild hatte ich lauter Sonnenblumen um Himari herum gezeichnet. Es gefällt mir heute noch.
Sie reagiert nicht. Egal. Wir sehen uns ja bald.
»Du weißt schon, dass du wenig Zeit für deinen Gast haben wirst«, warnt mich Papa immer wieder, wenn ich von Himari erzähle.
Gerade sitzen wir an einem späten Sonntagsmittagessen. Papa hat seinen Hörnligratin aus dem Ofen geholt, und die ganze Küche duftet nach dem Käse, den er reichlich darübergestreut hat. Er kann nur zwei Gerichte wirklich gut kochen: Hörnligratin und Käsefondue. Aber immerhin. Wie viele Männer in seinem Alter kochen überhaupt noch oder haben je gekocht?