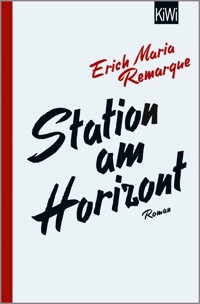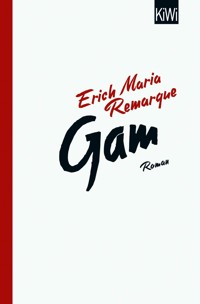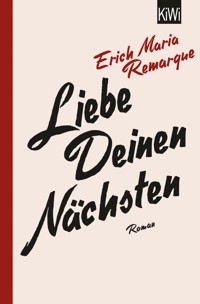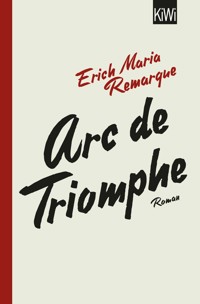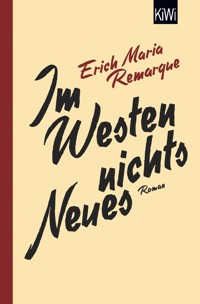14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein erschütterndes Zeugnis aus der Hölle des Konzentrationslagers – E.M. Remarques aufwühlender Antikriegsroman über die letzten Tage im KZ. In der Schlussphase des Zweiten Weltkriegs kämpfen die Insassen eines deutschen Konzentrationslagers verzweifelt um ihr Überleben. Nur ein Funke Leben trennt sie noch vom Tod, doch mit den näher rückenden alliierten Truppen keimt in den letzten Überlebenden wieder Hoffnung auf. »Der Funke Leben« ist ein eindringliches Werk über die grauenhafte Realität der nationalsozialistischen Konzentrationslager und die Aufarbeitung einer der dunkelsten Kapitel der Geschichte. E.M. Remarque, Autor des Weltbestsellers »Im Westen nichts Neues«, schildert in diesem erschütternden Antikriegsroman die unmenschlichen Zustände im KZ und den verzweifelten Kampf der Häftlinge um ihre Würde und ihre Befreiung. Ein Klassiker der Kriegsliteratur, der auch heute nichts von seiner Aktualität und Bedeutung verloren hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 665
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Erich Maria Remarque
Der Funke Leben
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Erich Maria Remarque
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Erich Maria Remarque
Erich Maria Remarque, 1898 in Osnabrück geboren, besuchte das katholische Lehrerseminar. 1916 als Soldat eingezogen, wurde er nach dem Krieg zunächst Aushilfslehrer, später Gelegenheitsarbeiter, schließlich Redakteur in Hannover und Berlin. 1932 verließ Remarque Deutschland und lebte zunächst im Tessin/Schweiz. Seine Bücher »Im Westen nichts Neues« und »Der Weg zurück« wurden 1933 von den Nazis verbrannt, er selber wurde 1938 ausgebürgert. Ab 1939 lebte Remarque in den USA und erlangte 1947 die amerikanische Staatsbürgerschaft. 1970 starb er in seiner Wahlheimat Tessin.
Der Herausgeber
Thomas F. Schneider, Leiter des Erich Maria Remarque-Friedenszentrums an der Universität Osnabrück, veröffentlichte zahlreiche Bücher zur Kriegs- und Antikriegsliteratur im 20. Jahrhundert, zur Exilliteratur und zu Erich Maria Remarque.
Das Gesamtwerk von Erich Maria Remarque liegt im Verlag Kiepenheuer & Witsch vor: www.kiwi-verlag.de
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Ein deutsches Konzentrationslager in der Schlussphase des Zweiten Weltkrieges. Nur ein Funke Leben trennt die Insassen noch vom Tod. Doch mit den immer näher rückenden Alliierten keimt in den letzten Überlebenden wieder Hoffnung auf …
Dieser Bericht aus einer grauenhaften Wirklichkeit ist eines der erschütterndsten Werke Remarques, ein Epos von der Unbesiegbarkeit des Lebens in einer Umwelt von Finsternis, Not und Verzweiflung, das nach Erscheinen eine heftige Kontroverse auslöste.
Inhaltsverzeichnis
Frontispiz
Widmung
I. Kapitel
II. Kapitel
III. Kapitel
IV. Kapitel
V. Kapitel
VI. Kapitel
VII. Kapitel
VIII. Kapitel
IX. Kapitel
X. Kapitel
XI. Kapitel
XII. Kapitel
XIII. Kapitel
XIV. Kapitel
XV. Kapitel
XVI. Kapitel
XVII. Kapitel
XVIII. Kapitel
XIX. Kapitel
XX. Kapitel
XXI. Kapitel
XXII. Kapitel
XXIII. Kapitel
XXIV. Kapitel
XXV. Kapitel
Anhang
Remarques Schwester Elfriede Scholz, ...
Im Dezember 1945 gab Remarque …
Als Reaktion auf das Interview …
Am 28. Juli 1946 trafen sich Remarque …
Ein früher Entwurf Remarques …
Ein weiter Entwurf für ein Vorwort …
Bereits im September 1949 …
Bereits vor der Veröffentlichung …
Nach dem Bruch mit Scherz …
Im Zuge der konkreten Vorbereitungen …
Remarques Entwurf eines Textes für den Schutzumschlag …
Mit Heinrich Böll äußerte sich Anfang Oktober 1952 …
Heinrich Bölls sehr kritische Rezension …
Auch Rudolf Krämer-Badoni als bedeutender, konservativ geprägter Gegenwartsautor …
Einer der seinerzeit führenden Literaturkritiker der Bundesrepublik …
Auch mehrere ehemalige Verfolgte des Nationalsozialismus …
Die Gegner Remarques führten in ihren Besprechungen …
Die Besprechung von H.H. …
Vollends zur Kontroverse wurden Remarque und der Roman …
Eine der negativsten und polemischsten Reaktionen …
Zum Jahresende 1952 fasste ein unbekannter Autor …
Am 29. Dezember 1959 schenkte Remarque …
Editorische Notiz
Eine deutsche Geschichte
Weiterführende Literatur
Dem Andenken
meiner Schwester
Elfriede
I
Das Skelett 509 hob langsam den Schädel und öffnete die Augen. Es wußte nicht, ob es ohnmächtig gewesen war oder nur geschlafen hatte. Zwischen dem einen und dem andern bestand auch kaum noch ein Unterschied; Hunger und Erschöpfung hatten seit langem dafür gesorgt. Beides war jedesmal ein Versinken in moorige Tiefen, aus denen es kein Auftauchen mehr zu geben schien.
509 lag eine Weile still und horchte. Das war eine alte Lagerregel; man wußte nie, von welcher Seite Gefahr drohte, und solange man sich unbeweglich hielt, hatte man immer die Chance, übersehen oder für tot gehalten zu werden, – ein einfaches Gesetz der Natur, das jeder Käfer kennt.
Er hörte nichts Verdächtiges. Die Wachen auf den Maschinengewehrtürmen waren halb am Schlafen, und auch hinter ihm blieb alles ruhig. Vorsichtig wandte er den Kopf und blickte zurück.
Das Konzentrationslager Mellern döste friedlich in der Sonne. Der große Appellplatz, den die SS humorvoll den Tanzboden nannte, war nahezu leer. Nur an den starken Holzpfählen, rechts vom Eingangstor, hingen vier Leute, denen die Hände auf dem Rücken zusammengebunden waren. Man hatte sie an Stricken so weit hochgezogen, daß ihre Füße die Erde nicht mehr berührten. Ihre Arme waren ausgerenkt. Zwei Heizer vom Krematorium vergnügten sich damit, aus dem Fenster mit kleinen Kohlestücken nach ihnen zu werfen; aber keiner der vier rührte sich mehr. Sie hingen schon eine halbe Stunde an den Kreuzen und waren jetzt bewußtlos.
Die Baracken des Arbeitslagers lagen verlassen da; die Außenkommandos waren noch nicht zurück. Ein paar Leute, die Stubendienst hatten, huschten über die Straßen. Links neben dem großen Eingangstor, vor dem Strafbunker, saß der SS-Scharführer Breuer. Er hatte sich einen runden Tisch und einen Korbsessel in die Sonne stellen lassen und trank eine Tasse Kaffee. Guter Bohnenkaffee war selten im Frühjahr 1945; aber Breuer hatte kurz vorher zwei Juden erwürgt, die seit sechs Wochen im Bunker am Verfaulen gewesen waren, und er hielt das für eine menschenfreundliche Tat, die eine Belohnung verdiente. Der Küchenkapo hatte ihm zu dem Kaffee noch einen Teller mit Topfkuchen geschickt. Breuer aß ihn langsam, mit Genuß; er liebte besonders die Rosinen ohne Kerne, mit denen der Teig reichlich gespickt war. Der ältere Jude hatte ihm wenig Spaß gemacht; aber der jüngere war zäher gewesen; er hatte ziemlich lange gestrampelt und gekrächzt. Breuer grinste schläfrig und lauschte auf die verwehenden Klänge der Lagerkapelle, die hinter der Gärtnerei übte. Sie spielte den Walzer »Rosen aus dem Süden«, – ein Lieblingsstück des Kommandanten, Obersturmbannführers Neubauer.
509 lag auf der gegenüberliegenden Seite des Lagers, in der Nähe einer Gruppe von Holzbaracken, die durch einen Stacheldrahtzaun vom großen Arbeitslager getrennt waren. Sie wurden das Kleine Lager genannt. In ihr befanden sich die Gefangenen, die zu schwach waren, um noch arbeiten zu können. Sie waren dort, um zu sterben. Fast alle starben rasch; aber neue kamen immer schon, wenn die andern noch nicht ganz tot waren, und so waren die Baracken stets überfüllt. Oft lagen die Sterbenden selbst in den Gängen übereinander oder sie krepierten einfach draußen im Freien. Mellern hatte keine Gaskammern. Der Kommandant war darauf besonders stolz. Er erklärte gern, daß man in Mellern eines natürlichen Todes stürbe. Offiziell hieß das Kleine Lager die Schonungsabteilung; – doch es gab nur wenige Insassen, die genug Widerstand aufbrachten, um die Schonung länger als ein bis zwei Wochen durchzuhalten. Eine kleine zähe Gruppe davon hauste in Baracke 22. Sie nannte sich mit einem Rest von Galgenhumor die Veteranen. 509 gehörte dazu. Er war vor vier Monaten ins Kleine Lager gebracht worden, und es schien ihm selbst ein Wunder, daß er immer noch lebte.
Der Rauch vom Krematorium trieb schwarz herüber. Der Wind drückte ihn auf das Lager, und die Schwaden strichen niedrig über die Baracken. Sie rochen fett und süßlich und reizten zum Erbrechen. 509 hatte sich nie an sie gewöhnen können; selbst nicht nach zehn Jahren im Lager. Die Reste von zwei Veteranen waren heute darunter; die des Uhrmachers Jan Sibelski und des Universitätsprofessors Joel Buchsbaum. Beide waren in Baracke 22 gestorben und mittags im Krematorium abgeliefert worden, Buchsbaum allerdings nicht ganz vollständig; drei Finger, siebzehn Zähne, die Zehennägel und ein Teil des Geschlechtsgliedes hatten gefehlt. Sie waren ihm während seiner Erziehung zu einem brauchbaren Menschen verloren gegangen. Die Sache mit dem Geschlechtsglied war an den Kulturabenden in der SS-Kaserne sehr belacht worden. Sie war eine Idee des Scharführers Günther Steinbrenner gewesen, der erst kürzlich ins Lager gekommen war. Einfach, wie alle großen Einfälle, – eine Einspritzung mit hochprozentiger Salzsäure, weiter nichts. Steinbrenner hatte sich damit sofort Achtung unter den Kameraden verschafft.
Der Märznachmittag war milde, und die Sonne hatte schon etwas Wärme; trotzdem fror 509, obschon er außer seinen eigenen Kleidern noch Sachen von drei anderen Personen trug, – die Jacke Josef Buchers, den Mantel des Althändlers Lebenthal und den zerrissenen Sweater Joel Buchsbaums, den die Baracke gerettet hatte, bevor die Leiche abgeliefert worden war. Aber wenn man ein Meter achtundsiebzig groß war und unter siebzig Pfund wog, hätten wahrscheinlich selbst Pelze nicht mehr viel gewärmt.
509 hatte das Recht, eine halbe Stunde in der Sonne zu liegen. Dann mußte er zur Baracke zurück, die geborgten Kleider abgeben, seine Jacke dazu, und ein anderer kam dran. Das war so abgemacht worden zwischen den Veteranen, seit die Kälte vorbei war. Manche hatten es nicht mehr gewollt. Sie waren zu erschöpft gewesen und hatten nach den Leiden des Winters nur noch in Ruhe in den Baracken sterben wollen; aber Berger, der Stubenälteste, hatte darauf bestanden, daß alle, die noch kriechen konnten, jetzt eine Zeitlang an die frische Luft kamen. Der nächste war Westhof; dann kam Bucher. Lebenthal hatte verzichtet; er hatte Besseres zu tun.
509 wandte sich wieder zurück. Das Lager war auf einer Anhöhe errichtet, und durch den Stacheldraht konnte er jetzt die Stadt sehen. Sie lag im Tal, weit unterhalb des Lagers, und über dem Gewirr der Dächer hoben sich die Türme der Kirchen. Es war eine alte Stadt mit vielen Kirchen und Wällen, mit Lindenalleen und winkligen Gassen. Im Norden lag der neue Teil mit breiteren Straßen, dem Hauptbahnhof, Mietskasernen, Fabriken und den Kupfer- und Eisenwerken, in denen Kommandos vom Lager arbeiteten. Ein Fluß zog sich in weitem Bogen hindurch, und in ihm spiegelten sich schläfrig die Brücken und die Wolken.
509 ließ den Kopf sinken. Er konnte ihn immer nur eine Weile hochhalten. Ein Schädel war schwer, wenn die Halsmuskeln zu Fäden zusammengeschrumpft waren, – und der Anblick der rauchenden Schornsteine im Tal machte nur noch hungriger als sonst. Er machte hungrig im Gehirn, – nicht nur im Magen. Der Magen war seit Jahren daran gewöhnt und keiner anderen Empfindung mehr fähig als einer gleichbleibenden, stumpfen Gier. Hunger im Gehirn war schlimmer. Er weckte Halluzinationen und wurde nie müde. Er fraß sich selbst in den Schlaf. Es hatte 509 im Winter drei Monate gekostet, um die Vorstellung von Bratkartoffeln loszuwerden. Er hatte sie überall gerochen, sogar im Gestank der Latrinenbaracke. Jetzt war es Speck. Speck mit Spiegeleiern.
Er blickte auf die Nickeluhr, die auf der Erde neben ihm lag. Lebenthal hatte sie ihm geborgt. Sie war ein kostbarer Besitz der Baracke; der Pole Julius Silber, der längst tot war, hatte sie vor Jahren ins Lager geschmuggelt. 509 sah, daß er noch zehn Minuten Zeit hatte; aber er beschloß trotzdem, zur Baracke zurückzukriechen. Er wollte nicht wieder einschlafen. Man wußte nie, ob man wieder aufwachen würde. Vorsichtig spähte er noch einmal die Lagerstraße entlang. Auch jetzt sah er nichts, was Gefahr bedeuten konnte. Er erwartete es eigentlich auch nicht. Die Vorsicht war eher die Routine des alten Lagerhasen als wirkliche Angst.
Das Kleine Lager befand sich wegen Dysenterie unter einer losen Art von Quarantäne, und die SS kam selten herein. Außerdem war die Kontrolle im ganzen Lager in den letzten Jahren bedeutend schwächer geworden als früher. Der Krieg hatte sich immer stärker bemerkbar gemacht, und ein Teil der SS-Leute, die bis dahin nur wehrlose Gefangene heroisch gefoltert und ermordet hatten, war endlich ins Feld geschickt worden. Jetzt, im Frühling 1945, hatte das Lager nur noch ein Drittel der früheren SS-Truppen. Die innere Verwaltung wurde schon lange fast ganz von Häftlingen erledigt. Jede Baracke hatte einen Blockältesten und einige Stubenälteste; die Arbeitskommandos unterstanden den Kapos und Vormännern, das ganze Lager den Lagerältesten. Alle waren Gefangene. Sie wurden kontrolliert von Lagerführern, Blockführern und Kommandoführern; das waren stets SS-Leute. Im Anfang hat das Lager nur politische Häftlinge gehabt; dann waren im Laufe der Jahre gewöhnliche Verbrecher in Mengen aus den überfüllten Gefängnissen der Stadt und der Provinz dazugekommen. Die Gruppen unterschieden sich durch die Farbe der dreieckigen Stoffwinkel, die außer den Nummern auf die Kleider aller Gefangenen genäht waren. Die der Politischen waren rot; die der Kriminellen grün. Juden trugen außerdem noch einen gelben Winkel dazu, so daß beide Dreiecke zusammen einen Davidstern ergaben.
509 nahm den Mantel Lebenthals und die Jacke Josef Buchers, hing sie sich über den Rücken und begann der Baracke zuzukriechen. Er spürte, daß er müder war als sonst. Selbst das Kriechen fiel ihm schwer. Schon nach kurzer Zeit fing der Boden an, sich unter ihm zu drehen. Er hielt inne, schloß die Lider und atmete tief, um sich zu erholen. Im selben Augenblick begannen die Sirenen der Stadt.
Es waren anfangs nur zwei. Wenige Sekunden später hatten sie sich vervielfacht, und gleich darauf schien es, als schriee unten die ganze Stadt. Sie schrie von den Dächern und aus den Straßen, von den Türmen und aus den Fabriken, sie lag offen in der Sonne, nichts schien sich in ihr zu regen, sie schrie nur plötzlich, als wäre sie ein paralysiertes Tier, das den Tod sieht und nicht weglaufen kann; – sie schrie mit Sirenen und Dampfpfeifen gegen den Himmel, in dem alles still war.
509 hatte sich sofort geduckt. Es war verboten, bei Fliegeralarm außerhalb der Baracken zu sein. Er hätte versuchen können, aufzustehen und zu laufen, aber er war zu schwach, um schnell genug vorwärts zu kommen, und die Baracke war zu weit; inzwischen hätte ein nervöser neuer Wachposten schon auf ihn schießen können. So rasch er konnte, kroch er deshalb ein paar Meter zurück zu einer flachen Bodenfalte, preßte sich hinein und zog die geborgten Kleider über sich. Er sah so aus wie jemand, der tot zusammengebrochen war. Das kam oft vor und war unverdächtig. Der Alarm würde ohnehin nicht lange dauern. Die Stadt hatte in den letzten Monaten alle paar Tage einen gehabt, und es war nie etwas passiert. Die Flugzeuge waren immer weitergeflogen in der Richtung nach Hannover und Berlin.
Die Sirenen des Lagers setzten ein. Dann kam nach einiger Zeit der zweite Alarm. Das Heulen schwoll auf und ab, als liefen unscharfe Platten auf riesigen Grammophonen. Die Flugzeuge näherten sich der Stadt. 509 kannte auch das. Es rührte ihn nicht. Sein Feind war der nächste Maschinengewehrschütze, der merken würde, daß er nicht tot war. Was außerhalb des Stacheldrahtes geschah, ging ihn nichts an.
Er atmete mühsam. Die stickige Luft unter dem Mantel wurde zu schwarzer Watte, die sich dichter und dichter über ihn häufte. Er lag in der Bodensenkung wie in einem Grab; – und allmählich kam es ihm vor, als wäre es wirklich sein Grab, – als könne er nie wieder aufstehen, als wäre es diesmal das Ende und er würde hier liegen bleiben und sterben, endlich übermannt von der letzten Schwäche, gegen die er so lange gekämpft hatte. Er versuchte sich zu wehren, aber es half wenig; er spürte es nur noch stärker, ein sonderbar ergebenes Warten, das sich in ihm ausbreitete, in ihm und über ihn hinaus, als warte plötzlich alles, – warte die Stadt, als warte die Luft, als warte selbst das Licht. Es war wie bei einer beginnenden Sonnenfinsternis, wenn die Farben schon den Hauch von Blei haben und die ferne Ahnung einer sonnenlosen, toten Welt, – ein Vakuum, ein Warten ohne Atem, ob der Tod noch einmal vorübergehen würde oder nicht.
Der Schlag war nicht heftig; aber er war unerwartet. Und er kam von einer Seite, die geschützter schien als jede andere. 509 spürte ihn als einen harten Ruck, tief aus dem Boden gegen den Magen. Gleichzeitig schnitt durch das Heulen draußen ein hohes, stählernes Sausen, das sich rasend verstärkte, ähnlich dem Lärm der Sirenen und doch völlig anders. 509 wußte nicht, was früher gekommen war, der Schlag aus der Erde oder das Sausen und der darauffolgende Krach, – aber er wußte, daß beides noch in keinem Alarm vorher dagewesen war, und als es sich jetzt wiederholte, näher und stärker, über und unter ihm, da wußte er auch, was es sein mußte: die Flugzeuge waren zum erstenmale nicht weitergeflogen. Die Stadt wurde bombardiert.
Der Boden bebte wieder. Es schien 509, als hieben gewaltige unterirdische Gummiknüppel auf ihn ein. Er war plötzlich ganz wach. Die Todesmüdigkeit war wie Rauch in einem Wirbelwind verflogen. Jeder Ruck aus dem Boden wurde zu einem Ruck in seinem Gehirn. Eine Zeitlang lag er noch still, – dann, fast ohne zu merken, was er tat, schob er behutsam eine Hand vorwärts und hob den Mantel von seinem Gesicht so weit hoch, daß er darunter hinweg zur Stadt hinabspähen konnte.
Langsam und spielerisch faltete sich unten gerade der Bahnhof auseinander und hob sich in die Luft. Es sah beinahe zierlich aus, wie die goldene Kuppel über die Bäume des Stadtparks segelte und hinter ihnen verschwand. Die schweren Explosionen schienen garnicht dazu zu gehören, alles war viel zu langsam dafür, und das Geräusch der Flak ertrank darin wie Terriergekläff im tiefen Bellen einer großen Dogge. Beim nächsten mächtigen Stoß begann einer der Türme der Katharinenkirche sich zu neigen. Auch er fiel sehr langsam und zerbrach während des Fallens gemächlich in mehrere Stücke, – als wäre das Ganze eine Zeitlupenaufnahme und keine Wirklichkeit.
Qualmfontänen wuchsen jetzt wie Pilze zwischen den Häusern empor. 509 hatte immer noch nicht das Gefühl von Zerstörung; unsichtbare Riesen spielten da unten, das war alles. In den unbeschädigten Stadtteilen stieg friedlich weiter der Rauch aus den Schornsteinen auf; der Fluß spiegelte wie früher die Wolken, und die Puffs der Flak säumten den Himmel, als sei er ein harmloses Kissen, dessen Nähte überall barsten und grauweiße Baumwollflocken ausstießen.
Eine Bombe fiel weit außerhalb der Stadt in die Wiesen, die sich zum Lager hinaufzogen. 509 spürte immer noch keine Furcht; alles das war viel zu weit weg von der engen Welt, die allein er noch kannte. Furcht konnte man haben vor brennenden Zigaretten an Augen und Hoden, vor Wochen im Hungerbunker, einem Steinsarg, in dem man weder stehen noch liegen konnte, vor dem Bock, auf dem einem die Nieren zerschlagen wurden; vor der Folterkammer im linken Flügel neben dem Tor, – vor Steinbrenner, vor Breuer, vor dem Lagerführer Weber, – aber selbst das war schon etwas verblaßt, seit er ins Kleine Lager abgeschoben worden war. Man mußte rasch vergessen können, um die Kraft zum Weiterleben aufzubringen. Außerdem war das Konzentrationslager Mellern nach zehn Jahren der Torturen etwas müder geworden; – selbst einem frischen, idealistischen SS-Mann wurde es mit der Zeit langweilig, Skelette zu quälen. Sie hielten wenig aus und reagierten nicht genügend. Nur wenn kräftige, leidensfähige Zugänge kamen, flammte der alte patriotische Eifer manchmal noch auf. Dann hörte man in den Nächten wieder das vertraute Heulen, und die SS-Mannschaften sahen ein bißchen angeregter aus, wie nach einem guten Schweinebraten mit Kartoffeln und Rotkohl. Sonst aber waren die Lager in Deutschland während der Kriegsjahre eher human geworden. Man vergaste, erschlug und erschoß fast nur noch oder arbeitete die Leute einfach kaputt und ließ sie dann verhungern. Daß ab und zu im Krematorium ein Lebender mit verbrannt wurde, lag eher an Überarbeitung und der Tatsache, daß manche Skelette sich lange nicht bewegten, als an böser Absicht. Es kam auch nur vor, wenn rasch Raum für neue Transporte geschaffen werden mußte durch Massenliquidierungen. Sogar das Verhungernlassen der Arbeitsunfähigen wurde in Mellern nicht zu roh betrieben; es gab im Kleinen Lager immer noch etwas zu essen, und Veteranen wie 509 hatten es fertiggebracht, Rekorde damit zu schlagen und am Leben zu bleiben.
Das Bombardement hörte plötzlich auf. Nur noch die Flak tobte. 509 hob den Mantel etwas höher, so daß er den nächsten Maschinengewehrturm sehen konnte. Der Stand war leer. Er blickte weiter nach rechts und dann nach links. Auch dort waren die Türme ohne Wachen. Die SS-Mannschaften waren überall heruntergeklettert und hatten sich in Sicherheit gebracht; sie hatten gute Luftschutzbunker nahe den Kasernen. 509 warf den Mantel ganz zurück und kroch näher an den Stacheldraht heran. Er stützte sich auf die Ellenbogen und starrte ins Tal hinunter.
Die Stadt brannte jetzt überall. Das, was vorher spielerisch ausgesehen hatte, hatte sich inzwischen in das verwandelt, was es wirklich war: Feuer und Zerstörung. Der Rauch hockte wie eine riesige Molluske der Vernichtung gelb und schwarz in den Straßen und fraß die Häuser. Flammen zuckten hindurch. Vom Bahnhof schoß eine mächtige Funkengarbe hoch. Der zerbrochene Turm der Katharinenkirche begann zu flackern, und Feuerzungen leckten wie fahle Blitze daran empor. Unbekümmert, als wäre nichts geschehen, stand die Sonne in goldener Glorie dahinter, und es wirkte fast gespenstisch, daß der Himmel mit seinem Blau und Weiß genau so heiter war wie vorher und daß die Wälder und Höhenzüge rundum ruhig und unbeteiligt weiter im sanften Licht lagen, – als sei nur die Stadt allein verdammt worden durch einen unbekannten, finsteren Richtspruch.
509 starrte hinunter. Er vergaß alle Vorsicht und starrte hinunter. Er kannte die Stadt nicht anders als durch den Stacheldraht, und er war nie in ihr gewesen; aber in den zehn Jahren, die er im Lager zugebracht hatte, war sie für ihn mehr geworden als nur eine Stadt.
Im Anfang war sie das fast unerträgliche Bild der verlorenen Freiheit gewesen. Tag für Tag hatte er auf sie hinuntergestarrt; – er hatte sie gesehen mit ihrem sorglosen Leben, wenn er nach einer Spezialbehandlung durch den Lagerführer Weber kaum noch kriechen konnte; – er hatte sie gesehen mit ihren Kirchen und Häusern, wenn er mit ausgerenkten Armen am Kreuz hing; – er hatte sie gesehen mit den weißen Kähnen auf ihrem Fluß und den Automobilen, die in den Frühling fuhren, während er Blut aus den zerschlagenen Nieren pißte; – die Augen hatten ihm gebrannt, wenn er sie gesehen hatte, und es war eine Folter gewesen, sie zu sehen, eine Folter, die zu allen andern des Lagers noch hinzugekommen war.
Dann hatte er begonnen, sie zu hassen. Die Zeit war hingegangen, und nichts hatte sich in ihr geändert, ganz gleich, was hier oben geschah. Der Rauch ihrer Kochherde war jeden Tag weiter aufgestiegen, unbekümmert um den Qualm des Krematoriums; – ihre Sportplätze und Parks waren voll fröhlichen Tumults gewesen, während gleichzeitig Hunderte von gejagten Kreaturen auf dem Tanzboden des Lagers verröchelten; – Scharen von ferienfrohen Menschen waren jeden Sommer aus ihr in die Wälder gewandert, während die Häftlingskolonnen ihre Toten und Ermordeten aus den Steinbrüchen zurückschleppten; er hatte sie gehaßt, weil er geglaubt hatte, daß er und die andern Gefangenen für immer von ihr vergessen worden wären.
Schließlich war auch der Haß erloschen. Der Kampf um eine Brotkruste war wichtiger geworden als alles andere, – und ebenso die Erkenntnis, daß Haß und Erinnerungen ein gefährdetes Ich ebenso zerstören konnten wie Schmerz. 509 hatte gelernt, sich einzukapseln, zu vergessen und sich um nichts mehr zu kümmern als um die nackte Existenz von einer Stunde zur andern. Die Stadt war ihm gleichgültig geworden und ihr unverändertes Bild nur noch ein trübes Symbol dafür, daß auch sein Schicksal sich nicht mehr ändern würde.
Jetzt brannte sie. Er spürte, wie seine Arme zitterten. Er versuchte, es zu unterdrücken, doch er konnte es nicht; es wurde stärker. Alles in ihm war plötzlich lose und ohne Zusammenhang. Sein Kopf schmerzte, als wäre er hohl und jemand trommele darin.
Er schloß die Augen. Er wollte das nicht. Er wollte nichts wieder in sich aufkommen lassen. Er hatte alle Hoffnung zerstampft und begraben. Er ließ die Arme auf den Boden gleiten und legte das Gesicht auf die Hände. Die Stadt ging ihn nichts an. Er wollte nicht, daß sie ihn anginge. Er wollte weiter, wie vorher, gleichgültig die Sonne auf das schmutzige Pergament scheinen lassen, das als Haut über seinen Schädel gespannt war, wollte atmen, Läuse töten, nicht denken, – so wie er es seit langem getan hatte.
Er konnte es nicht. Das Beben in ihm hörte nicht auf. Er wälzte sich auf den Rücken und streckte sich flach aus. Über ihm war jetzt der Himmel mit den Wölkchen der Flakgeschosse. Sie zerfaserten rasch und trieben vor dem Winde dahin. Er lag eine Weile so, dann konnte er auch das nicht mehr aushalten. Der Himmel wurde zu einem blauen und weißen Abgrund, in den er hineinzufliegen schien. Er drehte sich um und setzte sich auf. Er blickte nicht mehr auf die Stadt. Er blickte auf das Lager, und er blickte zum erstenmale darauf, als erwarte er Hilfe von dort.
Die Baracken dösten wie vorher in der Sonne. Auf dem Tanzplatz hingen die vier Leute immer noch an den Kreuzen. Der Scharführer Breuer war verschwunden, aber der Rauch vom Krematorium stieg weiter auf; er war nur dünner geworden. Entweder verbrannte man gerade Kinder, oder es war befohlen worden, mit der Arbeit aufzuhören.
509 zwang sich, das alles genau zu betrachten. Dieses war seine Welt. Keine Bombe hatte sie getroffen. Sie lag unerbittlich da wie immer. Sie allein beherrschte ihn; das da draußen, jenseits des Stacheldrahtes, ging ihn nichts an.
In diesem Augenblick schwieg die Flak. Es traf ihn, als wäre ein Reifen von Lärm gesprungen, der ihn fest umspannt gehalten hatte. Eine Sekunde lang glaubte er, er habe nur geträumt und wache gerade auf. Mit einem Ruck drehte er sich um.
Er hatte nicht geträumt. Da lag die Stadt und brannte. Da waren Qualm und Zerstörung, und es ging ihn doch etwas an. Er konnte nicht mehr erkennen, was getroffen war, er sah nur Rauch und das Feuer, alles andere verschwomm, aber es war auch egal: die Stadt brannte, die Stadt, die unveränderlich erschienen war, unveränderlich und unzerstörbar wie das Lager.
Er schrak zusammen. Ihm war plötzlich, als seien hinter ihm von allen Türmen alle Maschinengewehre des Lagers auf ihn gerichtet. Rasch blickte er herum. Nichts war geschehen. Die Türme waren leer wie vorher. Auch in den Straßen war niemand zu sehen. Doch es half nichts; – eine wilde Angst hatte ihn jäh wie eine Faust im Genick gepackt und schüttelte ihn. Er wollte nicht sterben! Jetzt nicht! Jetzt nicht mehr! Hastig ergriff er seine Kleidungsstücke und kroch zurück. Er verwickelte sich dabei in den Mantel Lebenthals und stöhnte und fluchte und riß ihn unter seinen Knien fort und kroch weiter zur Baracke, eilig, tief erregt und verwirrt, – als flüchte er noch vor etwas anderem als nur vor dem Tode.
II
Baracke 22 hatte zwei Flügel, die je von zwei Stubenältesten kommandiert wurden. In der zweiten Sektion des zweiten Flügels hausten die Veteranen. Es war der schmalste und feuchteste Teil, aber das kümmerte sie wenig; wichtig war für sie nur, daß sie zusammenlagen. Das gab jedem mehr Widerstandskraft. Sterben war ebenso ansteckend wie Typhus, und einzeln ging man in dem allgemeinen Krepieren leicht mit ein, ob man wollte oder nicht. Zu mehreren konnte man sich besser wehren. Wenn einer aufgeben wollte, halfen ihm die Kameraden, durchzuhalten. Die Veteranen im Kleinen Lager lebten nicht länger, weil sie mehr zu essen hatten; sie lebten, weil sie sich einen verzweifelten Rest von Widerstand bewahrt hatten.
In der Ecke der Veteranen lagen zur Zeit hundertvierunddreißig Skelette. Platz war nur da für vierzig. Die Betten bestanden aus Brettern, vier übereinander. Sie waren kahl oder mit altem faulenden Stroh bedeckt. Es gab nur ein paar schmutzige Decken, um die jedesmal, wenn die Besitzer starben, bitter gekämpft wurde. Auf jedem Bett lagen mindestens drei bis vier Menschen. Das war selbst für Skelette zu eng; denn Schulter- und Beckenknochen schrumpften nicht. Man hatte etwas mehr Platz, wenn man seitlich lag, gepackt wie Sardinen; aber trotzdem hörte man nachts oft genug das dumpfe Aufschlagen, wenn jemand im Schlaf herunterfiel. Viele schliefen hockend, und wer Glück hatte, dem starben seine Bettgenossen abends. Sie wurden dann hinausgeschafft, und er konnte sich für eine Nacht besser ausstrecken, bevor neuer Zuwachs kam.
Die Veteranen hatten sich die Ecke links von der Tür gesichert. Sie waren noch zwölf Mann. Vor zwei Monaten waren sie vierundvierzig gewesen. Der Winter hatte sie kaputt gemacht. Sie wußten alle, daß sie im letzten Stadium waren; die Rationen wurden ständig kleiner, und manchmal gab es ein bis zwei Tage überhaupt nichts zu essen; dann lagen die Toten zu Haufen draußen.
Von den zwölf war einer verrückt und glaubte, er sei ein deutscher Schäferhund. Er hatte keine Ohren mehr; sie waren ihm abgerissen worden, als man SS-Hunde an ihm trainiert hatte. Der Jüngste hieß Karel und war ein Knabe aus der Tschechoslowakei. Seine Eltern waren tot; sie düngten das Kartoffelfeld eines frommen Bauern im Dorfe Westlage. Die Asche der Verbrannten wurde nämlich im Krematorium in Säcke gefüllt und als künstlicher Dünger verkauft. Sie war reich an Phosphor und Kalzium. Karel trug das rote Abzeichen des politischen Gefangenen. Er war elf Jahre alt.
Der älteste Veteran war zweiundsiebzig. Er war ein Jude, der um seinen Bart kämpfte. Der Bart gehörte zu seiner Religion. Die SS hatte ihn verboten, aber der Mann hatte immer wieder versucht, ihn wachsen zu lassen. Er war im Arbeitslager jedesmal dafür über den Bock gekommen und verprügelt worden. Im Kleinen Lager hatte er mehr Glück. Die SS kümmerte sich hier weniger um die Regeln und kontrollierte auch selten; sie hatte zu viel Angst vor Läusen, Dysenterie, Typhus und Tuberkulose. Der Pole Julius Silber hatte den Alten Ahasver genannt, weil er fast ein Dutzend holländischer, polnischer, österreichischer und deutscher Konzentrationslager überlebt hatte. Silber war inzwischen an Typhus gestorben und blühte als Primelbusch im Garten des Kommandanten Neubauer, der die Totenasche gratis bekam; doch der Name Ahasver war geblieben. Das Gesicht des Alten war im Kleinen Lager geschrumpft, aber der Bart war gewachsen und jetzt Heimat und Wald für Generationen kräftiger Läuse.
Der Stubenälteste der Sektion war der frühere Arzt Dr. Ephraim Berger. Er war wichtig gegen den Tod, der die Baracke eng umstand. Im Winter, wenn die Skelette auf dem Glatteis gefallen waren und sich die Knochen gebrochen hatten, hatte er manche schienen und retten können. Das Hospital nahm niemand vom Kleinen Lager auf; es war nur da für Leute, die arbeitsfähig waren und für Prominente. Im Großen Lager war das Glatteis im Winter auch weniger gefährlich gewesen; man hatte die Straße während der schlimmsten Tage mit Asche aus dem Krematorium bestreut. Nicht aus Rücksicht auf die Gefangenen, – sondern um brauchbare Arbeitskräfte zu behalten. Seit der Eingliederung der Konzentrationslager in den allgemeinen Arbeitseinsatz wurde mehr Wert darauf gelegt. Als Ausgleich arbeitete man die Häftlinge allerdings rascher zu Tode. Die Abgänge machten nichts aus; es wurden täglich genug neue Leute verhaftet.
Berger war einer der wenigen Gefangenen, die Erlaubnis hatten, das Kleine Lager zu verlassen. Er wurde seit einigen Wochen in der Leichenhalle des Krematoriums beschäftigt. Stubenälteste brauchten im allgemeinen nicht zu arbeiten, aber Ärzte waren knapp; deshalb hatte man ihn kommandiert. Es war vorteilhaft für die Baracke. Über den Lazarettkapo, den Berger von früher kannte, konnte er so manchmal etwas Lysol, Watte, Aspirin und ähnliches für die Skelette bekommen. Er besaß auch eine Flasche Jod, die unter seinem Stroh versteckt war.
Der wichtigste Veteran von allen jedoch war Leo Lebenthal. Er hatte geheime Verbindungen zum Schleichhandel des Arbeitslagers und, wie es hieß, sogar welche nach draußen. Wie er das machte, wußte keiner genau. Es war nur bekannt, daß zwei Huren aus dem Etablissement »Die Fledermaus«, das vor der Stadt lag, dazugehörten. Auch ein SS-Mann sollte beteiligt sein; doch davon wußte niemand wirklich etwas. Und Lebenthal sagte nichts.
Er handelte mit allem. Man konnte durch ihn Zigarettenstummel bekommen, eine Mohrrübe, manchmal Kartoffeln, Abfälle aus der Küche, einen Knochen und hier und da eine Scheibe Brot. Er betrog niemanden; er sorgte nur für Zirkulation. Der Gedanke, heimlich für sich allein zu sorgen, kam ihm nie. Der Handel hielt ihn am Leben; nicht das, womit er handelte.
509 kroch durch die Tür. Die schräge Sonne hinter ihm schien durch seine Ohren. Sie leuchteten einen Augenblick wächsern und gelb zu beiden Seiten des dunklen Kopfes. »Sie haben die Stadt bombardiert«, sagte er keuchend.
Niemand antwortete. 509 konnte noch nichts sehen; es war dunkel in der Baracke nach dem Licht draußen. Er schloß die Augen und öffnete sie wieder. »Sie haben die Stadt bombardiert«, wiederholte er. »Habt ihr es nicht gehört?«
Keiner sagte auch diesmal etwas. 509 sah jetzt Ahasver neben der Tür. Er saß auf dem Boden und streichelte den Schäferhund. Der Schäferhund knurrte; er hatte Angst. Die verfilzten Haare hingen ihm über das vernarbte Gesicht, und dazwischen funkelten die erschreckten Augen. »Ein Gewitter«, murmelte Ahasver. »Nichts als ein Gewitter! Ruhig, Wolf, – ruhig!«
509 kroch weiter in die Baracke hinein. Er begriff nicht, daß die andern so gleichgültig waren. »Wo ist Berger?« fragte er.
»Im Krematorium.«
Er legte den Mantel und die Jacke auf den Boden. »Will keiner von euch raus?«
Er sah Westhof und Bucher an. Sie erwiderten nichts.
»Du weißt doch, daß es verboten ist«, sagte Ahasver schließlich. »Solange Alarm ist.«
»Der Alarm ist vorbei.«
»Noch nicht.«
»Doch. Die Flieger sind fort. Sie haben die Stadt bombardiert.«
»Das hast du nun schon oft genug gesagt«, knurrte jemand aus dem Dunkel.
Ahasver blickte auf. »Vielleicht werden sie ein paar Dutzend von uns zur Strafe dafür erschießen.«
»Erschießen«? Westhof kicherte. »Seit wann erschießen sie hier?«
Der Schäferhund bellte. Ahasver hielt ihn fest. »In Holland erschossen sie nach einem Luftangriff gewöhnlich zehn, zwanzig politische Gefangene. Damit sie keine falschen Ideen bekämen, sagten sie.«
»Wir sind hier nicht in Holland.«
»Das weiß ich. Ich habe auch nur gesagt, daß in Holland erschossen wurde.«
»Erschießen!« Westhof schnaubte verächtlich. »Bist du ein Soldat, daß du solche Ansprüche stellst? Hier wird erhängt und erschlagen.«
»Sie könnten es zur Abwechslung tun.«
»Haltet eure verdammten Schnauzen«, rief der Mann von vorher aus dem Dunkel.
509 hockte sich neben Bucher und schloß die Augen. Er sah noch immer den Rauch über der brennenden Stadt und spürte den dumpfen Donner der Explosionen.
»Glaubt ihr, daß wir heute abend Essen kriegen?« fragte Ahasver.
»Verdammt!« antwortete die Stimme aus dem Dunkel. »Was willst du noch? Erst willst du erschossen werden und dann fragst du nach Essen!«
»Ein Jude muß Hoffnung haben.«
»Hoffnung!« Westhoff kicherte wieder.
»Was sonst?« fragte Ahasver ruhig.
Westhof verschluckte sich und begann plötzlich zu schluchzen. Er hatte seit Tagen Barackenkoller.
509 öffnete die Augen. »Vielleicht geben sie uns heute abend nichts zu essen«, sagte er. »Als Strafe für das Bombardement.«
»Du mit deinem verfluchten Bombardement«, schrie der Mann im Dunkeln. »Halt doch endlich deine Schnauze!«
»Hat einer hier noch irgendwas zu essen?« fragte Ahasver.
»O Gott!« Der Rufer im Dunkeln erstickte fast über diese neue Idiotie.
Ahasver achtete nicht darauf. »Im Lager von Theresienstadt hatte jemand einmal ein Stück Schokolade und wußte es nicht. Er hatte es versteckt, als er eingeliefert wurde, und hatte es vergessen. Milchschokolade aus einem Automaten. Ein Bild von Hindenburg war auch in dem Karton.«
»Was noch?« krächzte die Stimme aus dem Hintergrund. »Ein Paß?«
»Nein. Aber wir haben von der Schokolade zwei Tage gelebt.«
»Wer schreit da so?« fragte 509 Bucher.
»Einer von denen, die gestern angekommen sind. Ein Neuer. Wird schon ruhig werden.«
Ahasver horchte plötzlich. »Es ist vorbei –«
»Was?«
»Draußen. Das war die Entwarnung. Das letzte Signal.«
Es wurde plötzlich sehr still. Dann hörte man Schritte. »Weg mit dem Schäferhund«, flüsterte Bucher.
Ahasver schob den Verrückten zwischen die Betten. »Kusch! Still!« Er hatte ihn so erzogen, daß er auf Kommandos hörte. Hätte die SS ihn gefunden, so wäre er als Verrückter sofort abgespritzt worden.
Bucher kam von der Tür zurück. »Es ist Berger.«
Doktor Ephraim Berger war ein kleiner Mann mit abfallenden Schultern und einem eiförmigen Kopf, der völlig kahl war. Seine Augen waren entzündet und tränten.
»Die Stadt brennt«, sagte er, als er hereinkam.
509 richtete sich auf. »Was sagen sie drüben dazu?«
»Ich weiß es nicht.«
»Wieso? Du mußt doch etwas gehört haben.«
»Nein«, erwiderte Berger müde. »Sie haben aufgehört zu verbrennen, als der Alarm kam.«
»Warum?«
»Wie soll ich das wissen? Es wird befohlen, fertig.«
»Und die SS? Hast du von der etwas gesehen?«
»Nein.«
Berger ging durch die Bretterreihen nach hinten. 509 sah ihm nach. Er hatte auf Berger gewartet, um mit ihm zu sprechen, und nun schien er ebenso teilnahmslos wie alle andern. Er verstand es nicht. »Willst du nicht raus?« fragte er Bucher.
»Nein.«
Bucher war fünfundzwanzig Jahre alt und seit sieben Jahren im Lager. Sein Vater war Redakteur einer sozialdemokratischen Zeitung gewesen; das hatte genügt, den Sohn einzusperren. Wenn er hier wieder herauskommt, kann er noch vierzig Jahre leben, dachte 509. Vierzig oder fünfzig. Ich dagegen bin fünfzig. Ich habe vielleicht noch zehn, höchstens zwanzig Jahre. Er zog ein Stück Holz aus der Tasche und begann daran zu kauen. Wozu denke ich plötzlich an sowas? dachte er.
Berger kam zurück. »Lohmann will mit dir sprechen, 509.«
Lohmann lag im hinteren Teil der Baracke auf einem unteren Bett ohne Stroh. Er hatte das so gewollt. Er litt an schwerer Dysenterie und konnte nicht mehr aufstehen. Er glaubte, es sei so reinlicher. Es war nicht reinlicher. Aber alle waren es gewöhnt. Fast jeder hatte mehr oder minder Durchfall. Für Lohmann war es eine Tortur. Er lag im Sterben und entschuldigte sich bei jedem Krampf seiner Eingeweide. Sein Gesicht war so grau, daß er ein blutloser Neger hätte sein können. Er bewegte eine Hand, und 509 beugte sich über ihn. Die Augenbälle Lohmanns glänzten gelblich. »Siehst du das?« flüsterte er und öffnete seinen Mund weit.
»Was?« 509 sah auf den blauen Gaumen.
»Hinten rechts – da ist eine Goldkrone.«
Lohmann drehte den Kopf in die Richtung des schmalen Fensters. Die Sonne stand dahinter, und die Baracke hatte an dieser Seite jetzt ein schwaches, rosiges Licht.
»Ja«, sagte 509. »Ich sehe sie.« Er sah sie nicht.
»Nehmt sie raus.«
»Was?«
»Nehmt sie raus!« flüsterte Lohmann ungeduldig.
509 sah zu Berger hinüber. Berger schüttelte den Kopf. »Sie sitzt doch fest«, sagte 509.
»Dann zieht den Zahn raus. Er sitzt nicht sehr fest. Berger kann es. Er macht es im Krematorium doch auch. Zu zweit könnt ihr es leicht.«
»Warum willst du sie raus haben?«
Lohmanns Augenlider hoben und senkten sich langsam. Sie waren wie die einer Schildkröte. Sie hatten keine Wimpern mehr. »Das wißt ihr doch selbst. Gold. Ihr sollt Essen dafür kaufen. Lebenthal kann sie eintauschen.«
509 antwortete nicht. Eine Goldkrone zu tauschen war eine gefährliche Sache. Goldplomben wurden im allgemeinen bei der Einlieferung ins Lager registriert und später im Krematorium ausgezogen und gesammelt. Stellte die SS fest, daß eine fehlte, die in den Listen verzeichnet war, so wurde die ganze Baracke verantwortlich gemacht. Sie bekam kein Essen, bis die Plombe zurückgegeben war. Der Mann, bei dem man sie fand, wurde gehängt.
»Zieht sie raus!« keuchte Lohmann. »Es ist leicht! Eine Zange! Oder ein Draht ist schon genug.«
»Wir haben keine Zange.«
»Ein Draht! Biegt einen Draht zurecht.«
»Wir haben auch keinen Draht.«
Lohmanns Augen fielen zu. Er war erschöpft. Die Lippen bewegten sich, aber es kamen keine Worte mehr. Der Körper war bewegungslos und sehr flach, und nur das Gekräusel der dunklen, trockenen Lippen war noch da – ein winziger Strudel Leben, in den die Stille schon bleiern floß.
509 richtete sich auf und blickte Berger an. Lohmann konnte ihre Gesichter nicht sehen; die Bretter der höheren Betten waren dazwischen. »Wie steht es mit ihm?«
»Zu spät für alles.«
509 nickte. Es war schon so oft so gewesen, daß er wenig mehr empfand. Die schräge Sonne fiel auf fünf Leute, die wie dürre Affen im obersten Bett hockten. »Kratzt er bald ab?« fragte einer, der seine Armhöhlen rieb und gähnte.
»Warum?«
»Wir kriegen sein Bett. Kaiser und ich.«
»Du wirst es schon kriegen.«
509 schaute einen Augenblick in das schwebende Licht, das garnicht zu dem stinkenden Raum zu gehören schien. Die Haut des Mannes, der gefragt hatte, sah darin aus wie die eines Leoparden; sie war übersät mit schwarzen Flecken. Der Mann begann faules Stroh zu essen. Ein paar Betten weiter zankten sich zwei Leute mit hohen, dünnen Stimmen. Man hörte kraftlose Schläge.
509 fühlte ein leichtes Zerren an seinem Bein; Lohmann zupfte an seiner Hose. Er beugte sich wieder herunter. »Rausziehen!« flüsterte Lohmann.
509 setzte sich auf den Bettrand. »Wir können nichts dafür tauschen. Es ist zu gefährlich. Keiner wird es riskieren.«
Lohmanns Mund zitterte. »Sie sollen ihn nicht haben«, stieß er mit Mühe hervor. »Die nicht! Fünfundvierzig Mark habe ich dafür bezahlt. 1929. Die nicht! Zieht ihn raus!«
Er krümmte sich plötzlich und stöhnte. Die Haut seines Gesichts verzog sich nur an den Augen und an den Lippen, – sonst waren keine Muskeln mehr da, um Schmerz anzuzeigen.
Nach einer Weile streckte er sich aus. Ein kläglicher Laut kam mit der ausgepreßten Luft aus seiner Brust. »Kümmere dich nicht darum«, sagte Berger zu ihm. »Wir haben noch etwas Wasser. Es tut nichts. Wir machen es weg.«
Lohmann lag einige Zeit still. »Versprecht mir, daß ihr ihn rausnehmt, – bevor sie mich abholen«, flüsterte er dann. »Wenn ich abgeschrammt bin. Dann könnt ihr es doch.«
»Gut«, sagte 509. »Ist er nicht eingetragen worden, als du ankamst?«
»Nein. Versprecht es! Bestimmt!«
»Bestimmt.«
Lohmanns Augen verschleierten sich und wurden ruhig. »Was war das – vorhin – draußen?«
»Bomben«, sagte Berger. »Man hat die Stadt bombardiert. Zum erstenmale. Amerikanische Flieger.«
»Oh –«
»Ja«, sagte Berger leise und hart. »Es kommt näher! Du wirst gerächt werden, Lohmann.«
509 blickte rasch auf. Berger stand noch, und er konnte sein Gesicht nicht sehen. Er sah nur seine Hände. Sie öffneten und schlossen sich, als würgten sie eine unsichtbare Kehle und ließen sie los und würgten sie wieder.
Lohmann lag still. Er hatte die Augen wieder geschlossen und atmete kaum. 509 wußte nicht, ob er noch verstanden hatte, was Berger gesagt hatte.
Er stand auf. »Ist er tot?« fragte der Mann auf dem oberen Bett. Er kratzte sich noch immer. Die andern vier hockten neben ihm wie Automaten. Ihre Augen waren leer.
»Nein.«
509 wandte sich zu Berger. »Weshalb hast du es ihm gesagt?«
»Weshalb?« Bergers Gesicht zuckte. »Deshalb! Verstehst du das nicht?«
Das Licht hüllte seinen eiförmigen Kopf in eine rosa Wolke. In der verpesteten, dicken Luft sah es aus, als dampfe er. Die Augen glitzerten. Sie waren voll Wasser, doch das waren sie meistens; sie waren chronisch entzündet. 509 konnte sich denken, warum Berger es gesagt hatte. Aber was war es schon für ein Trost für einen Sterbenden, das noch zu wissen? Es konnte es ebenso gut noch schwerer für ihn machen. Er sah, wie eine Fliege sich auf das schieferfarbene Auge eines der Automaten setzte. Der Mann blinkte nicht mit den Lidern. Vielleicht war es doch ein Trost, dachte 509. Vielleicht war es sogar der einzige Trost für einen untergehenden Mann.
Berger drehte sich um und schob sich durch den schmalen Gang zurück. Er mußte über die Leute steigen, die am Boden lagen. Es sah aus, als wate ein Marabu durch einen Sumpf. 509 folgte ihm.
»Berger!« flüsterte er, als sie aus dem Gang heraus waren.
Berger blieb stehen. 509 war plötzlich atemlos. »Glaubst du es wirklich?«
»Was?«
509 konnte sich nicht entschließen, es zu wiederholen. Ihm war, als flöge es dann weg. »Das, was du zu Lohmann gesagt hast.«
Berger sah ihn an. »Nein«, sagte er.
»Nein?«
»Nein. Ich glaube es nicht.«
»Aber –« 509 lehnte sich gegen das nächste Brettergestell. »Wozu hast du es dann gesagt?«
»Ich habe es für Lohmann gesagt. Aber ich glaube es nicht. Keiner wird gerächt werden, keiner – keiner – keiner –«
»Und die Stadt? Die Stadt brennt doch!«
»Die Stadt brennt. Viele Städte haben schon gebrannt. Das heißt nichts, nichts –«
»Doch! Es muß –«
»Nichts! Nichts!« flüsterte Berger heftig, mit einer Verzweiflung wie jemand, der sich eine phantastische Hoffnung gemacht und sie gleich wieder begraben hat. Der bleiche Schädel pendelte, und das Wasser lief aus den roten Augenhöhlen. »Eine kleine Stadt brennt. Was hat das mit uns zu tun? Nichts! Nichts wird sich ändern. Nichts!«
»Erschießen werden sie welche«, sagte Ahasver vom Boden her.
»Schnauze!« schrie die Stimme von früher aus dem Dunkel. »Haltet doch endlich einmal eure gottverdammten Schnauzen!«
509 hockte auf seinem Platz an der Wand. Über seinem Kopf befand sich eines der wenigen Fenster der Baracke. Es war schmal und hoch angebracht und hatte um diese Zeit etwas Sonne. Das Licht kam dann bis zur dritten Reihe der Bettbretter; von dort an lag der Raum in ständigem Dunkel.
Die Baracke war erst vor einem Jahr errichtet worden. 509 hatte sie aufstellen helfen; er hatte damals noch zum Arbeitslager gehört. Es war eine alte Holzbaracke aus einem aufgelösten Konzentrationslager in Polen. Vier davon waren eines Tages auseinandergenommen auf dem Bahnhof der Stadt angekommen, auf Lastwagen zum Lager geschafft und dort aufgebaut worden. Sie hatten nach Wanzen, Angst, Schmutz und Tod gestunken. Aus ihnen war das Kleine Lager entstanden. Der nächste Transport arbeitsunfähiger, sterbender Häftlinge aus dem Osten war hineingepfercht und sich selbst überlassen worden. Es hatte nur ein paar Tage gedauert, bis er hinausgeschaufelt werden konnte. Man hatte dann weiter Kranke, Zusammengebrochene, Krüppel und Arbeitsunfähige hineingesteckt, und es war zu einer dauernden Einrichtung geworden.
Die Sonne warf ein verschobenes Viereck von Licht auf die Wand rechts vom Fenster. Verblaßte Inschriften und Namen wurden darin sichtbar. Es waren Inschriften und Namen von früheren Insassen der Baracke in Polen und Ostdeutschland. Sie waren mit Bleistift auf das Holz gekritzelt oder mit Drahtstücken und Nägeln hineingeritzt worden.
509 kannte eine Anzahl davon. Er wußte, daß die Spitze des Vierecks jetzt gerade einen Namen aus dem Dunkel hob, der mit tiefen Strichen eingerahmt war, – Chaim Wolf, 1941. Chaim Wolf hatte ihn wahrscheinlich hineingeschrieben, als er wußte, daß er sterben mußte, und die Striche darum gezogen, damit niemand von seiner Familie hinzukommen sollte. Er hatte es endgültig machen wollen, so daß er allein es war und bleiben würde. Chaim Wolf, 1941, die Striche eng und hart darum, so daß kein anderer Name mehr hineinzuschreiben war; – eine letzte Beschwörung des Schicksals, von einem Vater, der hoffte, daß seine Söhne gerettet werden würden. Aber darunter, unter den Strichen, dicht, als wollten sie sich daran klammern, standen zwei andere Namen: Ruben Wolf und Moische Wolf. Der erste steil, ungelenk, eine Schülerschrift; der zweite schräg und glatt, ergeben und ohne Kraft. Eine andere Hand hatte daneben geschrieben: alle vergast.
Schräg darunter, über einem Astknoten an der Wand war mit einem Nagel eingeritzt: Jos. Meyer, und dazu: Lt.d.R. EK 1 & 2. Es hieß: Joseph Meyer, Leutnant der Reserve, Inhaber des Eisernen Kreuzes erster und zweiter Klasse. Meyer hatte das scheinbar nicht vergessen können. Es mußte noch seine letzten Tage vergiftet haben. Er war im ersten Weltkrieg an der Front gewesen; er war Offizier geworden und hatte die Auszeichnungen bekommen; er hatte, weil er Jude war, dafür doppelt so viel leisten müssen als jeder andere. Dann hatte man ihn später, ebenfalls weil er Jude war, eingesperrt und wie Ungeziefer vernichtet. Er war zweifellos überzeugt davon gewesen, daß das Unrecht für ihn wegen seiner Leistungen im Kriege größer gewesen sei als für andere. Er hatte sich geirrt. Er war nur schwerer gestorben. Das Unrecht lag nicht in den Buchstaben, die er seinem Namen hinzugefügt hatte. Sie waren nur eine schäbige Ironie.
Das Sonnenviereck glitt langsam weiter. Chaim, Ruben und Moische Wolf, die es nur mit der Spitze gestreift hatte, verschwanden wieder im Dunkel. Dafür rückten zwei neue Inschriften ins Licht. Die eine bestand nur aus zwei Buchstaben: F.M. Der, der sie mit dem Nagel eingekratzt hatte, hatte nicht mehr so viel auf sich gegeben wie der Leutnant Meyer. Schon sein Name war ihm fast gleichgültig gewesen; trotzdem hatte er nicht ganz ohne ein Zeichen untergehen wollen. Darunter aber erschien wieder ein voller Name. Mit Bleistift hingeschrieben stand da: Tevje Leibesch und die Seinen. Und daneben, flüchtiger, der Anfang des jüdischen Kaddischgebetes: Jis gadal –
509 wußte, daß das Licht in einigen Minuten eine andere verwischte Schrift erreichen würde: »Schreibt Leah Sand – New York –« Die Straße war nicht mehr zu lesen, dann kam: »Vat –« und nach einem Stück verfaulten Holzes: »tot. Sucht Leo.« Leo schien entkommen zu sein; doch die Inschrift war umsonst gemacht worden. Keiner der vielen Insassen der Baracke hatte jemals Leah Sanders in New York benachrichtigen können. Niemand war lebend herausgekommen.
509 starrte abwesend auf die Wand. Der Pole Silber hatte sie, als er noch mit blutenden Därmen in der Baracke lag, die Klagemauer genannt. Er hatte auch die meisten Namen auswendig gekannt und im Anfang sogar gewettet, welcher zuerst von dem Sonnenfleck getroffen werden würde. Silber war bald darauf gestorben; die Namen aber waren weiter an hellen Tagen für einige Minuten zu einem geisterhaften Leben erwacht und dann wieder im Dunkel versunken. Im Sommer, wenn die Sonne höher stand, waren andere, die tiefer unten eingekratzt waren, sichtbar geworden, und im Winter rückte das Viereck höher hinauf. Doch es gab noch viele mehr, russische, polnische, jiddische, die für immer unsichtbar blieben, weil das Licht nie bis zu ihnen kam. Die Baracke war so schnell aufgerichtet worden, daß die SS sich nicht darum gekümmert hatte, die Wände abhobeln zu lassen. Die Insassen kümmerten sich noch weniger darum, besonders nicht um die Inschriften an den dunklen Teilen der Wände. Niemand versuchte auch nur, sie zu entziffern. Wer wollte auch schon so töricht sein, ein kostbares Streichholz zu opfern, um noch mehr zu verzweifeln –
509 wandte sich ab; er wollte das jetzt nicht sehen. Er fühlte sich plötzlich auf eine sonderbare Weise allein; als wären die andern ihm durch etwas Unbekanntes entfremdet worden und sie verständen sich nicht mehr. Eine Weile zögerte er noch; dann konnte er es nicht mehr aushalten. Er tastete sich zur Tür und kroch wieder hinaus.
Er trug jetzt nur seine eigenen Lumpen und fror sofort. Draußen richtete er sich auf, lehnte sich gegen die Wand der Baracke und blickte auf die Stadt. Er wußte nicht genau, warum, – aber er wollte nicht wieder wie vorher auf allen Vieren hocken; er wollte stehen. Die Posten auf den Wachttürmen des Kleinen Lagers waren noch nicht zurück. Die Aufsicht an dieser Seite war nie sehr streng; wer kaum gehen konnte, entfloh nicht mehr.
509 stand an der rechten Ecke der Baracke. Das Lager verlief in einer Kurve, die dem Höhenzuge folgte, und er konnte von hier nicht nur die Stadt, sondern auch die Kasernen der SS-Mannschaften sehen. Sie lagen außerhalb des Stacheldrahtes hinter einer Reihe von Bäumen, die noch kahl waren. Eine Anzahl von SS-Leuten lief vor ihnen hin und her. Andere standen in aufgeregten Gruppen zusammen und blickten zur Stadt hinunter. Ein großes, graues Automobil kam rasch den Berg herauf. Es hielt vor der Wohnung des Kommandanten, die ein Stück abseits von den Kasernen lag. Neubauer stand bereits draußen; er stieg sofort ein, und der Wagen jagte los. 509 wußte von seiner Zeit im Arbeitslager, daß der Kommandant ein Haus in der Stadt besaß, in dem seine Familie wohnte. Aufmerksam blickte er dem Wagen nach. Dabei überhörte er, daß jemand leise den Mittelweg zwischen den Baracken entlang kam. Es war der Blockälteste von Baracke 22, Handke, ein untersetzter Mann, der immer auf Gummisohlen herumschlich. Er trug den grünen Winkel der Kriminellen. Meistens war er harmlos, aber wenn er seinen Koller kriegte, hatte er schon öfter Leute zu Krüppeln geschlagen.
Er schlenderte heran. 509 hätte noch versuchen können sich wegzudrücken, als er ihn sah, – Zeichen von Angst befriedigten gewöhnlich Handkes einfache Überlegenheitsgelüste – aber er tat es nicht. Er blieb stehen.
»Was machst du hier?«
»Nichts.«
»So, nichts.« Handke spuckte 509 vor die Füße. »Du Mistkäfer! Träumst dir wohl was, wie?« Seine flächsernen Brauen hoben sich. »Bilde dir bloß nichts ein! Ihr kommt hier nicht heraus! Euch politische Hunde jagen sie vorher alle erst noch durch den Schornstein.«
Er spuckte wieder aus und ging zurück. 509 hatte den Atem angehalten. Ein dunkler Vorhang wehte eine Sekunde hinter seiner Stirn. Handke konnte ihn nicht leiden, und 509 ging ihm gewöhnlich aus dem Wege. Diesmal war er stehen geblieben. Er beobachtete ihn, bis er hinter der Latrine verschwunden war. Die Drohung schreckte ihn nicht; Drohungen waren alltäglich im Lager. Er dachte nur an das, was dahinter steckte. Handke hatte also auch etwas gespürt. Er hätte es sonst nicht gesagt. Vielleicht hatte er es sogar drüben bei der SS gehört. 509 atmete tief. Er war also doch kein Narr.
Er blickte wieder auf die Stadt. Der Rauch lag jetzt dicht über den Dächern. Das Läuten der Feuerwehr klang dünn herauf. Aus der Richtung des Bahnhofs kam unregelmäßiges Knattern, als explodiere dort Munition. Der Wagen des Lagerkommandanten nahm unten am Berge eine Kurve so schnell, daß er rutschte. 509 sah es, und plötzlich verzog sich sein Gesicht. Es verzerrte sich zu einem Lachen. Er lachte, lachte, lautlos, krampfhaft, er wußte nicht, wann er zum letztenmale gelacht hatte, er konnte nicht aufhören, und es war keine Fröhlichkeit darin, er lachte und sah sich vorsichtig um und hob eine kraftlose Faust und ballte sie und lachte, bis ein schwerer Husten ihn niederwarf.
III
Der Mercedes schoß ins Tal hinunter. Obersturmbannführer Neubauer saß neben dem Chauffeur. Er war ein schwerer Mann mit dem schwammigen Gesicht des Biertrinkers. Die weißen Handschuhe an seinen breiten Händen leuchteten in der Sonne. Er bemerkte es und zog sie aus. Selma, dachte er, Freya! Das Haus! Niemand hatte am Telephon geantwortet. »Los!« sagte er. »Los, Alfred! Fahr zu!«
In der Vorstadt spürten sie den Brandgeruch. Er wurde beißender und dichter, je weiter sie kamen. Am Neuen Markt sahen sie den ersten Bombenkrater. Die Sparkasse war zusammengestürzt und brannte. Feuerwehr war ausgefahren und versuchte die Nachbarhäuser zu retten; aber die Wasserstrahlen schienen viel zu dünn zu sein, um Wirkung haben zu können. Der Krater auf dem Platz stank nach Schwefel und Säuren. Neubauers Magen krampfte sich zusammen. »Fahr durch die Hakenstraße, Alfred«, sagte er. »Hier kommen wir nicht weiter.«
Der Chauffeur wendete. Der Wagen fuhr in weitem Bogen durch die südliche Stadt. Häuser mit kleinen Gärten lagen hier friedlich in der Sonne. Der Wind stand nördlich, und die Luft war klar. Dann, als sie den Fluß kreuzten, kam der Brandgeruch wieder und wurde stärker, bis er in den Straßen lag wie schwerer Nebel im Herbst.
Neubauer zerrte an seinem Schnurrbart, der kurz gestutzt war wie der des Führers. Früher hatte er ihn hochgezwirbelt getragen wie Wilhelm II. Dieser Krampf im Magen! Selma! Freya! Das schöne Haus! Der ganze Bauch, die Brust, alles war Magen.
Sie mußten noch zweimal einen Umweg machen. Einmal war ein Möbelgeschäft getroffen worden. Die Vorderseite des Hauses war weggerissen; ein Teil der Möbel stand noch in den Etagen, der Rest lag über die Straße verstreut auf dem Schutt und brannte. Das zweitemal war es ein Friseurladen, vor dem herausgeschleuderte Wachsbüsten zu Fratzen zerschmolzen.
Endlich bog der Wagen in die Liebigstraße ein. Neubauer lehnte sich hinaus. Da war sein Haus! Der Vorgarten! Da waren der Terrakottazwerg und der Dachshund aus rotem Porzellan auf dem Rasen. Unbeschädigt! Alle Fenster heil! Der Krampf im Magen löste sich. Er stieg die Stufen empor und öffnete die Tür. Glück gehabt, dachte er. Verdammtes Schwein gehabt! Gehörte sich auch so! Warum sollte gerade ihm etwas passieren?
Er hing seine Kappe an den Huthaken aus Hirschgeweihen und ging in das Wohnzimmer. »Selma! Freya! Wo seid ihr?«
Niemand antwortete. Neubauer stampfte zum Fenster und riß es auf. Im Garten hinter dem Haus arbeiteten zwei russische Gefangene. Sie sahen kurz auf und gruben eifrig weiter.
»Heda! Bolschewiken!«
Einer der Russen hörte auf zu arbeiten. »Wo ist meine Familie?« schrie Neubauer.
Der Mann erwiderte etwas auf russisch.
»Laß deine Schweinesprache, Idiot! Du verstehst deutsch! Oder soll ich herauskommen und es dir beibringen?«
Der Russe starrte ihn an. »Ihre Frau ist im Keller«, sagte jemand hinter Neubauer.
Er drehte sich um. Es war das Dienstmädchen. »Im Keller? So, natürlich. Und wo waren Sie?«
»Draußen, einen Augenblick nur!« Das Mädchen stand in der Tür, das Gesicht gerötet, mit glänzenden Augen, als käme es von einer Hochzeit. »Hundert Tote schon, sagen sie«, plapperte es los. »Am Bahnhof, und dann im Kupferwerk, und in der Kirche –«
»Ruhe!« unterbrach Neubauer sie. »Wer hat das gesagt?«
»Draußen, die Leute –«
»Wer?« Neubauer trat einen Schritt vor. »Staatsfeindliche Reden! Wer hat das gesagt?«
Das Mädchen wich zurück. »Draußen – ich nicht – jemand – alle –«
»Verräter! Lumpen!« Neubauer tobte. Er konnte die aufgespeicherte Spannung endlich auslassen. »Bande! Schweine! Meckerer! Und Sie? Was haben Sie draußen zu tun?«
»Ich – nichts –«
»Weggerannt vom Dienst, was? Weitertratschen von Lügen und Greuelnachrichten! Wir werden das schon noch herausfinden! Durchgegriffen muß hier werden! Verdammt scharf durchgegriffen! Marsch, in die Küche!«
Das Mädchen lief hinaus. Neubauer schnaufte und schloß das Fenster. Nichts passiert, dachte er. Im Keller sind sie, natürlich. Hätte ich mir gleich denken können.
Er holte eine Zigarre hervor und zündete sie an. Dann zog er seinen Rock glatt, wölbte die Brust, sah in den Spiegel und ging hinunter.
Seine Frau und seine Tochter saßen dicht nebeneinander auf einer Chaiselongue, die an der Wand stand. Über ihnen hing in breitem Goldrahmen ein mehrfarbiges Bild des Führers.
Der Keller war 1940 als Luftschutzkeller hergerichtet worden. Neubauer hatte ihn damals nur aus Repräsentationsrücksichten bauen lassen; es gehörte zum Patriotismus, in diesen Dingen mit gutem Beispiel voranzugehen. Niemand hatte je im Ernst daran gedacht, daß Deutschland bombardiert werden könne. Die Erklärung Görings, man möge ihn fortan Meier nennen, wenn feindliche Flugzeuge so etwas im Angesicht der Luftwaffe fertig brächten, war jedem ehrlichen Deutschen genug gewesen. Leider war es anders gekommen. Ein typisches Beispiel für die Heimtücke der Plutokraten und Juden: sich schwächer zu stellen, als sie waren.
»Bruno!« Selma Neubauer erhob sich und begann zu schluchzen.
Sie war blond und fett und trug einen Morgenrock aus lachsfarbener französischer Seide mit Spitzen. Neubauer hatte ihn ihr 1941 von einem Urlaub aus Paris mitgebracht. Ihre Backen zitterten, und ihr zu kleiner Mund kaute an Worten.
»Es ist vorbei, Selma. Beruhige dich.«
»Vorbei –« sie kaute weiter, als wären die Worte zu große Königsberger Klopse. »Für wie – wie lange?«
»Für immer. Sie sind weg. Der Angriff ist abgeschlagen. Sie kommen nicht wieder.«
Selma Neubauer hielt ihren Morgenrock über der Brust fest. »Wer sagt das, Bruno? Woher weißt du das?«
»Wir haben mindestens die Hälfte abgeschossen. Die werden sich hüten, wiederzukommen.«
»Woher weißt du das?«
»Ich weiß es. Sie haben uns diesmal überrascht. Das nächste Mal werden wir ganz anders auf dem Posten sein.«
Die Frau hörte auf zu kauen. »Das ist alles?« fragte sie. »Das ist alles, was du uns sagen kannst?«
Neubauer wußte, daß es nichts war. »Ist es nicht genug?« fragte er deshalb barsch zurück.
Seine Frau starrte ihn an. Ihre Augen waren wässerig und hellblau. »Nein!« kreischte sie plötzlich. »Das ist nicht genug! Das ist nichts als Quatsch! Es heißt garnichts! Was haben wir nicht alles schon gehört? Erst erzählt man uns, wir wären so stark, daß nie ein feindlicher Flieger nach Deutschland hereinkäme, und auf einmal kommen sie doch. Dann heißt es, sie kämen nicht wieder, wir schössen sie von nun an alle an den Grenzen ab, und statt dessen kommen zehnmal so viele zurück, und der Alarm geht andauernd. Und jetzt haben sie uns schließlich hier auch erwischt, und da kommst du großartig und sagst, sie würden nicht wiederkommen, wir würden sie schon kriegen! Und das soll ein vernünftiger Mensch glauben?«
»Selma!« Neubauer warf unwillkürlich einen Blick auf das Bild des Führers. Dann sprang er zur Tür und warf sie zu. »Verdammt! Nimm dich zusammen!« zischte er. »Willst du uns alle ins Unglück bringen? Bist du verrückt geworden, so zu schreien?«
Er stand dicht vor ihr. Über ihren dicken Schultern blickte der Führer weiter kühn in die Landschaft von Berchtesgaden. Neubauer hatte einen Augenblick fast geglaubt, er hätte alles mit angehört.
Selma sah den Führer nicht. »Verrückt?« kreischte sie. »Wer ist verrückt? Ich nicht. Wir hatten ein wunderbares Leben vor dem Kriege, – und jetzt? Jetzt? Ich möchte wissen, wer da verrückt ist?«
Neubauer ergriff mit beiden Händen ihre Arme und schüttelte sie so, daß ihr Kopf hin- und herflog und sie nicht mehr schreien konnte. Ihr Haar löste sich, ein paar Kämme fielen heraus, sie verschluckte sich und hustete. Er ließ sie frei. Sie fiel wie ein Sack auf die Chaiselongue. »Was ist mit ihr los«?« fragte er seine Tochter.
»Nichts weiter. Mutter ist sehr aufgeregt.«
»Warum? Es ist doch nichts passiert.«
»Nichts passiert?« begann die Frau wieder. »Dir natürlich nicht, da oben! Aber wir hier allein –«
»Ruhig! Verdammt! Nicht so laut! Habe ich dafür fünfzehn Jahre geschuftet, damit du mit deinem Geschrei alles auf einen Schlag wieder vernichtest? Meinst du, es warten nicht schon genug darauf, meinen Posten zu schnappen?«
»Es war das erste Bombardement, Vater«, sagte Freya Neubauer ruhig. »Bisher haben wir doch nur Alarme gehabt. Mutter wird sich schon gewöhnen.«
»Das erste? Natürlich das erste! Wir sollten froh sein, daß bisher noch nichts passiert ist, anstatt Unsinn zu schreien.«
»Mutter ist nervös. Sie wird sich schon gewöhnen.«
»Nervös!« Neubauer war irritiert durch die Ruhe seiner Tochter. »Wer ist nicht nervös? Meinst du, ich bin nicht nervös? Man muß sich beherrschen können. Was würde sonst passieren?«