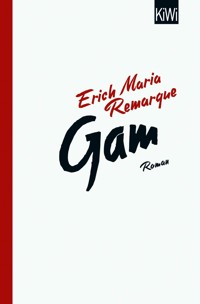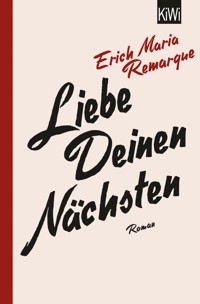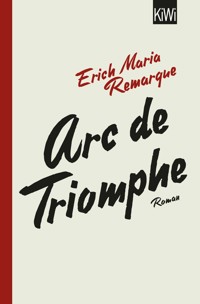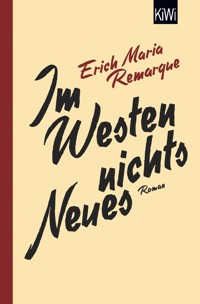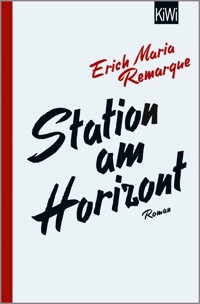
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zum Abschluss der großen Remarque-Edition: seine frühen Romane. Die Geburt eines großen Erzählers! »Station am Horizont« erzählt vom Lebemann und Rennfahrer Kai, von Männerfreundschaft und Rivalität, von drei Frauen, von Ruhelosigkeit und Exzess in einer trägen, verwöhnten Gesellschaft. Es ist der vielleicht schönste der frühen Romane Remarques, eine Verknüpfung von Liebesgeschichte, mondänem Gesellschaftsleben, Autorennen und exquisiten Dialogen. Ein Buch, das viele interessante Querverbindungen zu späteren Werken des Autors aufweist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 333
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Erich Maria Remarque
Station am Horizont
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Erich Maria Remarque
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Erich Maria Remarque
Erich Maria Remarque, 1898 in Osnabrück geboren, besuchte das katholische Lehrerseminar. 1916 als Soldat eingezogen, wurde er nach dem Krieg zunächst Aushilfslehrer, später Gelegenheitsarbeiter, schließlich Redakteur in Hannover und Berlin. 1932 verließ Remarque Deutschland und lebte zunächst im Tessin/Schweiz. Seine Bücher »Im Westen nichts Neues« und »Der Weg zurück« wurden 1933 von den Nazis verbrannt, er selber wurde 1938 ausgebürgert. Ab 1939 lebte Remarque in den USA und erlangte 1947 die amerikanische Staatsbürgerschaft. 1970 starb er in seiner Wahlheimat Tessin.
Thomas F. Schneider, Leiter des Erich Maria Remarque-Friedenszentrums an der Universität Osnabrück, veröffentlichte zahlreiche Bücher zur Kriegs- und Antikriegsliteratur im 20. Jahrhundert und zur Exilliteratur. Er hat die Romane Erich Maria Remarques einer kritischen Durchsicht unterzogen und jeweils mit Anhang, Nachwort und weiterführender Literatur versehen.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
An der Riviera in den 1920ern steht der junge Rennfahrer Kai zwischen drei Frauen: der scheuen Barbara, der geheimnisvollen Lilian und Maud, der selbstbewussten Freundin des Rennfahrers Murphy. Beim großen Europarennen kämpft er nicht nur um den Sieg auf der Rennbahn, sondern auch um Liebe und Beständigkeit in seinem Leben. Station am Horizont erzählt von Männerfreundschaft und Rivalität, von drei sehr unterschiedlichen Frauen und von Ruhelosigkeit und Exzess in einer trägen, verwöhnten Gesellschaft. 1927/28 erstmals in der Illustrierten Sport im Bild in Fortsetzungen abgedruckt, bereitet der vielleicht schönste Roman Remarques viele spätere Werke thematisch vor und erscheint nun in einer neu edierten Einzelausgabe mit umfangreichem Anhang und Nachwort.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 1998, 2000, 2020, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
©1998 by the Estate of the late Paulette Remarque
Covergestaltung: Rudolf Linn, Köln
Frontispiz: Erich Maria Remarque in den Redaktionsräumen von Sport im Bild, Berlin, 1925. © Erich Maria Remarque-Friedenszentrum Osnabrück
ISBN978-3-462-32153-1
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Frontispiz
I. Kapitel
II. Kapitel
III. Kapitel
IV. Kapitel
V. Kapitel
VI. Kapitel
VII. Kapitel
VIII. Kapitel
IX. Kapitel
X. Kapitel
XI. Kapitel
XII. Kapitel
XIII. Kapitel
XIV. Kapitel
XV. Kapitel
Anhang
Abbildung »Sport im Bild«
Erich Maria Remarque schrieb …
Bereits eine der ersten Veröffentlichungen …
Dem einzigen erhaltenen Typoskript …
Zeitgleich zur Niederschrift …
Editorische Notiz
»Rechts die Stille, links die Unruhe«
Weiterführende Literatur
I
Kai überraschte sich bei dem Gedanken, daß er jetzt seit einem Jahr wieder zu Hause war, in der Landschaft, in der er seine Jugend verbracht hatte, und unter Menschen, mit denen er aufgewachsen war. Er hatte sie immer, wenn er zurückkam, so wiedergefunden, wie er sie verlassen hatte; – die Gräfin Ghest, die eine Vorliebe für Zitronengebäck und romantische Musik besaß, den weißhaarigen Herrn von Croy, die Geschwister Holgersen. Nur die junge Barbara war kein Kind mehr wie damals.
Man saß noch auf der Terrasse vor dem Herrenhause. Die Türen zum Musikzimmer wurden geöffnet, weil man es stimmungsvoll fand, zur Musik einigen Herbstimpressionen Raum zu geben. Der Park mit den welkenden Blättern bot dafür eine gute Silhouette. Nachher würde sich das Diner um so freundlicher gestalten; – gemäßigte Paraphrasen über die Vergänglichkeit beleben den Appetit.
Ruhig und seßhaft, nahe dem Boden, floß das Dasein hier dahin, beherrscht von der Atmosphäre der Jahreszeiten und gestützt von den Terminereignissen des Tages; – es war wichtiger, an Saat und Ernte zu denken als an das Herz. – Einer lebte wie der andere, ohne großen Unterschied; – man kannte sich zu lange, um noch viel geben zu können, und begegnete sich deshalb am liebsten auf dem mittleren Niveau gesunder Praxis. Keinem wurde es unerträglich, daß sich das Dasein in kleinen Intervallen endlos wiederholte, und niemand ahnte, wie sehr pausenloses Beieinander korrumpierte und statt sanfter Spannung geschwätzige Öde förderte.
Der Wind rauschte in langen Stößen durch die Wipfel der Platanen und übertönte manchmal die Musik. Hinter den Bäumen stand ein verspätetes Wetterleuchten.
Kai wurde unruhig; er empfand plötzlich, daß Minuten und Sekunden seines Lebens ohne Wiederkehr versanken, während er hier mit halber Teilnahme saß; – immerfort ging lautlos irgendwo der Strom der Zeit, rätselhaft und beängstigend in seinem unaufhaltsamem, schattenhaften Vergleiten, ohne Aufhören wie ein unerbittliches Verbluten.
Er konnte es nicht mehr ertragen; – mit einem Vorwand verabschiedete er sich und ging zu den Stallgebäuden, um sein Pferd zu holen und über die Heide nach seinem Hause zu reiten.
Im warmen Halbdunkel, das nach Streu und Tieratem roch, lag Frute, seine blaue Dogge, zwischen den Pferden. Sie sprang auf, als sie seinen Schritt hörte, und stürmte bellend und erregt voraus.
Draußen ging ihr Gebell in freudiges Winseln über. Kai horchte auf. Im Ausschnitt der Tür stand die junge Barbara und rief: »Ich will ein Stück mit Ihnen reiten, Kai; – es ist ein Abend dafür. Hinter der Heide steht sogar noch ein Gewitter.«
Sie lehnte sich an die Box und sah ihm zu. Ihr Gesicht war vom Dunkel des Raumes verschattet, der Mund und die Stirn schienen nur angedeutet zu sein in den Konturen, verschwimmendes Bleiches und Dunkles von seltsamem Reiz. Das schwache Licht der Fenster spiegelte sich in ihren Augen.
Kai sah, wie etwas in ihr fortstrebte, von dem sie selbst noch nichts ahnte. Sie war ihm gefolgt, weil sie glaubte, reiten zu wollen; aber es ging um mehr.
Zwischen den nahen Leibern der Tiere, zwischen dem glatten Fell des Pferdes und dem blanken Haar des dicht herangedrängten Hundes, zwischen Stampfen und leisem Schnauben und Kettengeklirr nahm er ihre Hände, eindringlich: »Barbara, immer wenn ich fort war und zurückkam, waren Sie gewachsen, und es war schön, Sie wiederzufinden. Sie dürfen auch nie fortgehen, glauben Sie mir, Sie gehören hierher, in dieses Herrenhaus mit seinen Linden und Platanen, den Hunden und Pferden. Man sollte nie fortgehen oder nie wiederkommen; denn man findet doch niemals ganz zurück und bleibt im Zwiespalt. Sie aber, Barbara, gehören hierher, in die Stille, um sich selbst zu leben und die einfachen Dinge des Lebens zu tun.«
Ihre Hände zuckten in den seinen. Sie antwortete nicht. Ein Schweigen wuchs zwischen ihnen auf und verdichtete sich zur Erwartung.
Er zerbrach es, ehe es bedeutungsvoll wurde: »Wir wollen Ihre Stute satteln, Barbara –«
Sie ritten nebeneinander her. Hinter dem Park lagen Felder und Äcker, dazwischen das Dorf; dann begann die Heide mit Birken, Wacholderbüschen und Runensteinen. Am Horizont stand Gewölk. Die krausen Adern des Wetterleuchtens zuckten darin auf. Die Pferde hoben die Köpfe. Ein Wind, der vor dem Wald gelauert hatte, überfiel den Abend.
»Aber Sie wollen wieder fort, Kai?«
»Ich weiß es nicht – vielleicht.« Kai beugte sich rasch herunter und richtete sich wieder auf. »Vielleicht, Barbara.«
Sie ritten schneller. Der Weg führte eine Anhöhe hinauf. Von oben hatte man den Blick in die Weite. Sie zügelten die Tiere. Schatten hielten den Hügel umkreist und duckten sich zwischen Gestrüpp und Steinen heran. Hinter ihnen schwamm die Heide in leicht gebuckelter Dunkelheit.
Das Wetterleuchten war stärker geworden. In seinem fahlen Schein wurde jedesmal das Dorf, das am Horizont lag, wie eine Vision aus der Nacht gerissen. Ganz deutlich zeigte das heftige Licht die Dächerreihen und den niedrigen, hellen Turm, es flammte auf und erlosch, als wäre alles in einen Abgrund gestürzt. Der sekundenkurze Blick glich einer Fata Morgana der Ferne, einem unwirklichen Traumbild, weil kein Donner in den Wechsel von Licht und Dunkelheit hineinmurrte. –
Ein Eisenbahndamm schnitt in gerader Linie durch das Gelände. Die Schienen liefen darüber wie eine starke, glänzende Verheißung, wurden silberner und matter und mischten sich weit hinten zu einem phosphoreszierenden Punkte.
›Sie laufen in die Unendlichkeit‹, dachte Kai. Rhythmisch unter ihm ging der Pferderücken, – weit und lang dehnte sich der Schienenstrang hinaus, – die Nacht war durchweht von Winden und Blitzen. – Er rief zu Barbara hinüber: »Wir wollen langsam reiten – um diese Zeit muß ein Zug kommen –«
Das Beben rollte durch den Boden und rumorte unterirdisch heran. Metallen klangen plötzlich die Drähte am Bahndamm und sangen hoch über dem Dröhnen, das stärker wurde; – eine Kette Signallampen lief aufblinkend wie eine Schnur stehengebliebener Blitztümpel durch die Ebene, geräuschlos klappte der Querzeiger des Signalmastes hoch, Scheinwerfer schwollen über den Schienen empor, schleppten eine Fülle bleichen Lichtes vor sich her, und mit langen, hellerleuchteten Wagen zischte der Expreß an den Schauenden vorüber, – ein Blick in ein Fenster, – Menschen, – eine Gestalt, die sich an die Scheiben lehnte – eine Frau, ein Mann? – Vorbei, – schon schaukelten bunt die Schlußlichter des Zuges über die Heide, und die dröhnenden Schienen wurden leiser.
Kai hockte im Sattel, die Fäuste fest aufgestemmt. Eine helle Insel war wie ein Komet durch die Landschaft gesaust, aus dem Unbekannten kommend und im Unbekannten verschwindend, Menschen darin, zusammengeführt vor Stunden, auseinanderströmend nach Stunden, eine Fracht Schicksale, die in erleuchteten Kabinen durch das Dunkel schoß – ein Wirbel von Geheimnissen fegte hinter ihnen her und wurde zu phantastischer Lockung, – über die Ränder der Ebene, aus Wolken und Schatten, aus Boden und Nacht schienen Stimmen aufzuklingen, verworren und verwirrend, ein Meer, eine Brandung, die wogte und rief – –
Der erste Donner grollte über die Heide. Kai richtete sich auf. Er lächelte Barbara zu und faßte in ihre Zügel: »Barbara, Sie haben recht gehabt; ich will wieder fort. Ich werde reisen, gleich abreisen. Leben Sie wohl, ich danke Ihnen die schönste Sekunde –«
Er ließ die Zügel los und wollte davonreiten. Doch das Gesicht des Mädchens hielt ihn noch, da war noch etwas zu sagen, etwas Bestimmtes und Wichtiges, aber es wollte sich dem Wort nicht ergeben, es ließ sich nicht fassen von den suchenden Begriffen, es glitt unter ihnen hinweg und war fort im Strudel der Bilder. Eilig und fast heftig griff er zu in das Ungefähr, rief hinüber: »Ich komme wieder –«
Doch das war es auch noch nicht, aber die Zeit drängte, lebendig geworden, als versäume jede Minute ein Leben, das Pferd drehte sich und stampfte, angesteckt von der Unruhe des Reiters –
Da hob die junge Barbara den Kopf und machte eine Bewegung – Kai begriff. Er wendete wieder den Pferdehals, er wollte mehr, heranreiten zu dem Mädchen –, er wußte, sie würde still an seiner Brust liegen – doch er wußte auch: das »Nicht« war noch stärker, das Verhaltene war tiefer, in dieses Blut durfte keine Unruhe geworfen werden, er ließ sich nicht frei, drückte einen Augenblick vor dem Aufbrausen der Welle hart das Pferd herum, winkte und galoppierte, ohne den Blick zurückzugeben, den Abhang hinunter, seinem Hause zu. Vor ihm flog die Dogge durchs Kraut wie ein blauer Fuchs.
Kai ritt in den Hof ein, brachte das Pferd zum Stall, begann selbst, es abzureiben, hörte aber bald auf, gab dem Knecht Bürsten und Tücher und ging zu seinen Zimmern hinauf.
Da standen beherrschend und mächtig metallbeschlagene, große Koffer, abgestoßen an den Ecken, verschabt und verkratzt auf den Seiten, aber buntbeklebt, übersät mit Zetteln und Hotelmarken, – jeder Zettel eine Station, eine Flucht wie Möwen aufblitzender Tage, eine Erinnerung. Auf der Kante, halb herumgeklebt, der charakteristische Zettel von Mena House – Palmen, Wüste, Pyramiden, der schiefergraue Nil, Militärmusik vor dem Speisesaal des Shepheards, die Golfplätze des Grand Hotels Heluan, Sonnenuntergänge hinter Assuan, das Katarakt-Hotel, eine Fahrt mit langsamer Dahabyeh in den jadefarbenen Himmel hinein; – dort die Hotelmarke des Galle Face – der Strand von Colombo, wo die Brandung fast bis in die Fenster spritzte, wo im maurischen, ventilatorsummenden Saal zwanzig lautlose, weißgekleidete Inderboys hinter den Säulen darauf harrten, dem einsamen Gaste Sodawasser und grüne Zigarren zu bringen; – das Grand Hotel Gardone mit seinem kitschigen Bilde vom Lago di Garda – Motorfahrten durch Sprühgischt und Sonne, Maud und die Nachmittage von San Vigilio; – der braune Gepäckschein der Andenbahn – Kletterzüge über die Abgründe der Cordilleren, an einer Station ein Indianerkind, rührend hilflos in den Gliedern, schmal der Kopf, aus einem viel zu großen Poncho herausschauend, mit den erschütternden Augen eines Hundertjährigen; – die Zollbuchstaben von Buenos, von Rio, Nächte unter dem tropischen Mond, durchweht vom Passat, eine Amerikanerin und der Neger der Schiffskapelle; – das Hotel Medan, das Palace Hotel, das Grand Orient Hotel, das Hotel Buitenzorg – javanische Hochebene, bronzene Mädchen, und die ganze Nacht hindurch das Gonggeläute der tausend Gamelangs; – jeder Zettel war Vergangenheit, jeder Zettel wurde jetzt Gegenwart, Lockruf des Lebens; – diese klobigen Koffer, Holz und Messing und Leder, dick, eckig und plump, nachts in einem Heidehofe; sie waren Radiosender der Welt, Antennen des Daseins, und aus ihren bunten und verblichenen Zetteln stieg die Melodie der Fremde.
Kai holte einen Coupékoffer heran, öffnete die Schlösser, faul gähnten ihm die leeren Höhlungen entgegen und fraßen sich mit Wäsche und Anzügen und anderen Dingen prall.
Er packte in einem Zuge fertig und brachte die Koffer sofort zur Garage. Dann ging er zurück und kleidete sich zur Reise um. Er wußte genau, daß es töricht war, was er tat, und daß es besser wäre, seine Sachen in Ruhe zu ordnen und eine Stunde oder einen Tag später zu fahren; aber er wollte dieses lockere, geschwellte, rauschhafte Gefühl nicht eindämmen durch Vernunft und Überlegung, unbedenklich überließ er sich ihm; – und er vertiefte es, indem er sich selbst, seine Bewegungen, seine Worte, seine Gedanken mit in den Strudel hineinwarf.
Noch während er ein paar Bissen aß, gab er seinem Verwalter Anweisungen, unterschrieb einige Blätter und ging wieder hinüber zur Garage, zog einen staubdichten Autoanzug über, pfiff dem Hunde, der mit einem Satz neben ihm war, drückte auf den Anlasser und ließ den Wagen im kleinen Gang über den Hof schleichen. Dann ging das Heulen des Motors in Brausen über, die Hupe schrie lang und wild über die Felder, die Scheinwerfer tasteten den Weg ab, und der Wagen wendete nach Süden. –
Am Nachmittag des ersten Tages begegnete Kai Zigeunern. Eine verrunzelte Alte, die hinter dem Trupp zurückgeblieben war, um in den Dörfern zu betteln, lief ihm fast unter die Reifen. Spuckend vor Schreck, verfluchte sie die Räder und bedrohte sie mit ihren mageren Fäusten. Als sie jedoch Frute im Rücksitz kauern sah, fuhr sie zusammen und wollte flüchten.
Kai rief sie an. Sie kam zögernd zurück. Er forderte sie auf, sich in den Wagen zu setzen und mitzufahren, so weit sie wolle. Sie fing an, mit dem Hund zu sprechen; dann nickte sie und stieg ein.
Kai setzte die Alte bei ihren Gespannen ab und wollte weiterfahren. Er wurde daran gehindert durch einen Mann von stämmigem Wuchs, der aussah wie ein schlauer, dunkler Bauer. Mit vielen Gesten bat er ihn, eine Stunde zu bleiben, man werde hier in der Nähe lagern. Es ginge nicht anders, er müsse annehmen, wenn er die Alte nicht kränken wolle.
Kai willigte ein. Die Gespanne bogen in einen Waldweg ab und kamen an eine Lichtung, die von Forst umrahmt war und geschützt lag. Hier wurden die Wagen zusammengestellt, ein Feuer angezündet und ein großer Kupferkessel darübergehängt. Die Alte hockte sich davor und begann mit einem Schöpflöffel zu rühren, indes sie Kräuter und Fleischbrocken hineinwarf.
Die Suppe schmeckte fremdartig und sehr würzig, als ob sie mit Alkohol angesetzt worden wäre. Kai fragte danach; die Alte lächelte: »Nein, nur die Kräuter –«
Sie griff nach seiner Hand und wollte ihm aus der Linken weissagen. Eilig und eingelernt plapperte sie etwas; dann blickte sie genauer hin und schwieg. Kai fragte nicht, sondern zog Zigaretten heraus und verteilte sie. Die Mädchen stürzten sich hastig darauf; ihre Finger griffen und wühlten in der Schachtel; – an einer der Hände schimmerte ein Achat. Sie war sehr zierlich im Gelenk und lang in den Gliedern.
Kai suchte nach dem Gesicht. Das Mädchen hielt seinen Blick aus, errötete aber langsam und wurde dunkler und weicher, als das Blut unter ihrem olivfarbenen Teint aufstieg.
Er sagte etwas zu ihr; sie schüttelte den Kopf – sie verstand ihn nicht. So blickten sie sich an, getrennt vom Alltag der Sprache, in einer neuen und besonderen Weise, die nicht in Worten Verständnis und Ende finden konnte.
Kai sah, daß die Alte es bemerkt hatte und sprechen wollte. Er kam ihr rasch zuvor, indem er eine belanglose Redensart hinwarf, eine Frage nach ihren persönlichen Verhältnissen. Sie fing sie, berufsmäßig reagierend, sofort auf und lamentierte; mitten darin unterbrach sie sich, blinzelte von der Seite mit zusammengekniffenen Augen und lachte. Dann suchte sie für Frute Fleischbrocken aus dem Kessel. Kai brach auf.
In München besorgte er sich Triptyks und Sichtvermerke.
In Kochel regnete es. In Walchensee taumelten breiige Flocken gegen die Windschutzscheibe. Zwei Kilometer weiter lag Schnee. Vor dem Zirlberg war der Straßengrund unter dem Schnee vereist. Die Räder drehten sich, ohne zu fassen. Kai hatte keine Schneeketten bei sich.
Er nahm Kofferriemen und schlang sie um die Reifen. Ein paar hundert Meter weiter waren sie zerfetzt. Er verknotete sie, flocht Draht und Tannenreiser dazwischen und versuchte es wieder. Bei der letzten scharfen Steigung rutschte der Wagen abwärts und war nur mit Mühe zu halten. Kai mußte zurückfahren und Schneeketten kaufen.
Obschon er wußte, daß es das einzige war, um weiterzukommen, deprimierte es ihn gegen jede Logik, als er den Wagen umdrehen mußte. Er hätte am liebsten noch einmal riskiert, die Steigung zu nehmen. –
Der Wagen schnurrte mit den Schneeketten den Berg in einem Zuge hinauf. Der Himmel wurde klar. Sehr blau stand er über den Bergen. Kai hatte bisher kein eigentliches Ziel gehabt; – jetzt beschloß er, an die Riviera zu fahren.
Am nächsten Vormittag ließ er die Alpen hinter sich und jagte durch den weißen Staub der italienischen Straßen. Bald rechts, bald links, bald über, bald tief unter ihm lief die elektrische Schnellbahn. In großen Serpentinen führte die Straße abwärts nach Pontedecimo. Spätnachmittags war er in Genua. Er fuhr sofort weiter nach Monte Carlo.
Im Hotel nahm er ein brennheißes japanisches Bad mit Eukalyptusöl und frottierte sich mit Mentholalkohol. Erfrischt packte er seinen Smoking aus und kleidete sich an.
Im Kasino ließ er sich die grüneckige Karte für den Cercle privé ausschreiben und warf einen flüchtigen Blick in die großen Säle. Mittlere englische Geschäftsleute rauften sich dort mit ortsansässigen Russen und stockalten Amerikanerinnen um die Plätze und wagten Mindesteinsätze. Dazwischen saß mondäne Welt zweiten Grades, untermischt mit Kokotten und den in der ganzen Welt unvermeidlichen alten Engländerinnen –.
›Wie gut muß es in England zu leben sein‹, dachte Kai, ›alle seine alten Jungfern sind exportiert an die Riviera und nach Ägypten.‹
In den Salons privés fand gerade eine Baccaratserie ihr Ende. Es war nicht besonders interessant. Kai verließ das Kasino und schlenderte die Avenue de Monte Carlo entlang. Hinter der Post leuchteten die beiden Einfahrtslaternen des Hafens. Zugedeckt schwammen Segelboote und Motorjachten in einer Reihe nebeneinander. Automobile keuchten die Straße hinauf. Rechts waren die Fenster des Sporting-Clubs hell.
Kai trat ein und wies sich aus. Er traf unten Bekannte.
Es herrschte eine angeregte Stimmung; ein Russe hatte im Bac eine Viertelmillion Francs verloren; an einem Trente et Quarante-Tisch war sechsmal hintereinander Noir herausgekommen; gerade begann wieder eine Strähne damit, und man stürzte begeistert auf die Felder.
Kai pointierte im Stehen einige Male. Vor ihm saß ein Balkanier mit eingefallenen Schläfen. Er hatte die Finger voller Ringe. Die Fassungen zeigten verschiedene Stilarten; aber alle Steine waren Smaragde. Neben ihm stand ein Kästchen in japanischer Lackarbeit, das zur Hälfte rot, zur Hälfte schwarz lackiert war. Darin befand sich eine kleine Spinne.
Vor jedem Einsatz schüttelte er die Schachtel, und je nachdem, ob sich die Spinne in der roten oder in der schwarzen Hälfte befand, setzte er auf Rouge oder Noir.
»Was haben Sie für eine Mascotte?« fragte der Automobilfabrikant Bird Kai.
»Wozu eine Mascotte?« fragte Kai zurück.
»Dann dürfen Sie nicht spielen«, meinte Bird ernsthaft. »Niemand hier beginnt in dieser Saison ohne Mascotte einen Coup. Sie sehen drüben die rothaarige Amerikanerin. Die Kuhglocke, die sie mit der linken Hand umklammert hält, wiegt mindestens ein Kilogramm. Sie werden beobachten können, daß sie nicht eine Minute die Hand davon läßt. Es ist ihre Mascotte.«
»Welch ein Glück, daß sie nicht glaubt, vor jedem Spiel damit läuten zu müssen«, sagte Kai.
»Spotten Sie nicht. Der Mann gegenüber ist Brasilianer und baut, glaube ich, Plantagenkaffee. Neben ihm sehen Sie eine kleine Schildkröte liegen. Er hat sie von drüben mitgebracht. Sie soll leider die Kost hier nicht vertragen. Der Mann läßt deshalb jeden Tag aus Nizza einen bestimmten Salat für sie kommen. Jede Spielmarke tippt er auf den Panzer des Tieres, ehe er setzt. Damit hat er vorhin zweihunderttausend Francs gewonnen. Die Serie mit sechsmal Noir war dabei. Vor dem siebenten Einsatz fiel die Schildkröte durch eine Armbewegung des Nachbarn zu Boden. Der Mann hörte sofort auf zu spielen und ging. Von diesem Augenblicke an gewann Rouge. Vor einer Stunde ist die Schildkröte wieder angelangt; sie ist wahrscheinlich entsühnt worden. Aber kommen Sie zur Roulette drüben. Rechts sitzt der Prinz Fiola. Er hat durchgesetzt, daß von zwölf Uhr ab an diesem Tisch sehr hoch gespielt werden kann.«
Kai fand einen Platz und beteiligte sich. Er war wenig interessiert. Fiola begann jedoch, das Spiel hochzutreiben, so daß bald keine Einsätze mehr unter tausend Francs kamen.
Der Brasilianer erschien, postierte seine Schildkröte und setzte zunächst einige Nummern à cheval. Dann favorisierte er Noir. Es wurde jetzt schneller gespielt. Die Stimme des Croupiers wurde lebhafter, er raffte seinen stereotypen Satz knapper, und die Schläge folgten in kürzeren Abständen.
Kai sah gedankenlos auf die große Brosche einer Amerikanerin, die aus indianischem Gold gehämmert war und im Wert nur noch von ihrer Geschmacklosigkeit übertroffen wurde. Er hatte eine Fahrt von vierzehn Stunden hinter sich – in seinen Ohren klang immer noch das eingebildete Rauschen des Motors, eintönig, singend und einschläfernd.
Nach einer Weile erst entdeckte er, daß alle seine Einsätze verlorengegangen waren. Er nahm Banknoten heraus und schob sie auf die Felder. Ein wunderbares Gefühl des Doppel-Seins verließ ihn nicht und versetzte ihn in eine eigentümliche Stimmung. Leicht und schwerelos empfand er sich hier am Roulettetisch, – vor sich Menschen, bei denen alles Leben in den sparsamen Bewegungen der Hände konzentriert war – nur manchmal zuckte ein Lid, flatterte eine Braue, hob sich eine Hand von ihrem eigentlichen Tätigkeitsfeld, dem Tisch, empor und strich über die Schläfe, die Stirn, das Haar, – schaute ein Auge knapp und sehr glänzend auf –
Über all diesem und hinter ihm aber stand das sanfte, monotone Brausen, vor dem das Ornamentgetäfel der Wände dünner zu werden schien, transparent – Kai sah, wunderlich vermischt damit, Bergzüge und Wald vorüberfliegen, übersonnte Höhen, Täler, Abendrot an den Hängen – Straßen und Wege, die im Wind der Stunden heute hinter ihm geblieben waren – aber zu gleicher Zeit nahm er auch jede Einzelheit des Spiels wahr und pointierte weiter.
Es war fast ein wenig göttlich, dieses Ausgebreitetsein über zwei Sphären, dieses Hier- und gleichzeitig Woanders-Sein, versöhnlich erinnerte es an den Schmerz mancher Augenblicke, wo man die Ohnmacht des Menschlichen empfunden hatte: Daß immer nur eines zur selben Zeit da war und man nicht an allen Fronten des Daseins zugleich sein konnte.
Die Spielmarken und Geldscheine häuften sich vor Kai. Sie wanderten von dem Brasilianer zu ihm hinüber. Der Prinz Fiola hatte ihn beobachtet und deponierte jetzt auf dieselben Nummern wie er ein Päckchen Banknoten. Fast alle anderen setzten ebenfalls Kai nach; sie witterten mit dem untrüglichen Instinkt der Spielsaalhabitués eine Serie. Nur der Brasilianer hockte verbissen neben seiner Schildkröte und schlug schärfer und lauter als sonst die Galalithplatten gegen den Panzer des Tieres.
Kai wandte sich ironisch zu Bird: »Man scheint großes Vertrauen zu mir zu haben.«
Bird hatte die Augen auf der schon schwingenden Scheibe: »Bitte, sehen Sie nicht hin, ehe die Kugel festliegt –«
Kai lachte: »Aber Bird –« und drehte sich um.
Im selben Moment sprang die Kugel in das Fach der Sieben und blieb darin liegen.
Kai hatte gewonnen.
Bird strahlte. »Nun müssen Sie aufhören.« Dann aber zeigte er alle Nuancen des Erstaunens, denn Kai schob einen hohen Betrag noch einmal auf die Sieben.
Man sah ihn verwundert an, weil er einen solchen Fehler beging; denn wenn eine Serie zu Ende gezogen war, setzte niemand nach, sondern begann eine neue zu pointieren. Niemand außer Kai besetzte auch die Sieben. Er sah mit einem Hauch von Verschmitztheit umher und dachte: Es ist kein Unterschied zwischen ihnen und dem Kreise um die Gräfin Ghest. Sie tun immer nur das Richtige, es ist entsetzlich –
Kai verlor. Das Interesse am Spiel war ihm vergangen; er stand auf, um eine Zigarette zu rauchen und nach seinem Hunde zu sehen, den er im Wagen zurückgelassen hatte.
Der Prinz Fiola folgte ihm und ließ sich bekannt machen. Sie beschlossen, zu den Terrassen des Kasinos zu gehen; dort sollte eine kreolische Kapelle spielen.
Die Nacht stand draußen wie schwarzes Glas. Aber hinter dem Hotel de Paris verwandelte die wehende Luft des Meeres das Glas in schwarze Seidenfahnen, weiche, südliche Fahnen.
Vor dem Postgebäude stand Kais Wagen, Lehm unter den Kotflügeln, die Achsen zugeschmiert, verstaubt und mitgenommen vom Fahren über das Gebirge und die Landstraßen. Sichtbar hob er sich von den blanken Limousinen ab, die in langer Reihe, blinkend von Lack und Nickel, parkten, – der einzige niedrige Sportwagen, schmutzig und herrlich.
Fiola zeigte hinüber.
»Es ist mein Wagen«, sagte Kai.
»Sie sind heute gekommen?« fragte Fiola.
Kai nickte. »Vor drei Stunden –«
Sie waren schon fast vorbei, als sich im Rücksitz etwas regte. Ein Kopf tauchte auf, und klagendes Gebell wurde laut. Kai lachte: »Frute!«
Mit einem Satz war die Dogge heraus und federte heran. »Wir wollen beim Café de Paris vorbeigehen, der Hund braucht noch ein Abendessen.«
Er wählte unter den kalten Koteletts, die noch da waren, die besten Stücke heraus und wachte darüber, daß Frute sie bekam. Als sie sich die Lefzen leckte, deutete er zum Wagen. Gehorsam trottete sie fort, doch bevor sie in den Sitz kletterte, versuchte sie zu bluffen. Sie zuckte zusammen, als ob sie einen Pfiff gehört hätte, und kam in großen Sprüngen zurück. Aber im letzten Augenblick schien ihr das Gewissen zu schlagen, sie blieb ein Stück von Kai entfernt zaudernd stehen – den Kopf schief und argwöhnisch zur Seite. Er drohte ihr mit dem Finger; vorwurfsvoll bellte sie zurück, trotzte noch eine Weile und machte dann resigniert kehrt.
Auf der Terrasse wurde unter freiem Himmel getanzt. Eine quadratische Fläche war zwischen den Tischen dafür frei gemacht. Die Kapelle konnte man hinter der Brüstung des Musikkiosks kaum sehen; es war, als klänge der Pavillon von selbst. Der Himmel hing voller Sterne.
Man hörte das Meer. Ein Motorboot riß eine Schaumfurche in das Wasser. Weit dahinter, fern von den übrigen, stand ein Segel, das ganz scharf bestrahlt war durch ein von unten aus dem Boote kommendes Licht. Es wirkte unnatürlich auf der dunklen Fläche, hart ausgeschnitten aus der Nacht, stand es unbekümmert da wie ein selbstleuchtender Magnesia-Kreidefels.
Die Kreolen hatten eine geschickte Art zu improvisieren, daß die Routine dahinter sich völlig verbarg. Die Melodien ihrer Tangos waren sehr melancholisch. Es ließ sich gut dazu tanzen.
Fiola bereitete seinen Martini. Er unterbrach sich dabei und sagte zu Kai: »Sehen Sie nur, wie diese Frau den Kopf hält – – welch eine Linie von den Schläfen über die Wangen zum Kinn. – Zu spät, – sie ist schon fort –«
Nach einer Weile spülte die Musik sie wieder vorüber. Sie war in Brokat gewickelt, und man konnte nicht recht unterscheiden, ob sie ein Kleid trug oder nur einen ungemein geschickt gesteckten Stoff. Die Hüften setzten schmal und sehr hoch an; im Gelenk schimmerte ein Reflex. Den Kopf hatte sie etwas zurückgelehnt, die Schultern waren nackt und hatten viel Schwung über die Arme bis zu den Händen. Nichts war ganz deutlich; das gab der Frau den Zauber.
Das sparsam angebrachte Licht verhinderte die Enttäuschung durch klare Konturen. Diese in der Dämmerung verschwebende, mit der Musik vorüberwehende Frau war in dieser Stunde wundervoll –.
»Wie glücklich ist man schon, wenn man wenig von Assoziationen geplagt wird und eine sprungbereite Phantasie besitzt –«, sagte Kai, »man kann dann aus solchen Augenblicken beinahe etwas Romantisches machen. – Um wieviel besser ist man daran als der Mann, der mit diesem Brokatwesen tanzt. Er weiß, ob sie gern Horsd’œuvres ißt, welchen Wein sie bevorzugt und worüber sie am liebsten plaudert. Für ihn ist sie eine Frau, eine geliebte Frau vielleicht, – für uns ist sie –«, er schaute auf das Glas Fiolas –, »ich sehe, daß Sie Ihren Martini schon getrunken haben, deshalb kann ich den Ausdruck preziöser prägen: Für uns ist sie das Symbol einer superben Stimmung. Es ist nahezu das Höchste, was man verlangen kann.«
Fiola dachte nach. »Es mag sein. Diese Begegnungen an der Peripherie sind von besonderer Grazie. Warum glauben Sie, daß jeder Schritt näher enttäuscht?«
»Er enttäuscht nicht. Er gibt nur weniger. Er legt fest, er klärt auf, er schafft Beziehungen, er – um es extrem auszudrücken – entzaubert.«
»Das ist die Theorie.«
»Gewiß«, räumte Kai ein, »es wäre sehr töricht, danach zu leben. Es ist ja überhaupt ein Unfug, nach Prinzipien – selbst nach unfehlbaren – leben zu wollen. Theorie ist eine Medizin; man nimmt sie, wenn man sie braucht, und möglichst in sophistisch verbrämten Dosen.«
»Das ist bequem.«
»Alles Bequeme hat schon diesen Vorteil: bequem zu sein. Es hat noch den anderen: leichter zur Hand zu sein. Warum soll man nicht alles als Vorspann benutzen für das eigene Dasein –«
»Man hat für diese Ansicht den ausgezeichneten Ausdruck: unmoralisch«, sagte Fiola und verzog das Gesicht etwas.
»Außerdem ist sie nicht logisch, und das ist gut. Dem Fortschrittlichen sitzt die Logik in den Fingerspitzen. Generationen sind stolz darauf. Aber sie paralysiert das Gefühl, wenn man darunter keine Sentiments versteht, sondern diesen geschmeidigen, sehr aktiven Ansatz der Seele, der mit der Wirbelsäule der Katze verwandt ist, – biegsam, federnd, immer bereit zum Sprung. Logik schafft eine so prächtige Standardsituation von Überlegenheit, daß jede Ahnung, auch jenseits könnten noch lohnende Bezirke sein, schwindet. So bleibt das Wesentliche isoliert und frei von Professoren und Bankiers.«
Fiola ergänzte mokant: »Von Tüchtigen und Betriebsamen.«
Kai nahm Zigaretten heraus. »Zerpredigen wir uns nicht die Stimmung.«
»Ich finde, wir untermauern sie solide.«
»Das ist noch schlimmer. Man müßte etwas tun.«
Die Kreolen sangen jetzt zu ihren Banjos und Saxophonen. Zwischen den Silhouetten der Sitzenden näherte sich wieder das Profil der tanzenden Frau.
»Sie haben recht«, sagte Fiola, »man müßte etwas tun. Man müßte sogar etwas Besonderes tun, wenn man diese Frau tanzen sieht.« Er lächelte Kai mit blanken Zähnen an. »Wollen wir versuchen, eine Roulettebank zu sprengen?«
»Einverstanden.«
Sie brachen auf. »Ich glaube, wir sind sehr entschlossen«, meinte Fiola erfreut.
»Sehr. Wir haben eine gute Basis.«
»Ich möchte sagen, daß wir sogar die Moral auf unserer Seite haben.«
»Wir werden um so vorsichtiger setzen.«
Vor dem Eingang warf Fiola eine Spielmarke über seinen Kopf zurück auf die Straße. »Ein Opfer für Merkur –«
»Nein, für die Venus.« Kai deutete auf eine Kokotte zu hundert Francs, die überrascht den unverhofft vor ihre Füße gefallenen Gewinn aufhob und Kußhände herüberwarf.
»Das bedeutet sicher Glück.« –
Sie beobachteten eine Weile die Roulettes. Kai setzte als erster. Fiola machte sich Notizen. Das Spiel war hoch und hart, es tändelte nicht mehr und war auch keine Unterhaltung, sondern beschäftigte alle Nerven. Es stand Fluidum im Raum.
Die Bank hatte einige so große Schläge auf Zéro, daß der Balkanier seinen Spinnenkasten zerschlug und aufgab. An seine Stelle trat eine korpulente belgische Dame. Sie brütete wie eine Glucke auf den Kissen, mit denen sie den Stuhl bepacken ließ, und ruderte mit fetten, trägen Bewegungen der Arme über den Tisch.
Kai tastete das Roulette ab. Er war dreimal mit Rouge heraus, versuchte mit dem ganzen Gewinn Impair, gewann, sicherte sich die erste Douzaine, holte sich mit der verdreifachten Summe auch noch einen Viererblock heran und ließ den gesamten Betrag dann auf der Sieben stehen. Es war alles Geld, das er bei sich getragen hatte.
Die Spannung des Spiels konzentrierte ihn jetzt so stark, daß nichts für ihn mehr existierte als die grüne Tischplatte, die von Kräften geschwollen schien bis zum Bersten. Wie ein Strudel schwirrte in ihr die Nummernplatte und machte atemlos, bis sich wie ein Blitz eine Zahl löste, grell und groß wurde, die Kugel fraß, schwankte, schwand und als normales Feld stille stand: die Sieben. Kai hatte gewonnen.
Schon entspannt, fiel ihm ein, daß die Situation sich wiederholte wie vor einer Stunde. Es war, als hätte die Zeit ihr Rad zurückgedreht und böte ihm noch einmal eine Chance. Da erfaßte ihn der Augenblick und riß ihn mit, er tat dasselbe wie vorher und setzte noch einmal auf die Sieben.
Fiola, der bereits alles verloren hatte, machte eine beschwörende Geste. Selbst der Croupier zauderte. Kai ließ trotzdem den Satz stehen. Er verlor und setzte wieder nach. Dreimal holte die Harke des Croupiers den Höchstsatz in die Kassen der Bank zurück. Nach einigen weiteren Schlägen war der Platz vor Kai leer. Die Bank hatte ihren Verlust wettgemacht.
Kai wollte aufstehen. Da fühlte er unter der Hand, die sich schon aufstützte, wieder Chips; sie waren ihm unbemerkt hingeschoben worden. Jetzt erst sah er, daß eine Frau schon lange neben ihm gesessen und gespielt hatte – er stutzte; – sie hatte ihm die Marken zugeschoben, aber er kannte sie nicht. Sie sagte sehr leise und fest: »Sie müssen das nächste Spiel setzen –«
Kai zauderte einige Sekunden. Das Spiel war nicht mehr eine Kette einzelner Einsätze, die beliebig unterbrochen werden konnte, es war eine selbständige Macht geworden, die den ganzen Tisch beherrschte mit eigenem zwingenden Gesetz. Fast kompakt hing es über der Situation und löste jeden anderen Begriff auf. Verschmolzen zu einem Block Erwartung und Vorauswitterung war der ganze Raum, durchzittert vom Fieber der Spannung –
Vielleicht hätten alle, die hier saßen und sich jetzt zu einer Front zusammengeschmiedet fühlten, Kai verstanden und ihn nicht gehindert, wenn er fremde Chips genommen und damit weitergespielt hätte; denn der wahrhafte Spieler kennt die fluktuierende Magie, die eine Serie begleitet und ihr vorausgeht, und er weiß, daß ein ausgelassener Einsatz alles vernichtet und nicht nachzuholen ist.
Jeder in dieser passionierten Spielergruppe fühlte, daß eine Entscheidung kam, daß vor Kai eine Serie lag, und jeder war bereit mitzusetzen. Man hatte nicht bemerkt, daß Kai ohne Einsatzgeld war, sonst hätten seine Bekannten ihm ausgeholfen. Er hätte sich auch selbst an sie wenden können, aber das Spiel ging so schnell, daß er mindestens einen Einsatz darüber verpassen mußte. Und gerade auf diesen Einsatz kam es an; – ihn auszulassen, wäre ein Fehler gewesen und ein Wiederbeginn danach der absurde Versuch stilloser Imitation. Es war das nächste Spiel, nur das nächste Spiel, das gebieterisch Kais Einsatz forderte –
Schon leierte der Croupier seinen Satz und blickte zu ihm hinüber. Kai sah, wie Fiola seine Lage begriff und hastig eine Visitenkarte beschrieb, um sie herüberzureichen, er spürte verwandtes Blut dort gegenüber und hier neben sich – im letzten Augenblick schob er die Chips der Unbekannten auf Rouge und bekam sofort das Doppelte ausgezahlt.
Er gab den Einsatz mit kurzem Dank zurück und pflasterte Impair, Rouge und zwei Ziffern. Die Ziffern kamen heraus.
Eine Dreierserie nahm der Belgierin sämtliche Marken. Sie lachte ärgerlich und ging. Die Schildkröte erschien dafür mit einem Berg Banknoten und einem dichtbeschriebenen Notizbuch, Mascotte und System – was konnte da fehlgehen. –
Aber es ging fehl. Kai zwang die Bank zurück. Die Frau neben ihm verstand seine Absicht und griff gemeinsam mit ihm an. Fiola kaufte auf seine Visitenkarten Geld und begann ebenfalls wieder. Die Bank zahlte jedoch noch unter Deckung aus, da der Brasilianer stark verlor.
Es war noch ein zweiter Roulettetisch im Zimmer. Fiola stand auf und setzte gleichzeitig auch daran. Kai folgte. Kurze Zeit darauf verschwand die Schildkröte. Dafür kam Bird und machte gemeinsame Sache mit den anderen gegen die Bank.
Die Kunde von dem tollen Duell hatte sich schnell verbreitet. Die übrigen Säle verödeten. Man stand, teilweise noch die Zeitungen aus dem Lesezimmer in der Hand, in mehreren Reihen um die Tische. Ein Croupier verrechnete sich, ein unerhörter Vorfall.
Das Fieber verbreitete sich wie eine Suggestion. Immer mehr Menschen setzten und nahmen an der Schlacht teil. Bei aller Energie wurde umsichtig gespielt. Die Plätze mit zwei- und dreifachem Geld waren immer am stärksten belegt.
Langsam wurde die Bank schwächer. Sie gewann zwar einige gute Spiele, mußte aber im Durchschnitt abgeben und die Reserven angreifen.
Endlich gingen Fiola und Kai zum Äußersten. Sie sammelten sich mit den Höchstsätzen auf wenigen Feldern, die sofort auch von den anderen Spielern überschwemmt wurden. Der Coup glückte an einem Tisch. Er hatte so viel auszuzahlen, daß der Bestand nicht reichte. Der Croupier mußte um eine Pause bitten.
Man stürzte sich sehr animiert auf die zweite Roulette. Die Stimmung war so enthusiastisch brüderlich, daß die Kugel davon beeinflußt zu sein schien. Schon der nächste Satz zeigte das Maximum en plein mit so starken Verpflichtungen, daß auch hier unterbrochen und Geld geholt werden mußte. Wie eine Meeresbrandung schwoll mit einem Male das Gespräch auf. Der Sporting-Club hatte für die nächsten drei Tage seine Sensation: ein ganzer Saal der Bank war gesprengt.
Kai verließ den Club in ausgezeichneter Laune; ihm war, als hätte er glücklich eine schwere Arbeit beendet. Was drinnen noch gestikulierte und sich bewegte, ging ihn nichts mehr an.
Er fühlte eine Leichtigkeit der Glieder, die an Übermut grenzte; – es war ihm nicht so wichtig, Geld gewonnen zu haben, er wußte nicht einmal, ob er alles eingesteckt hatte; – aber er empfand, daß dieser Tag, der sich jetzt im Aufbau dem Blick als eine steile Spirale zeigte, gut gewesen war und ihm das Federnde und Leichte gab, als habe er tausend Verbündete.
Er ging geradewegs auf seinen Wagen zu, der wie ein Freund da stand, niedrig auf seinen Rädern gelagert, markant in der Linie des Sporttyps ausgeschwungen.
Auf der Kühlerhaube krustete Lehm. Kai bröckelte Stücke davon ab und zerrieb sie gedankenlos zwischen den Fingern. Dann nahm er ein Taschentuch, denn er hatte bemerkt, daß der Nickelbelag grau war, und rieb eine kleine Fläche blank.
Dabei überraschte ihn sein wacheres Bewußtsein, –er warf das Tuch fort und ließ den Motor anspringen. Er wollte bis La Turbie, die Grande Corniche hinauf, um mit diesem Eindruck den Tag zu enden.
Frute schob den Kopf unter seinem Arm durch und behinderte ihn im Lenken. Langsam und in Absätzen wendete er den Wagen. Die Avenue de Monte Carlo war ausgestorben; nur eine einzelne Gestalt kam aus der Richtung des Boulevard de la Condamine herauf. Eine kleine Toque, darunter ein etwas verschminktes Gesicht und ein müder Mund.
Kai glaubte, die Kokotte wiederzuerkennen, die den Chip Fiolas aufgehoben hatte. Sie kam heran, blieb unschlüssig stehen und lächelte. So stand sie, schmal und gering vor dem Hintergrund der leeren Straße und des dahinter ragenden Bergmassivs, ein winziges Stück Lebendigkeit vor Laternenreihen und Schweigen, und lächelte ein armes, berufsmäßiges Lächeln, unsicher wie ein Tier, das nicht weiß, was der nächste Augenblick bringt.
Dieses Lächeln rührte Kai; es war mehr darin als in lautem Jammer – eine Tragik, von der die kleine Kokotte selbst nichts ahnte. Es war auch wohl keine Tragik für sie selbst – sie war ein Wesen, das in dem Amalgam entgoltener Gefühle stumpf geworden war – es war nur tragisch für den anderen, der hinter ihr das Menschenhafte sah – hinter ihr – nicht in ihr –.
Kai öffnete den Schlag. »Ich will etwas hinausfahren. Würde es Ihnen Freude machen, dabei zu sein?«
Sie erstaunte nicht, ihr Beruf hatte sie an Wunderlichkeiten gewöhnt. Sie nickte und stieg wortlos ein; es würde sich schon früh genug zeigen, was kommen sollte.