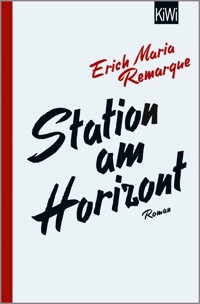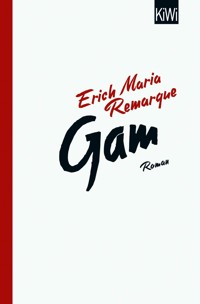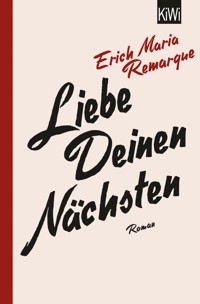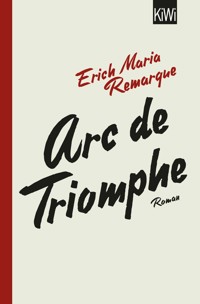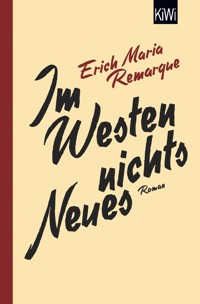11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Sie spielten mit dem Tode, sie tobten durch die Nacht, sie fielen der entsetzlichen Müdigkeit des frühen Morgens anheim mit starren, maskengleichen ... Gesichtern, sie rasten weiter, weiter, als ginge es um das Größte der Welt.« Zwei Schicksale in unruhigen Zeiten: Kurz nach Ende des Zweiten Weltkrieges erleben die lungenkranke Lillian und der Rennfahrer Clerfayt eine Liebe zwischen Paris, Rom und Monte Carlo, die nur von kurzer Dauer sein kann. Ein ungewöhnlicher Remarque-Roman und sein philosophisches Vermächtnis: Was ist der Wert des Lebens angesichts der Unausweichlichkeit des Todes?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 478
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Erich Maria Remarque
Der Himmel kennt keine Günstlinge
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Erich Maria Remarque
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Erich Maria Remarque
Erich Maria Remarque, 1898 in Osnabrück geboren, besuchte das katholische Lehrerseminar. 1916 als Soldat eingezogen, wurde er nach dem Krieg zunächst Aushilfslehrer, später Gelegenheitsarbeiter, schließlich Redakteur in Hannover und Berlin. 1932 verließ Remarque Deutschland und lebte zunächst im Tessin/Schweiz. Seine Bücher Im Westen nichts Neues und Der Weg zurück wurden 1933 von den Nazis verbrannt, er selber wurde 1938 ausgebürgert. Ab 1939 lebte Remarque in den USA und erlangte 1947 die amerikanische Staatsbürgerschaft. 1970 starb er in seiner Wahlheimat Tessin.
Der Herausgeber
Thomas F. Schneider, Leiter des Erich Maria Remarque-Friedenszentrums an der Universität Osnabrück, veröffentlichte zahlreiche Bücher zur Kriegs- und Antikriegsliteratur im 20. Jahrhundert, zur Exilliteratur und zu Erich Maria Remarque.
Das Gesamtwerk von Erich Maria Remarque liegt im Verlag Kiepenheuer & Witsch vor: www.kiwi-verlag.de
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Zu Beginn der fünfziger Jahre besucht der alternde Rennfahrer Clerfayt seinen ehemaligen Beifahrer in einem Sanatorium, in dem er seit längerer Zeit wegen Lungentuberkulose behandelt wird. Dort lernt Clerfayt die schwerkranke Lilian kennen. Sie verachtet die seit Jahren gleiche Routine, die Langeweile und die strengen Regeln des Sanatoriums und nutzt die Gelegenheit, um mit Clerfayt zu flüchten. Die beiden haben eines gemeinsam: die Tatsache, dass sie keine sichere Zukunft haben. Clerfayt lebt sein Leben immer nur bis zum nächsten Rennen, entgeht immer wieder dem nahen Tod, und Lilians Dasein ist ständig bedroht von einen neuen Ausbruch der Tuberkulose. Zwischen Paris, Rom und Monte Carlo erleben die beiden eine Liebe, die nur von kurzer Dauer sein kann.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 1947, 1961, 1990, 1998, 2018, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
© 1961 by the Estate of the late Paulette Remarque
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Rudolf Linn, Köln
Frontispiz: Erich Maria Remarque in Rom, 1968. © Erich Maria Remarque-Friedenszentrum Osnabrück
ISBN978-3-462-31911-8
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Frontispiz
Widmung
Hinweis
I. Kapitel
II. Kapitel
III. Kapitel
IV. Kapitel
V. Kapitel
VI. Kapitel
VII. Kapitel
VIII. Kapitel
IX. Kapitel
X. Kapitel
XI. Kapitel
XII. Kapitel
XIII. Kapitel
XIV. Kapitel
XV. Kapitel
XVI. Kapitel
XVII. Kapitel
XVIII. Kapitel
XIX. Kapitel
XX. Kapitel
XXI. Kapitel
XXII. Kapitel
Anhang
Chronologie
Über die Kontakte …
Erstmalig erscheint eine Figur …
Der Roman »Der Himmel kennt keine Günstlinge« …
Nach der Vereinbarung mit dem Chefredakteur Pabst …
Der Roman erschien unter dem Titel …
Die Szene mit Clerfayt und Lillian …
Die Dialoge zwischen Wolkow und Lillian …
Editorische Notiz
Vor den Toren des Hades
Weiterführende Literatur
Für Paulette Goddard Remarque
Der Verfasser mußte sich einige Freiheiten mit der Technik und dem Ablauf der Automobilrennen erlauben. Er hofft, daß die Rennfanatiker dafür Verständnis haben werden.
I
Clerfayt hielt den Wagen an einer Tankstation, vor der der Schnee weggeschaufelt war, und hupte. Krähen lärmten um die Telefonmasten, und in der kleinen Werkstatt hinter der Tankstelle hämmerte jemand auf Blech. Das Hämmern hörte auf, und ein Junge von sechzehn Jahren kam heraus, der einen roten Sweater und eine Stahlbrille trug.
»Füll den Tank auf«, sagte Clerfayt und stieg aus.
»Mit Super?«
»Ja. Kann man irgendwo noch etwas zu essen kriegen?«
Der Junge deutete mit dem Daumen über die Straße. »Drüben. Die Spezialität war heute mittag Berner Platte. Soll ich die Ketten abnehmen?«
»Warum?«
»Die Straße ist weiter oben noch vereister als hier.«
»Den ganzen Pass rauf?«
»Über den Pass können Sie nicht fahren. Der ist seit gestern wieder geschlossen. Mit einem so niedrigen Sportwagen kommen Sie da schon gar nicht rüber.«
»Nein?« sagte Clerfayt. »Du machst mich neugierig.«
»Sie mich auch«, erwiderte der Junge.
Die Wirtsstube war ungelüftet und roch nach altem Bier und langem Winter. Clerfayt bestellte Bündner Fleisch, Brot, Käse und eine Karaffe Aigle. Er ließ sich das Essen von dem Mädchen auf die Terrasse bringen. Es war nicht sehr kalt draußen. Der Himmel war mächtig und enzianblau.
»Soll ich die Kutsche mit dem Schlauch abspritzen?« fragte der Junge von der Tankstelle her. »Sie kann es verdammt gebrauchen.«
»Nein. Mach nur die Windschutzscheibe sauber.«
Der Wagen war lange nicht gewaschen worden und zeigte es. Ein Sturzregen hinter Aix hatte den roten Staub der Küste von St. Raphaël auf Kühlerhaube und Kotflügeln in ein Batikmuster verwandelt; dazu waren die Kalkspritzer aus den Pfützen der Straßen Mittelfrankreichs gekommen und der Dreck, den die Hinterräder zahlloser Lastwagen auf die Karosserie geschleudert hatten, wenn sie überholt wurden. Weshalb bin ich nur hierher gefahren? dachte Clerfayt. Zum Skilaufen ist es ohnehin fast zu spät. Und Mitleid? Mitleid ist ein schlechter Reisebegleiter – und ein noch schlechteres Reiseziel. Warum fahre ich nicht nach München? Oder nach Mailand? Aber was soll ich in München tun? Oder in Mailand? Oder irgendwo anders? Ich bin müde, dachte er. Müde des Bleibens und müde des Abschieds. Oder bin ich nur müde des Entscheidens? Aber was habe ich schon zu entscheiden? Er trank den Wein aus und ging in die Wirtsstube zurück.
Das Mädchen wusch Gläser hinter der Theke. Der ausgestopfte Kopf einer Gemse starrte aus gläsernen Augen über sie und Clerfayt hinweg auf die Reklame einer Züricher Brauerei an der Wand gegenüber. Clerfayt holte eine flache, mit Leder bezogene Flasche aus der Tasche. »Können Sie mir die mit Kognak füllen?«
»Courvoisier, Rémy-Martin, Martell?«
»Martell.«
Das Mädchen begann, den Kognak glasweise einzumessen. Eine Katze kam herein und strich um Clerfayts Beine. Er ließ sich noch zwei Pakete Zigaretten und Streichhölzer geben und bezahlte seine Rechnung.
»Sind das Kilometer?« fragte draußen der Junge im roten Sweater und zeigte auf den Geschwindigkeitsmesser.
»Nein, Meilen.«
Der Junge stieß einen Pfiff aus. »Was machen Sie denn hier in den Alpen? Warum sind Sie mit einer solchen Karre nicht auf der Autostrada?«
Clerfayt sah ihn an. Blinkende Brillengläser, eine aufgeworfene Nase, Pickel, abstehende Ohren – ein Wesen, das die Melancholie der Kindheit gerade gegen alle Fehler halben Erwachsenseins eingetauscht hatte. »Man tut nicht immer, was richtig ist, mein Sohn«, sagte er. »Selbst, wenn man es weiß. Darin kann manchmal der Charme des Lebens liegen. Kapiert?«
»Nein«, erwiderte der Junge und schnupfte. »Aber die SOS-Telefone finden Sie auf dem ganzen Pass. Anruf genügt, wenn Sie steckenbleiben. Wir holen Sie. Hier ist unsere Nummer.«
»Habt ihr keine Bernhardiner mehr mit Schnapsfläschchen um den Hals?«
»Nein. Der Kognak ist zu teuer, und die Hunde wurden zu schlau. Sie tranken den Schnaps selbst. Dafür haben wir jetzt Ochsen. Gesunde Ochsen zum Abschleppen.«
Der Junge hielt mit blinkenden Brillengläsern Clerfayts Blick stand. »Du hast mir heute noch gefehlt«, sagte der schließlich. »Ein Alpenschlauberger auf zwölfhundert Meter Höhe! Heißt du vielleicht auch noch Pestalozzi oder Lavater?«
»Nein. Göring.«
»Was?«
»Göring.« Der Junge zeigte ein Gebiss, in dem ein Vorderzahn fehlte. »Aber Hubert mit Vornamen.«
»Verwandt mit dem –«
»Nein«, unterbrach Hubert. »Wir sind Basler Görings. Wenn ich zu den andern gehörte, brauchte ich hier nicht Benzin zu zapfen. Dann kriegten wir eine dicke Pension.«
Clerfayt schwieg einen Augenblick. »Ein sonderbarer Tag«, sagte er dann. »Wer hätte das erwartet? Alles Gute, mein Sohn, für dein weiteres Leben. Du warst eine Überraschung.«
»Sie nicht. Sie sind Rennfahrer, nicht wahr?«
»Warum?«
Hubert Göring zeigte auf eine fast abgewaschene Nummer unter dem Dreck auf der Kühlerhaube.
»Ein Detektiv bist du auch noch?« Clerfayt stieg in den Wagen. »Vielleicht sollte man dich doch lieber bald einsperren, um die Menschheit vor einem neuen Unglück zu bewahren. Wenn du erst Ministerpräsident bist, ist es zu spät.«
Er ließ den Motor an. »Sie haben vergessen zu bezahlen«, erklärte Hubert. »Zweiundvierzig Fränkli.«
Clerfayt gab ihm das Geld. »Fränkli!« sagte er. »Das beruhigt mich wieder, Hubert. Ein Land, in dem das Geld einen Kosenamen hat, wird nie eine Diktatur.«
Eine Stunde später saß der Wagen fest. Ein paar Schneebretter waren am Hang abgebrochen und hatten die Strecke verschüttet. Clerfayt hätte umdrehen und wieder hinunterfahren können; aber er hatte keine Lust, dem Fischblick Hubert Görings so rasch wieder zu begegnen. Außerdem kehrte er nicht gerne um. So blieb er geduldig in seinem Wagen sitzen, rauchte Zigaretten, trank Kognak, horchte auf das Geschrei der Krähen und wartete auf Gott.
Gott erschien nach einiger Zeit in Gestalt eines kleinen Schneepfluges. Clerfayt teilte den Rest seines Kognaks mit dem Führer. Dann fuhr der Mann vor und begann mit seiner Maschine den Schnee aufzuwirbeln und zur Seite zu werfen. Es sah aus, als zersäge er einen riesigen, weißen, gefallenen Baum zu einem strahlenden Zirkel von Spänen, die in der schrägen Sonne alle Farben des Regenbogens zeigten.
Zweihundert Meter weiter war die Straße wieder frei. Der Schneepflug wich zur Seite, und der Wagen Clerfayts glitt an ihm vorbei. Der Führer winkte ihm nach. Er trug, ebenso wie Hubert, einen roten Sweater und eine Brille. Clerfayt hatte sich deshalb mit ihm in keine andere Unterhaltung eingelassen als in die sichere über Schnee und Schnaps; ein zweiter Göring am selben Tage wäre etwas zuviel gewesen.
Hubert hatte geschwindelt; der Pass war oben nicht gesperrt. Der Wagen zog jetzt rasch der Höhe zu, und plötzlich lag tief unten das Tal vor Clerfayt, blau und weich in der frühen Dämmerung, und darin verstreut, wie in einer Spielzeugschachtel, das Dorf mit weißen Dächern, einem schiefen Kirchturm, Eisplätzen, ein paar Hotels, und den ersten Lichtern in den Häusern. Er hielt den Wagen einen Augenblick an und sah hinunter. Dann fuhr er langsam die Kurven hinab. Irgendwo da unten in einem Sanatorium mußte Hollmann hausen, sein Beifahrer, der vor einem Jahr krank geworden war. Der Arzt hatte Tuberkulose festgestellt, und Hollmann hatte darüber gelacht – so etwas gab es doch nicht mehr im Zeitalter der Antibiotika und der Wunderpilze, und wenn es das noch gab, dann bekam man eine Handvoll Tabletten, eine Anzahl Spritzen und war wieder gesund. Aber die Wundermittel waren nicht ganz so glorreich und unfehlbar gewesen wie man sie gepriesen hatte, besonders nicht bei Menschen, die im Kriege aufgewachsen waren und wenig zu essen gehabt hatten. Bei der Tausendmeilenfahrt in Italien hatte Hollmann kurz vor Rom eine Blutung bekommen, und Clerfayt hatte ihn beim Depot absetzen müssen. Der Arzt hatte darauf bestanden, ihn für ein paar Monate in die Berge zu schicken. Hollmann hatte getobt und sich schließlich gefügt; doch aus den paar Monaten war jetzt fast ein Jahr geworden.
Der Motor begann plötzlich zu spucken. Die Kerzen, dachte Clerfayt; wieder einmal! Das kam davon, wenn man beim Fahren nicht ans Fahren dachte! Er ließ den Wagen das letzte Stück der Steigung ausgekuppelt hinabrollen, bis er auf der ebenen Straße hielt, und öffnete die Motorhaube.
Es waren, wie immer, die Kerzen des zweiten und vierten Zylinders, die verölt waren. Er schraubte sie heraus, putzte sie, setzte sie aufs neue ein und ließ die Maschine wieder an. Der Motor funktionierte jetzt, und Clerfayt schob mit der Hand den Gashebel ein paar Mal hin und her, um das überflüssige Öl aus den Zylindern zu entfernen. Als er sich aufrichtete, sah er, daß die Pferde eines Schlittens, der von der anderen Seite kam, durch das plötzliche Heulen des Motors scheu geworden waren. Sie stiegen auf und rissen den Schlitten quer auf den Wagen zu. Er lief ihnen entgegen, griff das linke Pferd am Kopfgeschirr und ließ sich schleppen.
Nach ein paar Sprüngen blieben die Tiere stehen. Sie zitterten, und der Dampf ihres Atems wehte um ihre Köpfe. Ihre erschreckten, irren Augen wirkten, als gehörten sie vorzeitlichen Kreaturen. Clerfayt ließ die Riemen vorsichtig los. Die Pferde blieben stehen, schnaubend und mit den Schellen klirrend. Er sah, daß es keine gewöhnlichen Schlittengäule waren.
Ein großer Mann, der eine randlose Kappe aus schwarzem Pelz trug, stand im Schlitten auf und redete beruhigend auf die Tiere ein. Neben ihm saß eine junge Frau, die sich an den Lehnen ihres Sitzes festhielt. Sie hatte ein braunes Gesicht und sehr helle Augen.
»Es tut mir leid, daß ich Sie erschreckt habe«, sagte Clerfayt. »Ich habe nicht daran gedacht, daß Pferde hier nicht an Autos gewöhnt sind.«
Der Mann beschäftigte sich noch eine Weile weiter mit den Tieren; dann ließ er die Zügel locker und wandte sich halb um. »Nicht an Autos, die solchen Lärm machen«, erklärte er abweisend. »Immerhin, ich hätte den Schlitten schon halten können. Vielen Dank, daß Sie uns retten wollten.«
Clerfayt blickte auf. Er sah in ein hochmütiges Gesicht, in dem eine Spur von Spott glimmte, als mache der Mann sich höflich darüber lustig, daß er unnötig den Helden hatte spielen wollen. Es war lange her, daß ihm jemand auf den ersten Blick derart missfallen hatte. »Ich wollte nicht Sie retten«, erwiderte er trocken. »Nur meinen Wagen vor Ihren Schlittenkufen.«
»Ich hoffe, Sie haben sich dabei nicht unnötig beschmutzt.«
Der Mann wandte sich wieder den Pferden zu. Clerfayt sah die Frau an. Wohl deshalb, dachte er. Will selbst der Held bleiben. »Nein, ich habe mich nicht beschmutzt«, erwiderte er langsam. »Dazu gehört schon etwas mehr.«
Das Sanatorium Bella Vista lag auf einer kleinen Anhöhe über dem Dorfe. Clerfayt parkte den Wagen auf einem flachen Platz neben dem Eingang, auf dem ein paar Schlitten standen. Er stellte den Motor ab und legte eine Decke über die Haube, um ihn warm zu halten. »Clerfayt!« rief jemand vom Eingang her.
Er drehte sich um und sah zu seinem Erstaunen Hollmann auf sich zugelaufen kommen. Er hatte geglaubt, er läge zu Bett.
»Clerfayt!« rief Hollmann. »Bist du es wirklich?«
»So wirklich, wie man es sein kann. Und du! Du läufst herum? Ich dachte, du lägest im Bett.«
Hollmann lachte. »Das ist hier altmodisch.« Er klopfte Clerfayt auf den Rücken und starrte auf den Wagen. »Ich glaubte, von unten Giuseppes Gebrüll zu hören, und dachte schon, es wäre eine Halluzination. Dann sah ich euch die Steigung heraufkommen. So eine Überraschung! Wo kommst du her?«
»Aus Monte Carlo.«
»So etwas!« Hollmann konnte sich nicht beruhigen. »Und mit Giuseppe, dem alten Löwen! Ich dachte schon, ihr hättet mich vergessen!«
Er tätschelte die Karosserie des Wagens. Er hatte ein halbes Dutzend Rennen in ihm mitgefahren. Er hatte in ihm auch seine erste schwere Blutung gehabt.
»Es ist doch noch Giuseppe, was? Nicht schon ein jüngerer Bruder?«
»Es ist Giuseppe. Aber er fährt keine Rennen mehr. Ich habe ihn von der Fabrik gekauft. Er ist jetzt im Ruhestand.«
»So wie ich.«
Clerfayt sah auf. »Du bist nicht im Ruhestand. Du bist auf Urlaub.«
»Ein Jahr! Das ist kein Urlaub mehr. Aber komm herein! Wir müssen das Wiedersehn feiern! Was trinkst du jetzt? Immer noch Wodka?«
Clerfayt nickte. »Gibt es bei euch denn Wodka?«
»Für Gäste gibt es hier alles. Dies ist ein modernes Sanatorium.«
»Das scheint so. Es sieht aus wie ein Hotel.«
»Das gehört zur Behandlung. Moderne Therapie. Wir sind Kurgäste; nicht mehr Patienten. Die Worte Krankheit und Tod sind tabu. Man ignoriert sie. Angewandte Psychologie. Sehr praktisch für die Moral; aber man stirbt trotzdem. Was hast du in Monte Carlo gemacht? Das Rallye mitgefahren?«
»Ja. Liest du keine Sportnachrichten mehr?«
Hollmann war einen Moment verlegen. »Anfangs habe ich es getan. Dann nicht mehr. Idiotisch, was?«
»Nein, vernünftig. Lies sie, wenn du wieder fährst.«
»Ja«, sagte Hollmann. »Wenn ich wieder fahre. Und wenn ich in der Lotterie das Große Los gewinne. Mit wem hast du das Rallye gefahren?«
»Mit Torriani.«
Sie gingen dem Eingang zu. Die Hänge waren rot von der untergehenden Sonne. Skiläufer schossen wie schwarze Kommas durch den Glanz. »Schön hier«, sagte Clerfayt.
»Ja, ein schönes Gefängnis.«
Clerfayt erwiderte nichts. Er kannte andere Gefängnisse. »Fährst du jetzt immer mit Torriani?« fragte Hollmann.
»Nein. Mal mit dem einen, mal mit dem anderen. Ich warte auf dich.«
Es war nicht wahr. Clerfayt fuhr seit einem halben Jahr die Sportwagen-Rennen mit Torriani. Aber da Hollmann keine Sportnachrichten mehr las, war es eine bequeme Lüge.
Sie wirkte auf Hollmann wie Wein. Ein feiner Streifen von Schweißtropfen bildete sich plötzlich auf seiner Stirn. »Hast du etwas im Rallye gemacht?« fragte er.
»Nichts. Wir waren zu spät.«
»Von wo seid ihr gefahren?«
»Von Wien. Es war eine Kateridee. Jede Sowjetpatrouille hat uns aufgehalten. Glaubten alle, wir wollten Stalin entführen oder hätten Dynamit geladen. Ich wollte auch gar nicht gewinnen, – nur den neuen Wagen ausprobieren. Straßen haben die da in der Russischen Zone! Wie aus der Eiszeit!«
Hollmann lachte. »Das war Giuseppes Rache! Wo bist du vorher gefahren?«
Clerfayt hob die Hand. »Laß uns etwas trinken. Und tu mir einen Gefallen: Laß uns die ersten Tage hier meinetwegen über alles reden, nur nicht über Rennen und Automobile!«
»Aber Clerfayt! Worüber sonst?«
»Nur für ein paar Tage.«
»Was ist los? Ist etwas passiert?«
»Nichts. Ich bin müde. Möchte mich ausruhen und einmal ein paar Tage nichts von diesem verdammten Unfug hören, Menschen auf zu schnellen Maschinen herumrasen zu lassen. Das verstehst du doch.«
»Natürlich«, sagte Hollmann. »Aber was ist los? Was ist passiert?«
»Nichts«, erwiderte Clerfayt ungeduldig. »Ich bin nur abergläubisch, wie jeder andere. Mein Kontrakt läuft ab und ist noch nicht erneuert. Ich will nichts berufen. Das ist alles.«
»Clerfayt«, sagte Hollmann, »wer ist gestürzt?«
»Ferrer. In einem albernen, kleinen Mistrennen an der Küste.«
»Tot?«
»Noch nicht. Aber man hat ihm ein Bein amputiert. Und das verrückte Weib, das mit ihm herumgezogen ist, die falsche Baronin, weigert sich, ihn zu sehen. Sie sitzt im Spielsaal und heult. Sie will keinen Krüppel. Komm jetzt und gib mir einen Schnaps. Mein letzter Kognak ist im Rachen eines Schneepflugführers verschwunden, der vernünftiger ist als wir; sein Wagen fährt nicht über fünf Kilometer die Stunde.«
Sie saßen in der Halle an einem kleinen Tisch neben dem Fenster. Clerfayt sah sich um. »Sind das alles Kranke?«
»Nein. Auch Gesunde, die die Kranken besuchen.«
»Natürlich! Und die mit den blassen Gesichtern sind die Kranken?«
Hollmann lachte. »Das sind die Gesunden. Sie sind blaß, weil sie erst vor kurzem heraufgekommen sind. Die andern, die braun wie Sportsleute sind, sind die Kranken, die schon lange hier sind.«
Ein Mädchen brachte ein Glas Orangensaft für Hollmann und eine kleine Karaffe Wodka für Clerfayt. »Wie lange willst du bleiben?« fragte Hollmann.
»Ein paar Tage. Wo kann ich wohnen?«
»Am besten im Palace Hotel. Da ist eine gute Bar.«
Clerfayt blickte auf den Orangensaft. »Woher weißt du das?«
»Wir gehen dahin, wenn wir hier mal ausreißen.«
»Ausreißen?«
»Ja, manchmal nachts, wenn wir uns als Gesunde fühlen wollen. Es ist verboten, aber wenn der Cafard einen erwischt, ist es besser, als eine erfolglose Diskussion mit Gott darüber zu führen, warum man krank sei.« Hollmann holte eine flache Flasche aus der Brusttasche und goß einen Schluck in sein Glas. »Gin«, sagte er. »Hilft auch.«
»Dürft ihr nicht trinken?« fragte Clerfayt.
»Es ist nicht ganz verboten; aber so ist es einfacher.« Hollmann schob die Flasche zurück in die Tasche. »Man wird ziemlich kindisch hier oben.«
Ein Schlitten hielt vor dem Eingang. Clerfayt sah, daß es derselbe war, dem er auf der Straße begegnet war. Der Mann mit der schwarzen Pelzkappe stieg aus. »Weißt du, wer das ist?« fragte Clerfayt.
»Die Frau?«
»Nein, der Mann.«
»Ein Russe. Er heißt Boris Wolkow.«
»Weißrusse?«
»Ja. Aber zur Abwechslung kein früherer Großfürst und nicht arm. Sein Vater soll zur rechten Zeit ein Konto in London eröffnet haben und zur falschen Zeit in Moskau gewesen sein; er wurde erschossen. Die Frau und der Sohn kamen heraus. Die Frau soll nußgroße Smaragde in ihr Korsett eingenäht gehabt haben. 1917 trug man noch Korsetts.«
Clerfayt lachte. »Du bist ja ein wahres Detektivbüro! Woher weißt du das alles?«
»Hier weiß man bald alles über einander«, erwiderte Hollmann mit einer Spur von Bitterkeit. »In zwei Wochen, wenn der Sportbetrieb vorbei ist, ist dies Dorf nichts anderes mehr als ein kleines Klatschnest für den Rest des Jahres.«
Eine Gruppe schwarzgekleideter kleiner Leute drängte sich hinter ihnen vorbei. Sie unterhielten sich lebhaft auf spanisch. »Für ein kleines Dorf scheint ihr ziemlich international zu sein«, sagte Clerfayt.
»Das sind wir. Der Tod ist immer noch nicht chauvinistisch.«
»Dessen bin ich nicht mehr so ganz sicher.« Clerfayt blickte zur Tür. »Ist das da die Frau des Russen?«
Hollmann sah sich um. »Nein.«
Der Russe und die Frau kamen herein. »Sind die beiden etwa auch krank?« fragte Clerfayt.
»Ja. Sie sehen nicht so aus, was?«
»Nein.«
»Das ist oft so. Eine Zeitlang sieht man aus wie das blühende Leben. Dann nicht mehr; aber dann läuft man auch nicht mehr herum.«
Der Russe und die Frau blieben neben der Tür stehen. Der Mann redete eindringlich auf die Frau ein. Sie hörte ihm zu, schüttelte dann heftig den Kopf und ging rasch nach hinten in die Halle. Der Mann sah ihr nach und wartete einen Augenblick; dann ging er nach draußen und stieg in den Schlitten.
»Sie scheinen Streit zu haben«, sagte Clerfayt, nicht ohne Genugtuung.
»So etwas passiert alle Augenblicke. Jeder wird hier nach einiger Zeit etwas verrückt. Gefangenenlager-Psychose. Die Proportionen verschieben sich; Kleinigkeiten werden wichtig, und Wichtiges wird nebensächlich.«
Clerfayt sah Hollmann aufmerksam an. »Bei dir auch?«
»Bei mir auch. Man kann nicht immer auf denselben Punkt starren.«
»Wohnen die beiden auch hier?«
»Die Frau; der Mann wohnt außerhalb.«
Clerfayt stand auf. »Ich fahre jetzt ins Hotel. Wo können wir zusammen zu Abend essen?«
»Hier. Wir haben ein Esszimmer, in dem Gäste erlaubt sind.«
»Gut. Wann?«
»Um sieben. Ich muß um neun zu Bett. Wie in der Schule.«
»Wie beim Militär«, sagte Clerfayt. »Oder vor einem Rennen. Erinnerst du dich noch, wie unser Rennleiter uns in Mailand wie Hühner ins Hotel scheuchte?«
Hollmanns Gesicht hellte sich auf. »Gabrielli? Ist er noch da?«
»Natürlich. Was kann ihm schon passieren? Rennleiter sterben im Bett – so wie Generäle.«
Die Frau, die mit dem Russen hereingekommen war, kam zurück. Sie wurde am Ausgang von einer grauhaarigen Frau aufgehalten, die leise und scharf etwas zu ihr sagte. Sie erwiderte nichts und drehte sich um. Unschlüssig blieb sie stehen, dann sah sie Hollmann und kam zu ihm herüber. »Das Krokodil will mich nicht mehr herauslassen«, flüsterte sie. »Es behauptet, ich hätte nicht ausfahren dürfen. Es müsse mich dem Dalai Lama melden, wenn ich es noch einmal versuche –«
Sie hielt inne. »Dies ist Clerfayt, Lillian«, sagte Hollmann. »Ich habe Ihnen von ihm erzählt. Er ist überraschend gekommen.«
Die Frau nickte. Sie schien Clerfayt nicht wiederzuerkennen und wandte sich aufs neue Hollmann zu. »Sie behauptet, ich müsse ins Bett«, sagte sie ärgerlich. »Nur, weil ich vor ein paar Tagen etwas Fieber gehabt habe. Aber ich lasse mich nicht einsperren. Nicht heute abend! Bleiben Sie auf?«
»Ja. Wir essen in der Vorhölle.«
»Ich komme auch.«
Sie nickte Clerfayt und Hollmann zu und ging zurück. »Das alles muß dir tibetanisch vorkommen«, sagte Hollmann. »Die Vorhölle heißt hier der Raum, in dem Gäste zugelassen werden. Der Dalai Lama ist natürlich der Professor, das Krokodil die Oberschwester –«
»Und die Frau?«
»Sie heißt Lillian Dunkerque, Belgierin mit einer russischen Mutter. Die Eltern sind tot.«
»Warum ist sie wegen solcher Lappalien so aufgeregt?«
Hollmann hob die Schultern. Er wirkte plötzlich müde. »Ich habe dir schon gesagt, daß alle hier etwas verrückt werden. Besonders, wenn jemand gestorben ist.«
»Ist jemand gestorben?«
»Ja, eine Freundin von ihr. Gestern, hier im Sanatorium. Es geht einen nichts an, aber irgendetwas stirbt doch immer mit. Etwas Hoffnung wahrscheinlich.«
»Ja«, sagte Clerfayt. »Aber das ist überall so.«
Hollmann nickte. »Sie fangen hier an zu sterben, wenn es Frühling wird. Mehr als im Winter. Merkwürdig, was?«
II
Die oberen Stockwerke des Sanatoriums sahen nicht mehr aus wie ein Hotel; sie waren ein Krankenhaus. Lillian Dunkerque blieb vor dem Zimmer stehen, in dem Agnes Somerville gestorben war. Sie hörte Stimmen und Lärm und öffnete die Tür.
Der Sarg war nicht mehr da. Die Fenster standen offen, und zwei Putzfrauen waren dabei, das Zimmer zu scheuern. Wasser planschte am Boden, es roch nach Lysol und Seife, die Möbel waren umgekehrt, und das elektrische Licht stach grell in jeden Winkel des Raumes.
Lillian glaubte einen Augenblick in ein falsches Zimmer gekommen zu sein. Dann sah sie, hoch auf einen Schrank geworfen, den kleinen Plüschbären, der die Maskotte der Toten gewesen war. »Hat man sie schon abgeholt?« fragte sie.
Eine der Putzfrauen richtete sich auf. »Sie ist auf Nummer sieben gebracht worden. Wir müssen hier saubermachen. Morgen früh kommt schon eine Neue.«
»Danke.«
Lillian schloß die Tür. Sie kannte Nummer sieben; es war ein kleines Zimmer neben dem Gepäckaufzug. Die Toten wurden dahin gebracht, weil sie von da leicht nachts mit dem Aufzug nach unten zu schaffen waren. Wie Koffer, dachte Lillian. Und hinter ihnen wusch man mit Seife und Lysol ihre letzten Spuren fort.
In Zimmer sieben brannte kein Licht. Es waren auch keine Kerzen mehr da. Der Sarg war bereits geschlossen. Man hatte den Deckel über das schmale Gesicht und das leuchtende, rote Haar gestülpt und ihn zugeschraubt. Alles war vorbereitet zum Transport. Die Blumen waren vom Sarg genommen worden; sie lagen in einem Stück Wachstuch auf einem Tisch nebenan. Das Wachstuch hatte Ringe mit Schnüren, so daß man die Blumen mit einem Griff transportieren konnte. Die Kränze lagen daneben, übereinandergeschichtet, wie Hüte in einem Hutgeschäft. Die Vorhänge waren nicht zugezogen, und die Fenster standen offen. Es war sehr kalt im Zimmer. Der Mond schien hinein.
Lillian war gekommen, um die Tote noch einmal zu sehen. Es war zu spät. Niemand würde das blasse Gesicht und das leuchtende Haar, das einmal Agnes Somerville gewesen war, jemals wieder sehen. Man würde den Sarg diese Nacht heimlich hinunterbringen und ihn auf einem Schlitten zum Krematorium transportieren. Dort würde er unter dem plötzlichen Ansturm des Feuers zu brennen beginnen, das rote Haar würde noch einmal knistern und Funken sprühen, der starre Körper würde sich in den Flammen noch einmal aufbäumen, als wäre er wieder lebendig geworden – und dann würde alles zusammensinken zu Asche und Nichts und ein bißchen fahler Erinnerung.
Lillian blickte auf den Sarg. Wenn sie noch lebte! dachte sie plötzlich. Konnte es nicht sein, daß sie noch einmal zu sich gekommen war in diesem unerbittlichen Kasten? Gab es das nicht manchmal? Wer wußte denn, wie oft das geschah? Man kannte nur die wenigen Fälle, in denen Scheintote gerettet worden waren, aber wer wußte, wie viele schweigend erstickt waren, die man nie gefunden hatte? Konnte es nicht sein, daß Agnes Somerville jetzt, gerade jetzt, in der engen Dunkelheit der raschelnden Seide zu schreien versuchte, mit vertrockneter Kehle, ohne einen Laut hervorbringen zu können?
Ich bin verrückt, dachte Lillian; was denke ich da? Ich hätte nicht hierhergehen sollen! Warum habe ich es getan? Aus Sentimentalität? Aus Verwirrung? Oder aus dieser entsetzlichen Neugier heraus, noch einmal in ein totes Gesicht zu starren wie in einen Abgrund, dem man vielleicht doch noch eine Antwort entreißen kann? Licht, dachte sie, ich muß Licht machen!
Sie ging zur Tür zurück; aber plötzlich blieb sie stehen und lauschte. Sie glaubte ein Knistern gehört zu haben, sehr leise, aber deutlich, als kratzten Nägel auf Seide. Rasch drehte sie den Schalter an. Das scharfe Licht der ungeschützten Lampe an der Decke trieb die Nacht, den Mond und das Entsetzen zurück. Ich höre Gespenster, dachte sie. Es war mein eigenes Kleid. Es waren meine eigenen Nägel. Es war nicht ein müder, letzter Rest von Leben, der sich noch einmal geregt hat.
Sie starrte wieder auf den Sarg, der jetzt im grellen Licht stand. Nein – dieser schwarze, polierte Kasten mit den Bronzegriffen enthielt kein Leben mehr. Im Gegenteil – in ihm war die finsterste Drohung eingeschlossen, die die Menschheit kannte. Es war nicht mehr Agnes Somerville, ihre Freundin, die in ihrem goldenen Kleide regungslos, mit gestocktem Blut und zerfallenden Lungen in ihm lag – es war auch nicht mehr das wächserne Abbild eines Menschen, in dem die eingeschlossenen Säfte langsam begannen, es zu zerstören, – nein, in diesem Kasten lauerte nur noch das absolute Nichts, der Schatten ohne Schatten, das unbegreifliche Nichts mit dem ewigen Hunger nach dem anderen Nichts, das in allem Leben wohnte und wuchs, das mit einem geboren wurde und das auch in ihr, Lillian Dunkerque, war und schweigend wuchs und Tag um Tag ihres Lebens fraß, bis nur es allein noch da sein würde, und man seine Hülle ebenso wie diese hier in eine schwarze Kiste packen würde zu Abfall und Zerfall.
Sie griff hinter sich nach der Türklinke. Im Augenblick, als sie sie berührte, drehte sich die Klinke scharf in ihrer Hand. Sie unterdrückte einen Schrei. Die Tür öffnete sich. Vor Lillian stand ein überraschter Hausknecht und starrte sie an. »Was ist los?« stotterte er. »Wo kommen Sie her?« Er blickte an ihr vorbei ins Zimmer, in dem die Vorhänge im Zugwind flatterten. »Es war doch abgeschlossen! Wie sind Sie hereingekommen? Wo ist der Schlüssel?«
»Es war nicht abgeschlossen.«
»Dann muß jemand –« Der Hausknecht sah auf die Tür. »Da steckt er ja!« Er wischte sich über das Gesicht. »Wissen Sie, einen Moment dachte ich –«
»Was?«
Er deutete auf den Sarg. »Ich dachte, Sie wären es und –«
»Ich bin es ja«, flüsterte Lillian.
»Was?«
»Nichts.«
Der Mann trat einen Schritt in das Zimmer. »Sie verstehen mich nicht. Ich dachte, Sie wären die Tote. So was! Dabei habe ich doch schon allerhand mitgemacht!« Er lachte. »Das nennt man einen Schreck in der Nachtstunde! Was machen Sie denn hier! Nummer achtzehn ist doch schon zugeschraubt.«
»Wer?«
»Nummer achtzehn. Ich weiß den Namen nicht. Ist ja auch nicht nötig. Wenn’s soweit ist, nützt der schönste Name nichts mehr.« Der Hausknecht drehte das Licht ab und schloß die Tür. »Freuen Sie sich, daß Sie es nicht sind, Fräulein«, sagte er gutmütig.
Lillian kramte Geld aus ihrer Tasche hervor. »Hier ist etwas für den Schreck, den ich Ihnen bereitet habe.«
Der Hausknecht salutierte und rieb sich die Bartstoppeln. »Herzlichen Dank! Ich werde es mit meinem Kollegen Josef teilen. Nach einem so traurigen Geschäft schmeckt ein Bier mit Korn immer besonders gut. Nehmen Sie es sich nicht zu sehr zu Herzen, Fräulein. Einmal müssen wir alle dran glauben.«
»Ja«, erwiderte Lillian. »Das ist ein Trost. Ein wirklich wunderbarer Trost ist das, nicht wahr?«
Sie stand in ihrem Zimmer. Die Zentralheizung summte. Alle Lichter brannten. Ich bin verrückt, dachte sie. Ich habe Angst vor der Nacht. Ich habe Angst vor mir selbst. Was soll ich tun? Ich kann ein Schlafmittel nehmen und das Licht brennen lassen. Ich kann Boris anrufen und mit ihm sprechen. Sie hob die Hand nach dem Telefon, aber sie nahm den Hörer nicht ab. Sie wußte, was er ihr sagen würde. Sie wußte auch, daß er recht haben würde; aber was nützte es, wenn man wußte, daß man recht hatte? Der Mensch hatte sein bißchen Vernunft, um zu erkennen, daß er nach ihr allein nicht leben konnte. Man lebte von Gefühlen, – und bei denen half Recht nicht.
Sie hockte sich in einen Sessel am Fenster. Ich bin vierundzwanzig Jahre alt, dachte sie, ebenso alt wie Agnes. Vier Jahre bin ich hier oben. Davor war fast sechs Jahre lang Krieg. Was kenne ich vom Leben? Zerstörung, die Flucht aus Belgien, Tränen, Angst, den Tod meiner Eltern, Hunger, und dann die Krankheit durch den Hunger und die Flucht. Davor war ich ein Kind. Ich erinnere mich kaum noch daran, wie Städte im Frieden nachts einmal ausgesehen haben müssen. Die tausend Lichter und die strahlende Welt der Straßen – was weiß ich noch davon? Ich kenne nur noch Verdunkelungen und den Bombenregen aus dem lichtlosen Dunkel, und dann Okkupationen und Furcht und Verstecken und Kälte. Glück? Wie war dieses endlose Wort, das einst in Träumen so geglänzt hatte, zusammengeschrumpft! Ein Zimmer ohne Heizung war bereits Glück gewesen, ein Brot, ein Keller, ein Platz, der nicht beschossen wurde. Dann war das Sanatorium gekommen. Sie starrte aus dem Fenster. Unten stand ein Schlitten neben dem Eingang für Lieferanten und Dienstboten. Vielleicht war es schon der Schlitten für Agnes Somerville. Vor einem Jahr war sie lachend mit Pelzen und Blumen am Haupteingang des Sanatoriums angekommen; jetzt verließ sie das Haus heimlich durch den Dienstboteneingang, als hätte sie ihre Rechnung nicht bezahlt. Vor sechs Wochen hatte sie mit Lillian noch Pläne gemacht für die Abreise. Die Abreise, das Phantom, die Fata Morgana, die nie kam.
Das Telefon klingelte. Sie zögerte, dann hob sie es ab. »Ja, Boris.« Sie lauschte. »Ja, Boris. Ja, ich bin vernünftig, – ja, ich weiß, daß viel mehr Menschen an Herzschlag und Krebs sterben – ich habe die Statistiken gelesen, Boris, ja, – ich weiß, daß es uns nur so scheint, weil wir hier oben so eng zusammen hausen, – ja, viele werden geheilt, ja, ja, – die neuen Mittel, ja, Boris, ich bin vernünftig, bestimmt, – nein, komm nicht, – ja, ich liebe dich, Boris, natürlich –«
Sie legte den Hörer auf. »Vernünftig«, flüsterte sie und starrte in den Spiegel, aus dem ihr Gesicht zurückstarrte, fremd, mit fremden Augen – »vernünftig!« Mein Gott, dachte sie, ich bin viel zu lange vernünftig gewesen! Wozu? Um Nummer zwanzig oder dreißig in Zimmer sieben neben dem Gepäckaufzug zu werden? Etwas in einem schwarzen Kasten, vor dem einem graute?
Sie sah auf die Uhr. Es war kurz vor neun. Die Nacht lag dunkel und endlos vor ihr, voll mit Panik und Langeweile, dieser entsetzlichen Mischung, die das Kennzeichen der Sanatorien war, – der Panik vor der Krankheit und der Langeweile des reglementierten Daseins, die zusammen unerträglich wurden, weil der Kontrast zu nichts anderem führte als zu einem intensiven Gefühl völliger Hilflosigkeit.
Lillian stand auf. Nur jetzt nicht allein bleiben! Es mußten noch ein paar Leute unten sein, – Hollmann zumindest und sein Besuch.
Im Speisezimmer saßen außer Hollman und Clerfayt noch drei Südamerikaner, zwei Männer und eine ziemlich dicke, kleine Frau. Alle drei waren schwarzgekleidet; alle drei schwiegen. Sie hockten wie kleine, schwarze Hügel in der Mitte des Raumes unter der hellen Lampe.
»Sie kommen aus Bogotá«, sagte Hollmann. »Man hat ihnen telegrafiert. Die Tochter des Mannes mit der Hornbrille lag im Sterben. Aber seit sie hier sind, geht es dem Mädchen plötzlich besser. Jetzt wissen sie nicht, was sie tun sollen – zurückfliegen oder hierbleiben.«
»Warum bleibt die Mutter nicht hier, und die andern fliegen zurück?«
»Die dicke Frau ist nicht die Mutter. Sie ist die Stiefmutter; sie hat das Geld, von dem Manuela hier lebt. Keiner will eigentlich hier bleiben; auch nicht der Vater. Sie hatten drüben Manuela fast vergessen. Sie schickten regelmäßig den Scheck und lebten in Bogotá, und Manuela lebte hier – seit fünf Jahren – und schrieb monatlich einen Brief. Der Vater und die Stiefmutter haben längst Kinder, die Manuela nicht kennt. Alles war gut, – bis sie so lästig wurde zu sterben. Da mußte man natürlich kommen, der Reputation wegen. Die Frau wollte den Mann nicht allein fliegen lassen. Sie ist älter als er und eifersüchtig, und sie weiß, daß sie zu dick ist. Zur Verstärkung nahm sie deshalb ihren Bruder mit. Man hatte in Bogotá ohnehin schon darüber geredet, daß sie Manuela aus dem Hause gedrängt habe; jetzt will sie zeigen, daß sie sie liebt. Es ist also nicht nur eine Sache der Eifersucht, sondern auch eine des Prestiges. Wenn sie allein zurückflöge, würde das Gerede wieder beginnen. So sitzen sie da und warten.«
»Und Manuela?«
»Der Vater und die Stiefmutter liebten sie heiß, als sie ankamen, weil sie ja jede Stunde sterben sollte. Die arme Manuela, die nie Liebe gekannt hatte, war dadurch so beglückt, daß sie begann sich zu erholen. Jetzt sind die Eltern bereits ungeduldig. Außerdem werden sie jeden Tag dicker, weil sie nervösen Hunger haben und sich mit dem berühmten Konfekt des Ortes voll stopfen. In einer Woche werden sie Manuela hassen, weil sie nicht schnell genug stirbt.«
»Oder sie werden sich an das Dorf gewöhnen, das Konfektgeschäft kaufen und sich hier niederlassen«, sagte Clerfayt.
Hollmann lachte. »Du hast eine makabre Phantasie.«
»Im Gegenteil. Nur makabre Erfahrungen. Aber woher weißt du all das?«
»Ich habe dir doch schon gesagt, daß es hier keine Geheimnisse gibt. Schwester Cornelia Wehrli spricht Spanisch und ist die Vertraute der Stiefmutter.«
Die drei schwarzen Gestalten standen auf. Sie hatten kein Wort miteinander gesprochen. Mit feierlicher Würde schritten sie hintereinander zur Tür.
Sie stießen fast mit Lillian Dunkerque zusammen, die so rasch hereinkam, daß die dicke Frau erschrak und mit einem hohen Vogelschrei zur Seite wich. Lillian ging eilig an den Tisch zu Hollmann und Clerfayt und sah sich dann nach der Frau um. »Was schreit sie denn?« flüsterte sie. »Ich bin doch kein Gespenst! Oder doch? Schon?« Sie suchte nach ihrem Spiegel. »Ich scheine heute abend jeden Menschen zu erschrecken.«
»Wen sonst?« fragte Hollmann.
»Den Hausknecht.«
»Was? Josef?«
»Nein, den andern, der Josef hilft. Sie wissen schon –«
Hollmann nickte. »Uns erschrecken Sie nicht, Lillian.«
Sie steckte den Spiegel weg. »War das Krokodil schon hier?«
»Nein. Es muß aber jeden Augenblick kommen und uns rauswerfen. Es ist pünktlich wie ein preußischer Feldwebel.«
»Josef ist an der Tür heute nacht. Ich habe mich erkundigt. Wir können raus. Kommen Sie mit?«
»Wohin? In die Palace Bar?«
»Wohin sonst?«
»In der Palace Bar ist nichts los«, sagte Clerfayt. »Ich komme gerade daher.«
Hollmann lachte. »Für uns ist immer genug los. Selbst wenn kein Mensch da ist. Alles außerhalb des Sanatoriums ist für uns bereits aufregend. Man wird hier bescheiden.«
»Wir können jetzt durchschlüpfen«, sagte Lillian Dunkerque. »Außer Josef paßt niemand auf. Der andere Hausknecht ist noch beschäftigt.«
Hollmann hob die Schultern. »Ich habe etwas Temperatur, Lillian. Plötzlich, heute abend – weiß der Teufel, warum! Vielleicht, weil ich den schmutzigen Sportwagen Clerfayts wieder gesehen habe.«
Eine Putzfrau kam herein und begann, die Stühle auf die Tische zu stellen, um aufzuwischen. »Wir sind auch schon mit Fieber ausgerissen«, sagte Lillian.
Hollmann sah sie verlegen an. »Ich weiß. Aber heute nicht, Lillian.«
»Auch wegen des schmutzigen Sportwagens?«
»Vielleicht. Wie ist es mit Boris? Will er nicht mit?«
»Boris glaubt, ich schliefe. Ich habe ihn schon heute nachmittag gezwungen, mit mir auszufahren. Er würde es nicht noch einmal tun.«
Die Putzfrau zog die Vorhänge auf. Gewaltig und feindlich stand die Landschaft auf einmal vor dem Fenster, – die mondbeschienenen Hänge, der schwarze Wald, der Schnee. Die drei Menschen wirkten verloren dagegen. Die Putzfrau begann, die Lichter an den Wänden auszulöschen. Mit jedem gelöschten Licht schien die Landschaft einen Schritt weiter gegen die Menschen im Zimmer vorzurücken. »Da ist das Krokodil«, sagte Hollmann.
Die Oberschwester stand in der Tür. Sie lächelte mit starkem Gebiss und kalten Augen. »Die Nachtschwärmer, wie immer! Feierabend, meine Herrschaften!« Sie sagte nichts darüber, daß Lillian Dunkerque noch auf war. »Feierabend«, wiederholte sie. »Zu Bett! Zu Bett! Morgen ist auch noch ein Tag!«
Lillian stand auf. »Sind Sie dessen so sicher?«
»Ganz sicher«, erwiderte die Oberschwester mit deprimierender Fröhlichkeit. »Für Sie liegt ein Schlafmittel auf Ihrem Nachttisch, Miss Dunkerque. Sie werden ruhen wie in Morpheus’ Armen!«
»Wie in Morpheus’ Armen!« wiederholte Hollmann mit Abscheu, als sie gegangen war. »Das Krokodil ist die Königin der Klischees. Heute abend war sie noch gnädig. Warum müssen diese Polizistinnen der Gesundheit jeden Menschen, wenn er in ein Hospital kommt, mit dieser entsetzlich geduldigen Überlegenheit behandeln, als wäre er ein Kind oder ein Kretin?«
»Es ist die Rache für ihren Beruf«, erwiderte Lillian böse. »Wenn Kellner und Krankenschwestern das nicht hätten, stürben sie an Minderwertigkeitskomplexen.«
Sie standen in der Halle vor dem Aufzug. »Wohin gehen Sie jetzt?« fragte Lillian Clerfayt.
Er sah sie an. »Zur Palace Bar.«
»Nehmen Sie mich mit?«
Er zögerte einen Augenblick. Er hatte gewisse Erfahrungen mit überspannten Russinnen. Auch mit Halbrussinnen. Aber dann erinnerte er sich an die Szene mit dem Schlitten und an das hochmütige Gesicht Wolkows. »Warum nicht?« sagte er.
Sie lächelte ein hilfloses Lächeln. »Ist es nicht trostlos? Man bittet um ein bißchen Freiheit wie ein Trunkenbold einen abweisenden Barmixer um ein letztes Glas. Ist das nicht erbärmlich?«
Clerfayt schüttelte den Kopf. »Ich habe das oft genug selbst getan.«
Sie sah ihn zum ersten Male voll an. »Sie?« fragte sie. »Warum Sie?«
»Jeder hat Gründe. Sogar ein Stein. Wo soll ich Sie abholen? Oder wollen Sie gleich mitkommen?«
»Nein. Sie müssen durch den Haupteingang hinausgehen. Das Krokodil paßt dort auf. Gehen Sie dann die erste Serpentine herunter, nehmen Sie dort einen Schlitten, und fahren Sie rechts hinter das Sanatorium zum Eingang für Lieferanten und Dienstboten. Ich komme da heraus.«
»Gut.«
Lillian stieg in den Aufzug. Hollmann wandte sich zu Clerfayt. »Es macht dir doch nichts, daß ich heute abend nicht mitkomme?«
»Natürlich nicht. Ich fahre ja morgen noch nicht weg.«
Hollmann blickte ihn forschend an. »Und Lillian? Wärst du lieber allein geblieben?«
»Auf keinen Fall. Wer will schon allein bleiben?«
Clerfayt ging durch die leere Halle hinaus. Nur ein kleines Licht brannte noch neben der Tür. Durch die großen Fenster fiel das Mondlicht in breiten Rhomben auf den Fußboden. Neben der Tür stand das Krokodil. »Gute Nacht«, sagte Clerfayt.
»Good night«, erwiderte sie, und er konnte sich nicht vorstellen, warum sie auf einmal Englisch sprach.
Er ging die Serpentinen hinunter, bis er einen Schlitten fand. »Können Sie das Verdeck schließen?« fragte er den Kutscher.
»Heute nacht? Es ist doch nicht mehr so kalt!«
Clerfayt wollte Lillian nicht in einen offenen Schlitten setzen, aber er hatte auch keine Lust zu Argumenten. »Für Sie nicht, für mich schon. Ich komme aus Afrika«, erwiderte er. »Können Sie also den Schlitten schließen?«
»Das ist was anderes.« Der Kutscher kletterte umständlich von seinem Bock und klappte das Verdeck hoch. »Geht es so?«
»Ja. Fahren Sie jetzt bitte zum Sanatorium Bella Vista zurück; – zum Hintereingang.«
Lillian Dunkerque wartete bereits. Sie hatte einen dünnen, schwarzen Pelz aus Breitschwanz um sich gezogen. Clerfayt hätte sich nicht gewundert, wenn sie in einem Abendkleid ohne Mantel gekommen wäre. »Es hat alles geklappt«, flüsterte sie. »Ich habe Josefs Schlüssel. Er bekommt eine Flasche Kirsch dafür.«
Clerfayt half ihr in den Schlitten. »Wo ist Ihr Wagen?« fragte sie.
»Er wird gewaschen.«
Sie lehnte sich in das Dunkel des Verdecks zurück, als der Schlitten wendete und am Haupteingang des Sanatoriums vorbeifuhr. »Haben Sie den Wagen heute abend Hollmanns wegen nicht heraufgebracht?« fragte sie nach einer Weile.
Er sah sie an. »Warum Hollmanns wegen?«
»Damit er ihn nicht sieht. Um ihn zu schonen.«
Es stimmte. Clerfayt hatte gemerkt, daß der Anblick Giuseppes Hollmann zu sehr aufgeregt hatte. »Nein«, erwiderte er. »Der Wagen mußte nur dringend gewaschen werden.«
Er holte ein Päckchen Zigaretten heraus. »Geben Sie mir auch eine«, sagte Lillian.
»Dürfen Sie rauchen?«
»Natürlich«, erwiderte sie so schroff, daß er sofort spürte, es sei nicht wahr.
»Ich habe nur Gauloises. Schwarzen, schweren Tabak der Fremdenlegion.«
»Ich kenne sie. Wir haben sie während der Okkupation geraucht.«
»In Paris?«
»In einem Keller in Paris.«
Er gab ihr Feuer. »Woher sind Sie heute gekommen?« fragte sie. »Aus Monte Carlo?«
»Nein, aus Vienne.«
»Vienne? In Österreich?«
»Vienne bei Lyon. Sie kennen es sicher nicht. Es ist ein verschlafenes Städtchen, dessen einziger Ruhm darin besteht, eines der besten Restaurants Frankreichs zu besitzen – das Hotel de la Pyramide.«
»Sind Sie über Paris gekommen?«
»Das wäre ein zu großer Umweg gewesen. Paris liegt viel weiter im Norden.«
»Wie sind Sie gefahren?«
Clerfayt wunderte sich, warum sie das so genau wissen wollte. »Die übliche Route«, sagte er. »Über Belfort und Basel. Ich hatte noch etwas in Basel zu tun.«
Lillian schwieg eine Weile. »Wie war es?« fragte sie dann.
»Was? Die Fahrt? Langweilig. Grauer Himmel und flaches Land, bis man an die Alpen kommt.«
Er hörte sie im Dunkeln atmen. Dann sah er im vorübergleitenden Licht eines Ladens mit Uhren ihr Gesicht. Es hatte einen merkwürdigen Ausdruck von Erstaunen, Spott und Schmerz. »Langweilig?« sagte sie. »Flaches Land? Mein Gott, was ich darum geben würde, einmal keine Berge mehr sehen zu müssen.«
Er begriff plötzlich, warum sie ihn so eingehend gefragt hatte. Für die Kranken hier oben waren die Berge Mauern, die ihre Freiheit beschränkten. Sie gaben ihnen den leichten Atem und die Hoffnung; aber sie konnten sie nicht verlassen. Ihre Welt war auf dieses Hochtal beschränkt, und deshalb war jede Nachricht von unten eine Nachricht aus dem verlorenen Paradies.
»Wie lange sind Sie schon hier?« fragte er.
»Vier Jahre.«
»Und wann können Sie wieder hinunter?«
»Fragen Sie den Dalai Lama«, erwiderte Lillian bitter. »Er verspricht es alle paar Monate – so wie bankrotte Regierungen einen Vierjahresplan nach dem anderen versprechen.«
Der Schlitten hielt an der Einfahrt zur Hauptstraße. Eine Gruppe Touristen in Skianzügen zog lärmend an ihm vorbei. Eine sehr blonde Frau in einem blauen Pullover legte ihre Arme um den Hals des Pferdes. Das Pferd schnaubte. »Come, Daisy, darling«, rief einer der Touristen. Lillian warf heftig ihre Zigarette in den Schnee. »Die Leute da zahlen eine Menge Geld, um hier heraufzukommen, – und wir würden alles geben, um wieder hinunterzukommen, – ist das nicht zum Totlachen?«
»Nein«, erwiderte Clerfayt ruhig.
Der Schlitten zog wieder an. »Geben Sie mir noch eine Zigarette«, sagte Lillian.
Clerfayt hielt ihr das Paket hin. »Sie verstehen das alles sicher nicht«, murmelte sie. »Daß man sich hier wie in einem Gefangenenlager fühlen kann. Nicht wie in einem Gefängnis; da weiß man wenigstens, wann man herauskommt. Wie in einem Lager, wo es kein Urteil gibt.«
»Ich verstehe es«, sagte Clerfayt. »Ich war selbst in einem.«
»Sie? In einem Sanatorium?«
»In einem Gefangenenlager. Im Kriege. Aber bei uns war es gerade umgekehrt.« Er lächelte. »Wir waren im flachen Moor eingesperrt, und die Schweizer Berge waren für uns der Traum der Freiheit. Wir konnten sie vom Lager aus sehen. Einer von uns, der aus dieser Gegend hier kam, machte uns fast verrückt mit seinen Erzählungen. Hätte man uns damals die Entlassung angeboten, wenn wir uns dafür verpflichtet hätten, einige Jahre in diesen Bergen zu leben, ich glaube, viele hätten das angenommen. Auch zum Totlachen, wie?«
»Nein. Hätten Sie es auch angenommen?«
»Ich hatte einen Plan zu fliehen.«
»Wer hätte den nicht? Sind Sie geflohen?«
»Ja.«
Lillian beugte sich vor. »Sind Sie entkommen? Oder wieder gefangen worden?«
»Entkommen. Ich wäre sonst nicht hier. Es gab nichts dazwischen.«
»Und der andere Mann?« fragte sie nach einer Weile. »Der, der immer von den Bergen hier erzählte?«
»Er starb an Typhus im Lager. Eine Woche bevor es befreit wurde.«
Der Schlitten hielt vor dem Hotel. Clerfayt sah, daß Lillian keine Überschuhe trug. Er hob sie heraus, trug sie über den Schnee und setzte sie vor dem Eingang nieder. »Ein Paar Seidenschuhe gerettet«, sagte er. »Wollen Sie wirklich in die Bar?«
»Ja. Ich brauche etwas zu trinken.«
In der Bar stampften Skiläufer in schweren Schuhen auf der Tanzfläche herum. Der Kellner schob einen Tisch in einer Ecke zurecht. »Wodka?« fragte er Clerfayt.
»Nein. Etwas Heißes. Glühwein oder Grog.« Clerfayt sah Lillian an. »Was von beiden?«
»Wodka. Haben Sie den nicht vorher auch getrunken?«
»Ja. Aber vor dem Essen. Einigen wir uns auf etwas, was die Franzosen den lieben Gott in Samthosen nennen. Einen Bordeaux.«
Er sah, daß sie ihn mißtrauisch musterte. Wahrscheinlich glaubte sie, er wolle sie als Kranke behandeln und sie schonen. »Ich beschwindele Sie nicht«, sagte er. »Ich würde den Wein auch bestellen, wenn ich jetzt allein hier wäre. Wodka können wir morgen vor dem Essen trinken, soviel Sie wollen. Wir werden eine Flasche ins Sanatorium schmuggeln.«
»Gut. Dann lassen Sie uns den Wein trinken, den Sie gestern abend unten in Frankreich gehabt haben – im Hotel de la Pyramide in Vienne.«
Clerfayt war überrascht, daß sie die Namen behalten hatte. Man muß achtgeben bei ihr, dachte er; wer sich Namen so gut merkt, merkt sich auch anderes. »Es war ein Bordeaux«, sagte er, »ein Lafite Rothschild.«
Es war nicht wahr. Er hatte in Vienne einen leichten Wein der Region getrunken, der nicht ausgeführt wurde; aber es war unnötig, das zu erklären. »Bringen Sie uns einen Château Lafite 1937, wenn Sie ihn haben«, sagte er dem Kellner. »Und wärmen Sie ihn nicht mit einer heißen Serviette an. Bringen Sie ihn lieber so, wie er im Keller liegt.«
»Wir haben ihn chambré, mein Herr.«
»Welch ein Glück!«
Der Kellner ging zur Bar und kam zurück. »Sie werden am Telefon verlangt, Herr Clerfayt.«
»Von wem?«
»Das weiß ich nicht, mein Herr. Soll ich fragen?«
»Das Sanatorium!« sagte Lillian nervös. »Das Krokodil!«
»Das werden wir gleich herausfinden.« Clerfayt stand auf. »Wo ist die Kabine?«
»Draußen, rechts neben der Tür zur Bar.«
»Bringen Sie inzwischen den Wein. Machen Sie die Flasche auf, und lassen Sie ihn atmen.«
»War es das Krokodil?« fragte Lillian, als er zurückkam.
»Nein. Es war ein Anruf aus Monte Carlo.« Clerfayt zögerte einen Moment, aber als er ihr Gesicht aufleuchten sah, dachte er, es könne ihr nicht schaden zu hören, daß auch anderswo Menschen stürben. »Aus dem Hospital in Monte Carlo«, sagte er. »Ein Bekannter von mir ist gestorben.«
»Müssen Sie zurück?«
»Nein. Es ist da nichts weiter zu tun. Ich glaube sogar, daß es ein Glück für ihn war.«
»Ein Glück?«
»Ja. Er ist beim Rennen gestürzt und wäre ein Krüppel geblieben.«
Lillian starrte ihn an. Sie glaubte, nicht richtig gehört zu haben. Was redete dieser gesunde Eindringling da für barbarischen Unsinn? »Denken Sie nicht, daß auch Krüppel manchmal noch gerne leben?« fragte sie sehr leise und plötzlich voll Hass.
Clerfayt antwortete nicht gleich. Die harte, metallische, verzweifelte Stimme der Frau, die ihn angerufen hatte, war noch in seinen Ohren: Was soll ich machen? Ferrer hat nichts hinterlassen! Kein Geld? Kommen Sie! Helfen Sie mir! Ich sitze fest! Sie sind schuld! Ihr alle seid schuld! Ihr mit euren verfluchten Rennen!
Er schüttelte es ab. »Es kommt darauf an«, sagte er zu Lillian. »Dieser Mann war sinnlos in eine Frau verliebt, die ihn mit jedem Mechaniker betrog. Und er war ein begeisterter Rennfahrer, der aber nie über den Durchschnitt hinausgekommen wäre. Alles, was er vom Leben wollte, waren Siege in großen Rennen und die Frau. Er starb, bevor er über beides die Wahrheit herausfand, – und er starb auch, ohne zu wissen, daß die Frau ihn nicht mehr sehen wollte, weil er amputiert war. Das meine ich mit Glück.«
»Vielleicht hätte er trotzdem noch gerne gelebt!«
»Das weiß ich nicht«, erwiderte Clerfayt, plötzlich irritiert. »Aber ich habe Menschen elender sterben sehen. Sie nicht auch?«
»Ja«, sagte Lillian hartnäckig. »Aber alle hätten gern noch gelebt.«
Clerfayt schwieg. Was rede ich da nur? dachte er. Und wozu? Aber rede ich nicht, um mich selbst von etwas zu überzeugen, was ich nicht glaube? Diese harte, kalte, metallische Stimme von Ferrers Freundin am Telefon!
»Niemand entkommt«, sagte er schließlich ungeduldig. »Und niemand weiß, wann und wie es ihn trifft. Wer kann da schachern um Zeit? Was ist denn ein langes Leben? Eine lange Vergangenheit. Und die Zukunft reicht immer nur bis zum nächsten Atemzug. Oder bis zum nächsten Rennen. Darüber hinaus weiß man nichts.« Er hob sein Glas. »Wollen wir darauf trinken?«
»Worauf?«
»Auf nichts. Auf ein bißchen Courage vielleicht.«
»Ich bin der Courage müde«, sagte Lillian. »Und des Trostes auch. Erzählen Sie mir lieber, wie es unten aussieht. Auf der anderen Seite der Berge.«
»Trostlos. Nichts als Regen. Seit Wochen.«
Sie stellte ihr Glas langsam auf den Tisch zurück. »Regen!« Sie sagte es, als sagte sie: Leben. »Hier hat es seit Oktober nicht mehr geregnet. Nur geschneit. Ich habe schon fast vergessen, wie Regen aussieht –«
Es schneite, als sie herauskamen. Clerfayt pfiff einen Kutscher heran.
Sie fuhren die Serpentinen hinauf. Die Glocken des Pferdegeschirrs läuteten. Die Straße war still in der wirbelnden Dunkelheit. Nach einer Weile hörten sie vom Berg her ein zweites Geschirr läuten. Der Kutscher hielt an einer Ausweichstelle neben einer Laterne, um dem anderen, der von oben kam, Platz zu machen. Das Pferd stampfte und prustete. Der zweite Schlitten glitt im Schneegestöber fast lautlos an ihnen vorüber. Es war ein niedriger Transportschlitten, auf dem eine lange Kiste stand, die in schwarzes Wachstuch gehüllt war. Man sah neben der Kiste eine Zeltbahn, unter der Blumen hervorlugten, und eine zweite, die über einen Stapel Kränze geworfen war.
Der Kutscher bekreuzigte sich und trieb das Pferd wieder an. Schweigend fuhren sie die letzten Kurven hinauf und hielten vor dem Seiteneingang des Sanatoriums. Eine elektrische Birne unter einem Porzellanschirm warf einen Kreis gelben Lichtes auf den Schnee. Darin lagen ein paar abgerissene grüne Blätter. Lillian stieg aus. »Es hilft alles nichts«, sagte sie mit einem mühsamen Lächeln. »Man kann es eine Weile vergessen, – aber man kann ihm nicht entgehen.«
Sie öffnete die Tür. »Danke«, murmelte sie. »Und verzeihen Sie – ich war keine gute Gesellschaft. Aber ich konnte nicht allein sein heute abend.«
»Ich auch nicht.«
»Sie? Warum Sie nicht?«
»Aus demselben Grund wie Sie. Ich habe es Ihnen erzählt. Das Telefon aus Monte Carlo.«
»Aber Sie sagten doch, das sei ein Glück.«
»Es gibt verschiedene Arten von Glück. Und man sagt manches.« Clerfayt griff in die Tasche seines Mantels. »Hier ist der Kirsch, den Sie dem Hausknecht versprochen haben. Und hier die Flasche Wodka für Sie. Gute Nacht.«
III
Als Clerfayt erwachte, sah er einen verhangenen Himmel und hörte den Wind an den Fenstern rütteln. »Föhn«, sagte der Kellner. »Der warme Wind, der müde macht. Man fühlt ihn immer schon vorher in den Knochen. Die Bruchstellen schmerzen.«
»Sind Sie Skiläufer?«
»Nein. Bei mir sind es Kriegsverwundungen.«
»Als Schweizer?«
»Ich bin Österreicher«, sagte der Kellner. »Mit dem Skilaufen ist es bei mir aus. Ich habe nur noch einen Fuß. Aber Sie glauben nicht, wie der, der mir fehlt, bei diesem Wetter weh tut.«
»Wie ist der Schnee?«
»Unter uns gesagt: klebrig wie Honig. Nach dem Hotel-Bulletin: gut, Pulverschnee in den höheren Lagen.«
Clerfayt beschloß, das Skilaufen zu verschieben. Er war ohnehin noch müde; der Kellner schien recht zu haben mit dem Wind. Er hatte auch Kopfschmerzen. Der Kognak gestern nacht, dachte er. Warum hatte er weitergetrunken, nachdem er das sonderbare Mädchen mit seiner Mischung aus Weltschmerz und Lebensgier zum Sanatorium gebracht hatte? Merkwürdige Menschen hier oben – Menschen ohne Haut. Ich war auch einmal so ähnlich, dachte er. Vor tausend Jahren. Habe mich gründlich geändert. Mußte es. Aber was war geblieben? Was, außer etwas Zynismus, Ironie und falscher Überlegenheit? Und was kam noch? Wie lange konnte er noch Rennen fahren? War er nicht schon überfällig? Und was kam dann? Was erwartete ihn noch? Ein Posten als Autovertreter in irgendeiner Provinzstadt, – und das langsam herandämmernde Alter mit den endlosen Abenden, den schwindenden Kräften, der Erinnerung, die schmerzte, der Resignation, die zermürbte, der Schablone und dem Phantom eines Daseins, das sich in schalen Wiederholungen erschöpfte?
Der Weltschmerz steckt an, dachte er und stand auf. Mitte des Lebens, ohne Ziel und ohne Halt. Er zog seinen Mantel an und entdeckte darin einen schwarzen Samthandschuh. Er hatte ihn gestern auf dem Tisch gefunden, als er allein in die Bar zurückgekommen war. Lillian Dunkerque mußte ihn vergessen haben. Er steckte ihn in die Tasche, um ihn später im Sanatorium abzugeben.
Er war eine Stunde durch den Schnee gegangen, als er, abseits der Straße, in der Nähe des Waldes, ein kleines, quadratisches Gebäude entdeckte, das eine runde Kuppel hatte, aus der schwarzer Rauch quoll. Er blieb stehen. Eine ekelhafte Erinnerung stieg in ihm auf an etwas, das er hatte vergessen wollen und für das er einige Jahre sinnlosen Lebens verschwendet hatte, um es zu vergessen. »Was ist denn das da?« fragte er einen jungen Burschen, der vor einem Laden Schnee wegschaufelte.
»Da drüben? Das Krematorium, mein Herr.«
Clerfayt schluckte. Er hatte sich also nicht geirrt. »Hier?« sagte er. »Wozu habt ihr denn hier ein Krematorium?«
»Für die Hospitäler natürlich. Die Toten.«
»Dazu brauchen Sie ein Krematorium? Sterben denn so viele?«
Der Bursche lehnte sich auf seine Schaufel. »Jetzt nicht mehr so viele, mein Herr. Aber früher – vor dem Kriege, vor dem ersten Kriege, meine ich, und auch nachher, – da gab es hier viele Tote. Wir haben hier lange Winter, und im Winter kann man die Erde schwer aufhacken. Alles ist tief zu Stein gefroren. Ein Krematorium ist da viel praktischer. Wir haben unseres hier schon fast dreißig Jahre.«
»Dreißig Jahre? Dann hattet ihr es also schon, bevor Krematorien wirklich modern wurden, was? Lange vor dem Massenbetrieb.«
Der Bursche verstand nicht, was Clerfayt meinte. »Wir waren hier immer die ersten für etwas Praktisches, mein Herr. Es ist auch billiger. Die Leute wollen jetzt nicht mehr so viel Geld ausgeben für den Leichentransport. Früher war das anders. Da ließen viele Familien ihre Toten in versiegelten Zinksärgen in die Heimat kommen. Das waren schönere Zeiten als heute!«
»Das glaube ich.«
»Und ob! Sie müssen einmal meinen Vater davon erzählen hören! Er hat die ganze Welt so gesehen!«
»Wie?«
»Als Leichenbegleiter«, sagte der Bursche, erstaunt über soviel Unkenntnis. »Die Leute hatten damals noch Pietät, mein Herr. Sie ließen ihre Toten nicht allein reisen. Besonders nicht nach Übersee. Mein Vater kennt zum