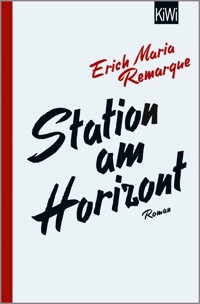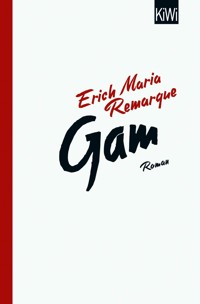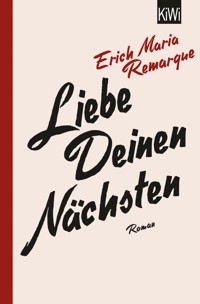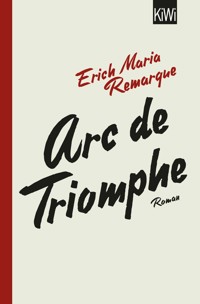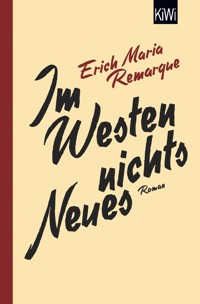11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der Weg zurück - Eine ergreifende Geschichte über die Heimkehr traumatisierter Soldaten nach dem Ersten Weltkrieg. Ende 1918: Eine Handvoll Soldaten kehrt von der Westfront in die Heimat zurück. Doch aus den einst gefeierten Helden sind Bettler geworden, für die es in der Nachkriegsgesellschaft keine Verwendung mehr gibt. Die einstige Kriegsbegeisterung ist in Verachtung und Feindseligkeit umgeschlagen. In Der Weg zurück, der Fortsetzung des Klassikers Im Westen nichts Neues, schildert Erich Maria Remarque eindringlich die Schwierigkeiten der Soldaten bei der Rückkehr in ein ziviles Leben. Mit psychologischem Feingefühl zeigt er, wie die Kriegserlebnisse die Männer geprägt haben und wie sie darum ringen, wieder in der Gesellschaft Fuß zu fassen. Remarques zeitloser Roman ist ein ergreifendes Porträt einer Generation, die vom Krieg gezeichnet wurde, und ein eindringliches Plädoyer gegen das Vergessen. Der Weg zurück ist ein Muss für alle Leser, die sich für die Folgen des Ersten Weltkriegs und die Weimarer Republik interessieren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 411
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Erich Maria Remarque
Der Weg zurück
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Erich Maria Remarque
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Erich Maria Remarque
Erich Maria Remarque, 1898 in Osnabrück geboren, besuchte das katholische Lehrerseminar. 1916 als Soldat eingezogen, wurde er nach dem Krieg zunächst Aushilfslehrer, später Gelegenheitsarbeiter, schließlich Redakteur in Hannover und ab 1924 in Berlin. 1932 verließ Remarque Deutschland, lebte zunächst im Tessin/Schweiz. Seine Bücher Im Westen nichts Neues und Der Weg zurück wurden 1933 von den Nazis verbrannt, er selber 1938 ausgebürgert. Ab 1941 lebte Remarque offiziell in den USA, erlangte 1947 die amerikanische Staatsbürgerschaft. 1970 starb er in seiner Wahlheimat Tessin.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
November 1918: endlich Frieden. Von Frankreich aus treten ein paar Frontsoldaten den Rückzug in die Heimat, den Weg ins Leben an. In Deutschland tobt die Revolution, von der Begeisterung, mit der man sie vor Jahren in den Kampf fürs Vaterland schickte, ist nichts geblieben. Stattdessen schlagen den ehemaligen Helden Unverständnis, Gleichgültigkeit und offene Verachtung entgegen. Sie fühlen sich fremd und überflüssig, verzweifelt suchen sie nach einem Sinn: »Unsere Ideale sind bankrott, unsere Träume kaputt.« Geblieben ist nur die Kameradschaft, aber selbst die bröckelt nach und nach.
Spannend, zuweilen witzig, mit autobiografischen Zügen malt Remarque das Bild einer »Jugend, die starb, bevor sie zu leben beginnen konnte«. Der Krieg wird sie nie loslassen, ihre Illusionen sind zerstört, Unbelehrbare schreien schon wieder »Front Heil!«. Und doch sind Mut und Tatkraft nicht völlig geschwunden, keimt der Wille, »auszugraben, was verschüttet worden ist in den Jahren der Granaten und der Maschinengewehre.«
Der Weg zurück ist die konsequente Fortsetzung des von Millionen gelesenen Klassikers Im Westen nichts Neues, der zu einem der sensationellsten und meistdiskutierten Erfolge der deutschen Literatur wurde. Das Buch wurde zusammen mit Im Westen nichts Neues 1933 von den Nazis öffentlich verbrannt.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 1931 by the Estate of the late Paulette Remarque
© 1959, 1990, 1998, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
eBook © 2012, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Covergestaltung: Philipp Starke, Hamburg
Covermotiv: Egon Schiele, Historisches Museum der Stadt Wien
Abbildung © Historisches Museum der Stadt Wien
ISBN978-3-462-30548-7
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Eingang
Erster Teil
I. Kapitel
II. Kapitel
III. Kapitel
Zweiter Teil
I. Kapitel
II. Kapitel
III. Kapitel
IV. Kapitel
V. Kapitel
Dritter Teil
I. Kapitel
II. Kapitel
III. Kapitel
IV. Kapitel
Vierter Teil
I. Kapitel
II. Kapitel
III. Kapitel
IV. Kapitel
V. Kapitel
Fünfter Teil
I. Kapitel
II. Kapitel
III. Kapitel
Sechster Teil
I. Kapitel
II. Kapitel
III. Kapitel
IV. Kapitel
V. Kapitel
Siebenter Teil
I. Kapitel
II. Kapitel
III. Kapitel
Ausgang
I. Kapitel
II. Kapitel
Nachwort von Tilman Westphalen
‣Eingang
Der Rest des zweiten Zuges liegt in einem zerschossenen Grabenstück hinter der Front und döst.
»Komische Art von Granaten –«, sagt Jupp plötzlich.
»Wieso?«, fragt Ferdinand Kosole und richtet sich halb auf.
»Hör doch!«, antwortet Jupp.
Kosole legt eine Hand hinters Ohr und lauscht. Wir horchen ebenfalls in die Nacht hinaus. Aber es ist nichts anderes zu vernehmen als das dumpfe Geräusch des Artilleriefeuers und das hohe Zwitschern der Granaten. Von rechts kommt dazu nur noch das Knarren von Maschinengewehren und ab und zu ein Schrei. Aber das kennen wir nun seit Jahren, deshalb braucht man doch nicht extra den Mund aufzumachen.
Kosole sieht Jupp bedenklich an.
»Jetzt hat’s gerade aufgehört«, verteidigt sich der verlegen.
Kosole mustert ihn noch einmal forschend. Da Jupp jedoch ruhig bleibt, wendet er sich ab und brummt nur: »Dir zischt der Kohldampf im Bauch, das sind deine Granaten. Solltest lieber ein Auge voll Schlaf nehmen.«
Dabei klopft er aus Erde eine Kopfstütze zurecht und streckt sich vorsichtig so aus, dass seine Stiefel nicht ins Wasser rutschen können. »Mensch, zu Hause hat man nun ’ne Frau und ein zweischläfriges Bett«, murmelt er, schon mit geschlossenen Augen.
»Wird schon einer dabei liegen«, gibt Jupp aus seiner Ecke zurück.
Kosole öffnet ein Auge und wirft ihm einen scharfen Blick zu. Er sieht aus, als wollte er doch noch aufstehen. Dann aber knurrt er: »Möcht ich ihr nicht raten, du Rheineule.« Gleich darauf schnarcht er bereits.
Jupp macht mir ein Zeichen, zu ihm herüberzuklettern. Ich steige über Adolf Bethkes Stiefel und setze mich neben ihn. Mit einem behutsamen Blick nach dem Schnarchenden bemerkt er bitter: »Keine Ahnung von Bildung hat so was, sage ich dir.«
Jupp war vor dem Kriege Schreiber bei einem Rechtsanwalt in Köln. Obwohl er schon drei Jahre Soldat ist, hat er immer noch ein empfindliches Gemüt und legt sonderbarerweise Wert darauf, hier draußen ein gebildeter Mensch zu sein. Worum es sich dabei genau handelt, weiß er selbst natürlich auch nicht; aber von allem, was er früher einmal gehört hat, ist ausgerechnet das Wort Bildung bei ihm hängen geblieben, und er klammert sich daran wie an eine Planke im Meer, um nicht unterzugehen. Jeder hat hier so irgendetwas, der eine seine Frau, der andere sein Geschäft, der Dritte seine Stiefel, Valentin Laher seinen Schnaps und Tjaden den Wunsch, noch einmal dicke Bohnen mit Speck zu fressen. Kosole hingegen wird durch das Wort Bildung ohne Weiteres gereizt. Er bringt es irgendwie mit dem Begriff Stehkragen zusammen, und das genügt ihm. Sogar jetzt wirkt es. Ohne sein Schnarchen zu unterbrechen, äußert er kurz: »Du Miststock von Schreiberseele.«
Jupp schüttelt resigniert und erhaben den Kopf. Eine Weile sitzen wir schweigend dicht nebeneinander, um uns zu wärmen. Die Nacht ist nass und kalt, Wolken ziehen, und manchmal regnet es. Dann nehmen wir die Zeltbahnen, auf denen wir hocken, und hängen sie über unsere Köpfe.
Am Horizont leuchtet das Mündungsfeuer der Geschütze. Man hat den Eindruck, es müsse dort eine weniger kalte Gegend sein, so gemütlich sieht es aus. Wie bunte und silberne Blumen steigen die Raketen über das Wetterleuchten der Artillerie hinaus. Groß und rot schwimmt der Mond in der diesigen Luft über den Ruinen einer Ferme.
»Glaubst du, dass wir nach Hause kommen?«, flüstert Jupp.
Ich zucke mit den Schultern. »Es heißt ja so. –«
Jupp atmet laut. »Ein warmes Zimmer und ein Sofa und abends ausgehen – kannst du dir das noch vorstellen?«
»Bei meinem letzten Urlaub habe ich mein Zivilzeug anprobiert«, sage ich nachdenklich, »aber es ist mir viel zu klein geworden; ich müsste neue Sachen haben.« Wie wunderlich das alles hier klingt: Zivilzeug, Sofa, Abend –. Sonderbare Gedanken kommen einem hoch dabei – wie schwarzer Kaffee, wenn er manchmal zu sehr nach dem Blech und Rost des Kochgeschirrs schmeckte und man ihn heiß und würgend wieder erbrach.
Jupp bohrt versonnen in der Nase. »Menschenskind, Schaufenster – und Cafés – und Weiber.«
»Ach, Mann, sei froh, wenn du zuerst mal aus der Scheiße hier raus bist«, sage ich und blase in meine kalten Hände.
»Hast recht.« Jupp zieht die Zeltbahn über seine mageren, krummen Schultern. »Was machst du denn, wenn du hier weg bist?«
Ich lache. »Ich? Ich werde wohl wieder zur Schule müssen. Ich und Willy und Albert – und sogar Ludwig drüben auch.« Damit zeige ich rückwärts, wo jemand vor einem zerschossenen Unterstand liegt, mit zwei Mänteln zugedeckt.
»Ach, verflucht! Aber das werdet ihr doch nicht machen?«, meint Jupp.
»Weiß ich nicht. Werden wir wohl müssen«, antworte ich und werde wütend, ohne zu wissen warum.
Unter den Mänteln regt es sich. Ein blasses, schmales Gesicht hebt sich hoch und stöhnt leise. Dort liegt mein Mitschüler, der Leutnant Ludwig Breyer, unser Zugführer. Seit Wochen hat er blutigen Durchfall, es ist zweifellos Ruhr, aber er will nicht zurück ins Lazarett. Er will lieber hier bei uns bleiben, denn wir warten alle darauf, dass es Frieden gibt, und dann können wir ihn gleich mitnehmen. Die Lazarette sind übervoll, niemand kümmert sich da recht um einen, und wenn man erst auf so einem Bett liegt, ist man gleich schon ein Stück mehr tot. Rundum krepieren die Leute, das steckt an, wenn man allein dazwischen ist, und ehe man sich’s versieht, ist man dabei. Max Weil, unser Sanitäter, hat Breyer eine Art flüssigen Gips besorgt, den frisst er, damit die Därme auszementiert werden und wieder Halt kriegen. Trotzdem lässt er den Tag so zwanzig-, dreißigmal die Hosen herunter.
Auch jetzt muss er wieder nebenan. Ich helfe ihm um die Ecke, und er hockt sich nieder.
Jupp winkt mir: »Hörst du, da ist es wieder!«
»Was denn?«
»Die Granaten von vorhin.«
Kosole rührt sich und gähnt. Dann erhebt er sich, sieht seine schwere Faust bedeutungsvoll an, schielt nach Jupp und erklärt: »Mann, wenn du uns jetzt aber wieder Fiole vorgemacht hast, kannst du deine Knochen im Rübensack nach Hause schicken.«
Wir lauschen. Das Zischen und Pfeifen der unsichtbaren Granatbögen wird unterbrochen durch einen sonderbaren, heiseren, lang gezogenen Laut, der so seltsam und neu ist, dass mir die Haut schauert.
»Gasgranaten!«, ruft Willy Homeyer und springt auf.
Wir sind alle wach und horchen angespannt.
Weßling zeigt in die Luft. »Da sind sie! Wilde Gänse!«
Vor dem trüben Grau der Wolken zieht dunkler ein Strich, ein Keil. Die Spitze steuert den Mond an, jetzt durchschneidet sie seine rote Scheibe, deutlich sind die schwarzen Schatten zu sehen, ein Winkel von vielen Flügeln, ein Zug mit quarrenden, fremden, wilden Rufen, der sich in der Ferne verliert.
»Da gehen sie hin«, knurrt Willy. »Verflucht, wer auch so abhauen könnte! Zwei Flügel, und dann weg!«
Heinrich Weßling sieht hinter den Gänsen her. »Jetzt wird’s Winter«, sagt er langsam. Er ist Bauer, er weiß so was.
Ludwig Breyer lehnt schwach und traurig an der Böschung und murmelt: »Das erste Mal, dass ich welche sehe.«
Aber am muntersten ist mit einem Schlage Kosole geworden. Er lässt sich die Sache rasch noch einmal von Weßling erklären und fragt vor allem, ob wilde Gänse so groß wie Mastgänse wären.
»Ungefähr«, sagt Weßling.
»Meine Fresse noch mal«, Kosole zittern die Kinnbacken vor Aufregung, »dann fliegen da ja jetzt so fuffzehn, zwanzig tadellose Braten durch die Luft!«
Wieder rauscht es von Flügeln dicht über uns, wieder stößt uns der raue, kehlige Ruf wie ein Habicht in die Schädel, und das Klatschen der Schwingen vereinigt sich mit den ziehenden Schreien und den Stößen des stärker werdenden Windes zu einem heftigen, ‣jähen Begriff von Freiheit und Leben.
Ein Schuss knallt. Kosole setzt die Knarre ab und späht eifrig zum Himmel. Er hat mitten in den Keil hineingehalten. Neben ihm steht Tjaden, bereit, wie ein Jagdhund loszurasen, wenn eine Gans fällt. Aber der Schwarm fliegt geschlossen weiter.
»Schade«, sagt Adolf Bethke, »das wäre der erste vernünftige Schuss in diesem Lausekrieg gewesen.«
Kosole schmeißt enttäuscht das Gewehr weg. »Wenn man doch ein paar Schrotpatronen hätte!« Er versinkt in Schwermut und Fantasien, was dann alles getan werden könnte. Unwillkürlich kaut er.
»Jawohl«, sagt Jupp, der ihn beobachtet hat, »mit Apfelmus und Bratkartoffeln, was?«
Kosole sieht ihn giftig an. »Halt die Schnauze, Schreiberseele!«
»Du hättest Flieger werden sollen«, grinst Jupp, »dann könntest du sie jetzt mit einem Netz fangen.«
»Arschloch!«, antwortet Kosole abschließend und haut sich wieder zum Schlafen hin. Es ist auch das Beste. Der Regen wird stärker. Wir setzen uns mit den Rücken gegeneinander und hängen uns die Zeltbahnen über. ‣Wie dunkle Haufen Erde hocken wir in unserem Grabenstück. Erde, Uniform und etwas Leben darunter.
Ein scharfes Flüstern weckt mich. »Vorwärts – vorwärts!«
»Was ist denn los?«, frage ich schlaftrunken.
»Wir sollen nach vorn«, knurrt Kosole und rafft seine Sachen zusammen.
»Da kommen wir ja gerade her«, sage ich verwundert.
»So ein Quatsch«, höre ich Weßling schimpfen, »der Krieg ist doch aus.«
»Los, vorwärts!« Es ist Heel selbst, unser Kompanieführer, der uns antreibt. Ungeduldig läuft er durch den Graben. Ludwig Breyer ist schon auf den Beinen. »Es hilft nichts, wir müssen raus«, sagt er ergeben und nimmt ein paar Handgranaten.
Adolf Bethke sieht ihn an. »Du solltest hier bleiben, Ludwig. Mit deiner Ruhr kannst du nicht nach vorn.« Breyer schüttelt den Kopf.
Die Koppel schnurren, die Gewehre klappern und der fahle Geruch des Todes steigt plötzlich wieder aus der Erde empor. Wir hatten gehofft, ihm schon für immer entronnen zu sein, denn wie eine Rakete war der Gedanke an Frieden vor uns hochgegangen, und wenn wir es auch noch nicht geglaubt und begriffen hatten, die Hoffnung allein war doch bereits genug gewesen, um uns in den wenigen Minuten, die das Gerücht zum Erzähltwerden brauchte, mehr zu verändern als vorher in zwanzig Monaten. Ein Jahr Krieg hat sich bisher auf das andere gelegt, ein Jahr Hoffnungslosigkeit kam zum anderen, und wenn man die Zeit nachrechnete, war die Verwunderung fast gleich groß darüber, dass es schon so lange und dass es erst so lange her war. Jetzt aber, wo bekannt geworden ist, dass der Friede jeden Tag da sein kann, hat jede Stunde tausendfaches Gewicht, und jede Minute im Feuer erscheint uns fast schwerer und länger als die ganze Zeit vorher.
Der Wind miaut um die Reste der Brustwehren, und die Wolken ziehen eilig über den Mond. Licht und Schatten wechseln immerfort. Wir gehen dicht hintereinander, eine Gruppe von Schatten, ein armseliger zweiter Zug, zusammengeschossen bis auf ein paar Mann – die ganze Kompanie hat ja kaum noch die Stärke eines normalen Zuges –, aber dieser Rest ist gesiebt. Wir haben sogar noch drei alte Leute von vierzehn hier: Bethke, Weßling und Kosole, die alles kennen und manchmal von den ersten Monaten des Bewegungskrieges erzählen, als wäre das zur Zeit der alten Deutschen gewesen.
Jeder sucht sich in der Stellung seine Ecke, sein Loch. Es ist wenig los. Leuchtkugeln, Maschinengewehre, Ratten. Willy schmeißt eine mit gut gezieltem Tritt hoch und halbiert sie in der Luft mit einem Spatenschlag.
Vereinzelte Schüsse fallen. Von rechts klingt entfernt das Geräusch explodierender Handgranaten.
»Hoffentlich bleibt’s hier ruhig«, sagt Weßling.
»Jetzt noch eins vor den Bregen kriegen –« Willy schüttelt den Kopf.
»Wer Pech hat, bricht sich den Finger, wenn er in der Nase bohrt«, brummt Valentin.
Ludwig liegt auf einer Zeltbahn. Er hätte wirklich hinten bleiben können. Max Weil gibt ihm ein paar Tabletten zum Einnehmen. Valentin redet auf ihn ein, Schnaps zu trinken. Ledderhose versucht, eine saftige Schweinerei zu erzählen. Keiner hört hin. Wir liegen herum. Die Zeit geht weiter.
Mit einem Male zucke ich zusammen und hebe den Kopf. Ich sehe, dass auch Bethke bereits hochgefahren ist. Selbst Tjaden wird lebendig. Der jahrelange Instinkt meldet irgendetwas, keiner weiß noch was, aber bestimmt ist etwas Besonderes los. Vorsichtig recken wir die Köpfe und lauschen, die Augen zu engen Spalten verengt, um die Dämmerung zu durchdringen. Alle sind wach, in allen sind alle Sinne bis aufs Äußerste angespannt, alle Muskeln bereit, das noch Unbekannte, Kommende, das nur Gefahr bedeuten kann, zu empfangen. Leise schurren die Handgranaten, mit denen Willy, der beste Werfer, sich vorschiebt. Wir liegen wie Katzen angeschmiegt am Boden. Neben mit entdecke ich Ludwig Breyer. In seinen gespannten Zügen ist nichts mehr von Krankheit. Er hat dasselbe kalte, tödliche Gesicht wie alle hier, das Gesicht des Schützengrabens. Eine rasende Spannung hat es gefroren, so außergewöhnlich ist der Eindruck, den das Unterbewusstsein uns vermittelt hat, lange bevor unsere Sinne ihn erkennen können.
Der Nebel schwankt und weht. Und plötzlich fühle ich, was uns alle zu höchstem Alarm gebannt hat. Es ist nur still geworden. Ganz still.
Kein MG mehr, kein Abschuss, kein Einschlag; kein Granaten-pfeifen, nichts, gar nichts mehr, kein Schuss, kein Schrei. Es ist einfach still, vollkommen still.
Wir sehen uns an, wir können es nicht begreifen. Es ist das erste Mal so still, seit wir im Kriege sind. Wir wittern unruhig, um zu erfahren, was es zu bedeuten hat. Schleicht Gas heran? Aber der Wind steht schlecht, er würde es abtreiben. Kommt ein Angriff? Aber dann wäre er durch die Stille ja vorzeitig verraten. Was ist bloß los? Die Granate in meiner Hand ist nass, so schwitze ich vor Erregung. Es ist, als wollten die Nerven reißen. Fünf Minuten. Zehn Minuten. »Jetzt schon eine Viertelstunde«, ruft Valentin Laher. Seine Stimme schallt hohl im Nebel wie aus einem Grabe. Und immer noch geschieht nichts, kein Angriff, keine plötzlich verdunkelnden, springenden Schatten … Die Hände lockern sich und schließen sich fester. Das ist nicht mehr zum Aushalten! Wir sind den Lärm der Front so gewohnt, dass wir das Gefühl haben, jetzt, wo er mit einmal nicht mehr auf uns lastet, zerplatzen zu müssen, hochzufliegen wie Ballons.
»Mensch, pass auf, es ist Frieden«, sagt Willy plötzlich, und das schlägt ein wie eine Bombe.
Die Gesichter lockern sich, die Bewegungen werden ziellos und unsicher. Frieden? Wir sehen uns ungläubig an. Frieden? Ich lasse meine Handgranaten fallen. Frieden? Ludwig legt sich langsam wieder auf seine Zeltbahn. Frieden? Bethke hat einen Ausdruck in den Augen, als würde sein Gesicht gleich zerbrechen. Frieden? Weßling steht unbeweglich wie ein Baum, und als er das Gesicht abwendet und sich zu uns dreht, sieht er aus, als wolle er gleich weitergehen bis nach Hause.
Auf einmal, wir haben es kaum bemerkt im Wirbel unserer Erregung, ist das Schweigen zu Ende, dumpf dröhnen wieder die Abschüsse, und wie Spechtgehacke knarrt auch bereits von weither ein MG Wir werden ruhig und sind fast froh, die vertrauten Geräusche des Todes wieder zu hören.
Den Tag über haben wir Ruhe. Nachts sollen wir ein Stück zurück, wie schon oft bisher. Aber die von drüben folgen nicht einfach, sondern sie greifen an. Ehe wir uns versehen, kommt schweres Feuer herüber. Hinter uns tost es in roten Fontänen durch die Dämmerung. Einstweilen ist es bei uns noch ruhig. Willy und Tjaden finden zufällig eine Büchse Fleisch und fressen sie sofort auf. Die andern liegen da und warten. Die vielen Monate haben sie ausgeglüht, sie sind fast gleichgültig, solange sie sich nicht wehren können.
Der Kompanieführer kriecht in unsern Trichter. »Habt ihr alles?«, fragt er durch den Lärm. »Zu wenig Munition«, schreit Bethke. Heel zuckt die Achseln und schiebt Bethke eine Zigarette über die Schulter zu. Der nickt, ohne umzusehen. »Muss so gehen«, ruft Heel und springt zum nächsten Trichter. Er weiß, dass es gehen wird. Jeder dieser alten Soldaten könnte genauso gut Kompanieführer sein wie er selber.
Es wird dunkel. Das Feuer erwischt uns. Schutz haben wir wenig. Wir wühlen im Trichter mit Händen und Spaten Löcher für die Köpfe. So liegen wir fest angepresst, Albert Troßke und Adolf Bethke neben mir. Zwanzig Meter neben uns wichst es ein. Wir reißen die Schnauzen auf, als das Biest ranpfeift, um die Trommelfelle zu retten, aber auch so sind wir halb taub, Erde und Dreck spritzen uns in die Augen, und der verfluchte Pulver-und Schwefelqualm kratzt uns im Halse. Es regnet Sprengstücke. Einen hat es bestimmt erwischt, denn in unsern Trichter saust mit einem heißen Granat-fetzen eine abgerissene Hand, gerade neben Bethkes Kopf.
Heel springt zu uns herein, kalkweiß vor Wut unter dem Helm beim Aufflackern der Explosionen. »Brand«, keucht er, »Volltreffer, alles weg.«
Wieder kracht es, braust, brüllt, regnet Dreck und Eisen, die Luft donnert, die Erde dröhnt. Dann hebt sich der Vorhang, gleitet zurück, im gleichen Augenblick heben sich Menschen, verbrannt, schwarz aus der Erde, Handgranaten in den Fäusten, lauernd und bereit. »Langsam zurück«, ruft Heel.
Der Angriff liegt links von uns. Ein Trichternest von uns wird umkämpft. Das MG bellt. Die Blitze der Handgranaten zucken. Plötzlich schweigt das MG – Ladehemmung. Sofort wird das Nest von der Flanke gefasst. Ein paar Minuten noch und es ist abgeschnitten. Heel sieht es. »Verflucht«, er setzt über die Böschung. »Vorwärts!« Munition fliegt mit hinüber, rasch liegen Willy, Bethke, Heel in Wurfweite und werfen, Heel springt schon wieder hoch, er ist verrückt in solchen Momenten, ein wahrer Satan. Aber es gelingt, die im Trichter fassen neuen Mut, das MG kommt wieder in Schwung, die Verbindung ist da, und wir springen gemeinsam zurück, um den Betonklotz hinter uns zu erreichen. Es ist so schnell gegangen, dass die Amerikaner gar nicht gemerkt haben, wie das Nest geräumt wurde. Blitze zucken immer noch in den verlassenen Trichter.
Es wird ruhiger. Ich habe Angst um Ludwig. Aber er ist da. Dann kriecht Bethke heran. »Weßling?«
»Was ist mit Weßling? Wo ist Weßling?« – Der Ruf steht plötzlich im dumpfen Rollen der Ferngeschütze. »Weßling – Weßling –«
Heel taucht auf. »Was ist?«
»Weßling fehlt.«
Tjaden hat neben ihm gelegen, als es zurückging, ihn dann aber nicht mehr gesehen. »Wo?«, fragt Kosole. Tjaden zeigt dahin. »Verdammt! –« Kosole sieht Bethke an. Bethke Kosole. Beide wissen, dass dies vielleicht unser letztes Gefecht ist. Sie zögern keinen Moment. »Einerlei«, knurrt Bethke. »Los«, schnauft Kosole. Sie verschwinden im Dunkel. Heel springt hinter ihnen heraus.
Ludwig macht alles fertig, um sofort vorzustoßen, falls die drei angegriffen werden. Es bleibt vorläufig still. Plötzlich aber blitzen Explosionen von Handgranaten. Revolverschüsse knallen dazwischen. Wir springen sofort vor, Ludwig als Erster – da tauchen die schweißigen Gesichter Bethkes und Kosoles schon auf, die jemand auf einer Zeltbahn hinter sich herschleifen.
Heel? Es ist Weßling, der stöhnt. Heel? Hält die andern auf, er hat geschossen; gleich darauf ist er zurück, »die ganze Bande im Trichter erledigt«, schreit er, »und zwei noch mit dem Revolver.« Dann starrt er auf Weßling. »Na, was ist?« Der antwortet nicht. Sein Bauch ist aufgerissen wie ein Fleischerladen. Man kann nicht sehen, wie tief die Wunde reicht. Sie wird notdürftig verbunden. Weßling stöhnt nach Wasser, aber er kriegt keins. Bauchverletzte dürfen nicht trinken. Dann verlangt er nach Decken. Ihn friert, er hat viel Blut verloren.
Ein Gefechtsläufer bringt den Befehl, weiter zurückzugehen. Weßling nehmen wir in einer Zeltbahn mit, durch die ein Gewehr zum Tragen gesteckt wird, bis wir eine Bahre finden. Vorsichtig tappen wir hintereinander her. Es wird allmählich hell. Silberner Nebel im Gebüsch. Wir verlassen die Gefechtszone. Schon glauben wir, es sei alles vorbei, da sirrt es leise heran und schlägt tackend auf. Ludwig Breyer krempelt schweigend seinen Ärmel hoch. Er hat einen Schuss in den Arm bekommen. Weil verbindet ihn.
Wir gehen zurück. Zurück.
Die Luft ist milde wie Wein. Das ist kein November, das ist März. Der Himmel blassblau und klar. In den Lachen am Wege spiegelt sich die Sonne. Wir gehen durch eine Pappelallee. Die Bäume stehen zu beiden Seiten der Straße, hoch und fast unversehrt, nur manchmal fehlt einer. Diese Gegend war früher Hinterland, sie ist nicht so verwüstet worden wie die Kilometer davor, die wir Tag um Tag, Meter um Meter aufgegeben haben. Die Sonne leuchtet auf der braunen Zeltbahn, und während wir durch die gelben Alleen gehen, schweben segelnd immerfort Blätter darauf herunter; einige fallen hinein.
In der Lazarettstation ist alles voll. Viele Verwundete liegen schon vor der Tür. Wir lassen Weßling einstweilen auch draußen. Eine Anzahl Armverwundeter mit weißen Verbänden formiert sich zum Abmarsch. Das Lazarett wird schon aufgelöst. Ein Arzt läuft herum und untersucht die Neuangekommenen. Einen Mann, dem das Bein lose, falsch geknickt im Kniegelenk hängt, lässt er sofort hereinschaffen. Weßling wird nur verbunden und bleibt draußen.
Er wacht aus seinem Dösen auf und sieht dem Arzt nach. »Weshalb geht er denn ab?«
»Wird schon wiederkommen«, sage ich.
»Aber ich muss doch rein, ich muss operiert werden.« Er wird auf einmal furchtbar aufgeregt und tastet nach dem Verband. »Das muss doch gleich genäht werden.«
Wir versuchen, ihn zu beruhigen. Er ist ganz grün und schwitzt vor Angst: »Adolf, renn hinterher, er soll kommen.«
Bethke zögert einen Moment. Aber er kann nicht anders unter Weßlings Augen, obschon er weiß, dass es keinen Zweck hat. Ich sehe ihn mit dem Arzt sprechen. Weßling blickt ihm nach, so weit er kann, es sieht schrecklich aus, wie er den Kopf herumzudrehen versucht.
Bethke kommt so zurück, dass Weßling ihn nicht erblicken kann, schüttelt den Kopf und zeigt mit den Fingern eins und macht mit dem Munde unhörbar: Ei-ne Stun-de. –
Wir setzen zuversichtliche Gesichter auf. Aber wer kann einen sterbenden Bauern täuschen! Als Bethke ihm sagt, er werde später operiert werden, die Wunde müsse erst etwas anheilen, weiß Weßling schon alles. Einen Augenblick schweigt er, dann keucht er leise: »Ja, da steht ihr und seid heil – und kommt nach Hause – und ich – vier Jahre und so was – vier Jahre – und so was –«
»Du kommst ja gleich rein ins Lazarett, Heinrich«, tröstet Bethke ihn.
Er wehrt ab. »Lasst man.«
Von da ab sagt er nicht mehr viel. Er will auch nicht hineingetragen werden, sondern draußen bleiben. Das Lazarett liegt an einem kleinen Hang. Die Allee, durch die wir gekommen sind, kann man von hier aus weithin sehen. Sie ist bunt und golden. Die Erde liegt still und weich und geborgen da, sogar Äcker sind zu sehen, kleine, braune, aufgegrabene Stücke, dicht beim Lazarett. Wenn der Wind den Blut- und Eiterbrodem wegfegt, kann man den herben Geruch der Schollen riechen. Die Ferne ist blau und alles sehr friedlich; denn der Blick von hier geht nicht zur Front. Die Front liegt rechts.
Weßling ist still. Er betrachtet alles ganz genau. Die Augen sind aufmerksam und klar. Er ist Bauer und versteht sich mit der Landschaft noch besser und anders als wir. Er weiß, dass er jetzt weg muss. Deshalb will er nichts versäumen und wendet keinen Blick mehr ab. Von Minute zu Minute wird er blasser. Endlich macht er eine Bewegung und flüstert: »Ernst …«
Ich beuge mich zu seinem Munde herunter. »Nimm meine Sachen heraus«, sagt er.
»Das hat doch noch Zeit, Heinrich …«
»Nein, nein. Los.«
Ich lege sie vor ihn hin. Die Brieftasche aus abgeschabtem Kaliko, das Messer, die Uhr, das Geld – man kennt das ja allmählich. Lose in der Brieftasche liegt das Bild seiner Frau.
»Zeig her«, sagt er.
Ich nehme es heraus und halte es so, dass er es sehen kann. Es ist ein klares, bräunliches Gesicht. Er betrachtet es. Nach einer Weile flüstert er: »Das ist dann alles weg«, und die Lippen zittern ihm. Endlich wendet er den Kopf ab.
»Nimm’s mit«, sagt er. Ich weiß nicht, was er meint, aber ich will nicht noch lange fragen und stecke es deshalb in die Tasche. »Das bring ihr …«, er sieht mich mit einem sonderbaren, großen Blick an, murmelt, schüttelt den Kopf und stöhnt. Ich versuche krampfhaft, noch etwas zu verstehen, doch er gurgelt nur noch, reckt sich, atmet schwerer und langsamer, mit Pausen, stockend – dann noch einmal ganz tief und seufzend – und hat plötzlich Augen, als sei er erblindet, und ist tot.
Am nächsten Morgen liegen wir zum letzten Male vorn. Es wird kaum noch geschossen. Der Krieg ist zu Ende. In einer Stunde sollen wir abziehen. Wir brauchen nun nie wieder hierher zu kommen. Wenn wir gehen, gehen wir für immer.
Wir zerstören, was zu zerstören ist. Wenig genug. Ein paar Unterstände. Dann kommt der Befehl zum Rückzug.
Es ist ein sonderbarer Moment. Wir stehen beieinander und sehen nach vorn. Leichte Nebelschwaden liegen über dem Boden. Die Trichterlinien und Gräben sind deutlich erkennbar. Es sind zwar nur noch die letzten Linien, denn dieses hier gehört zur Reservestellung, aber es ist doch immer noch Feuerbereich. Wie oft sind wir durch diesen Laufgraben vorgegangen; wie oft mit wenigen durch ihn zurückgekommen. – Grau liegt die eintönige Landschaft vor uns – in der Ferne der Rest des Wäldchens, ein paar Stümpfe, die Ruinen des Dorfes, dazwischen eine hohe einsame Mauer, die sich immer noch gehalten hat.
»Ja«, sagt Bethke nachdenklich, »da hat man nun vier Jahre dringesessen …«
»Verdammt ja«, nickt Kosole. »Und nun ist einfach Schluss.«
»Mensch, Mensch«, Willy Homeyer lehnt sich gegen die Brustwehr. »Komisch so was, nicht …«
Wir stehen und starren. Die Ferne, der Waldrest, die Höhen, die Linien am Horizont drüben, das war eine furchtbare Welt und ein schweres Leben. Und jetzt bleibt das ohne Weiteres zurück, wenn wir die Füße vorwärts setzen, es versinkt Schritt für Schritt hinter uns, und in einer Stunde ist es weg, als wäre es nie gewesen. Wer kann das begreifen!
Da stehen wir und sollten lachen und brüllen vor Vergnügen – und haben doch ein flaues Gefühl im Magen, als hätte man einen Besen gefressen und müsste das Kotzen kriegen.
Keiner sagt recht was. Ludwig Breyer lehnt müde am Grabenrand und hebt die Hand, als stände gegenüber ein Mensch, dem er winken wollte.
Heel erscheint. »Könnt euch wohl nicht trennen, was? Ja, jetzt kommt der Dreck.«
Ledderhose sieht ihn verwundert an. »Jetzt kommt doch der Frieden.«
»Ja, eben der Dreck«, sagt Heel und geht weiter mit einem Gesicht, als sei seine Mutter gestorben.
»Dem fehlt der Pour le mérite«, erklärt Ledderhose.
»Ach, halt’s Maul«, sagt Albert Troßke.
»Na, nun los«, meint Bethke, bleibt aber auch noch stehen.
»Liegt mancher da von uns«, sagt Ludwig.
»Ja – Brandt, Müller, Kat, Haie, Bäumer, Bertinck –«
»Sandkuhl, Meinders, die beiden Terbrüggen, Hugo, Bernhard …«
»Mensch, hör auf …«
Viele liegen da von uns, aber bislang haben wir es nicht so empfunden. Wir sind ja zusammengeblieben, sie in den Gräbern, wir in den Gräben, nur durch ein paar Handvoll Erde getrennt. Sie waren uns nur etwas voraus, denn täglich wurden wir weniger und sie mehr – und oft wussten wir nicht, ob wir schon zu ihnen gehörten oder nicht. Aber manchmal brachten die Granaten auch sie wieder herauf zu uns, hochgeschleuderte zerfallende Knochen, Uniformreste, verweste, nasse, schon erdige Köpfe, die im Trommelfeuer noch einmal aus ihren verschütteten Unterständen in die Schlacht zurückkehrten. Wir empfanden es nicht als schrecklich; wir waren ihnen zu nahe. Aber jetzt gehen wir ins Leben zurück, und sie müssen hierbleiben.
Ludwig, dessen Vater in diesem Abschnitt gefallen ist, schnäuzt sich durch die Hand und dreht sich um. Langsam folgen wir. Aber wir halten noch einige Male und sehen uns um. Und stehen wieder still und spüren plötzlich, dass das da vorn, diese Hölle des Grauens, diese zerfetzte Ecke Trichterland, uns in der Brust sitzt, dass es – verflucht, wenn es nicht so ein Quatsch und uns nicht zum Brechen wäre –, dass es beinahe aussieht, als wäre es uns vertraut geworden wie eine qualvolle, furchtbare Heimat, und wir gehören einfach hierher.
Wir schütteln die Köpfe darüber – aber sind es die verlorenen Jahre, die dort bleiben, sind es die Kameraden, die da liegen, ist es all das Elend, das diese Erde deckt –, ein Jammer sitzt uns in den Knochen, dass wir losheulen könnten.
Dann marschieren wir.
Erster Teil
Die Straßen gehen lang durch die Landschaft, die Dörfer liegen in grauem Licht, die Bäume rauschen, und die Blätter fallen, fallen.
Über die Straßen aber ziehen Schritt um Schritt, in ihren fahlen, schmutzigen Uniformen, die grauen Kolonnen. Die stoppeligen Gesichter unter den Stahlhelmen sind schmal und ausgehöhlt von Hunger und Not, ausgemergelt und zusammengeschmolzen zu den Linien, die Grauen, Tapferkeit und Tod zeichnen. Schweigsam ziehen sie dahin, wie sie schon so viele Straßen entlangmarschiert, in so vielen Güterwaggons gesessen, in so vielen Unterständen gehockt, in so vielen Trichtern gelegen haben, ohne viele Worte: so ziehen sie jetzt auch diese Straße in die Heimat und den Frieden. Ohne viele Worte.
Alte Leute mit Bärten und schmale, noch nicht zwanzigjährige, Kameraden ohne Unterschied. Neben ihnen ihre Leutnants, halbe Kinder, aber Führer in vielen Nächten und Angriffen. Und hinter ihnen das Heer der Toten. So ziehen sie vorwärts, Schritt um Schritt, krank, halb verhungert, ohne Munition, in dünnen Kompanien, mit Augen, die es immer noch nicht begreifen können: Entronnene der Unterwelt – den Weg zurück ins Leben.
I
Die Kompanie marschiert langsam, denn wir sind müde und haben noch Verwundete bei uns. Dadurch bleibt unsere Gruppe allmählich zurück. Die Gegend ist hügelig, und wenn die Straße ansteigt, können wir von der Höhe aus nach der einen Seite den Rest unserer abziehenden Truppen und nach der anderen die dichten, endlosen Linien sehen, die uns folgen. Es sind Amerikaner. Wie ein breiter Fluss schieben sich ihre Kolonnen zwischen den Baumreihen vorwärts, und das unruhige Glitzern der Waffen läuft über sie hin. Ringsum aber liegen die stillen Felder, und die Wipfel der Bäume ragen ernst und unbeteiligt mit ihren herbstlichen Farben aus der vordringenden Flut.
Wir sind die Nacht über in einem kleinen Dorf geblieben. Hinter den Häusern, in denen wir gelegen haben, fließt ein Bach, der mit Weiden bestanden ist. Ein schmaler Pfad führt daran entlang. Einzeln hintereinander, in langer Reihe, folgen wir ihm. Kosole ist der Vorderste. Neben ihm läuft Wolf, der Kompaniehund, und schnuppert an seinem Brotbeutel.
Plötzlich, an der Kreuzung, wo der Pfad in den Hauptweg mündet, springt Ferdinand zurück.
»Achtung!«
Im nächsten Moment haben wir die Gewehre hoch und spritzen auseinander. Kosole liegt fertig zum Feuern im Chausseegraben, Jupp und Troßke ducken sich spähend hinter einer Holunderhecke, Willy Homeyer reißt an seinem Koppel mit Handgranaten, und selbst unsere Verwundeten sind kampfbereit.
Die Landstraße entlang kommen Amerikaner. Sie lachen und schwatzen miteinander. Es ist die Spitzengruppe, die uns eingeholt hat.
Adolf Bethke ist als Einziger von uns stehen geblieben. Er geht ruhig einige Schritte aus der Deckung heraus, auf die Straße. Kosole steht wieder auf. Wir anderen besinnen uns ebenfalls und rücken verwirrt und verlegen unsere Koppel und Gewehrriemen zurecht – seit einigen Tagen wird ja nicht mehr gekämpft.
Die Amerikaner stutzen, als sie uns sehen. Ihr Gespräch bricht ab. Sie nähern sich langsam. Wir ziehen uns gegen einen Schuppen zurück, um den Rücken gedeckt zu haben, und warten ab. Nach einer Minute des Schweigens löst sich ein baumlanger Amerikaner aus der Gruppe vor uns und winkt.
»Hallo, Kamerad!«
Adolf Bethke hebt ebenfalls die Hand. »Kamerad!«
Die Spannung weicht. Die Amerikaner kommen heran. Einen Augenblick später sind wir von ihnen umringt. So nahe haben wir sie bisher nur gesehen, wenn sie gefangen oder tot waren.
Es ist ein sonderbarer Moment. Schweigend blicken wir sie an. Sie stehen im Halbkreis um uns herum, lauter große, kräftige Leute, denen man gleich ansieht, dass sie immer satt zu essen gehabt haben. Alle sind jung – nicht einer von ihnen ist annähernd so alt wie Adolf Bethke oder Ferdinand Kosole, und das sind doch noch längst nicht unsere Ältesten. Aber auch keiner von ihnen ist so jung wie Albert Troßke oder Karl Bröger – und das sind noch immer nicht unsere Jüngsten.
Sie tragen neue Uniformen und neue Mäntel; ihre Schuhe sind wasserdicht und passen genau; ihre Waffen sind gut und ihre Taschen voller Munition. Alle sind frisch und unverbraucht.
Gegen diese Leute sind wir die reine Räuberbande. Unsere Uniformen sind gebleicht vom Dreck der Jahre, vom Regen der Argonnen, vom Kalk der Champagne, vom Sumpfwasser in Flandern – die Mäntel zerfetzt von Splittern und Schrapnells, geflickt mit groben Stichen, steif von Lehm und manchmal von Blut –, die Stiefel zerlatscht, die Waffen ausgeleiert, die Munition fast zu Ende; alle sind wir gleich dreckig, gleich verwildert, gleich müde. Der Krieg ist wie eine Dampfwalze über uns hinweggegangen.
Immer mehr Truppen rücken heran. Der Platz ist jetzt voll von Neugierigen.
Wir stehen immer noch in der Ecke, um unsere Verwundeten gedrängt – nicht weil wir Angst haben, sondern weil wir zusammengehören. Die Amerikaner stoßen sich an und zeigen auf unsere alten, verbrauchten Sachen. Einer bietet Breyer ein Stück weißes Brot an, aber der nimmt es nicht, obschon in seinen Augen der Hunger steht.
Plötzlich deutet jemand mit einem unterdrückten Ausruf auf die Verbände unserer Verwundeten. Sie bestehen aus Krepp-Papier und sind mit Bindfäden umschnürt. Alle blicken hin – dann treten sie zurück und flüstern miteinander. Ihre freundlichen Gesichter werden mitleidig, weil sie sehen, dass wir nicht einmal mehr Mullbinden haben. Der Mann, der uns vorhin gerufen hat, legt Bethke die Hand auf die Schulter. »Deutsche – gute Soldat –«, sagt er, »brave Soldat –«
Die anderen nicken eifrig.
Wir antworten nicht, denn wir können jetzt nicht antworten. Die letzten Wochen haben uns mächtig mitgenommen. Wir mussten immer wieder ins Feuer und verloren unnütz Leute; aber wir haben nicht viel gefragt, sondern haben es getan, wie wir es all die Zeit getan haben, und zum Schluss hatte unsere Kompanie noch zweiunddreißig Mann von zweihundert. So sind wir herausgekommen, ohne weiter nachzudenken und ohne mehr zu fühlen, als dass wir richtig gemacht haben, was uns aufgetragen worden war.
Jetzt aber, unter den mitleidigen Augen der Amerikaner, begreifen wir, wie sinnlos das alles zuletzt noch gewesen ist. Der Anblick ihrer endlosen, reichlich ausgerüsteten Kolonnen zeigt uns, gegen welch eine hoffnungslose Übermacht an Menschen und Material wir standgehalten haben.
Wir beißen uns auf die Lippen und sehen uns an. Bethke zieht die Schulter unter der Hand des Amerikaners fort, Kosole starrt vor sich hin, Ludwig Breyer richtet sich auf – wir fassen unsere Gewehre fester, unsere Knochen straffen sich, die Augen werden härter und senken sich nicht, wir sehen wieder die Landschaft entlang, aus der wir kommen, unsere Gesichter werden verschlossen vor Bewegung, und heiß geht es noch einmal durch uns hin: alles, was wir getan, alles, was wir gelitten und alles, was wir zurückgelassen haben.
Wir wissen nicht, was mit uns ist; aber wenn jetzt ein scharfes Wort hineinflöge, so würde es uns zusammenreißen, ob wir wollten oder nicht, wir würden vorstürzen und losbrechen, wild und atemlos, verrückt und verloren, und kämpfen – trotz allem wieder kämpfen –
Ein stämmiger Sergeant mit erhitztem Gesicht schiebt sich zu uns durch. Er übersprudelt Kosole, der ihm am nächsten steht, mit einem Schwall deutscher Worte. Ferdinand zuckt zusammen, so überrascht ihn das.
»Der spricht ja genau wie wir«, sagt er verwundert zu Bethke, »was sagst du nun?«
Der Mann spricht sogar besser und geläufiger als Kosole. Er erzählt, dass er vor dem Kriege in Dresden gewesen wäre und dort viele Freunde hätte.
»In Dresden?«, fragt Kosole immer verblüffter, »da war ich ja auch zwei Jahre. –«
Der Sergeant lächelt, als wäre das eine Auszeichnung. Er nennt die Straße, in der er gewohnt hat.
»Keine fünf Minuten von mir«, erklärt Ferdinand jetzt aufgeregt, »dass wir uns da nicht gesehen haben! Kennen Sie vielleicht die Witwe Pohl, Ecke Johannisgasse? So eine Dicke mit schwarzen Haaren? Meine Wirtin.«
Der Sergeant kennt sie zwar nicht, dafür aber den Rechnungsrat Zander, auf den sich wiederum Kosole nicht besinnen kann. Aber beide erinnern sich an die Elbe und an das Schloss und strahlen sich deshalb an, als wären sie alte Freunde. Ferdinand haut dem Sergeanten auf den Oberarm: »Mensch, Mensch – quatscht deutsch wie ein Alter und ist in Dresden gewesen! Mann, wozu haben wir beide eigentlich Krieg geführt?«
Der Sergeant lacht und weiß es auch nicht. Er holt ein Päckchen Zigaretten heraus und hält es Kosole hin. Der greift eilig zu, denn für eine Zigarette würde jeder von uns gern ein Stück seiner Seele hingeben. Unsere eigenen sind nur aus Buchenlaub und Heu, und das ist noch die bessere Sorte. Valentin Laher behauptet, die gewöhnlichsten wären aus Seegras und getrocknetem Pferdemist – und Valentin ist Kenner.
Kosole bläst den Rauch voll Genuss von sich. Wir schnuppern gierig. Laher wird blass. Seine Nasenflügel beben. »Gib mal einen Zug«, sagt er flehentlich zu Ferdinand. Aber ehe er die Zigarette nehmen kann, hält ihm ein anderer Amerikaner ein Paket Virginiatabak entgegen. Ungläubig sieht Valentin ihn an. Dann nimmt er es und riecht daran. Sein Gesicht verklärt sich. Zögernd gibt er den Tabak zurück. Doch der andere wehrt ab und deutet heftig auf die Kokarde an Lahers Krätzchen, das aus dem Brotbeutel hervorlugt.
Valentin versteht ihn nicht. »Er will den Tabak gegen die Kokarde tauschen«, erklärt der Sergeant aus Dresden. Das versteht Laher noch weniger. Diesen erstklassigen Tabak gegen eine blecherne Kokarde – der Mann muss übergeschnappt sein. Valentin würde das Päckchen nicht rausrücken, selbst wenn er dafür auf der Stelle Unteroffizier oder Leutnant werden könnte. Er bietet dem anderen gleich die ganze Mütze an und stopft sich mit zitternden Händen gierig die erste Pfeife.
Wir haben jetzt begriffen, was los ist: die Amerikaner wollen tauschen. Man merkt, dass sie noch nicht lange im Kriege sind; sie sammeln noch Andenken, Achselklappen, Kokarden, Koppelschlösser, Orden, Uniformknöpfe. Wir versorgen uns dagegen mit Seife, Zigaretten, Schokolade und Konserven. Für unsern Hund wollen sie uns sogar eine ganze Handvoll Geld obendrein geben – aber da können sie bieten, was sie wollen, Wolf bleibt bei uns. Dafür haben wir mit unseren Verwundeten Glück. Ein Amerikaner mit so viel Gold im Munde, dass die Schnauze wie eine Messingwerkstatt glänzt, will gerne Verbandfetzen mit Blut daran haben, um zu Hause beweisen zu können, dass sie tatsächlich aus Papier gewesen sind. Er bietet erstklassigen Keks und vor allem einen Arm voll Verbandzeug dafür. Sorgfältig und sehr zufrieden verstaut er die Lappen in seiner Brieftasche, besonders die von Ludwig Breyer, denn das ist ja Leutnantsblut. Ludwig hat mit Bleistift Ort, Namen und Truppenteil darauf schreiben müssen, damit jeder in Amerika gleich sehen kann, dass die Sache kein Schwindel ist. Zuerst wollte er zwar nicht – aber Weil redete ihm zu, denn wir brauchen das gute Verbandzeug bitter nötig. Außerdem ist der Keks für ihn mit seiner Ruhr direkt eine Rettung.
Den besten Schlag jedoch macht Arthur Ledderhose. Er schleppt eine Kiste mit Orden heran, die er in einer verlassenen Schreibstube gefunden hat. Ein ebenso zerknitterter Amerikaner wie er, mit ebensolchem Zitronengesicht, will die ganze Kiste auf einmal erwerben. Aber Ledderhose sieht ihn nur mit einem langen überlegenen Blick aus zusammengekniffenen Augen an. Der Amerikaner hält den Blick ebenso unbeweglich und scheinbar harmlos aus. Beide gleichen sich auf einmal wie Brüder. Über Krieg und Tod trifft hier plötzlich etwas aufeinander, das alles überstanden hat: der Geschäftsgeist.
Ledderhoses Gegner merkt bald, dass nichts für ihn zu machen ist, denn Arthur lässt sich nicht täuschen: sein Handel ist im Einzelnen bedeutend vorteilhafter. Er tauscht, bis die Kiste leer ist. Neben ihm sammelt sich allmählich ein Haufen Sachen an, sogar Butter, Seide, Eier und Wäsche, sodass er zum Schluss dasteht wie ein Kolonialwarenladen auf O-Beinen.
Wir brechen auf. Die Amerikaner rufen und winken hinter uns her. Besonders der Sergeant ist unermüdlich. Auch Kosole ist bewegt, soweit das einem alten Soldaten möglich ist. Er grunzt ein paar Abschiedslaute und winkt; allerdings sieht das bei ihm immer noch so aus, als ob er drohe. Dann äußert er zu Bethke: »Ganz vernünftige Kerle, was?«
Adolf nickt. Schweigend gehen wir weiter. Ferdinand lässt den Kopf hängen. Er denkt. Das tut er nicht oft, aber wenn es ihn gepackt hat, dann ist er zähe und kaut lange daran herum. Ihm will der Sergeant aus Dresden nicht aus dem Kopf.
In den Dörfern starren die Leute hinter uns her. In einem Bahnwärterhaus stehen Blumen am Fenster. Eine Frau mit vollen Brüsten stillt ein Kind. Sie hat ein blaues Kleid an. Hunde bellen uns an. Wolf bellt zurück. Am Wege bespringt ein Hahn eine Henne. Wir rauchen gedankenlos.
Marschieren, marschieren. Die Zone der Feldlazarette. Die Zone der Proviantämter. Ein großer Park mit Platanen. Unter den Bäumen Tragbahren und Verwundete. Die Blätter fallen und decken sie zu mit Rot und Gold.
Ein Gaslazarett. Schwere Fälle, die nicht mehr transportiert werden können. Blaue, wächserne, grüne Gesichter, tote Augen, zerfressen von der Säure, röchelnde, würgende Sterbende. Alle wollen fort, denn sie fürchten sich vor der Gefangennahme. Als wenn es nicht gleich wäre, wo sie sterben.
Wir versuchen, sie zu trösten, indem wir ihnen sagen, bei den Amerikanern würden sie besser verpflegt werden. Aber sie hören nicht darauf. Sie rufen uns immer wieder zu, wir möchten sie mitnehmen.
Das Rufen ist schrecklich. Die blassen Gesichter sehen so unwirklich aus in der klaren Luft hier draußen. Am schlimmsten aber ist es mit den Bärten. Sie stehen sonderbar für sich, hart, eigensinnig, wuchernd und wachsend um die Kinnbacken, ein schwarzer Pilzbelag, der sich nährt, je mehr sie verfallen.
Manche von den Schwerverletzten strecken ihre dünnen, grauen Arme aus wie Kinder. »Nehmt mich doch mit, Kameraden«, betteln sie, »nehmt mich doch mit, Kameraden.«
In ihren Augenhöhlen hocken schon tiefe, fremde Schatten, aus denen sich die Pupillen nur noch wie Ertrinkende hervorquälen. Andere sind still; sie folgen uns nur mit den Blicken, so weit sie können.
Allmählich wird das Rufen schwächer. Die Straßen gehen langsam vorbei. Wir schleppen viele Sachen, denn man muss doch etwas mitbringen nach Hause. Wolken hängen am Himmel. Nachmittags bricht die Sonne durch, und Birken, nur noch mit wenigen Blättern, spiegeln sich in den Regenlachen am Wege. Leichter, blauer Duft hängt in den Ästen.
Während ich marschiere, den Tornister auf dem Rücken, den Kopf gesenkt, sehe ich am Rande der Straße, in den klaren Regenpfützen, das Bild der hellen, seidenen Bäume. Es ist in diesem zufälligen Spiegel stärker als in Wirklichkeit. Eingebettet in den braunen Boden liegt da ein Stück Himmel mit Bäumen, Tiefe und Klarheit, und ich erschauere plötzlich. Zum ersten Mal seit langer Zeit fühle ich wieder, dass etwas schön ist, dass dieses hier einfach schön ist, schön und rein, dieses Bild in der Wasserlache vor mir – und in diesem Erschauern steigt mir das Herz hoch, alles fällt für einen Augenblick ab, und jetzt spüre ich es zum ersten Male: Frieden – sehe es: Frieden – empfinde es ganz: Frieden. Der Druck weicht, der nichts freigab bisher, ein Unbekanntes, Neues fliegt auf, Möwe, weiße Möwe, Frieden, zitternder Horizont, zitternde Erwartung, erster Blick, Ahnung, Hoffnung, Schwellendes, Kommendes: Frieden.
Ich schrecke auf und blicke mich um; dahinten liegen nun meine Kameraden auf den Tragbahren und rufen immer noch. Es ist Frieden, und sie müssen trotzdem sterben. Ich aber bebe vor Freude und schäme mich nicht. Sonderbar ist das. –
Vielleicht ist nur deshalb immer wieder Krieg, weil der eine nie ganz empfinden kann, was der andere leidet.
II
Nachmittags sitzen wir auf dem Hof einer Brauerei. Unser Kompanieführer, der Oberleutnant Heel, kommt aus dem Büro der Fabrik und ruft uns zusammen. Es ist ein Befehl da, dass aus der Mannschaft Vertrauensleute gewählt werden sollen. Wir sind erstaunt darüber. Bislang gab es so was nicht.
Da erscheint Max Weil auf dem Hof. Er schwenkt ein Zeitungsblatt und ruft: »In Berlin ist Revolution.«
Heel wendet sich um. »Unsinn«, sagt er scharf, »in Berlin sind Unruhen.«
Aber Weil ist noch nicht fertig. »Der Kaiser ist nach Holland geflohen.«
Das weckt uns auf. Weil muss verrückt sein. Heel wird knallrot und schreit:
»Verdammter Lügner!«
Weil übergibt ihm die Zeitung. Heel zerknüllt sie und starrt Weil wütend an. Er kann ihn nicht leiden, denn Weil ist Jude, ‣ein ruhiger Mensch, der immer herumsitzt und Bücher liest. Heel aber ist ein Draufgänger.
»Alles Quatsch«, knurrt er und sieht Weil an, als wolle er ihn fressen.
Max knöpft seinen Rock los und holt ein zweites Extrablatt heraus. Heel wirft einen Blick darauf, dann reißt er es in Fetzen und geht in sein Quartier. Weil setzt das Blatt wieder zusammen und liest uns die Nachrichten vor. Wir sitzen da wie besoffene Hühner. Das versteht keiner mehr. »Es heißt, er wollte einen Bürgerkrieg vermeiden«, sagt Weil.
»Blödsinn«, ruft Kosole, »wenn wir das nun auch gesagt hätten, damals. Verflucht, und dafür hat man hier ausgehalten.«
»Jupp, fass mich mal an, ob ich noch da bin«, sagt Bethke kopfschüttelnd. Jupp bestätigt es. »Dann muss es ja stimmen«, fährt Bethke fort, »aber trotzdem begreife ich nichts. Wenn einer von uns das gemacht hätte, wäre er an die Wand gestellt worden.«
»Ich darf jetzt nicht an Weßling und Schröder denken«, sagt Kosole und ballt die Fäuste, »sonst fliege ich auseinander. Küken Schröder, das Kind, plattgehauen hat er dagelegen, und der, für den er gefallen ist, reißt aus! – Kotzverflucht! –« Er knallt die Absätze gegen eine Biertonne. Willy Homeyer macht eine wegwerfende Handbewegung. »Wollen lieber von was anderm reden«, schlägt er dann vor, »der Mann ist für mich endgültig erledigt.«
Weil erklärt, dass bei verschiedenen Regimentern Soldatenräte gebildet worden seien. Die Offiziere seien keine Vorgesetzten mehr. Vielen hätte man die Achselstücke heruntergerissen.
Er will auch bei uns einen Soldatenrat gründen. Aber er findet wenig Gegenliebe. Wir wollen nichts mehr gründen. Wir wollen nach Hause. Und dahin kommen wir auch so.
Schließlich werden drei Vertrauensleute gewählt: Adolf Bethke, Max Weil und Ludwig Breyer.
Weil verlangt von Ludwig, er solle seine Achselstücke abmachen. »Hier –«, sagt Ludwig müde und tippt an seine Stirn. Bethke schiebt Weil zurück. »Ludwig gehört doch zu uns«, sagt er kurz. Breyer ist als Kriegsfreiwilliger zur Kompanie gekommen und da Leutnant geworden. Er duzt sich nicht nur mit uns, mit Troßke, Homeyer, Bröger und mir – das ist selbstverständlich, denn wir sind seine Mitschüler von früher –, sondern auch mit seinen älteren Kameraden, wenn kein anderer Offizier in der Nähe ist. Das wird ihm hoch angerechnet. »Aber Heel«, beharrt Weil.
Das ist eher zu verstehen. Weil ist oft von Heel schikaniert worden: kein Wunder, dass er jetzt seinen Triumph erleben will. Uns ist es schnuppe. Heel war zwar scharf, aber er ging ran wie Blücher und war immer vorneweg. Da unterscheidet der Soldat schon.
»Kannst ihn ja mal fragen«, sagt Bethke.
»Aber nimm dir Verbandpäckchen mit«, ruft Tjaden hinterher. Doch es wird anders. Heel kommt aus dem Büro, als Weil gerade hinein will. Er hat ein paar Formulare in der Hand und zeigt darauf. »Es stimmt«, sagt er zu Max.