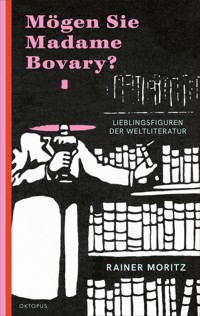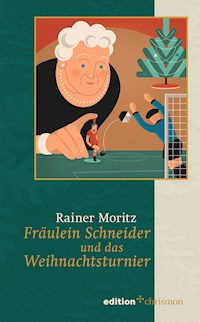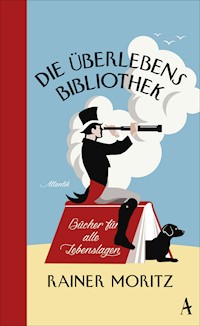8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Im Sommer 1874 kehrt der junge Lehrer Konrad Koch aus England nach Braunschweig zurück. Er soll am kaiserlichen Gymnasium Englisch unterrichten. Dort herrschen noch militärischer Drill und drakonische Erziehungsmethoden. Und Koch hat es mit seinen modernen Ansichten nicht leicht. Um den Unterricht aufzulockern, bedient er sich einer in Deutschland noch unbekannten Sportart: Er nennt sie Fußball. Schnell sind die Untertertianer vom Ballfieber gepackt. Doch das passt nicht allen. Der junge Lehrer eckt an mit seinem seltsamen neuen Sport, denn die Engländer gelten vielen als Feinde. Als die Schüler gegen die verständnislosen Autoritäten aufbegehren, muss Koch sich entscheiden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 210
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Rainer Moritz
Der ganz große Traum ... oder wie der Lehrer Konrad Koch den Fußball nach Deutschland brachte
Roman
Vorwort des DFB
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Lesen, so heißt es im Volksmund, bildet. Für meine Person trifft dies in Bezug auf Konrad Koch allemal zu. Natürlich hatte ich diesen Namen schon früher des Öfteren gehört, allerdings nur dann, wenn es darum ging, wer Ende des 19.Jahrhunderts erstmals die Fußballregeln in deutscher Sprache niedergeschrieben hat. Das war für mich Konrad Koch. Dass er darüber hinaus jedoch so etwas wie der «Erfinder» des Fußballs in unserem Land gewesen ist, das wurde mir erst durch einen Zeitungsbericht zum Kinofilm «Der ganz große Traum» bewusst. Und einige Wochen später, als ich den Film dann im Kino sehen durfte, war mir klar, dass Konrad Koch mehr war als «nur» der Verfasser deutscher Fußballregeln. Konrad Koch war ein besonderer Mensch. Ein Mensch, ohne den die rasante Entwicklung des heutigen Volkssports Fußball in Deutschland möglicherweise erst viel später eingesetzt hätte.
Der Deutsche Fußball-Bund zählt derzeit rund 6,7Millionen Mitglieder, über 40Millionen Menschen in unserem Land interessieren sich direkt oder indirekt für das Spiel mit dem runden Ball, und das Halbfinalspiel unserer Nationalmannschaft gegen Spanien bei der WM in Südafrika verfolgten 31,1Millionen Bundesbürger vor den Fernsehschirmen. Die zusätzlichen Millionen beim Public Viewing auf den Straßen unseres Landes gar nicht mit eingerechnet. Beeindruckende Zahlen, die belegen, dass Fußball in Deutschland mehr als nur ein Sport ist. Fußball ist ein starker Teil unserer Gesellschaft.
Und dies alles, Sie werden es auf den folgenden Seiten in spannender Art und Weise lesen, nahm 1874 seinen Anfang in Braunschweig. 26Jahre bevor in Leipzig der Deutsche Fußball-Bund gegründet wurde. Es war ebenjener Konrad Koch, der seine Schüler am Braunschweiger Martino-Katharineum mit der bis dahin im deutschen Kaiserreich noch unbekannten Sportart Fußball erstmals in Berührung brachte.
Eher unwahrscheinlich, dass Koch, dessen Todestag sich 2011 zum 100.Male jährt, in diesem Moment auch nur ansatzweise geahnt hat, welche rasante Entwicklung der Fußball bis in die heutige Zeit nehmen würde. Unstrittig ist jedoch, dass der Lehrer ein Vordenker war, der schon früh erkannt hatte, wie wichtig leibliche Betätigung für die Entwicklung der Jugendlichen ist. Und vor allem auch, welch soziale Kraft im Sport und speziell im Fußball steckt. Gerade deshalb setzte er sich gemeinsam mit seinen Mitstreitern gegen viele Widerstände durch, um den Fußball an «seiner» Schule zu etablieren.
Die soziale Kraft hat der Fußball bis heute nicht verloren. Und sie ist dieser Tage mindestens genauso wichtig wie damals, ausgangs des 19.Jahrhunderts.
In Zeiten, in denen viel über Integrationsprobleme und soziale Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft diskutiert wird, zeigt der Deutschen liebster Sport ebendiese Kraft und sorgt für ein Stück Gemeinschaft und Zusammenhalt. Dem Ball ist es nun mal egal, wer ihn tritt. Es interessiert ihn nicht, ob jemand arm oder reich, schwarz oder weiß, Christ oder Moslem ist. Deshalb spielen in Deutschland Woche für Woche Millionen von Menschen unterschiedlichster Hautfarben, Religionen und sozialer Schichten gemeinsam in einem Team, suchen gemeinsam den Erfolg, lernen aber auch mit Rückschlägen, Niederlagen und Enttäuschungen umzugehen. Der Fußball in Deutschland kann und muss gesellschaftliche Orientierung geben. Diese soziale und integrative Kraft des Fußballs fördert und vermittelt der Deutsche Fußball-Bund vielfältig und intensiv. Und dass wir dies in der heutigen Zeit können, ist auch ein Verdienst von Konrad Koch.
Viel Spaß bei der Lektüre dieses Buches über einen außergewöhnlichen Mann mit einem «ganz großen Traum».
Ihr
Dr.Theo Zwanziger
Präsident des Deutschen Fußball-Bundes
«Die Frage, ob Fußball in Deutschland eingeführt werden soll oder nicht, bedarf keiner Erörterung mehr, sie ist durch die Macht der Tatsachen entschieden.»
Konrad Koch, 1894
1
Schwächlinge! Schwächlinge und Memmen, wohin das Auge blickt!
Missmutig musterte Turnlehrer Jessen seine Zöglinge, die vergeblich versuchten, seinen Anforderungen gerecht zu werden. Große Erwartungen hegte er ohnehin nicht. Wenn er an frühere Schülergenerationen dachte, schien alles auf einen Niedergang zuzusteuern. Seit über zwanzig Jahren lehrte er bereits am Martino-Katharineum in Braunschweig, und von Jahrgang zu Jahrgang mehrte sich die Zahl der verweichlichten Schüler, die von modernem, undeutschem Gedankengut infiziert waren.
«Bornstedt, bewegen Sie sich», bellte Jessen. «Es wird Ihnen hoffentlich noch vor Sonnenuntergang gelingen, den Medizinball in die Höhe zu stemmen!»
Mit Abscheu beobachtete er den schwächlichen Jungen, der es nie zu einem herausragenden Turner bringen würde. Dagegen sprach schon seine dürftige Konstitution, was vermutlich an seinem Elternhaus lag. Warum nur hatte sich der Direktor unbedingt neuem Gedankengut gegenüber aufgeschlossen zeigen müssen? Wieso hatte er es für richtig gehalten, das Katharineum für untere Schichten zu öffnen? Für einen wie Bornstedt, der keinen Vater mehr hatte und dessen Mutter in der Fabrik arbeitete und der vermutlich deshalb so schwach auf den Knochen war. Aber Jessen vermied es, sich auf derartige Diskussionen einzulassen. Als Turnlehrer stand ihm das nicht zu, obwohl er insgeheim davon überzeugt war, dass das Vaterland ihm weit mehr verdankte als den verweichlichten Deutschlehrern, bei denen die Schüler höchstens «Die Wacht am Rhein» auswendig lernten. GutsMuths und dem seligen Jahn, was verdankte die Nation nicht diesen Vorreitern! Jessen sah sich in dieser Tradition und fand es deshalb umso beschämender, wenn manch einer sich kaum noch an diese stolze Geschichte erinnerte.
«Und eins und zwei und drei und vier, die Rolle, zwei und drei und vier… Nur weiter so.»
Je intensiver er die Jungen dazu anhielt, nach den Medizinbällen nun lange Eisenstangen hoch über ihre Köpfe zu hieven, desto schneller trennte sich die Spreu vom Weizen. Viel Staat war mit dieser Klasse nicht zu machen. Der ungelenke Schricker, der kleingewachsene Bornstedt, der sich in den hinteren Reihen zu verstecken pflegte. Wie, dachte Jessen kopfschüttelnd, sollte man mit diesen Schwächlingen eine schlagkräftige Turnerriege auf die Beine stellen?
Wohlgefällig beobachtete er den hochaufgeschossenen Felix Hartung, der gut zwanzig Zentimeter größer als seine Mitschüler war und trotz seiner vierzehn Jahre fast schon erwachsen wirkte. Seine Oberarmmuskeln traten hervor, und es schien ihm nichts auszumachen, eine Turnübung nach der anderen zu absolvieren. Ein Knabe aus gutem, vermögendem Haus, dachte Jessen, und dazu noch einer, der den anderen ein körperliches Vorbild war. Wenngleich er sich nicht größter Beliebtheit erfreute.
«Und jetzt wieder die Bälle!» Jessen reckte den Kopf in die Höhe, sein millimetergenau getrimmter Schnurrbart glänzte ein wenig, Schweißtröpfchen hatten sich unter der Nase gesammelt. Wie stolz er auf seine Barttracht war. Eine Viertelstunde mindestens verbrachte er bei der Morgentoilette damit, überstehende Barthaare sorgfältig zu stutzen und sich das Haar zu pomadisieren. Anschließend fletschte er die Zähne und grimassierte vor dem Spiegel, stets darauf bedacht, dass der Schnurrbart bei jeder erdenklichen Bewegung das Gesicht zierte.
Auch wenn er seine Gedanken schweifen ließ – ein erfahrener Pädagoge konnte sich das erlauben–, verlor er die schwitzende Schar nicht aus den Augen.
«Im Gleichschritt nach vorne», befehligte er, «die Bälle kreisen lassen, von einem zum anderen. Nicht aus dem Takt kommen, Schricker.» Was für einen jämmerlichen Anblick dieser fettleibige Kerl bot! Seine Pausbacken liefen schon nach wenigen Übungen rot an. Er sonderte Schweiß aus allen Poren ab und schien sich nach einem kräftigen Brot mit Braunschweiger Wurst zu sehnen, die sich auch Jessen des Öfteren schmecken ließ, obgleich nicht in den Mengen, die der übergewichtige Otto Schricker vertilgte. Dennoch verzichtete er darauf, den Jungen zu sehr an die Kandare zu nehmen. Ottos Vater zählte zu den wichtigen Unternehmern am Ort. Seine Turngerätefabrik belieferte auch das Katharineum, und immer wieder profitierte Jessen davon, wenn ihm der alte Schricker etwa eine Serie neuer Medizinbälle überließ, um deren Qualität zu prüfen. Mit seinem Sohn, dachte Jessen und schüttelte den Kopf, war dagegen nichts anzufangen, zumindest nicht im Turnsaal. Einfachste Rumpfbeugen misslangen dem Filius, und wenn er wie jetzt zwischen den Ringen taumelte, schämte Jessen sich für die gesamte deutsche Jugend.
Mit zitternden Armen versuchte sich Otto Schricker hochzuziehen, seine Augen flackerten. Er wusste, dass es ihm niemals gelingen würde, seinen Oberkörper über die wackelnden Ringe zu ziehen, und er wusste, dass ihn der Turnlehrer mit hämischer Miene beobachtete und sich nicht scheuen würde, ihn mit Hohn und Spott zu übergießen. Wie monoton und einfallslos dieser Unterricht war, dachte er. Als ginge es darum, schon in der Schule für die kommenden Schlachten mit den Engländern und Franzosen vorbereitet zu werden. Ein letztes Mal nahm er seine schwindenden Kräfte zusammen, ehe er wie ein Mehlsack auf den Turnhallenboden plumpste, sich das Knie anstieß und leise aufweinte.
Vorturner Felix Hartung widmete sich bereits einem anderen Gerät. Und auch die anderen Mitschüler nahmen kaum Notiz von Ottos Schwächeanfall, nur der schüchterne Bornstedt reichte Schricker eine Hand.
«Hast du dir wehgetan?»
Otto übersah die Hand und schwieg. Seinem Vater durfte er von dieser Blamage nichts erzählen. Der tapsige Sohn eines Turngeräteherstellers – das gab kein gutes Bild ab, obwohl auch Ottos Vater zugelegt hatte. Kein Wunder bei den zahlreichen Schoppen, die er sich als erfolgreicher Unternehmer allabendlich gönnte.
Jessen sah auf die Wanduhr. Schrickers Missgeschick hatte er geflissentlich ignoriert, dieser Tölpel. Von Hartung abgesehen hatte sich keiner hervorgetan heute. Beim nächsten Mal würde er härtere Saiten aufziehen, der Verweichlichung musste vorgebeugt werden. Wenn der Direktor der Dekadenz Tür und Tor öffnen wollte, nun gut – er nicht!
Jessen griff sich unauffällig ans Gesäß. Gut, dass die Stunde gleich vorüber war. So wohl er sich in seinem blau-weiß gestreiften Trikot fühlte, so wenig ließ sich leugnen, dass sein Turnanzug heute zwickte und zwackte. Er versuchte, sich unauffällig zu recken und den Stoff am Gesäß zu straffen. Welch unangenehme Enge. Doch es galt, sein Ungemach vor den Schülern zu verbergen. Der dünne Stoff schnitt ihn in die Gesäßfalte, wie heftig er auch bemüht war, seine Körperhaltung zu verändern.
Schließlich führte Jessen die Pfeife zum Mund, blies kräftig hinein und entließ die Untertertia mit einem unwilligen Befehl. Er sehnte sich danach, sich endlich das Trikot vom Leibe zu reißen.
2
Mit verächtlichem Blick prüfte der Kutscher das Innere des Wagens. Das hätte er sich denken können. Er besah den Lederbezug der Sitzbänke und hoffte, dass sich sein Fahrgast wenigstens nicht erbrochen hatte. Der Mann schien zu schlafen. Zusammengekauert lag er quer über der hinteren Bank, und seine Arme umklammerten ein unförmiges Paket. Seinen Kopf zierte ein merkwürdiger, abgerundeter Hut, der jeden Augenblick zu Boden zu rutschen drohte.
Was für einen ungesunden Eindruck dieser Mann macht, dachte der Kutscher und versuchte, den Schläfer mit einem lautstarken «Hallo, wir sind angekommen!» hochzuschrecken.
«Die Fahrt ist zu Ende. Ich werde nicht dafür bezahlt, Ihren Schlaf zu bewachen!» Er ließ die Peitsche vor der Kutschentür schnalzen. Doch der seltsam gekleidete Fremde rührte sich nicht.
Erst der dritte Anlauf, als der Kutscher unwirsch begann, seinen Gast an der Schulter zu rütteln, zeitigte Erfolg. Begleitet von einem leichten Stöhnen, regten sich die Lebensgeister des müden Mannes, während der Kutscher einen schweren Koffer vom Kutschendach herunterhievte.
Konrad Koch richtete sich mühsam auf. Er schlug sich den Kopf am Kutschenhimmel, blinzelte und schien erst Gewissheit erlangen zu müssen, wohin ihn diese Fahrt geführt haben mochte. Langsam kehrten die Sicherheiten zurück. Er beugte seinen Kopf aus dem Kutschenfond und sah sich um, ohne den vor sich hin schimpfenden Kutscher zu beachten. Der Himmel zeigte sich von einer freundlichen Seite, sodass die prachtvolle Fassade der Schulanlage, vor der sie gehalten hatten, in Sonnenlicht getaucht war.
Er war wieder zu Hause, keine Frage. Er, Konrad Koch, Sohn des in Braunschweig hochgeachteten Professors Koch. In dessen Fußstapfen sollte er nun treten, an demselben Gymnasium. Seit gut fünf Jahren befand sich das Martino-Katharineum in diesem imposanten Neubau zwischen der Breiten Straße und der Scharnstraße. Man hatte sich nicht lumpen lassen und nach Plänen des Baurats Krähe einen Gebäudekomplex im neoromanischen Stil errichtet, der sowohl dem Katharineum als auch dem Realgymnasium ausreichend Platz bot. Der alte Bau am Ziegenmarkt war aus allen Nähten geplatzt. Braunschweig gedieh im jungen Kaiserreich; die Schülerzahlen stiegen, und Schulleitung und Förderverein setzten alles daran, den guten Ruf des Katharineums zu erhalten.
Hier würde er also künftig versuchen, seine Erfahrungen umzusetzen, und unterrichten. Konrad Koch wusste, dass man ihm einerseits Wohlwollen entgegenbrachte, denn schließlich zählten die Eltern zu den alteingesessenen Braunschweiger Familien, und der Name seines Vaters war an der Schule nicht vergessen. Andererseits stand zu befürchten, dass man ihm auch mit Skepsis begegnen würde. In dem freundlichen Schreiben, das ihm Direktor von Merfeld übermittelt hatte, war von einem «Experiment» die Rede gewesen. Von einer pädagogischen Maßnahme, die nicht überall im Kollegium und bei den Honoratioren der Stadt auf Zustimmung stieß.
Konrad Koch unterbrach seine Überlegungen und kletterte umständlich aus dem Gefährt.
«Good morning, äh… Entschuldigen Sie», sagte er und mühte sich, den misstrauischen Kutscher zu beruhigen. «Einige Strapazen liegen hinter mir. Die letzte Nacht habe ich über der Reling verbracht, Sie verstehen…»
Er fühlte sich zerschlagen, die umständliche Reise mit Fähre, Zug und Kutsche hatte sich als äußerst beschwerlich erwiesen, und er hoffte, dass seine Unterkunft ihm die Möglichkeit bot, sich die Müdigkeit alsbald aus den Knochen zu schlafen.
Die Schulanlage war so konzipiert, dass sie Lehrer- und Hausmeisterwohnungen integrierte. Er würde, freute sich Konrad Koch, seinen Schülern nahe sein, ihnen gleichzeitig keine Gelegenheit geben, seinen neuen Ideen zu entkommen. Wie gern er die jungen Erwachsenen dafür begeisterte, obgleich er wusste, dass viele seiner älteren Kollegen wenig davon hielten, sich neuartige Lehrmethoden anzueignen.
Konrad Koch entlohnte den ungeduldigen Kutscher und richtete mit einer Hand seinen Koffer auf, der unsanft auf dem staubigen Schulhof gelandet war. Mit der anderen hielt er noch immer das rundliche Paket. Bei dem Versuch, den Griff seines zentnerschweren Gepäcks zu fassen, geriet Koch aus dem Tritt. Er strauchelte, wäre um ein Haar gestolpert. In letzter Sekunde gelang es ihm, einen Sturz zu vermeiden, doch der Verlust seines Gleichgewichts brachte es mit sich, dass ihm das bis dahin fest umklammerte Paket aus den Händen glitt und sich selbständig machte.
Gebannt beobachteten Konrad Koch und der Kutscher, wie das in braunes Packpapier geschlagene Objekt auf den Boden fiel, aufsprang und nach mehreren ungleichmäßigen Hüpfern auf drei Arbeiter zurollte, die gerade im Begriff waren, ein Erdloch auszuheben. Entgeistert ließ Koch den Koffer los und sprang dem kürbisförmigen Paket hinterher.
Was wäre das, dachte er, für ein böses Omen, wenn dieses wertvolle Geschenk gleich bei seiner Ankunft verloren ginge!
Nach wenigen Sätzen hatte er die Baugrube erreicht und entriss den verdutzten Arbeitern das Päckchen, das zu ihrer Verwunderung in dem Loch gelandet war.
«Thank you!», rief er ihnen zu und umschloss es liebevoll – nicht ohne zu merken, wie der Kutscher ihm fassungslos nachblickte. Offenbar war der Mann nun endgültig davon überzeugt, einen Geistesgestörten befördert zu haben. Eilig sprang er auf den Kutschbock des gelben Wagens und rief seinem Fahrgast einen kaum verständlichen Abschiedsgruß zu. Mit einem Peitschenhieb trieb er die Pferde an und verschwand in einer Staubwolke.
Konrad Koch ließ sich davon nicht beeindrucken, staubte mit der freien Hand sein auffällig kariertes Tweed-Jackett ab und strebte schließlich mit Koffer und Paket dem Hauptportal der Schule zu. Seine festen, knöchelhohen Lederschuhe gaben guten Halt. Mit diesen, dachte Koch, ließ sich so manches Abenteuer bestehen und mancher Tritt verabreichen. Die Engländer verstanden das Schusterhandwerk, keine Frage.
Die Sorge um das Paket hatte ihn seine Erschöpfung für einen Moment vergessen lassen. Er blickte die dreistöckige Fassade des Martino-Katharineums hinauf, wo der Unterricht bereits in vollem Gange war. Aus einem der Fenster im Erdgeschoss hörte er die schneidende Stimme eines Kollegen, der darüber zu verzweifeln schien, dass seine vehement vorgetragenen Kommandos nicht im Geringsten zu richtigen Antworten seiner Zöglinge führten.
3
Die Geschichtslehrer, das duldete für Doktor Roman Bosch keinen Widerspruch, bilden das Fundament einer deutschen Lehranstalt. Männer wie er waren es, die den Sinn für die Tradition schärften und den von vielerlei Ablenkungen beeinträchtigten Schülern das Verständnis für die glanzvolle Vergangenheit des endlich vereinigten Landes beibrachten. Gerade jetzt nach den glanzvollen Ereignissen von 1870/71 hieß es, das Erreichte zu festigen und vor umstürzlerischen Umtrieben zu schützen. Selbst in Braunschweig, ja, selbst am ehrwürdigen Martino-Katharineum schlichen sich Nachlässigkeiten ein, ein Schlendrian, dem es mit aller Schärfe entgegenzutreten galt.
Zum Glück, frohlockte Bosch, als er den Blick über die Köpfe der Untertertia schweifen ließ und durchs Fenster eine grün angelaufene Kirchturmspitze ins Visier nahm, zum Glück umfasst der Lehrkörper am Katharineum eine Vielzahl von Kollegen, denen nationales Denken selbstverständlich war. Jessen zum Beispiel, mit dem sich am Biertisch trefflich die politische Weltlage erörtern ließ und der sich begeistert zeigte, wenn Bosch die Zusammenhänge zurückverfolgte und die ruhmreiche deutsche Geschichte heraufbeschwor, die mindestens bis zu Karl dem Großen reichte. Dass ein gesunder Geist und ein gesunder Körper eine untrennbare Einheit bildeten, zählte für die Doctores Bosch und Jessen zu den unumstößlichen Erkenntnisgewissheiten. Sie beide – darin bestärkten sie sich jedes Mal, wenn sie die Bierkrüge aneinanderstießen – würden niemals Wasser auf die Mühlen der Sozialdemokratie gießen!
Unwillig riss sich Bosch aus seinen patriotischen Gedanken und fuhr sich mit seinem Sacktuch über den Nacken, der einem Stier zur Ehre gereicht hätte. Viel zu warm war es für die Jahreszeit. Sein Hemdkragen war durchgeschwitzt, und die einfältige Schülerschar trug nicht dazu bei, seine Transpiration zu mindern. Wie sollte das gelingen, wenn ihn die dummen Antworten zur Weißglut trieben und er zu Züchtigungsmaßnahmen gezwungen war!
Seit Monaten verwendete Doktor Bosch alle Kraft darauf, seinen Schülern das Grundgerüst historischer Daten einzubläuen. Daten und Namen – das zählte in der weltgeschichtlichen Betrachtung. Sich an den Herrscherpersönlichkeiten, an den Feldherrn, kurzum, an den herausragenden Männern der Geschichte zu orientieren, darauf kam es an. Und wer als Schüler kein Gespür für die großen historischen Stunden, für die entscheidenden Schlachten besaß, hatte am Martino-Katharineum nichts verloren!
Bosch schlug mit dem Stock aufs Katheder. «Weiter geht es, keine Müdigkeit vorschützen, alle zusammen», brüllte er in den Klassenraum.
Merkverse, so seine Überzeugung, eignen sich bestens als Eselsbrücken, mit denen sich selbst in den Köpfen der dämlichsten Schüler geschichtliche Daten verankern ließen. Nicht ohne Stolz legte er sich gehörig ins Zeug, um nach dem Muster «Drei, drei, drei – bei Issus große Keilerei» zeitgemäße Beispiele zu bilden, die den Ereignissen der letzten Jahrzehnte die gebührende Anerkennung verschafften. Allabendlich sinnierte er im Ohrensessel über neue Zahlenreime und erprobte sie an seiner geduldigen, aus dem Alten Land stammenden Ehefrau, die es gewohnt war, abgefragt zu werden, während sie sich über das Nähzeug beugte. Dass sich Bosch gegenüber seiner Gemahlin nachsichtiger als gegenüber den Schülern zeigte, wenn sie Feldherrn und Herrscherdynastien durcheinanderbrachte, verstand sich für ihn von selbst. Die Gehirne von Frauen, so führte er auch gern im Kollegenkreis aus, seien nicht für komplexe politische und historische Zusammenhänge geschaffen, weshalb man ihnen auf diesem Gebiet Fehler nachsehen müsse. Der deutschen Hausfrau und Mutter seien von der Natur andere Domänen zugewiesen, wo sie – Roman Bosch liebte es, die Klassiker zu zitieren – züchtig zu walten habe.
«Achtzehn, sieben, eins – Frankreich ist dem Kaiser seins!» Wie aus der Pistole geschossen, donnerte der Schülerchor gleichzeitig aus allen hochgereckten Hälsen.
Befriedigt blickte Bosch in die Runde; sein grimmiger Gesichtsausdruck verflüchtigte sich.
«Na also», rief er der eingeschüchterten Untertertia zu. «Es scheint mir, als müssten Ihre bedauernswerten Eltern noch nicht alle Hoffnung fahrenlassen. In der nächsten Stunde werden wir das Zahlengerüst des Jahrhunderts, in dem zu leben wir das Glück haben, noch einmal durchgehen. Angefangen mit den Schlachten Napoleons bis hin zu den Heldentaten der Schlacht von Sedan, deren Truppenbewegungen wir heute noch einmal nachvollziehen wollen.»
Bosch ließ den Zeigestock über eine Landkarte neben der Tafel kreisen und machte sich weitschweifig daran, die Abläufe der Schlacht bis ins Kleinste zu veranschaulichen. Er neigte dazu, sich in die Gedanken der Soldaten einzufühlen, und spielte mit überschwappender Stimme nach, was die Generäle zu ihren Entscheidungen bewegt haben mochte. Ohne sich um die Reaktionen seiner Schüler zu kümmern, imitierte er das Für und Wider in den Schlachtbesprechungen und passte seine Stimme den jeweiligen Diskutanten an.
Die Schüler wussten, dass Bosch – derart in Fahrt gekommen – ihr Tun kaum noch wahrnahm, und so nutzten sie den Freiraum, um sich kleine Zettel mit wichtigen Botschaften zuzuspielen und Papierkügelchen durch den Raum zu schießen. Stets waren sie jedoch vorsichtig darauf bedacht, nicht jenen Moment zu verpassen, da Bosch jählings sein Rollenspiel unterbrechen und sie mit Fragen traktieren würde.
«Aufgemerkt, aufgemerkt!», rief Bosch und drehte sich zur Klasse um. «General Graf von Moltke, dieser große Mann… Was bewegte ihn in dieser entscheidenden Stunde? Das deutsche Heer war bestens aufgestellt, der richtige Moment gekommen – und dennoch hielt Graf von Moltke in seiner unermesslichen Weitsicht die Reitertruppen zurück. Warum tat er das? Warum tat er das?» Wie immer wiederholte Bosch die Fragen, die ihm besonders elementar erschienen, auf dass kein Schüler ihm mit der Ausflucht kommen konnte, die Frage nicht verstanden zu haben.
«Warum handelte General von Moltke so?»
Die Schülerköpfe duckten sich, furchtsam darum bemüht, nicht Boschs Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.
«Bornstedt, ja, Bornstedt – was hat er dazu zu sagen?»
Mit einem leichten Zittern erhob sich Joost Bornstedt und setzte zu einer Antwort an. Er formte die Lippen, doch er brach ab, ehe er ein Wort herausgebracht hatte. Nichts war zu hören.
«Bornstedt, ich muss mich wundern», stichelte Bosch, «nicht über Ihre verstockte Ahnungslosigkeit, sondern darüber, dass Sie keine Anstalten unternehmen, Ihrem ohnehin vermutlich nur kurzen Aufenthalt an dieser traditionsreichen Schule Berechtigung zu geben.» Boschs Gesicht lief rot an. Er liebte es, seine Unzufriedenheit mit dem fehlenden Lerneifer der Schüler an dem kleinen, verängstigten Bornstedt abzureagieren. Bei Hartung, dem Bankierssohn, wäre er behutsamer vorgegangen.
«Bornstedt– Sie wissen, welche Strafaufgabe ich Ihnen zuweisen werde? Ein Schüler, dem es offensichtlich gleichgültig ist, was unseren besten Generälen zu ihren klugen Strategien verhalf, hat es nicht verdient, das Martino-Katharineum zu besuchen, verstanden?»
Boschs Zeigestock trommelte auf die Landkarte, deren spröde Bespannung seiner Wut bald nicht mehr standhalten würde.
Genau dort, so hoffte Joost Bornstedt insgeheim, wo der Name Sedan prangte, würde sich dann die Spitze des Stocks hineinbohren. Genau dort!
4
Wellkamm… tu… se… Martino-Katharineum!»
Die Augen des Schuldirektors Gustav von Merfeld tasteten jedes der Wörter ab, die er gestern Abend in großen Buchstaben auf einen blütenweißen Zettel notiert hatte. Feierlich las er den Willkommensgruß ab und mühte sich erst gar nicht, seine Unkenntnis des Englischen zu kaschieren. Merfeld, der die sechzig gerade überschritten hatte, fühlte sich unwohl, da er es als erfahrener Schulleiter nicht gewohnt war, Situationen ausgesetzt zu sein, die ihn in einer gewissen Hilflosigkeit zeigten. Gleichzeitig jedoch empfand er Stolz darüber, den jungen Konrad Koch, dessen Vater sich immense Verdienste um das Gymnasium erworben hatte, an die Schule geholt zu haben. Er strich sich über seinen sorgsam gestutzten Kinnbart, überprüfte erneut den Sitz eines goldgefassten Monokels und breitete die Arme aus, um den neuen Kollegen herzlich zu empfangen.
«Seien Sie willkommen, lieber Koch! Hatten Sie eine angenehme Reise?»
«Das würde der Wahrheit nicht in Gänze entsprechen», erwiderte Koch, der sich sofort auf den angebotenen Stuhl fallen ließ. «Die Nordsee hat sich ein wenig stürmisch, ja, recht rau gezeigt. Wirklich bekommen ist mir das nicht, wenn Sie verstehen, Herr Direktor. Ich hatte auf der Überfahrt mit Unpässlichkeiten zurechtzukommen.»
Konrad Koch seufzte, und seine Magenwände zogen sich allein bei der Erinnerung an die schrecklichen Stunden auf Deck zusammen, ohne dass sich von Merfeld dadurch in seiner Begeisterung hätte beeinträchtigen lassen.
«Wenn ich Sie, lieber Koch, so vor mir sehe, meine ich den frischen Wind zu riechen, den Sie von der Insel mitbringen. Wir setzen auf Sie und Ihren Tatendrang, obwohl Sie nicht denken müssen, das deutsche Kaiserreich und insbesondere Ihre Heimatstadt Braunschweig hätten sich im Dämmerschlaf befunden, während Sie in Oxford und Cambridge Ihre Studien betrieben. Sehen Sie nur hinaus.»
Direktor von Merfeld verließ seinen Schreibtisch, hinter dem ein pompöses Bildnis Kaiser Wilhelms hing, und gab Koch zu verstehen, dass er sich erheben solle. Unter dem gestrengen Blick des Monarchen traten beide Männer an das zum Hof liegende Fenster.
«Die drei Arbeiter dort, Koch – was glauben Sie, welcher bedeutenden Aufgabe diese gerade nachgehen?»
Konrad Koch erkannte die Männer wieder, die sein rundliches Paket aufgefangen hatten, und schüttelte den Kopf.
«Ein Loch. Ich vermute, Herr Direktor, sie graben ein Loch…»
Von Merfeld lachte auf. «Natürlich ein Loch, aber doch nicht irgendein Loch. Das ist gewissermaßen ein bedeutsames Loch, das unsere Schule und die Stadt in die Zukunft führt. Diese Männer sind dabei, das Ihnen, Koch, so unscheinbar anmutende Loch zu füllen, mit einem riesigen Holzmast, den das Pferdefuhrwerk dort hinten bringt.» Er deutete auf eine der Auffahrten zum Schulgelände und war kurz davor, dem verdutzten Koch vor Begeisterung auf die Schulter zu schlagen.
«Ein Telegraphenmast ist das!», rief von Merfeld euphorisch. «Überlegen Sie nur, ein Telegraphenmast! Demnächst werde ich meiner verdienten Sekretärin Frau von Salchow einen Brief diktieren an das Kaiserliche Schulamt. Und dieses Schreiben wird sie nach Berlin kabeln, Sie verstehen? Und noch am selben Tag, jawohl, am selben Tag, werden wir die Antwort aus Berlin in Händen halten. Eine kolossale Entwicklung, finden Sie nicht auch, Koch?»
Den Direktor hielt es nicht mehr am Fenster. Er wandte sich einem Globus zu, den er in Bewegung setzte, bis die Weltkugel sich so schnell drehte, dass die Kontinente und Ozeane nicht mehr zu unterscheiden waren. Seine Hände folgten fahrig der kreisenden Bewegung, und von Merfeld setzte an, von den sich beschleunigenden Zeitläufen zu dozieren und von nahenden Erfindungen, von denen man sich gegenwärtig noch kein Bild machen könne.