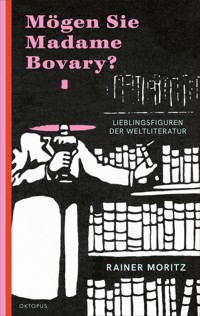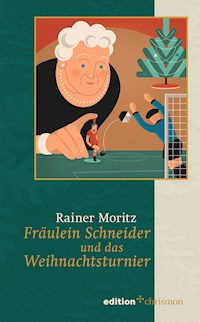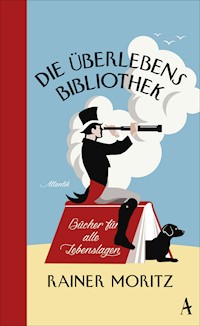6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Reclam 100 Seiten
- Sprache: Deutsch
»Die unverstellte Kühnheit, die sich die Schlagertexter herausnehmen, für große Gefühle nicht mehr Zeit als für ein weichgekochtes Ei aufzuwenden, hat mich schon früh beeindruckt.« »Es war der Itsy Bitsy Teenie Weenie Honolulu-Strand-Bikini«, »Wenn bei Capri die rote Sonne …«, »Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht …« – wer hat das noch nicht lauthals mitgesungen (ob alkoholisiert oder nicht, sei dahingestellt)? Erinnern Sie sich nicht auch gleich an ganz bestimmte Situationen, Menschen, Zeiten? Rainer Moritz ist für dieses Buch in die Vergangenheit gereist. Er zeigt, wann der Schlager »erfunden« wurde, welche Themen er jeweils verarbeitete und was diese – Liebe, Heimat, Bruttosozialprodukt – über uns, die Fans und Hörer, aussagen. Und er führt den Beweis, dass unsere Nationalelf nicht nur trainieren, sondern auch Schlager singen sollte (vielleicht mit Helene Fischer?).
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 113
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Rainer Moritz
Schlager. 100 Seiten
Reclam
Für mehr Informationen zur 100-Seiten-Reihe:
www.reclam.de/100Seiten
2., aktualisierte Ausgabe 2019
2017 Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Covergestaltung: zero-media.net
Coverabbildung: FinePic®
Infografiken: Infographics Group GmbH
Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Made in Germany 2019
RECLAM ist eine eingetragene Marke
der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN978-3-15-961278-2
ISBN der Buchausgabe 978-3-15-020440-5
www.reclam.de
Inhalt
Laugenbrezel, Bill Ramsey und Der kleine Prinz
Die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen
Ist das Kitsch?
Eine kurze Geschichte des Schlagers
Atemlos: die Phänomene Andrea Berg und Helene Fischer
Dieser Sänger braucht nur ein Chanson – die Macht der Interpreten
Peter Alexander
Drafi Deutscher
Howard Carpendale
Was der Schlager uns gibt – eine Leistungsbilanz
Wovon der Schlager handelt, wenn er nicht von der Liebe handelt
Glück
Mode
Fußball
Ökonomie
Abseitiger Exkurs: seltene Schlagervokabeln
Wenn nicht mehr gesungen wird – Desiderata und andere Sprechgesänge
Lektüretipps
Bildnachweis
Zum Autor
Über dieses Buch
Leseprobe aus Royals. 100 Seiten
Laugenbrezel, Bill Ramsey und Der kleine Prinz
Auch Leidenschaften entstehen, irgendwie und irgendwann. Und wenn sich im Nachhinein nicht mehr exakt bestimmen lässt, wann genau sie ihren Anfang nahmen, dann ist die Fantasie gefordert, sich einen symbolischen Startpunkt auszudenken. Mein eigentümliches Interesse für den Schlager setzte ein – und dies gilt für die meisten Interessen –, ohne dass ich es bemerkte. Das Phänomen zeigte sich erstmals ohrenfällig an einem Samstagmorgen in einem Einzelhandelsgeschäft meiner Heimatstadt Heilbronn, bei Bäcker Käser. Dorthin wurde ich, wohl im unschuldigen Alter von acht oder neun Jahren, ausgeschickt, um den familiären Frühstückstisch mit dem zu bereichern, was ein schwäbischer Wochenendauftakt auf jeden Fall benötigt: Laugenbrezeln und Laugenweckle.
Gut zweihundert gefahrlose Meter galt es zurückzulegen, ehe das solide Fachgeschäft an der Ecke Schiller-/Goethestraße erreicht war. Was dort, zur Freude und Erheiterung der reichlich anwesenden Kundschaft und der tresenfüllenden Bäckersfrau, geschah, zeugt von einer musikalischen Früherziehung, die unter strengen pädagogischen Gesichtspunkten mit einigen Fragezeichen zu versehen ist: Ich brachte im Laden, offenkundig ohne größeres Lampenfieber, Bill Ramseys seinerzeit sehr populäres Lied Pigalle (»… das ist die große Mausefalle mitten in Paris«) zu Gehör. Natürlich hatte ich keinerlei Vorstellung, um welche Art von Etablissement es sich dabei handelte oder warum Interpret Ramsey, der häufig mit originellen Schlagern hervortrat, dieses als gefahrvollen Ort bezeichnete. Es mag im Rückblick bedenklich erscheinen, dass ich früh eine Neigung zum moralisch zweideutigen Liedgut entwickelt habe; unter ökonomischen Gesichtspunkten freilich – und diese sind in Schwaben nie von der Hand zu weisen – erwies sich der samstägliche Morgenauftritt als lohnendes Unternehmen: Ich wurde für die schwungvolle Darbietung mit einer Extra-Brezel bedacht, ganz »umsonscht«.
Man muss versuchen, die Wurzeln von obskuren Neigungen zu erfassen; nur so lässt sich verstehen, warum sich ein junger Mensch in den späten sechziger und siebziger Jahren für einen Ausschnitt der Alltagskultur interessierte, der von Gleichaltrigen mit Hohn und Spott bedacht wurde. Sich mit den Verlautbarungen eines Rex Gildo, einer Mary Roos oder einer Juliane Werding zu beschäftigen galt in diesen Jahren (und das Vorurteil hält sich zum Teil bis heute) als Zeichen geistiger Zurückgebliebenheit. Deutsche Schlager zu hören, regelmäßig die ZDF-Hitparade oder Ilja Richters Disco (und das nicht wegen Suzi Quatro oder The Sweet) einzuschalten, damit ließ sich kein Staat und kein Eindruck machen. »Wie die Seele ihre Leidenschaften an falschen Gegenständen auslässt, wenn die richtigen ihr fehlen«, ist einer der Essays von Michel de Montaigne überschrieben, und gewiss ließe sich unter sozialpsychologischem oder ideologiekritischem Blickwinkel (der damals selbst in Heilbronn existierte) ergründen, weshalb sich ein jugendliches Gemüt wie meines derartigen Verirrungen hingab … doch ehrlich gesagt hatte ich dazu noch nie Lust. Es ist besser, zu seinen Geschmacksverirrungen zu stehen.
Zurück zu Bill Ramsey und Bäcker Käser: Show-Einlagen dieser Art fallen nicht vom Himmel. Wer Pigalle oder zumindest dessen Refrain aufs Linoleum eines Ladengeschäftes hinlegt, muss zuvor im häuslichen Kreis manches gehört haben. Meine erste Platte gehörte mir nicht. Sie entstammte der dunkelbraunen Musiktruhe meiner Eltern und war die Langspielplatte Die große Polydor-Schlagerauslese 1964/65, die die großen deutschen Hits jenes Jahres versammelte. Ich habe keine Ahnung, warum mir diese Blütenlese (das Wort Sampler kam erst später) in die Hände fiel und warum ich mir dessen Nummern so genau anhörte. Geblieben ist die festsitzende Erinnerung an einige der Titel, zum Beispiel an den heute in der tiefsten Versenkung verschwundenen Charles Hickman, der Jeder geht seinen Weg singen durfte. Oder an Sacha Distel, den Franzosen mit der unglaublich französischen, vibrierend einschmeichelnden Stimme, der den Frauenfreund beschwor – glaube ich. Oder an Freddy Quinn, einen Lieblingssänger meines Vaters, der auf dieser LP mit einem unbekannteren Lied, Abschied vom Meer, vertreten war, das freilich einprägsame Textzeilen bereitstellte.
Kinder sprechen oft Wörter aus und nach, deren Sinn ihnen vollkommen unverständlich ist. Wie ich Jahre brauchte, um die – im Prinzip schlichte – Etymologie des Wortes »Autobahn-Zubringer« zu begreifen, so blieben mir Freddys dunkle Verse »Abschied vom Meer, von Wolken, von Winden, von Sternen …, von Häfen, vom Flaggenhof im Wind, von Kameraden, die unvergessen sind« rätselhaft. Was oder wer ist ein »Flaggenhof«? Einem meer- und hafenfern aufwachsenden Kind war das nicht einsichtig, und erst Jahre später, beim Wiederhören, verflüchtigte sich der Zauber dieses Substantivs, und ich musste erkennen, dass der Silben verschleifende Freddy keineswegs das Areal einer wohlgeordneten Fahnen- und Flaggenansammlung, sondern vielmehr »Flaggen hoch im Wind« im Blick hatte.
Der allerwichtigste Fund auf dieser Platte war für mich Connie Francis, deren flatterndes italo-amerikanisches Timbre Lass mich gehn forderte, das traurige, entschlossene Abschiedslied einer Frau, die nicht länger Spielball (»Es war nur Liebelei, / dein Herz war nie dabei«) eines leichtfertigen Mannes sein möchte. Abschied gab es, das ist unschwer zu erkennen, reichlich auf dieser Polydor-Langspielplatte. Neben Freddy war – die Erinnerung kommt beim Schreiben – auch Ivo Robić zu hören, mit Rot ist der Wein, der deutschen Version von Spanish Eyes. Freddy und Ivo Robić, diese Namen standen bei meinem Vater hoch im Kurs, weil er sich nie davon abbringen ließ, dass Schlagersänger über gesangliche Fähigkeiten zu verfügen hatten. Interpreten mit einer »guten Stimme« erregten sein Wohlgefallen, und so kam es, dass er auch die Lolitas, Nana Mouskouris und Karel Gotts freudig aufnahm. An dieser Stelle setzte bald kindlicher Widerstand ein, denn ich fühlte mich hingezogen zu Sängern, deren Brüchigkeit im Vortrag mehr schillernderen Reiz besaß als der glatte, vermeintliche Wohlklang der väterlichen Favoriten. Für meinen Vater brach die schwerste Zeit in den Siebzigern an, als mehr und mehr ausländische Erzeugnisse den deutschen Bildschirm okkupierten. Figuren wie Smokie, Joe Cocker oder gar Bonnie Tyler, die, wie mein Vater nicht müde wurde zu betonen, das Mikrofon verschlucken musste, um sich Gehör zu verschaffen, konnte er nichts, rein gar nichts abgewinnen. »Die hat ja überhaupt keine Stimme«, lautete sein knappes Urteil, verbunden mit der Verwunderung, dass dergleichen heutzutage erlaubt sei und sogar gesendet werde.
Die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen
Ernst Blochs Buch Erbschaft dieser Zeit, entstanden zwischen 1924 und 1934, analysiert in Anbetracht des nahenden Faschismus den Niedergang des traditionellen Bürgertums. Seine Formel von der »Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen« als Epochenbeschreibung wird bis heute in philosophischen, soziologischen und feuilletonistischen Schriften aufgegriffen, um, grob gesagt, das Phänomen zu beschreiben, dass sich ein gesellschaftlicher Zustand aus vielen heterogenen Momenten zusammensetzt, aus überkommenen und neuen Strömungen, die gleichzeitig nebeneinander existieren und miteinander konkurrieren. Wer diese Einsicht ernst nimmt, versteht auch Menschen besser, die merkwürdigen, dem Zeitgeist widerstreitenden Neigungen nachgehen.
Konkret: Meine neugierige Anteilnahme am deutschen Schlager der siebziger Jahre stieß bei Mitschülern auf blankes Unverständnis. Zwar hatte ich mich seit meinem Bill-Ramsey-Auftritt in gewissem Maße entwickelt und begann allmählich eine ironisch gefärbte Beschäftigung mit dem Sujet an den Tag zu legen, doch weit, meilenweit entfernt blieb ich von jenen Zeitgenossen, die sich mit den Rock-, Jazz- oder Pop-Highlights befassten. Anders gesagt: Mit dem eminent progressiven Standard, der selbst an einem süddeutschen Gymnasium herrschte, hatte ich nichts zu tun; meine Adoleszenz verlief – ich muss es so sagen – außerhalb der angesagten Gleise.
1999 legte der Musikjournalist Karl Bruckmaier, der ungefähr mein Jahrgang ist, seine Übersicht Soundcheck. Die 101 wichtigsten Platten der Popgeschichte vor … selten zuvor gab mir Gelesenes so stark das Gefühl verpasster Jugend. Viele der von Bruckmaier aufgelisteten Namen sind mir völlig fremd, kaum eine der gerühmten Platten besitze ich, und unter Nummer 79, die T. Rex gnädigerweise Einlass in Bruckmaiers Parnass gewährt, lese ich eine Rundumvernichtung meines frühen Lebens: »Nein, T. Rex durfte man nicht mögen, wenn man ein ernsthafter junger Mann sein wollte zu Beginn der siebziger Jahre.« Wenn schon die Sympathie für T. Rex ausreichte, um ausgeschlossen zu werden, dann möchte ich lieber nicht wissen, in welchem Niemandsland, in welchem Nordkorea ich mich seinerzeit befand.
Was mir folglich blieb, war das offensive, das Selbstbewusstsein stärkende Bekenntnis zu absonderlichen Vorlieben. Ich gewöhnte mir bald an, nicht nur in fußballerischer Hinsicht meine Liebe zum TSV1860 München (der mich immer wieder aufs Tiefste demütigt) demonstrativ zu zeigen, sondern auch mit profunden Christian-Anders- und Bernd-Clüver-Werkkenntnissen aufzuwarten. Wie ernst mir das war, wusste ich selbst wohl nicht immer genau, und so kann ich rückblickend damit leben, mich in dieser Hinsicht außerhalb des Angesagten bewegt zu haben. Ärgerlich erscheint es mir nur, wenn heute Vertreter meiner Generation es für gottgegeben halten, dass man in dieser Zeit unmöglich groß werden konnte, ohne einen anständigen Musikgeschmack zu besitzen. Sie unterschätzen den unterschwelligen Einfluss, den auch abgelehnte Musik zu nehmen vermag. Der Schriftsteller Walter Kempowski hat das auf eine schöne Formel gebracht: »Neulich wurde ich im Radio gefragt, was ich gegen Schlager habe. Nun, ich zog vom Leder, und da sagte der Reporter: ›Vorsicht‹! (Verbrennen Sie sich nicht den Mund!). Alte Schlager, ja, das ist etwas anderes. Melodien, Texte, mit denen man aufgewachsen ist.«
Es wäre gelogen zu sagen, dieser Wesenszug hätte meinem Lebens- und Liebesglück gedient. Mit Schlagern war bei den Mädchen, für die ich mich zaghaft zu interessieren begann, tragischerweise kein Blumentopf zu gewinnen. Versuche, mein Spektrum zu erweitern und mit Platten von Johnny Cash oder Emmylou Harris zu arbeiten, schlugen ebenfalls fehl – etwa an einem sicherlich strahlenden Frühlingsnachmittag, als es mir endlich gelungen war, mit Regine, einem der wenigen nachgerückten Mädchen an unserem vormals reinen Knabengymnasium, näheren Kontakt aufzunehmen. Die Wege zum Glück sind oft Umwege, und so bot eine nahende Physikarbeit Anlass, der Verehrten und Begehrten vorzuschlagen, man könne sich gemeinsam die erforderlichen Kenntnisse aneignen: »Du, zu zweit begreifen wir das vielleicht …« Die raffinierte Anbahnung gelang … was nicht gelang, war die Anstrengung, den Nachmittag mit einer liebevoll aufgenommenen Johnny-Cash-Kassette entspannt ausklingen zu lassen. Regine blieb davon ganz und gar ungerührt, mit dem Man in Black oder dem Ring of Fire war hier nichts auszurichten (und andernorts auch nicht). Die allgemeine Cash-Verehrung kam erst viel später.
Meine Beschäftigung mit Schlagern war somit meist eine introvertierte. Zur Erleichterung meiner Mutter hatte ich schon im zarten Alter keine Probleme damit, mich selbst zu beschäftigen. Stundenlang erwürfelte ich Bundesligatabellen, die ich mit Akribie auf kariertes Papier niederschrieb – künstliche Welten von sich selbst generierendem Reichtum. Nicht minder hartnäckig begann ich mit dreizehn oder vierzehn Jahren, Ordnung in die unübersichtliche Welt des Schlagers zu bringen. Ob Radio Luxemburg, Deutschlandfunk, Südwestfunk 3 – ich wurde zum eifrigen Hörer von Hitparaden und gab mich alsbald mit den Zufälligkeiten und Widersprüchen dieser Ranglisten nicht zufrieden. Ich erstellte Woche für Woche meine hauseigene, dreißig Plätze umfassende Hitparade, die sich zwar an den vergleichbaren, ›objektiv‹ messbaren Unternehmungen der Sendeanstalten orientierte, jedoch bewusst subjektiv Auf- und Absteiger notierte und mit weniger geliebten Interpreten wie Nina & Mike oder Chris Roberts möglicherweise ungerecht verfuhr. Sauber, mit Schreibmaschine geschrieben, wurden diese Listen in einem Leitz-Ordner abgeheftet – mein Wunsch, eine übersichtliche Welt zu schaffen, fand seine erste anschauliche Umsetzung.
Ist das Kitsch?
Wer pubertiert, hat mit ungewohnten Gefühlen zu kämpfen und mit den oft desaströs scheiternden Versuchen, dieses Neuland sprachlich zu beackern. Zwar hält dieser Zustand bei vielen Menschen und vor allem Männern bis ins hohe Alter an, doch die ersten Erfahrungen mit solchen Defiziten sind besonders prekär.
Der Schlager lebt davon, mit klaren Aussagen Hilfestellung zu leisten; seine textlich leicht fassbaren Stehsatzformeln haben, wie es der Volkskundler Werner Mezger ausdrückte, »Prothesenfunktion«. Wer seine Empfindungen nicht zu verbalisieren vermag, sucht Beistand bei anderen, und der Schlager füllt diese Rolle der emotionalen Krücke ideal aus. »Glaube mir«, »Schenk mir dein Vertrauen«, »Weil du ein zärtlicher Mann bist«, »Tanze mit mir in den Morgen« …, so zum Beispiel lauten die Wendungen des Schlagers, die komplexe (partnerschaftliche) Beziehungen auf einfache Formeln bringen – sei es als Sentenz, sei es als Imperativ. Große Schlager, die sich in die Gedächtnisschleifen der Menschen eingraben, erlangen nach und nach Zitatcharakter und taugen allmählich fürs Poesiealbum. Ihre Refrains gewinnen, wie Goethe- und Schiller-Verse, eine Eingängigkeit, nach der viele Schriftsteller zeitlebens vergeblich streben.
Richtige Literatur – so lernte ich früh – zeichne sich dadurch aus, dass sie ambivalent sei, »Leerstellen« aufweise und permanent zu neuen Deutungen einlade, was den damit befassten Wissenschaftlern nur recht ist. Der Schlager also biete – wie die Romane einer Utta Danella – Triviales und entziehe sich deshalb einer ernsthaften Beschäftigung, es sei denn, reformierte Lehrpläne sehen es vor, dass die Gebrauchsformen der Unterhaltungsgenres zu behandeln seien. In den siebziger Jahren, als ich meine ersten prägenden Erfahrungen mit Literatur machte, kam es in Mode, den gymnasialen Unterricht nicht allein mit Faust und Wallenstein zu bestreiten, sondern sich – in ideologiekritischer Absicht – auch »Texten« des Alltags (aus der Waschmittelwerbung zum Beispiel) oder literarisch nicht satisfaktionsfähigen Kommerzprodukten zuzuwenden. Wer durchschaue, so die Intention, wie die Mechanismen der Unterhaltungs- und Vernebelungsindustrie funktionierten, der sei für die Zukunft gewappnet … und für die hehre Kunst gerettet.