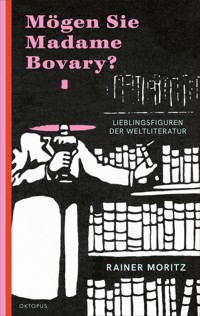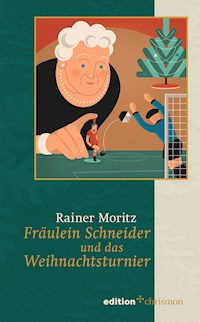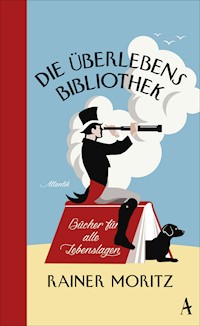8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Wie war das damals in den Sechziger- und Siebzigerjahren, als der erste VW-Käfer vors Haus kam, Heide Rosendahl Weitsprunggold holte und Willy Brandt zurücktreten musste? Wie fühlte sich das an, zum ersten Mal französischen Wein zu trinken und ein Mädchen zu küssen, obwohl der Kontakt zum anderen Geschlecht ungleich mühsamer war? Vieles, was Rainer Moritz vom Aufwachsen in den Zeiten des Wirtschaftswunders erzählt, ist sonderbar und doch wieder typisch: Wurden die heute Fünfzigjährigen deshalb, wie sie sind?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
1. Auflage 2010
ISBN 978-3-492-95684-0
© Piper Verlag GmbH, München 2008 Covergestaltung: semper smile, München Covermotiv: Gunter Glücklich, Hamburg Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck
»In der Tasche waren ein dickes Notizbuch, beinahe vollgeschrieben, meine Brille für zweitausendfünfhundert Kronen und ein Buch von Alice Munro gewesen: ›A Friend of my Youth‹. Ich lese es zum dritten Mal, ich habe alle ihre Bücher, denn sie haben ein Gewicht und eine Kraft, die nicht beschönigt, sondern sagt, dass nichts vergebens ist, was immer wir tun, solange wir nur rechtzeitig zurückschauen.«
PER PETTERSON, Im Kielwasser
»Ist das nicht ein Kleinbürgersyndrom, zu glauben, dass alles irgendwie exemplarisch ist, was man ist und wie man ist und warum man so ist?«
ROBERT MENASSE, Don Juan de la Mancha
Schönen Gruß vom Getriebe
FAMILIE
Wir waren eine richtige Familie. Damals, als es fast nur richtige Familien gab. Mal abgesehen von der alten Frau Schilling im Haus, einer Witwe, die familienlos war. Oder von den Seewalds, die im Erdgeschoss wohnten, keine Kinder hatten und Ölbilder malten. Wir waren eine Familie, mit Vater und Mutter, die 1952 jung geheiratet hatten. Dass sie das auch taten, weil mein Bruder »unterwegs« war, ließ sich selbst mit bescheidenen Rechenkünsten ermitteln. Wenn wir meine Mutter darauf ansprachen, errötete sie, lachte verlegen und versuchte zu meinem Leidwesen rasch das Thema zu wechseln. Immerhin, so hieß es, sei Vater, gebürtiger Oberpfälzer, ein fescher Bursch gewesen. Die Krabbelkiste mit den Familienfotos – Anlass für Erinnerungsabende, die von den Teilnehmern unterschiedlich stark genossen wurden – belegte es: Man sah Vater als schneidigen, gut gebauten Feldhandballer, der auf Geselligkeiten in Neusäß, wo sich meine Eltern kennengelernt hatten, gekonnt das Tanzbein geschwungen und herumpoussiert habe. Das deutete zumindest die Verwandtschaft an. Auch darüber wurde nie ausführlich gesprochen.
Vater als Handballer[1]
Vater und Mutter, das waren die Eltern, daran gab es nichts zu rütteln. Dass Ehen auseinandergehen und Kinder zu Scheidungsopfern werden, kannte ich nur vom Hörensagen oder aus der Zeitung, Elizabeth Taylor zum Beispiel, doch die zählte nicht zu unserem Bekanntenkreis. Schlüsselkinder hingegen gab es, bemitleidenswerte Geschöpfe, deren Eltern beide arbeiteten, weil sonst das Geld nicht gereicht hätte. Meine Frau braucht nicht zu arbeiten, pflegte Vater zu sagen. Ein Satz, den er mit der Genugtuung des Ernährers intonierte. Meine Mutter kommentierte ihn nicht. Jahre später, als wir Kinder aus dem Haus waren, setzte sich Mutter durch und begann wieder zu arbeiten. Es dauerte eine Weile, bis Vater aus dieser Not eine Tugend machte und die Berufstätigkeit seiner Frau mit verhaltenem Stolz erwähnte. Den Führerschein machte Mutter in den Siebzigerjahren, heimlich. Bis sie beim Mittagessen das graue Dokument neben Vaters Teller legte, triumphierend.
Auf Familienfahrten fuhr dennoch Vater. Neben seiner ungeübten, zu spät und ruppig schaltenden Frau – schönen Gruß vom Getriebe! – auf dem Beifahrersitz Platz zu nehmen hätte ihm stark zugesetzt. Dieses heftige Mitbremsen, dieses verkrampfte Sich-Festhalten an der Handschlaufe, dieses »Pass auf, da vorne kommt einer!«.
Wie kann man nur so unmusikalisch sein!
MUSIK
Vater sang gut. Eine Familienfeierlichkeit ohne seinen Auftritt war undenkbar. Angefeuert von einem Hammer Jubelbrand oder einem Scharlachberg, ließ es sich Vater nicht nehmen, Rudi Schurickes »Capri-Fischer« zu intonieren. Unentwegt diese Italiener, die unentwegt aufs Meer hinausfuhren, die untergehende rote Sonne und eine Bella Marie, zu der der Fischer zurückkommt, morgen früh. Mir waren diese Auftritte peinlich. Zu wissen, dass Vater gleich wieder singen würde, weckte den Wunsch, von der Familie abzurücken. Überhaupt veränderte sich die Stimmung, wenn Alkohol im Spiel war. Die Erwachsenen ereiferten sich, hatten rote Backen, erzählten Witze und benahmen sich anders als sonst, so, als bräche aus ihnen heraus, was im Alltag sorgsam verborgen blieb. Schneidender Zigarettenrauch hing über den Holztischen; das Bier stand schaumlos in dickwandigen, gefurchten Gläsern, und wenn ich an solchen Abenden endlich im Bett lag, hoffte ich inständig, dass am nächsten Morgen alles wieder wäre wie vorher.
Ich sang schlecht und vermied es, mit musikalischer Früherziehung in Berührung zu kommen. Mein Bruder musste als Erstgeborener mehr über sich ergehen lassen. Selbst in einem Nicht-Bildungsbürger-Haushalt galt es als erstrebenswert, ein Musikinstrument zu beherrschen. Mit der hellbraunen Blockflöte nahm es seinen Anfang, und dabei blieb es auch, denn die eingeschränkte Begabung meines Bruders war so ohrenfällig, dass seine Unterweisung bald eingestellt wurde. Wie kann man nur so unmusikalisch sein! Ich erinnere mich nicht, ernsthaft mit einer Flöte hantiert zu haben. Überhaupt waren Flöten unattraktiv und etwas für Mädchen. Selbst Gheorghe Zamfir, der später die elegante Panflöte salonfähig machte, änderte daran nichts. Außerdem war der Ausländer, kam vom Balkan oder so, und diesen Menschen lag die Musikalität im Blut, wie den Zigeunern.
Gut, dass wir da nicht wohnen
FAMILIE
Mit drei Kindern galten wir als klassisch bestückte Familie. Mehr Kinder zu haben, das kam bei Pfarrers vor oder in Familien, die asozial waren. Ein Wort, in dem tiefe Missbilligung mitschwang. Mit asozialen Verhältnissen wollten wir nichts zu tun haben, das klang nach verwahrlost, schmutzig, arm und vom Kriminellen nicht weit entfernt. Davon hielten wir uns abseits. Bestimmte Stadtteile wiesen einen hohen Asozialenanteil auf, unserer nicht. Gut, dass wir da nicht wohnen.
Eine gut gekleidete Familie[2]
Ungewöhnlich an unserer Familie war nur, dass wir Geschwister in großen Abständen zur Welt gekommen waren. Jeweils mit gut fünfeinhalb Jahren Unterschied. Ich war das Mittelkind – ein Ausdruck wie Mittelklassewagen. Mittelkinder hatten es, wie ich später erfuhr, selten leicht: kein Anrecht auf die Thronfolge und auch nicht das verhätschelte Nesthäkchen. Als Mittelkind läuft man mit, fällt nicht auf, ist nichts Besonderes.
Alte Reichsstadt, junge Großstadt
ORTE
Heilbronn kämpfte lange darum, Großstadt zu werden, zahlenmäßig. Mit Eingemeindungen gelang es schließlich, die Schallmauer von 100000 Einwohnern zu durchbrechen: »Alte Reichsstadt, junge Großstadt« hieß es danach. Wenn man in Heilbronn aufwuchs, machte man sich wenig Gedanken darüber, ob es anderswo aufregender wäre. Heilbronn lag irgendwo zwischen allem, kein richtiges Schwaben, auch nicht Baden oder Hohenlohe. »Zentrum der Region Franken«, dieser Slogan erschien mir unsinnig. Franken, wusste ich, das war Nürnberg oder Bamberg, wo man das »r« rollte. Heilbronn, gebeutelt durch die Bombenangriffe vom Dezember 1944, wurde aufgebaut, wie man es damals für zweckmäßig hielt: mit der Horten-Kaufhausfassade als Fluchtpunkt, mit einer flachen Festhalle namens Harmonie, einem Betonverhau namens Wollhaus-Center, dem Shopping-Haus, das dubiose Etablissements beherbergte, ein immerhin so reizloses Gebäude, dass man sich ungesehen in den ersten Stock schleichen konnte, um die Ankündigungsfotos von »Lass jucken, Kumpel« zu prüfen. Heilbronn galt nicht viel. Wenn man erzählte, dass man von dort komme, machte das nur Eindruck bei solchen, die es noch schlimmer erwischt hatten, Bielefeldern, Wolfsburgern. Gestört hat mich das nicht: Wir lebten eben in Heilbronn; das kannte ich, da gehörte ich hin. Auf Urlaubsfahrten winkten wir Autos mit HN-Kennzeichen zu, kaum dass wir hinterm Drackensteiner Hang waren. Je ferner man der Heimat kam, desto dringlicher mein Bedürfnis, sich zu ihr zu bekennen. Einen Unterschied merkte man erst, wenn man nach München kam, in Stuttgart weniger. Oft fuhren wir nicht in größere Städte. Warum auch.
Heilbronner Reize:Tankstelle an der Weinsberger Straße[3]
Wählt Dr.Nägele
POLITIK & GESELLSCHAFT
Früh übte ich mich im Wahlkampf und versuchte die Heilbronner Oberbürgermeisterwahlen zu beeinflussen. 1967 schrieb ich »Wählt Dr.Nägele« mit weißer Kreide auf die Gehwege in der Schillerstraße. Warum? Weil sein Gegenkandidat Hoffmann aus dem benachbarten Neckarsulm kam? Meinem Vater gefiel dieses Engagement, zumal Dr.Nägele kein SPD-Mann war. Freie Wähler, das versprach Unabhängigkeit. OB-Wahlen seien noch Persönlichkeitswahlen, sagte Vater, nicht so wie bei Bundestagswahlen, wo es anderes zu bedenken gebe. Genützt hat es nichts; gewählt wurde Dr.Nägele nicht.
Ich habe auch hinten Augen
FILM & FERNSEHEN
Ein Fernsehgerät wurde angeschafft, der Unterhaltung wegen und weil es als Symbol ersten Wohlstands galt, wenn man sich diesen Luxus leistete. Natürlich durfte ich nicht sehen, was ich sehen wollte. Manchmal gelang es mir, mich aus dem Bett zur Wohnzimmertür zu schleichen und durch den Spalt – die Türe war »bei«, ein Ausdruck, der außerhalb unserer Familie nicht zu existieren schien – Ausschnitte von Krimiserien zu erhaschen. Ich atmete übervorsichtig, fror an den Füßen, verrenkte den Kopf und versuchte, jedes verdächtige Geräusche zu vermeiden. Hoffentlich brauchte Vater kein frisches Bier aus der Küche, Riegele-Bräu. Mutter hielt mit einem Glas Riesling länger durch. Roger Moore als Simon Templar musste ich unbedingt sehen. Wie attraktiv eine Sendung durch den Hinweis »Der nachfolgende Film ist für Jugendliche unter 18Jahren nicht geeignet« wurde! Meistens funktionierte das Türspaltfernsehen nur ein paar Minuten, bis Mutter merkte, was sich hinter ihrem Rücken abspielte. Ich habe auch hinten Augen.
Fernsehserien, die die Eltern interessant fanden, waren grauenvoll. Wie Wastl Fanderls »Baierisches Bilder- und Notenbüchl«, wo alpenländische Weisen auf der Zither gezupft wurden. Stubenmusi. Oder »Der Fenstergucker«, mit Stadtporträts, historischen Erzählungen, vorgetragen von einer Stimme, die gar nichts von der Leidenschaft der geliebten Sportreporter hatte. Klose, Maibohm, Wolfbauer … ja, wenn die beim »Fenstergucker« im Einsatz gewesen wären. Aber so … dafür hatte keiner den Fernsehapparat erfunden.
Ob die auch privat etwas miteinander haben?
SPORT
Es gab Sportarten, die fast so schrecklich anzuschauen waren wie der »Fenstergucker«. Dressurreiten, Rudern oder Eiskunstlaufen, das sich Mutter gern ansah. Weil sich die Läufer so künstlerisch bewegten und weil nicht gehauen und gegrätscht wurde. Das Paar laufe so harmonisch, als ob man zwei Stiefmütterchen aneinanderreibe, sagte ein Reporter, der Rauschenbach hieß. Ich wartete darauf, dass sich die Kufen plötzlich verkanteten und die Läufer kräftig aufs Eis knallten. Wie schnell die dann wieder auf die Beine kamen. Aber das nützte denen nichts: Innerhalb weniger Sekunden ging die Hoffnung auf Gold dahin, ein Sturz, und aus der Traum. Ein bisschen grausam, aber unterhaltsamer anzusehen als all diese fehlerlos faden Todesspiralen und weggeworfenen Rittberger.
Paarlaufen galt als ästhetisch. Fünf Minuten Anmut und Harmonie. Und am Ende trotz völliger Erschöpfung ein eingefrorenes Lächeln in die Kamera. Immer so tun, als sei alles großartig gewesen. Meistens gewannen die Russen mit den schwierig auszusprechenden Namen: Ludmila Belousowa und Oleg Protopopow. Und das gegen unser Traumpaar Kilius/Bäumler! Im Gegensatz zu dem ältlich wirkenden russischen Paar besangen die Schallplatten, über einen Honeymoon in St.Tropez. Ob die auch privat etwas miteinander haben?, fragte Vater in die Runde. Mutter hatte so was läuten hören. Die Kilius-Kollegin Margot Glockshuber lief allein und sang nichts – aber was für ein Name: Glockshuber. Fast so wie Margit Sponheimer.
Russische Eislaufkunst[4]
Ich mochte das amerikanische Geschwisterpaar am liebsten, das sich wohl oder übel immer mit Platz 3 begnügte, Cynthia und Ronald Kauffmann. Mit seiner eigenen Schwester Sport zu treiben, ihr ständig zuzulächeln und freundlich zu tun erschien mir bewundernswert. Das gab es sogar in Deutschland, in Ravensburg, woher die Eistänzer Erich und Angelika Buck kamen. Manche Geschwister sangen zusammen, Caterina Valente und Silvio Francesco, obwohl man das ihren Namen nicht anmerkte. Quando, quando … Itsy Beetsy Teenie Weenie Honololu Strand-Bikini. Oder Renate und Werner Leismann aus dem Sauerland – was für ein merkwürdiger Name!–, die gern mit einem Schlafsack und einer Gitarre durch die Natur zogen. Bei Gesangsduos schnitten die Männer dürftig ab, das schien die Regel zu sein, egal ob Geschwister oder Eheleute. Cindy & Bert, Inga & Wolf, Nina & Mike, Ike & Tina Turner – die Männer waren Beiwerk mit dünner Stimme und schlechter Frisur. Bei Cynthia und Ronald Kauffmann, die an den Russen und den Deutschen partout nicht vorbeikamen, war das anders. Ronald sang ja nicht.
Heute kommt die liebe Brigitte dran
EROTIK
Am Anfang war Tante Gisela, die Kindergartentante. Ihre Frisur saß wie aufgeschäumt; tröstend nahm sie mich in die Arme, denn zu trösten gab es im Kindergarten genug. Ich roch ihr Kölnisch Wasser, schmiegte mich an sie, sie strich mir übers Haar. Wie gut das tat. Der Fußweg dorthin, vorbei an der Metzgerei, in deren Hinterhof ein Schäferhund schläfrig vor seiner Hütte lag. Minutenlang verharrte ich auf der anderen Straßenseite, bibbernd, fürchtend, dass das gefährliche Tier die Straße kreuzen und mich anfallen würde. Und dann die fremden, anstrengenden Kinder, die ohne Tante Gisela nicht zu ertragen gewesen wären.
Sich ihr freundlich anzunähern zog keine Begünstigung nach sich. In der Adventszeit, als schön eingeschlagene Päckchen an einer Schnur quer durch den Raum hingen, für jedes Kind eines: Wer kam als Erster dran, wer musste bis zum Zweiundzwanzigsten warten? Ruhig atmen, bis Tante Gisela den Namen des Glücklichen ausrief. Ganz fest wollen, dass man selbst endlich drankäme. Sich nichts anmerken lassen. Gleichgültig an die Decke schauen, seine Schuhspitzen prüfen, Tante Gisela auf keinen Fall ansehen, nicht unruhig auf dem Sitz herumrutschen. Es wäre zu gemein, wenn schon wieder einer von den anderen an der Reihe wäre. Tante Gisela verteilte ihre Gunst gerecht. Dass sie die Stillen und Schüchternen bevorzugte, merkte ich. Heute kommt die liebe Brigitte dran. Das war ja in Ordnung, von mir aus. Aber jetzt müsste ich endlich aufgerufen werden. Dann nach Hause rennen, der Schäferhund war mittags nicht zu sehen, vorbei an der Schule, am Lichdi und Konsum, am Schuhmacherladen, Sturm klingeln, die Treppe hoch und sofort von dieser Sternstunde erzählen. Ein Weihnachtspäckchen, überreicht von Tante Gisela!
Dein Teller wird aufgegessen!
ESSEN & TRINKEN
Der Freitag war fleischlos, was mit Religion zu tun hatte. Der Freitag war fleischlos, ohne lange Erklärungen, billiger war es auch. Fischstäbchen, ja. Spiegelei mit Rahmspinat. Leberspätzlesuppe – das galt nicht als Fleisch – mit süßem Auflauf und Kompott hinterher. Später, als die Küche feiner wurde, überbackenes Fischfilet mit Käsesoße. Reibekuchen mit – das galt nicht als Fleisch – einem kleinen Stück fettem Speck in der Mitte, um das ich so lange herumschnitt, bis es allein auf dem Teller zurückblieb. Das Beste zum Schluss.
Wenn es nicht Freitag war, gab es Kutteln – einmal zumindest. Kutteln, diese ekelhaften Vormagenstreifen, eingetaucht in braune Tunke, wie Regenwürmer sich windend, von ledriger Konsistenz, auf der Zunge verharrend, den Rachen verstopfend, die Speiseröhre sich mühsam hinunterhangelnd. Für die Franzosen und Italiener sind Kutteln eine Delikatesse! Vaters Appell blieb ungehört. Die essen auch Frösche. Ich saß trotzig vor meinem Teller, rührte darin herum, wollte keinen der scheußlichen Bissen zum Mund führen. Du isst deinen Teller auf. Der Scherz, dass man schon an dem genug habe, was auf dem Teller liege, half nicht. Der Nachmittagsunterricht nahte, die kalt gewordenen Kutteln quollen auf in der erstarrten, morastigen Soße, wurden ums Verrecken nicht weniger. Mutter ignorierte mich. Dein Teller wird aufgegessen. Ich weinte. Nichts half. Kutteln hat es danach zu Hause nie wieder gegeben. Wenn Vater meinte, es ohne diese schwäbische Spezialität nicht aushalten zu können, musste er auf Weinfesten oder in Wirtschaften zuschlagen.
Alle in einer Reihe aufstellen!
SCHULE
Am ersten Schultag blieb ich im Bett: Röteln. Kein stolzer Gang mit der Schultüte. Dahin darfst du noch oft genug. In das Pavillongebäude mit dem kleinen Hof, Ecke Siebennussbaumstraße, wo man im Herbst Walnüsse schlug. Einen Stock hochwerfen in die Äste, hoffend, dass ein paar grün vernarbte Kugeln herunterfielen. Oberlehrer Räpple wartete auf uns, im weißen Mantel, trockene Kreide in der Hand, die staubte, durchdringend roch und markerschütternd quietschte, wenn man sie schräg an der Tafel aufsetzte. Alle in einer Reihe aufstellen! Räpple stand erhaben da, prüfte die Sauberkeit der Schüler. Ängstlich wartete ich, bis er zu mir kam. Würde er merken, dass ich an den Fingernägeln kaute? Er sah mich fragend an: Beißt du an deinen Nägeln herum? Nein, nein, ich schüttelte schnell den Kopf, wollte nicht ertappt werden. Die sind nur gerade kurz geschnitten worden, ganz kurz, gestern Abend. Lehrer Räpple zog weiter, zu Reinald, Norbert, Thomas, Edeltraud, Annette, Ulrike, Dorothea. Ich verschränkte die Hände auf dem Rücken, sah starr auf die Glasfront des Pavillons und blies Luft durch die Nase.
Allein auf dem Balkon[5]
Danke, Meister!
FILM & FERNSEHEN
Plötzlich Angst haben, nicht mehr wissen, wie einem zu helfen ist, wer einem helfen wird. Mutter und Vater mochten Opern und Operetten, vor allem im Fernsehen. Was einem das gab, begriff ich nicht: albern gestikulierende Schauspieler, die auf einen Schlag zu singen anfingen in einer Lautstärke und Tonlage, dass man kein Wort verstand. Oft italienisch, das war ehrlicher, das versuchte ich erst gar nicht zu verstehen. Die Sängerinnen waren sehr kräftig, um nicht zu sagen fett. Resonanzkörper nannte Vater das, und ohne den ließen sich keine Arien singen. Einmal sah ich genauer hin, bei einer Oper, die »Hänsel und Gretel« hieß, wie das Märchen, das ich gut kannte. Die Oper machte mir Angst, der düstere Wald, die böse Hexe, die den Kindern keine Chance ließ. In den Ofen wollte sie die beiden stecken, in die glühende Hitze, bis sie elend verbrennen würden. Was geschähe mit Hänsel und Gretel, wenn sie tot wären, nicht mehr auf der Erde? Wo kämen sie hin? Tot sein, das war sicher vorübergehend; unter dem Himmel, von dem Mutter redete, wusste ich mir nichts vorzustellen. Sich selbst nicht mehr zu haben – wie ging das? Ich war ich, und wenn es mich nicht mehr gäbe, wo wäre ich dann? Eine Vorstellung, die mich in eine bodenlose Schlucht fallen ließ, eine Vorstellung, die mir den Brustkorb zudrückte und die ich nicht zu bannen vermochte. Ich zwang mich, diesen Gedanken wegzuschieben, der meist nachts im Bett kam, vor dem Einschlafen. Schnell sich etwas anderes überlegen. An den Tod ließ sich nicht dauerhaft denken. Der Tod gefährdete das Schöne, selbst an Nikolaus, der mitunter persönlich einen Besuch abstattete und die Wunschzettel in Empfang nahm. Wenn ihr nicht brav seid, steckt euch der Nikolaus in seinen großen braunen Sack und nimmt euch mit. Wohin brächte mich der Nikolaus, fort von den Eltern und den Geschwistern? Wo würde ich leben und wie? In den Sack gesteckt und in den Ofen der Hexe geschoben zu werden war ein und dasselbe. Sich zu wehren hätte keinen Sinn, aber dass Vater und Mutter es zuließen, dass der fremde Nikolaus mich mitnähme, konnte ich mir nicht vorstellen. Andererseits verkörperte der vielleicht eine höhere Macht, gegen die selbst die Eltern nichts ausrichteten. Wenn die Angst abends im Bett wiederkam, schloss ich sofort die Augen, ganz fest, wollte die Gedanken verscheuchen. Aufhören damit, aufhören, sonst würde es mich zerreißen. An das Gegenteil denken, an Jeannie den Flaschengeist, diese wasserstoffblonde Frau. Die war über 2000Jahre alt, lebte ewig und sorgte zudem dafür, dass ihrem Major nichts Böses geschah. Ehe man sich versah, tauchte Jeannie leicht bekleidet aus einer Plüschflasche auf. Mit einer solchen Frau an der Seite fühlte man sich sicher. An Jeannie denken, jetzt im Bett, sich ihren Zopf vorstellen, ihr helles Lachen, ihr Augenblinzeln und wie sie Major Nelson in den Wahnsinn trieb. Danke, Meister! Wenn ich lange genug an Jeannie dachte, verblasste die Angst vor dem Tod.
Da kann euch der Winter nichts anhaben!
FAMILIE
Erkältungskrankheiten muss man vorbeugen. Mit Vitaminen, versteckt in Äpfeln, Orangen, die Apfelsinen hießen, im Rhabarbersaft, den Mutter in einem großen Apparat, dem Entsafter, selbst herstellte. Im Winter, wenn die Grippewelle heranrollte, hatte Mutter – das ist wissenschaftlich erwiesen! – Lebertrankügelchen zur Hand, nach dem Frühstück. Nur gleich hinunterschlucken mit einem Schwall Nesquick. Da kann euch der Winter nichts anhaben! Ja nicht darauf herumkauen, sonst platzten die Dinger auf, und eine widerlich schmeckende Flüssigkeit ergoss sich in den Mund. Habt ihr eure Kugeln geschluckt? Ja, Mutti, klar. Besser als der ölige Saft, den Mutter auf einen Löffel träufelte und einem in den Mund zwängte. Augen zu, grimassieren und schnell schlucken. Lebertran als Pastille war ein Fortschritt.
Der hat Stimme
MUSIK
Im Wohnzimmer die nussbraune Musiktruhe, die Lautsprecher versteckt hinter schmuddliggelben Lamellen. Ab und zu kramte ich in der Plattensammlung. Operetten- und Opernausschnitte. Die knisternde Weihnachtsplatte mit einem Hund, der vor einem Grammophon saß. In einem Skai-Kunstlederalbum mit durchsichtigen Folien die 45-er-Schallplatten, Willy Schneider, Medium Terzett. Und die Langspielplatte »Polydor-Schlagerauslese«, die ich häufig anhörte. Vorsichtig den Hebel umlegen, bis der Arm des Plattenspielers langsam hinüberschwenkte und die Nadel sanft aufsetzte. Es rauschte und knackte, dann sang ein Amerikaner namens Charlie Hickman von einem Weg, der mal zu Ende geht, Connie Francis von einem Mann, dem alles nur »Liebelei« war … lass mich gehn, lass mich gehn, denn es hat keinen Sinn, weil der Platz neben dir nicht mehr frei ist … und Freddy, einer von Vaters Lieblingsinterpreten – »Der hat Stimme, der muss das Mikrofon nicht verschlucken!«–, vom Meer und vom Abschiednehmen, von Häfen, vom Flaggenhof hoch im Wind. Mir gefielen die traurigen Lieder am besten, ohne rhythmisches Klatschen und aufgesetzte Fröhlichkeit. Musik hören ganz für sich allein, ungestört von den anderen, das genoss ich intensiver, wenn einem mulmig ums Herz wurde. »Lass mich gehn«, bat Connie Francis den Mann, der sie nicht so aufrichtig behandelt hatte, wie sie es wollte. Wie bedauerlich, zu lieben und hinterher zugeben zu müssen, dass es besser wäre, sich zu trennen.
Das Größte überhaupt war der automatische Plattenwechsler. Ein Metallstab, auf dem man zehn Schallplatten stapelte, und kaum war eine abgespielt, fiel die nächste herunter, einfach so, und weiter ging es. Damit stellte ich mein eigenes Musikprogramm zusammen, wie im Radio. Mit professioneller Ansage: Als Nächstes, meine lieben Schlagerfreunde, hören Sie aus Frankreich Sacha Distel mit »Adios amigo«! Mit einem Kochlöffel oder der Staubsaugerdüse als Mikrofon.
Die hat uns an den Ami verraten
FILM & FERNSEHEN
Auf Western war Verlass. Andere Filme sah Vater ohnehin nicht gern. Vielleicht mal alte Heimat- oder Musikschnulzen mit den großen Künstlern – »Solche gibt es heute gar nicht mehr!« – seiner Jugend. Mit Hans Moser, Paul Hörbiger, O. W. Fischer, Ruth Leuwerik, Rudolf Prack, Zarah Leander. Nichts mit Marlene Dietrich: Die hat uns an den Ami verraten. Bei Western gab es keinen Streit. Für einen guten Western brauchte es keinen Frankenfeld oder Otto Höpfner. Und es durfte deftig zugehen, mit wüsten Schlägereien, Schusswechseln und leichten Mädchen, die für die Handlung meist unerheblich waren. Was für Kerle, die da auf Pferden heranstürmten, sich nur mit einer ganzen Flasche Whisky zufriedengaben – gefärbtes Wasser, erklärte Vater – und nach dem zehnten Faustschlag ins Gesicht kaum verletzt aufstanden, während ich mir das Kinn rieb. Duelle, in Sekundenschnelle ging da ein Leben dahin, wand sich ein winselnder Körper auf der staubigen Straße. Gut, dass es bei uns in der Kerner- oder Eberstädter Straße anders zuging und man das nur in der Faschingszeit nachmachte. Mit Cowboyhut und Käpselespistole, als Sheriff oder Marshal.
Burt Lancaster, Richard Widmark, John Wayne, die gab es nur in Amerika, im Wilden Westen. Männer, die das Recht durchsetzten, auch gegen die Indianer, die verschlagen und feige waren.
Erst mit Winnetou änderte sich die Lage, dann durfte sich ein guter Indianer sogar mit den guten Revolverhelden messen. Mit Gary Cooper freilich nahm es selbst der beste Apachenhäuptling nicht auf. Gary Cooper, wie er in »Zwölf Uhr mittags«von allen verlassen gegen die fiesen Miller-Brüder kämpfte. Alle schmeichelten ihm, alle taten dankbar, und dann, als es darauf ankam, drückten sie sich, hatten sie Dringendes zu erledigen. Der Minutenzeiger, der gnadenlos vorrückte, die einprägsame Melodie im Hintergrund. An diesem Film sah ich mich nicht satt. Immer an der gleichen Stelle kamen mir die Tränen: Wenn Gary Cooper beziehungsweise Will Kane die Kirche betritt und mitbekommt, wie Sympathie umschlägt in Feigheit, wie er merkt, dass er mutterseelenallein sein wird. Am Ende die Genugtuung, nachdem er die Miller-Bande erlegt und selbst seine Frau (Vater, was ist denn das, eine Quäkerin?) die Waffe in die Hand genommen hat: Cooper reißt sich den Stern von der Weste und wirft ihn in den Straßenschmutz, den engstirnigen Angsthasen trotzig in die Augen sehend. Was für eine Geste! Ja, so wie Gary Cooper wollte ich werden. Auch bei den Frauen, erst diese heißblütige Saloonbesitzerin, die so dunkle Haare wie Schneewittchen hatte, und später die hellhäutig-sanfte Grace Kelly mit dem hingebungsvollem Blick, hatte man als gerechter Marshal Erfolg.
Die sind fast noch wie neu
FAMILIE
Ihr immer mit euren Western. Mutter zuckte mit den Achseln, wäre nie auf die Idee gekommen, sich gegen diese »ständige Knallerei« zur Wehr zu setzen. Während Vater und Söhne fieberten, ob der Treck unschuldiger Farmer dem feigen Hinterhalt der Rothäute entkommen würde, saß Mutter im Sessel, nur ab einem bestimmten Geräuschpegel resigniert zum Fernsehschirm aufblickend, und ging hausfraulichen Abendbeschäftigungen nach. Woher ihr immer diese Löcher in die Socken bekommt! Sie schüttelte den Kopf, mehr eingespielte Mimik als echte Empörung. Mit sicheren Handgriffen stopfte sie die Löcher. Ihr müsst nicht glauben, dass ich ständig neue Strümpfe für euch kaufe. Schön sahen die geflickten nicht aus. Beim Sportunterricht die Straßenschuhe ausziehen und schnell in die Sportschuhe schlüpfen. Sandalen und gestopfte Stocken geht nicht. Und dazu die Flicken auf den Hosen, ständig scheuerst du sie an den Knien durch. Und immer die abgelegten Sachen meines Bruders, die ich auftragen sollte. Die sind fast noch wie neu, viel zu gut für die Altkleidersammlung.
Jetzt kommen die Saläter!
ORTE
Am Sonntag in die Natur. Ihr wollt doch nicht den ganzen Tag in der Stube hocken, kommt nicht in Frage. Ich wäre gern zu Hause geblieben, vor dem Radio oder Plattenspieler. Stattdessen: Bei schönem Wetter fuhr man am Sonntagmorgen hinaus, immer in die gleiche Richtung: Mainhardter Wald, Löwensteiner Berge, wandern in Lederhose und Trachtenjanker, der auf der Haut kratzte. War das langweilig. Was für eine herrliche Luft!, rief Mutter aus, sich selbst anfeuernd. Vielleicht finden wir Pilze. Früher in Vaters Jugend in der Oberpfalz, da wuchsen Steinpilze und Rotkappen, wie das Herz sie begehrte. Im Mainhardter Wald brauchte man Glück, jetzt, da immer mehr Leute am Wochenende ins Grüne fuhren, die nicht mehr ganz so herrliche Luft verpesteten, ins Dickicht vorpreschten und blindlings alle Pilze sammelten, die ihnen in die Quere kamen. Nur der Pilzberater, der in der Stadtbücherei Sonntagsdienst schob, hielt die Verrückten davon ab, einen Fliegen- und Knollenblätterpilzpfannkuchen zuzubereiten. Vater lehnte das rundherum ab: Er sammelte nur Steinpilze, Rotkappen, Birkenpilze (selten!) und Pfifferlinge. Später, als er sein System verwässerte, durften Maronen mit ins Spankörbchen.
Und die Walderdbeeren! Nicht zu vergleichen mit den normalen Erdbeeren, die es im Laden zu kaufen gab, wässrig schmeckten, gar kein Aroma hatten. Klein, dunkelrot und duftend wuchsen sie am Wegrand, schwer zu entdecken und immer seltener werdend. Manchmal hieß es, man müsse sie meiden, wegen der Füchse und der Tollwut. Blaubeeren waren leichter zu finden, wenngleich nicht mehr so zahlreich wie in Vaters Kindertagen, als seine Brüder und er die Beeren kannenweise sammelten und auf dem Markt verkauften. Immerhin, am Steinknickle oder Jux, den von uns tapfer erklommenen Anhöhen, gab es genügend Blaubeeren. Oder Schwarzbeeren. Oder Heidelbeeren. Mutter, die im Ruhrgebiet geboren und aufgewachsen war, sagte Bickbeeren. Abends gab es nach der »köstlichen« Pilzsuppe Bickbeeren in Milch.
Nach absolvierter Wanderung parkten wir auf dem Marktplatz in Löwenstein; schräg gegenüber in der Bäckerei an der Durchfahrtsstraße holte Mutter Eiskugeln für jeden. Ist da viel günstiger als in der Stadt, bei Presutti. Malaga, meine Lieblingseissorte, gab es nicht, aber wenigstens Schokolade, Erdbeere oder Vanille. Mit einem knusprigen Kekshörnchen, wenn man mindestens zwei Kugeln nahm. Bei einer – 20Pfennige – musste man sich mit einem watteartigen Oblatenhörnchen begnügen, das nach aufgeblähtem Papier schmeckte.
Wenn es schon morgens – bei dem schönen Wetter! – losging, war das Murren laut. Den ganzen Tag wandern! Kehren wir mittags wenigstens ein? Gibt es da Pommes? Und Cola? Meistens klappte das nicht, vor allem wenn wir in Grab bei Großerlach Rast machten, im Rössle, wo es gemischten Braten gab, mit handgeschabten Spätzle und viel Soß. Pommes waren denen unbekannt. Stattdessen lernte ich ungewöhnliche Pluralformen kennen. »Jetzt kommen die Saläter!« Der Ruf der kräftigen Bedienung schallte durch die sonntags eng besetzte Stube. Echte Schwaben schubsten den Kartoffelsalat in die Bratensoße und mischten alles gut durch. Manchmal gab es drei- oder viergeteilte Teller, wo Braten und Spätzle und G'müs ihre eigenen Fächer hatten. Statt Cola bestellte Vater Apfelsaftschorle. Interessant wurde es am Schluss, wenn es ums Trinkgeld ging. Warum bekommt die Bedienung extra Geld? Und wie viel? Vaters Blick war hoch aufmerksam; als kaufmännischer Angestellter überschlug er im Kopf die angemessene Trinkgeldsumme. Zuvor vergaß er nie, die Rechnungsposten mit dem zu vergleichen, was die Bedienung in ihrer weißen Schürze mit dem Kugelschreiber auf ihren Block addiert hatte. Wehe, wenn sie sich vertat. Manche, erklärte Vater, machten das mit Absicht. Wir kontrollierten alles. Immerhin aß man im Rössle preiswert. Der Löwe ein paar hundert Meter weiter war zu vornehm, aber die hatten sicher Pommes auf der Karte.
Sie sind ja eine kleinkarierte Person!
FAMILIE
»Kleinkariert« war ein Schimpfwort, das die Eltern nie verwendeten. Wenn, dann mokierte man sich über Proleten, Landpomeranzen aus Mosbach oder Asoziale. Damit wollte man nichts zu tun haben, die hatten kein Benehmen, wohnten in üblen Gegenden. Kleinkariert, so nannte uns Frau Altmann, die zwei Etagen über uns wohnte. Sie sind ja eine kleinkarierte Person!, rief sie Mutter im Treppenhaus hinterher. Und das von dieser Zugezogenen aus Norddeutschland, die sich aufbretzelte, wenn sie das Haus verließ, eine Perücke aufsetzte und sich mit womöglich teurem Parfüm einnebelte. Im Treppenhaus, wenn sie zur Waschküche ging, sah sie nichts gleich. Erkennt man sofort, dass das eine Perücke ist. So wie man es Männern anmerkte, wenn sie ein Toupet trugen. Vater mit seinem vollen schwarzen Haar sah das mit einem Blick.
Ich sorge dafür, dass Sie ausziehen müssen, schrie Vater ins Telefon, als er abends bei Altmanns anrief. Lass das doch, beschwichtigte Mutter, so schlimm ist das nicht. Von wegen, rief mein Vater, meine Frau lass ich nicht beleidigen, von der da, die nach Kiel zurückziehen soll, wenn es ihr hier nicht passt. Ich saß unbeweglich im Sofaeck, wollte, dass der Tumult ein Ende fände. Vaters Bellen in den Telefonhörer, Mutters angstvoller Blick. Und die Vorstellung, wie zwei Stockwerke darüber Herr Altmann seinen Telefonapparat traktierte, bestürmt von seiner perückenlosen Frau. Lass dir nichts gefallen von diesen Leuten!
Jetzt tanzen wir nach deren Pfeife
POLITIK & GESELLSCHAFT
Amerika, das war der große Bruder, einerseits. Andererseits: Sie haben uns im Krieg besiegt, und jetzt tanzen wir nach deren Pfeife. Immerhin besser als nach der des Russen. Mutters Schwester hatte einen amerikanischen Lehrer geheiratet, in Heidelberg gewohnt und war nach Colorado gezogen. Sie schrieb fünf-, sechsmal im Jahr lange Briefe – telefonieren war zu teuer, kam nur an Weihnachten in Frage–, in einem Deutsch, das verworrener wurde und sich mit englischen Brocken mischte. Zum Geburtstag schickte mir »Auntie« eine Dollarnote im Briefumschlag, immerhin, das waren vier Mark. Dann erschossen sie den Politiker Robert Kennedy; von John F. Kennedys Ermordung, Jahre zuvor, hatte ich gehört. Dieser Robert Kennedy wollte seinen toten Bruder rächen, gewissermaßen, und Präsident werden. Bis die Bilder im Fernsehen zeigten, wie er blutend dalag. Was für eine Tragödie!, riefen alle. Zwei Brüder, beide so gut aussehend, beide erschossen! Dieses Amerika war ein gefährliches Land, mit Rassenunruhen, Straßenschießereien. Wir können froh sein, dass wir es in Heilbronn ruhig haben. Wann ereigneten sich hier schon Verbrechen. Ja, gut, der Arzt, der angeklagt wurde, seine Frau um die Ecke gebracht zu haben. Obwohl man deren Leiche nie fand. Jeden Morgen blätterte ich schnell zum Lokalteil der »Heilbronner Stimme«, um die Details aus dem Gerichtsprozess nachzulesen. Der beschuldige Arzt tat ganz unschuldig. Er wisse nicht, wo seine Frau geblieben sei, habe keinerlei Erklärung für deren spurloses Verschwinden.
Die Hoffnungsträger[6]
Aber so etwas geschah in Heilbronn nur alle Jubeljahre, leider. Abends musste man freilich aufpassen, vor allem als Frau. Man traut sich abends gar nicht mehr auf die Straße! So weit ist es gekommen, fast wie in Amerika. Kennedy gefiel mir; er kämpfte für die Armen, hieß es, für die Rechte der Schwarzen. Obwohl die nicht gut röchen, sagte Auntie, wenn man im Bus neben ihnen säße. Neger waren nicht dabei, als die Amerikaner kurz darauf zum Mond flogen und es den Russen zeigten. Ich sah aus dem Küchenfenster in den Abendhimmel, Vollmond. Du gehst so stille. Und da oben, ungeheuer viele Kilometer entfernt, stapften Amerikaner in dicken Anzügen umher, rammten ihre Flagge in einen fernen Mondkrater. Man könne, sagten die Kommentatoren, noch nicht abschätzen, ob diesem Beispiel bald viele Menschen folgen würden, ob es zu Urlaubsreisen auf den Mond kommen werde. Irgendwann sicher. Die technische Entwicklung und der Fortschritt seien nicht aufzuhalten. Und die hohen Kosten ließen sich mühelos rechtfertigen durch die Forschungsergebnisse, die sich aufgrund der Messunngen der Astronauten ergäben. Die ließen sich nutzen für neue Medikamente oder Revolutionen auf dem Bratpfannensektor. Die Eroberung des Weltraums könne nicht aufgehalten werden. Der Mensch sei zu allem fähig. Schon tolle Kerle, diese Amis, sagte Vater, da wird sich der Russe schwarz ärgern, Juri Gagarin und der Weltraumhund änderten daran nichts. Warum heißen eigentlich die Amerikaner beim Bäcker Amerikaner? Na, weil die das nach dem Krieg mitgebracht haben. Da waren die Deutschen auf alles scharf, was von da kam, Strümpfe, Zigaretten. Ich mochte am liebsten die mit Schokoguss, vom Böhringer oder wenn Mutter sie selbst backte. Das beherrschte sie wie keine andere. Meine Frau ist eine hervorragende Köchin, sagte Vater oft vor Leuten. Besser als in jeder Wirtschaft isst man bei ihr.
Das Spielfeld ist mein Königreich
SPORT
Für Fußball interessierten sich alle, abgesehen von Mutter und meiner Schwester, die zu klein war. Vater schwärmte von den Spielern vor dem Krieg, von den Nürnbergern und Fürthern, von Stuhlfauth im Tor, Streitle, Goldbrunner, Lechner, Janes. Von Stadionbesuchen am Dutzenteich, im Ronhof, beim BC Augsburg. Stolz saßen wir vor dem Fernsehgerät mit der leicht gewölbten Mattscheibe, als die ersten Spiele übertragen wurden. Ich durfte zuschauen, auf dem Teppichboden liegend und hoffend, dass es die Münchner Löwen im Endspiel gegen West Ham United, die starken Engländer, packten. Vater fand es ungerecht, dass das Spiel in London ausgetragen wurde, im Wembley-Stadion: Heimvorteil! Aber die Münchner mit ihrem strengen Trainer Merkel hatten ja den Radenkovic im Tor. Den verrückten Hund, der sein Gehäuse verließ, Ausflüge machte, bis die Zuschauer ängstlich aufschrien. Geh zurück in deinen Kasten, du Spinner! Der Radi machte sich daraus nichts. Im Halbfinale, im Entscheidungsspiel, hatte er die Italiener aus Turin zur Verzweiflung gebracht. So einer wollte ich werden, ein »goalkeeper«, wie die Engländer sagten. Ganz in Schwarz stand Radenkovic auf der Linie, hechtete, griff sich die Flanken herunter, auch gegen West Ham, bis in der zweiten Halbzeit nichts mehr zu machen war: null zu zwei. Vater ärgerte sich; mir steckte ein Kloß im Hals. Wie ungerecht, dass die Löwen das Spiel verloren.
Meine Löwen-Meistertruppe![7]
Als Torwart war man ein Einsamer, einmal danebengegriffen, und schon konnte alles versaut sein. Wenn Küppers oder Rebele einen Abspielfehler machten, war das nicht so schlimm. Manche machten dauernd Abspielfehler. Aber wehe, wenn der Zerberus, wie ein Rundfunkreporter Radenkovic nannte, den Ball abklatschen ließ, den Aufsetzer unterschätzte und einen Hosenträger kassierte. Fliegenfänger!, riefen sie ihm zu – egal, welche Bomben und Granaten er Minuten zuvor abgewehrt hatte. Radenkovic war Jugoslawe, aus dem Osten. Eigentlich ein Gastarbeiter, aber das Wort verwendete man beim Fußball selten. Auch in Heilbronn gab es Gastarbeiter. In Deutschland verdienen die gutes Geld, schicken es nach Hause und bauen sich da stattliche Häuser. Mutter sagte, dass sie nicht so leben wolle.
Als Radenkovic zu singen und Bücher zu schreiben begann, wollte ich alles von ihm haben. »Das Spielfeld ist mein Königreich« wünschte ich mir von Tante Vroni, Vaters Schwester. Da las ich nach, wie man es zu einem Spitzentorwart brachte. Radenkovic erklärte mir alles. Er sagte, dass es keine unhaltbaren Schüsse gebe, nur falsch postierte Torhüter. Wenn man schlau sei und erahne, wohin der Stürmer schießen würde, dann ließen sich alle Schüsse, selbst die gemeinsten und härtesten, parieren. Allerdings brachten es die wenigstens zu solcher Meisterschaft, standen oft falsch. Andernfalls wären alle Spiele null zu null ausgegangen, was das blödeste Ergebnis war, das man sich vorstellen konnte. Es gibt keine unhaltbaren Tore – darüber lohnte es sich nachzudenken.
Das wird dir eine Lehre sein, du Saubub!
SCHULE
Als die Schule umzog von der Siebennussbaumstraße in das neue Gebäude an der Karlstraße, war es mit der Gemütlichkeit vorbei. Gerhart-Hauptmann-Schule hieß der eckige Betonbau, und wir bekamen ausführlich erklärt, wer dieser Gerhart Hauptmann gewesen war, dessen Vornamen viele falsch schrieben. Agnetendorf, da war er gestorben. Komisch, dass eine Schule in Württemberg nach einem schlesischen Dichter benannt wurde. Immerhin waren seine Theaterstücke für die unteren Klassen zu schwierig. Ich ging gern in die Schule. Man musste sich aber ranhalten, sonst schaffte man es nicht aufs Gymnasium. Für jede Eins im Zeugnis gab es eine Mark. Am übelsten war Heimatkundelehrer Wanner, ein alter Mann mit graugelben Raucherzähnen, der Kopfnüsse und Tatzen verteilte. Oder Rektor Wehrmann, in dessen Stunden es mucksmäuschenstill war. Zu ihm wurde man nur in schwerwiegenden Fällen einbestellt, aber wir hatten gleich das Pech, Mathe-Unterricht bei ihm zu haben. Er schleppte ein Holzbein hinter sich her – aus dem Krieg, wie es hieß – und geriet schnell in Zorn. Seine Adern am Hals traten hervor, sein Gesicht verfärbte sich puterrot, und er begann zu schreien. Das Wort Disziplin stieß er ständig aus, und wenn er die Fassung verlor, griff er nach dem Handfeger, der neben dem Waschbecken hing. Wo kommen wir denn da hin! Das wird dir eine Lehre sein, du Saubub! Der Sünder hatte sich über den Tisch zu legen, und Rektor Wehrmann schlug ihm mit dem hölzernen Stiel des kleinen Besens aufs Hinterteil. Tränen flossen. Die Nicht-Sünder saßen beklommen in ihren Bänken, blickten nicht auf. Stillhalten, nicht auffallen. Wer weiß, wen Wehrmanns Wut als Nächsten ereilen würde. Warum mussten wir auch den Rex abbekommen, als Nachfolger von Referendarin Nuber–
Das ist bei Referendaren so üblich
EROTIK
Ende der Leseprobe