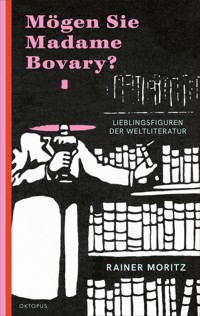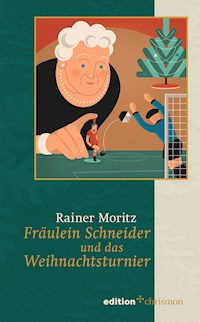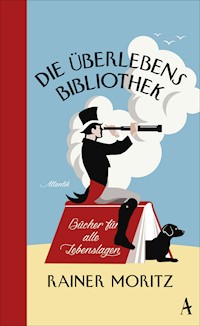2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Liebesgschichte der besonderen Art in Paris Ein Appartement am Montmartre, ein erfüllender Beruf, Freunde: Eigentlich könnte Nathalie Cottard glücklich sein. Warum aber bringt sie dann ein Wasserschaden so aus der Fassung? Fehlt ihr doch etwas? Als ihr Wohnungsnachbar, der scheue Robert Bernthaler, auf den Plan tritt, muss sie sich eine ganz neue, entscheidende Frage stellen: eine Pariser Buchhändlerin und ein deutscher Korkenverkäufer – kann das gut gehen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
PIPER DIGITAL
die eBook-Labels von Piper
Unsere vier Digitallabels bieten Lesestoff für jede Lesestimmung!
Für Leserinnen und Leser, die wissen, was sie wollen.
Mehr unter www.piper.de/piper-digital
ISBN 978-3-492-98168-2
© für diese Ausgabe: Fahrenheitbooks, ein Imprint der Piper Verlag GmbH, München 2014 © Piper Verlag GmbH, München 2009 Covergestaltung: FAVORITBUERO, München Covermotiv: © Aleshyn_Andrei / Shutterstock.com Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
4. Auflage 2010
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich Fahrenheitbooks die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
Pour ne pas vivre seul
on vit pour le printemps
et quand le printemps meurt
pour le prochain printemps
DALIDA
EINS
Der Aufzug kam nicht. Wenn man diese altertümliche Kabine überhaupt Aufzug nennen wollte. Er rüttelte an dem abgewetzten Handgriff, doch die metallene Schiebetür machte keinerlei Anstalten, sich ächzend aufzufalten. Er drückte auf den grünen Knopf, mehrmals. Hoffnung, dass sich das Ungetüm bewegen würde, hatte er keine. Tage würde es wieder dauern, bis das gerichtet würde. Er nahm sich vor, heute Abend schriftlich festzuhalten, an wie vielen Tagen im Monat dieses gottverdammte Ding seinen Dienst quittierte und dass das meistens geschah, wenn er mit Wasserkästen bepackt war. Er stieß einen leisen Fluch aus, auf Deutsch, französisch kam ihm das spontan noch nicht über die Lippen.
Dann also zu Fuß, vier Stockwerke hinauf, in dem schlecht beleuchteten Treppenhaus. Grünliche Auslegeware bedeckte die Stufen, ungezählte Flecken breiteten sich aus, undefinierbare Ablagerungen, Straßen-schmutz. An jeder Treppenbiegung hatte der Teppich Wellen aufgeworfen, er verlangsamte seinen Schritt, voller Furcht, in einer der Falten hängen zu bleiben, zu stürzen und längs gegen das Geländer zu schlagen, mit einem Getöse, das die Concierge in Sekundenschnelle aus ihrer Höhle locken würde. Die Vorstellung, diese mit einer bunten Großmutterschürze bekleidete und in einem fremdartigen portugiesisch-französischen Slang sprechende Frau würde sich über ihn beugen, sein Haar berühren und womöglich seine Wangen aufmunternd tätscheln, ließ ihn beim Aufstieg besonders achtsam sein.
In der dritten Etage hielt er inne, stützte sich am Handlauf ab, atmete stoßweise. Wie schnell man an Kondition verlor, wenn man keinen Sport trieb. Er gehörte zu den mittelalten Männern, die stolz an jene Zeiten dachten, da sie regelmäßig zum Joggen aufgebrochen waren oder in Freizeitmannschaften im Park gegen Fußbälle getreten hatten. Auch dann noch, als die Knochen morscher wurden und man am nächsten Morgen Muskeln spürte, von deren Existenz man nichts geahnt hatte.
Immerhin verzichtete er seit Längerem darauf, gute Vorsätze zu fassen. Er wollte keine Sportart betreiben, ein überteuertes Fitnessstudio-Abo kaufen oder in einem nach Chlor stinkenden Schwimmbad seine Runden drehen. Dann lieber ein paar Métrostationen auslassen, zu Fuß durch die Stadt gehen und die Höhenunterschiede des Montmartre-Hügels überwin-den. Auf den Aufzug wollte er dennoch nicht verzichten; nach der Arbeit gezwungen zu sein, auf diese Annehmlichkeit – wozu zahlte er Nebenkosten? – zu verzichten, erschien ihm als Beleidigung, als Angriff auf sein Wohlbefinden. Er würde mindestens eine halbe Stunde brauchen, bis sein Ärger verraucht wäre und er von dem Plan, umgehend der Hausverwaltung zu schreiben, Abstand nähme.
Gleich hatte er es geschafft, noch ein Treppenstück. Komisch, dass einem fast nie Menschen begegneten, dass nie Mitbewohner aus ihren Appartements traten. Gelegentlich bekam er etwas vom Leben der anderen mit, Chansonklänge etwa, die aus einer der Nachbarwohnungen auf dem Flur zu ihm hinüberdrangen, und neulich war ihm abends eine ältere Frau, Schneiderin im Ruhestand, hieß es, zwischen dem zweiten und dritten Stockwerk über den Weg gelaufen, im Halbdunkel hätte er sie beinahe übersehen und umgerissen. Sie hatte einen Schrei ausgestoßen, sein »Bonsoir, Madame« beruhigte sie zwar, aber es war nicht mehr zu verhindern, dass sich ihre Mäntel streiften, er sich an die Wand drücken musste, um eine weitere Berührung zu vermeiden.
Endlich stand er vor seiner Wohnungstür. Wer nur war auf die Idee gekommen, Türschlösser einzubauen, deren Riegel in unterschiedliche Richtungen wiesen? Wochen hatte es ihn gekostet, sich die drei Schlüsseltypen zu merken und sie in die passenden Schlösser zu schieben: Der Schlüssel mit der eingeprägten Zahlen-folge gehörte in die Mitte, der mit dem rissigen Bart nach oben und der schlanke mit dem Namenskürzel des Herstellers nach unten.
Als allein lebender Mann, zumal in einem fremden Land, musste man aufpassen, nicht verloren zu gehen. Die paar Menschen, die er in den letzten anderthalb Jahren in Paris kennengelernt hatte, würden ihm nicht sofort zu Hilfe eilen. Man sah sich ab und zu zum Essen, ging gelegentlich ins Kino oder spazieren, aber Freunde hätte er sie nicht genannt, ebenso wenig wie seine Kollegen aus der Firma, fast alles Franzosen, von denen die meisten in der Banlieue wohnten und selten in die Stadt kamen. Er lebte auf Zeit hier, das hatte die Geschäftsleitung angedeutet, obwohl er nicht wusste, was damit genau gemeint war. Hatte er jemals anders gewohnt, dachte er, als er die Tür zu seinem Appartement aufstemmte.
ZWEI
Höchste Zeit, dass der Türcode geändert würde. Dutzendfach war er inzwischen an Freunde und Bekannte weitergegeben worden, halb Paris konnte sich hier Einlass verschaffen. Obwohl eine Änderung es mit sich brächte, einen neuen Zettel zu beschriften, ihn im Geldbeutel zu verwahren und darauf achtzugeben, ihn nicht zu verlieren. Bei den vielen Rechnungen und Coupons, die sich bei ihr ansammelten, war es kein Wunder, dass sie ständig auf der Suche war, wonach auch immer. Mademoiselle Chaos, so hatte ein Schulfreund sie bezeichnet, jahrelang hatte er versucht, ihr beizubringen, mit welchem Ordnungssystem sie ihr Leben besser in den Griff bekommen könnte. Vergebliche Liebesmüh, sie setzte darauf, dass sich die Dinge irgendwann wieder einfänden, zumal in ihrem überschaubaren Appartement.
Sollte sie noch einmal hinüber zum Ed-Markt gehen, Quark kaufen und ein bisschen Käse fürs Frühstück? Sie blickte auf die andere Straßenseite hinüber zu dem wenig anheimelnden Laden, dessen Neonsignet über dem Eingang beim geringsten Windstoß bedrohlich klapperte. Ja, praktisch war es, einen solchen Laden auf der anderen Straßenseite zu haben, doch jedes Mal, wenn sie dort einkaufte, genierte sie sich. Zum Obsthändler oder zum Metzger in der Rue Caulaincourt wären es nur ein paar Schritte mehr gewesen, aber nach acht Stunden Steherei in der Buchhandlung schwanden ihr zum Feierabend die Kräfte, und so kam Ed immer wieder zu unverdientem Umsatz. Heute aber beschloss sie, gleich ins Haus zu gehen, irgendetwas Essbares würde sich im Kühlschrank schon finden. Ein Hachis parmentier müsste im Tiefkühlfach lagern. Sie konnte sich Schöneres vorstellen, als allein zu essen.
Sie öffnete ihren Briefkasten, gleich zwei Stromrechnungen, der Prospekt eines Installateurs, der darauf spekulierte, dass in einem alten Pariser Haus ständig ein Schaden zu beheben war, und ein Irrläufer – an Herrn Robert Bernthaler stand da, in verschlungener Handschrift, dazu ein Absender mit abgekürztem Namen. Dieser Bernthaler war ihr Wohnungsnachbar, zwei Türen weiter, ein Deutscher, den sie kaum einmal zu Gesicht bekam. Ein verschlossener Typ, als wäre er nicht richtig angekommen. Vielleicht schlief der nächtelang woanders, so still war es meist nebenan, nicht einmal der Fernseher oder die Toilettenspülung meldeten sich. Sie zögerte, erinnerte sich daran, wie sie als Kind heimlich Briefe über Wasserdampf geöffnet und den für andere Leute bestimmten Inhalt gelesen hatte. Das Gefühl, Unrechtes zu tun, die Angst, entdeckt zu werden, die Lust, Geheimnissen auf die Spur zu kommen … obwohl in den Briefen damals oft nur von der Einschulung des kleinen Thomas oder vom Urlaub in der Provence und den herrlichen Lavendelfeldern die Rede gewesen war. Sie fühlte sich ertappt, wenngleich aus der Wohnung der Concierge kein Laut zu vernehmen war, und steckte den Brief rasch dorthin, wo er hingehörte.
Mit kräftigem Schritt ging sie auf die Treppe zu – montags, mittwochs und freitags benutzte sie nie den Aufzug, Training musste sein –, machte sich daran, zwei Stufen auf einmal zu nehmen, und summte ein Lied von Charles Aznavour vor sich hin. Il faut savoircacher ses larmes, quand le meilleur s’est retiré … Wer außer ihr interessierte sich für diese alten Sänger, von denen einer nach dem anderen starb, sie freute sich, wenn ab und zu einer irgendwo auftrat, mit brüchiger Stimme vor einem faltig gewordenen Publikum die ewiggleichen Chansons sang und ein paar angegraute Fans rührte. Als Buchhändlerin, dachte sie, hatte man es da leichter. Kunden gegenüber ein Loblied auf Stendhals »Rot und Schwarz« oder Colettes »Erwachende Herzen« zu singen würde sie noch mit siebzig zuwege bringen.
Sie sang leise weiter … cacher sa peine sous le masque de tous les jours … nahm sich vor, nach ihrem vierzigsten Geburtstag die Treppe auch dienstags, donnerstags, samstags und sonntags zu nehmen. Zu einer Senkung der Nebenkosten, missbilligend sah sie auf den Umschlag mit der Gasrechnung, würde das nicht führen. Sie entriegelte ihre Tür, was Zeit in Anspruch nahm, denn vor drei Jahren hatte sie einen Fachmann beauftragt, ihre Wohnung mit Quer- und Längsbalken zu sichern. Sie lebte seit Langem allein, aber noch immer quälte sie vor dem Zubettgehen die Vorstellung, ein Einbrecher habe sich ausgerechnet ihre vier Wände als Ziel ausgesucht. Auf dem Nachttischchen lag ein Küchenmesser bereit, ein solides Instrument mit schwarzem Kunststoffgriff, gut, um Braten zu tranchieren oder den Fettrand von Lammkoteletts einzuschneiden. Dass sie es wirklich einem Eindringling in die Rippen stoßen würde, kam nicht infrage. Vermut-lich hätte sie sich dabei selbst verletzt. Aber der Anblick des matt schimmernden Metalls beruhigte sie, bevor sie die Messingschnur an ihrer Nachttischlampe zog und darauf hoffte, dass die Müllabfuhr am nächsten Morgen nicht zu früh die Rue Francœur hinunterrumpeln würde.
DREI
Wie immer wenn er nach Hause kam, warf er die Wohnungsschlüssel und den Geldbeutel auf einen der hölzernen, weißen Zwischenböden, die eine tote Ecke des Gangs ausfüllten. Seinen schwarzen Mantel, Staubmantel, hatte seine Mutter dazu gesagt, hängte er achtlos an den Garderobenständer, ehe er ins Wohnzimmer ging. So nannte er den größeren seiner zwei Räume, obwohl ihm das übertrieben vorkam. Bei sechzig Quadratmetern schien es unpassend, solche Unterscheidungen zu treffen. Er riss die Balkontüre auf und stellte sich an die eiserne Brüstung. Die Farbe blätterte an einigen Stellen ab; irgendwann würde die Hausverwaltung nicht umhinkönnen, einen neuen Anstrich in Auftrag zu geben. Mit welchen Unannehmlichkeiten das verbunden wäre…
Der schmale Balkon hatte ihm sofort gefallen, damals, als der Personalchef seines Betriebs ihm das Appartement anbot. Als Übergangslösung, Sie verstehen, auf Dauer ist Ihnen das sicher zu klein. Er hatte genickt, ohne sich im Klaren darüber zu sein, welche Quadratmeterzahl einem Mann angemessen ist, der sich allenfalls für ein paar Jahre in Paris einrichten wollte. Mittlerweile war ihm das Provisorium ans Herz gewachsen, vor allem der kleine, nur ein Meter breite Balkon, der sich um die Hausecke schlängelte und so schön pariserisch wirkte. Er blickte hinunter auf die Straße, wo gegen Feierabend die Autos an den abenteuerlichsten Ecken abgestellt wurden. Wie gut, dass er seinen Wagen vor dem Umzug verkauft hatte. Mit der Lässigkeit der Franzosen, die ihre Fahrzeuge irgendwo stehen ließen, kam er nicht zurecht. Unter der Woche ab sechs, sieben Uhr in der Frühe setzten die Hupkonzerte der erregten Fahrer ein, die mit ihren über Nacht eingeklemmten Autos ihre Parknischen nicht verlassen konnten.
Wenn er den Kopf schräg hielt, sah er vom Balkon aus die weiße Spitze von Sacré-Cœur. Eine Sahnebaiserkirche, gewiss, für Touristentrosse ideal geeignet. Wer etwas auf sich hielt, rümpfte über Sacré-Cœur die Nase, ließ etwas von Kitsch verlauten und beteuerte, die Aufgänge dort stets zu meiden. Er selber hegte eine sentimentale Schwäche für diese Kirche, seitdem er als Student erstmals nach Paris gekommen war und ihn der weite Blick über die Stadt berauscht hatte. Bei jedem Besuch führte ihn der erste Weg auf die Treppenstufen von Sacré-Cœur; er setzte sich zwischen die jungen Leute, mitten ins Gewimmel der Touristen, die sich von der Place Pigalle im Pulk nach oben schoben, und gleichzeitig von dem Gefühl eingenommen, unverwechselbar zu sein und nichts mit den Rucksackträgern, den Musikanten und Taschendieben zu tun zu haben. Wenn er sich heute bei einem Abendspaziergang über die Place du Tertre auf die Basilika zubewegte, meinte er zu spüren, was er damals, vor über zwanzig Jahren, empfunden hatte. Vielleicht fühlte er sich distanzierter inzwischen, im Wissen darum, dass er aller Hochrechnung nach wohl die Hälfte seines Lebens hinter sich hatte. Mit zwanzig schien die vor einem liegende Zeit unendlich zu sein, und er dachte daran, wie er auf der Treppe mit leicht melancholischem Blick die Mädchen um ihn herum gemustert hatte. Manchmal hatte er eines von ihnen angesprochen, in ordentlichem Schulenglisch, und erzählt, dass er eine Gymnasiastengruppe nach Paris begleitet habe, im Zug von Stuttgart aus, und dass ihm zwei Tage blieben, sich ein paar Sehenswürdigkeiten anzusehen und französisches Lebensgefühl einzusaugen. Eine Studentin, Farmerstochter aus Iowa, hatte sich von ihm einladen lassen, in eines der Lokale, die sich traditionell gaben und zu überteuerten Preisen das servierten, was Paris-Besucher aus Tübingen oder Davenport erwarteten. Mit festem Gesichtsausdruck bestellte er ein dreigängiges Menü, das er sich gerade würde leisten können. Er gab dem Kellner auf Französisch Anweisungen, die souverän wirken sollten. Debbie verstand ohnehin nichts, stocherte in der Terrine de campagne, trank den Landwein aus der Provence mit schnellen Zügen. Mehr geschah nicht an diesem Abend, er begleitete Debbie zur Métrostation an der Place Pigalle, küsste sie ungeschickt auf den Rand ihrer Lippen, die vom Fett des Coq au vin blanc glänzten. Sie winkte, als sie die U-Bahn-Treppen hinuntertrippelte, rief ihm noch ein »Thanks a lot. That was great« hinauf.
Das war die Sache mit dem Mädchen aus Iowa. Vermutlich lebte sie wieder in ihrer Heimat, wie Meryl Streep in »Die Brücken am Fluss«, verheiratet mit einem einfachen Farmer, der ihre Bedürfnisse nicht verstand. Heute wäre er nie auf den Gedanken gekommen, auf den Sacré-Cœur-Treppenabsätzen irgendjemanden anzusprechen. Er näherte sich Frauen ohnehin zurückhaltend. Nach seiner Scheidung, die ohne Blutvergießen abgelaufen war – Stefanie und er telefonierten mindestens zweimal im Monat –, fühlte er sich gehemmt, so als sei ihm die Leichtigkeit im Umgang mit anderen abhandengekommen. Vielleicht hatte er auch deshalb das Angebot angenommen, für eine Weile in der französischen Niederlassung zu arbeiten. Sich auf Neues einlassen und eine charmante Französin kennenlernen, eine Amélie oder so.
Was man sich alles so einredet, dachte er, als er in die Küche ging, um einen Sancerre aus dem Kühlschrank zu holen. Er entkorkte die Flasche bedächtig, fast feierlich. Er betrachtete den Korken, prüfte seine Maserung, den Aufdruck der Kellerei. Eine Berufskrankheit, kein Wunder, wenn der ganze Büroalltag um Korken kreiste, um die Lieferengpässe der Portugiesen, die schonenden Reinigungsmethoden, um neue Aufträge und um den Kampf mit jenen Weingütern, die auf Glaspfropfen umstellen wollten. Immerhin hatte seine Firma frühzeitig erkannt, dass mit Naturkorken allein auf Dauer kein Geschäft zu machen war. Sich anpassen, den Bedürfnissen der Kunden entsprechen, darum ging es. Solange sich nicht der Tetrapak für Qualitätsweine durchsetzte.
Er roch am Sancerre-Korken, fand nichts zu beanstanden und goss das Glas halbvoll, den Biedermeierkelch, den ihm Stefanie zum Geburtstag geschenkt hatte, vor zig Jahren. Wie immer würde er einen großen ersten Schluck nehmen und sich dann auf den Balkon setzen, mit dem Blick auf das Wohnhaus gegenüber, wo er alte Bekannte wiedersehen würde, mit denen er noch nie ein Wort gewechselt hatte.
VIER
Einmal durch die Wohnung sausen, einen Blick in jedes Zimmer, auch in die Toilette, werfen, dann erst fühlte sie sich zu Hause. Sie riss die Balkontüren auf, atmete tief durch. Die für Mai überraschende Schwüle der letzten Tage war verflogen, trotzdem keine Spur von gesunder Seeluft oder Frische, aber wenn man schon ein paar Dächer unter sich hatte, musste sie einmal am Tag durchschnaufen und den Ausblick genießen. Sie verzichtete darauf, aufs Trottoir zu spucken, auch so eine Angewohnheit aus Kindertagen. Was man sich als Erwachsener alles abgewöhnte. Sie machte auf dem Absatz kehrt, warf das Kostümoberteil über die Lehne des Ledersessels, schob die Schuhe unter den Heizkörper und legte sich quer über das kirschrote Ligne-roset-Sofa. Wie lange war es her, dass sie es zu einer Schlafstätte umgeklappt hatte? Viele Freundinnen besuchten sie ohnehin nicht. Solange zuletzt, ihre Schulfreundin aus Grenoble, die dort wohnte wie eh und je, in einem baufälligen Dachgeschoss unweit der Place Grenette, in Mamans Nähe.
Von Männern ganz abgesehen. Die kamen ihr nicht ins Haus, der Letzte, Philippe, hatte ihr zugesetzt, sie gedemütigt, sich nach zwei Jahren über Nacht davongestohlen. Es habe nicht mehr gepasst zwischen ihnen, nicht gefunkt, was für ein alberner Ausdruck, ständig sei sie unzufrieden mit ihm gewesen, mit seinem Freizeitverhalten, seinem Kommunikationsverhalten. Und was den Sex angehe, habe sie sich immer stärker entzogen. Was unzumutbar sei, weshalb es für beide besser wäre, in Frieden auseinanderzugehen. Sie hatte seine gewundenen Ausflüchte mit einem Lachen quittiert, ein wenig gekünstelt vielleicht, und ihn aus der Wohnung geworfen, samt seinem Aktenköfferchen, für das er sich einmal im Monat entschuldigte, da er ja auf keinen Fall einer von diesen Anzugträgern sein wollte, die durch das Bankenviertel zogen, ihr Mobiltelefon nie vom Ohr nahmen und mittags in einem Bistro Kontaktpflege betrieben. Dabei war Philippe gar keiner von diesen Langweilerschnöseln gewesen, verfügte über Humor, eine Eigenschaft, mit der Männer sofort Pluspunkte bei ihr einheimsten, küsste zärtlich und brachte es mitunter sogar fertig, über sich selbst in ganzen Sätzen zu sprechen. Mit einer Buchhändlerin musste man reden, nicht über jede Neuerscheinung, aber einen Kerl mit permanent verschlossenem Innenleben brauchte sie nicht an ihrer Seite.
Dass er von heute auf morgen gegangen war, mit lauter Floskeln und ohne ihr ins Gesicht zu sehen, hatte wehgetan, sehr weh. Warum dachte sie an Philippe, wenn sie von der Arbeit nach Hause kam? Weil sie dann die Vorstellung überfiel, ein vorzeigbarer Typ mit halbwegs normalen Charakterzügen – zu große Erwartungen hatte sie beileibe nicht – säße im Sessel, das Gesicht von einem Lächeln erhellt, kaum dass er ihren Schlüsselbund klappern hörte, und schlösse sie in die Arme? Ein nicht sehr spektakuläres Bedürfnis, doch es wäre schön, wenn es zumindest hin und wieder befriedigt würde.
Sie ging hinüber in die Küche, griff nach der Mineralwasserflasche und trank in schnellen Zügen. Immer ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen, sie schämte sich ein wenig, zu den Nachbeterinnen dieses Lehrsatzes zu gehören. Damit der Körper entschlackt, damit die Zellen nicht zu Trockenerbsen schrumpfen und das Gewebe straff bleibt. Und was es noch an Lobpreisungen aus den Werbeabteilungen der Mineralwasserindustrie gab.
Das Telefon klingelte, ein Klingelzeichen aus dem Gilbert-Bécaud-Archiv, an das sie nur schwer herangekommen war. Sie sah aufs Display, stöhnte kurz auf, zögerte, das Gespräch anzunehmen. Mutter. Mittwoch Abend, das war Mutters Zeit, während sie sonntags in der Pflicht stand. Sie meldete sich mit einem nüchternen »Allô«, ganz so, als wüsste sie nicht, wer sich in Sekundenschnelle in einem Wortschwall entladen würde. Schön, Maman, dich zu hören. Wie geht es dir … weiter kam sie nicht. Sie warf ihren Kopf zurück, legte die Beine über den gläsernen Tisch, diesen wackligen Fehleinkauf, blickte auf die Uhr und bereute, die Wasserflasche auf dem Küchenschrank stehen gelassen zu haben.
Ungefähr fünf Minuten lang würde ihre Mutter detailliert berichten, was sich in den letzten Tagen in Grenoble ereignet habe. Neuerdings interessierte sie sich für Fußball, der einheimische Club durfte erstmals in der höchsten Liga antreten. Niemand hat das für möglich gehalten, sagte Mutter, wo man sich doch hier eher für den Wintersport begeistert, du kennst das ja, jetzt aber ziehen am Wochenende Horden von Anhängern durch die Stadt, aus Lyon, Toulouse und Marseille sogar, schon am Nachmittag, belagern die Fußgängerzone und geben sich ganz unfranzösisch. Nathalie, du kannst dir nicht vorstellen, rief Mutter mit schriller Stimme in den Apparat, was hier los ist.
Die nächsten zehn Minuten gehörten der Familie. Vater, der vor fünf Jahren plötzlich an einer Lungenembolie gestorben war, besaß eine Verwandtschaft, deren Skurrilitätsfaktor über dem Normalmaß lag. Tante Claire mit dem Hündchen, das Mousse au chocolat aus Glasschälchen aß, Onkel Frédéric, der als Laienschauspieler keine Hobbybühne ausließ, aber beim Krippenspiel schon mit der textarmen Rolle des Schafs überfordert war, und nicht zuletzt Vaters Patentante Jacqueline, die mit ihren knapp neunzig Jahren die Erstplatzierten aller Tour-de-France-Rennen nach dem Zweiten Weltkrieg aufzuzählen vermochte. Stell dir vor, prustete Mutter in den Hörer, stell dir vor, wie diese Dopinggeschichten sie mitnehmen. Selbst in ihrem hohen Alter habe sie sich in die komplexe Thematik des Blutdopings eingelesen, wo man doch früher allenfalls Traubenzucker zu sich genommen habe, in Jacquelines Jugend, die sie in Südfrankreich verbracht habe, am Fuße des Mont Ventoux, dieses Schicksalsbergs der Tour.
Nach zwanzig Minuten ebbte Mutters Redefluss ab. Warum nur schrie sie immer so? Wohl aus Höflichkeit stellte Mutter ihr jetzt eine Frage. Geht es gut in deinem Laden? Kaufen die Menschen noch Bücher, trotz der Computer und dieser elektronischen Leseapparate? Nathalie antwortete freundlich, einsilbig. Was würde sie Mutter sagen, wenn es ihr wirklich schlecht ginge, wenn ihr alles zu viel würde und die Fassade nicht aufrechtzuerhalten wäre? Wie sollte sie offen mit einer Frau sprechen, die gar nichts Beschwerliches hören mochte, die mit den Problemen ihres eigenen Umfeldes völlig ausgelastet war? Wann nur war der enge Kontakt zu Maman eingeschlafen, wann hatte Nathalie begonnen, ihre Regungen für sich zu behalten? Vielleicht nach Vaters Tod, als sie zu spüren begann, dass sich Maman abkapselte, sich kaum mehr in die Gefühle anderer versetzen konnte und wollte. Zweimal im Jahr fuhr sie hinunter nach Grenoble, für drei, vier Tage, die sich wie Nudelteig zogen, schon nach einer Nacht sehnte sie sich in ihre Wohnung zurück, mit dem schlechten Gewissen einer undankbaren Tochter.
Ja, Maman, mach es gut, genehmige dir noch einen Chartreuse, dein giftgrünes, kitschsüßes Gesöff, und grüß alle schön von mir. Dann das Freizeichen, wie immer hatte Mutter hektisch aufgelegt, und wie immer blickte Nathalie auf das Telefon, als säße sie in einem Theaterstück und hätte soeben einer nicht mehr ganz jungen Frau beim Telefonieren mit ihrer anstrengenden Mutter zugesehen. Sie blieb regungslos sitzen, blinzelte mit den Augen. Erst mit dem Ausruf »Jetzt ein kaltes Bier« holte sie sich in die Wirklichkeit zurück. Hoffentlich versteckte sich ein Kronenbourg in den hinteren Kühlschrankfluchten.
FÜNF
An die Métrofahrten am Morgen hatte er sich mühsam gewöhnt. Dieses Gedränge und Geschubse, diese Körperausdünstungen, diese eingefallenen Gesichter, diese Halbschlafgesten, dieser Ärger, wenn sich kein Platz fand, nicht einmal auf den Klappsitzen, die man im Berufsverkehr ohnehin nicht nutzen durfte. In Tübingen hatte es natürlich keine U-Bahn gegeben. Wer wie er mit Fahrrad oder Bus aufgewachsen war, der gewöhnte sich nur allmählich an die Selbstverständlichkeit, mit der die Pariser über bettelnde Gitarrenspieler, verwahrloste Zigeunerinnen mit elend aussehenden Kleinkindern, eingedreckte Sitzbänke und unendlich lange Übergänge wie am Châtelet-Knoten hinwegsahen, finstere Schluchten, die nachts gut und gern als Drehort für Horrorfilme herhalten konnten. Diesen Gleichmut hatte er noch nicht erreicht, doch Schrecken oder Unbehagen flößte ihm seine frühe Fahrt Richtung Norden nicht mehr ein.
Sein Morgen war fest strukturiert, von den ersten Tönen des Radioweckers um 6 Uhr 32 – eine Uhrzeit, die sich zufällig ergeben hatte und die er nie geändert hatte – bis hin zur Wechseldusche in seinem Badezimmer, das so eng geschnitten war, dass jede Drehung, jede Bewegung der Arme und Beine genau überlegt sein wollte, und zum spartanischen Frühstück, mit dem er in den Tag ging. Gelegentlich, wenn er sich aus einer Laune heraus selbst beobachtete, begann er über sich selbst zu lächeln, fand er sich komisch. Wäre es nicht aufregender gewesen, den Tagesrhythmus umzustoßen, sich treiben zu lassen und beispielsweise erst nach dem Morgenkaffee zu duschen? In die Tat setzte er solche Überlegungen nie um. Zu intensiv spürte er in diesen wankelmütigen Momenten, dass er auf die Rituale angewiesen war, dass er sie benötigte, um sein Seelenleben im Gleichgewicht zu halten. Er brauchte den Halt des Immergleichen, obwohl er sich dafür ein wenig schämte.
Spontaneität, hatte ihm seine letzte Freundin, Sandrine, Lohnbuchhalterin aus der Firma, zugerufen, das könne er gut gebrauchen. Ständig war sie auf dem Sprung gewesen, wollte ihn in puristisch eingerichtete Clubs am Seineufer locken und am Wochenende Ausflüge zu angesagten Orten unternehmen, Strapazen sondergleichen.