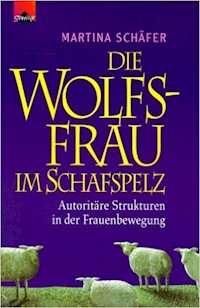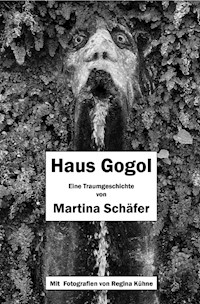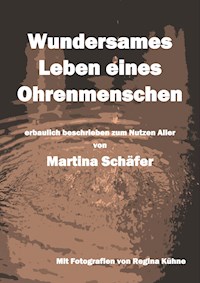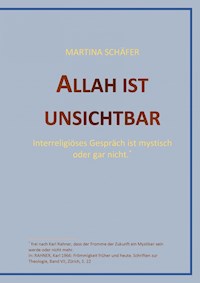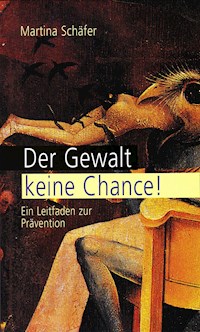
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Kein Mensch muss sich Gewalt gefallen lassen. Sie kann im Vorhinein verhindert werden oder im Moment abgewehrt. Jeder Mensch hat das Recht auf ein gewaltfreies Leben in unserer Gesellschaft, in der Familie, in religiösen Gemeinschaften oder am Arbeitsplatz. Das Buch zeigt auf, wie man prekäre Situationen rasch einschätzen lernt, um auf Bedrohungen adäquat reagieren zu können. Die Autorin, welche drei Jahrzehnte als Selbstverteidigungstrainerin sowie in der Gewaltprävention tätig war, zeigt weiterhin, wie man sein eigenes Selbstwertgefühl aufbaut und Machtmissbrauch jedweder Art vorbeugt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 293
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
MARTINASCHÄFER
Der Gewalt keine Chance!
Ein Leitfaden zur Prävention
Für Helga und Gudrun, weil sie als Mädchen nie eine Chance hatten.
Die Deutsche Bibliothek CIP-Einheitsaufnahme
Schäfer, Martina
Der Gewalt keine Chance! Ein Leitfaden zur Prävention
ISBN:
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1.Gewalt hat ein GesichtSexuelle Gewalt in unvermeidbaren Gruppen – Familie, Schule, Ausbildung, Arbeitsplatz
1.1 Mein Parfüm und dein Geruch oder: Wie weit reiche ich? Von Raumkapseln, Flügelspannweiten und Duftwolken
1.2Mehr als eine «Aura»: Die «Wolke» einer Frau reicht meterweit!
1.3Meine Haut gehört mir oder: Wer liebt, lässt los
1.4Von Leuten ohne Feeling und Energiesaugern: «Zombies» und «Vampire» oder: Was haben Blicke, Witze, dumme Sprüche und ewiges Herumrechten mit Gewalt zu tun?
1.5Das habe ich gar nicht gewusst. Von Zuschauern, ängstlichen Müttern undanderenZeugen
1.6Halt! Bleib weg! Fass mich nicht an! Zehn Regeln zur Selbstverteidigung oder: Wann man einem Zombie die Nase einhaut und einem Vampir durchs Knie schlägt
2. Gewalt hat viele Gesichter
2.1 Machtspiele oder: Was hat das eigentlich mit Sexualität zu tun?
2.2 Es macht doch Spaß, Schwächere zu schlagen
2.3 Ein Bankraub ist zu anstrengend oder: Raubzüge an der Seele
3. Wenn die Gewalt «Gruppe» heißt Gewalt von rechtsradikalen und ähnlichen Gruppen
3.1 Motive und Gründe von Männern und Frauen, solchen Gruppen beizutreten
3.2 Wir gehören dazu, die anderen nicht
3.3 Wir sind besser als die anderen
3.4 Früher war alles besser – wir sind es heute
3.5 Wir sehen alle gleich aus
3.6 Wir denken nicht, wir fühlen
3.7 Wir brauchen Platz, die anderen sollen raus, oder: Wer Achtung hat, lässt rein
3.8 Ein Feigling ist, wer es weitersagt, oder: Mitläufer, Mitschweiger und andereSchläger
3.9 Und über allen schwebt ein «Führer»
3.10 Wir arbeiten rund um die Uhr
4. Wenn die Gewalt «Guru» heißtGewalt in religiös-fundamentalistischen Gruppen und Sekten
4.1 Wie kann es geschehen, dass man sich plötzlich in einer Sekte wiederfindet?
4.2 Der direkte Draht oder: Warum der Guru ein besserer Mensch ist
4.3 Sehnsucht heißt das alte Lied oder: Fliegenfänger der Verführung
4.4 Wes Lied ich dann sing, des Brot ich ess, oder: Wie schön dazuzugehören
4.5
Einleitung
In den letzten Jahren sind einige Bücher darüber erschienen, wie man sich gegen tätliche Angriffe – insbesondere als Frau oder Mädchen gegen sexuelle Gewalt – zur Wehr setzen kann.
Doch mittlerweile haben nicht mehr nur Frauen Angst, überfallen und vergewaltigt zu werden. Auch Männer, männliche Jugendliche und Jungen zittern vor der zunehmenden Brutalisierung der Gesellschaft; ausländische und behinderte Menschen fürchten die rechtsradikale Straßengewalt. Schon die Kinder in den Schulen leiden unter Schlägereien und Erpressungsversuchen durch ältere Schüler – übrigens auch durch Schülerinnen! – oder Schulhof-Gangs.
Verstört und ungeheuer hilflos verfolgt man die unglaublichen Angriffe bewaffneter Jugendlicher auf ihre Lehrer und Mitschüler; das Wort «Frontalunterricht» hat mittlerweile eine ganz eigene, makabre Bedeutung gewonnen: Es herrscht «Krieg» – nicht allein an der sexuellen Front, wie es die Frauenbewegung seit den Siebzigerjahren beklagt, sondern ganz allgemein in Klassenzimmern, Supermärkten, Vereinslokalen und Einbahnstraßen.
Wie der fundamentalistische Terror fehlgeleiteter Fanatiker und die erschütternden Gewalt- und Selbstmordszenarien in abgeschotteten Sektengemeinschaften sind die Morde an den Schulen die Eisbergspitze einer nach und nach immer gewalttätiger werdenden globalen Gesellschaftsstruktur.
In vielen Abhandlungen seit dem Beginn des Medienzeitalters, als die ersten Fernsehapparate auf stakeligen Beinen neu im Mittelpunkt der Nachkriegswohnzimmer standen, wurde die Verantwortlichkeit der Medien für das Herabsetzen der Hemmschwellen immer und immer wieder beschworen. Seit Internet und Videospiele durch die Kinderzimmer geistern, weist man, zu Recht, auf deren Gefährlichkeit hin. Auch die Erreichbarkeit des einzelnen allein durch die täglichen Nachrichten bewirkt ganz sicherlich eine Art schleichender Veränderung in den unbewussten Einstellungen zu Gewalt und Gewaltanwendung, der sich auch Menschen kaum entziehen können, die keine brutalen Videospiele lieben oder Schlächterfilme anschauen. Es geschieht etwas mit uns, wenn wir aus den Nachrichten über das soundsovielte Selbstmordattentat erfahren; die suggestiven Bilder der anfliegenden Jets am 11. September 2001 bewirken eine Art Gewöhnung – Ästhetisierung der Gewalt sagen manche Intellektuelle, was letztlich eine fatale Beschönigung ist –, die meiner Meinung nach selbst im pazifistischsten Gemüt Hemmschwellen gegenüber der Akzeptanz von Gewalt niederreißen.
Betrachtete man bis vor etwa zwanzig Jahren Gewalt und Machtmissbrauch durchaus noch als etwas von Menschen Verursachtes, weshalb man davon ausging, dass die Gewalt durch Menschen auch zu verhindern sei, so bekommt die Gewalttätigkeit heutzutage allmählich etwas Unausweichliches. Sie wird zu einer Art Naturereignis, einer Katastrophe, gegen die man eigentlich nichts machen kann, der man hilflos ausgeliefert ist, deren Ursachen man vielleicht sogar erforschen und benennen kann, aber gegen die man letztlich, wie bei einer Sturmflut oder einem Meteoritenabsturz, nichts ausrichten kann.
In den frühen neunziger Jahren beklagte ich einmal gegen über einer Isländerin die Gewalttätigkeit ihrer deutschen Schwester, die eine sektenartige Gemeinschaft führte, woraufhin ich zur Antwort bekam: «Das ist wie bei einem unserer Vulkanausbrüche – da können wir nichts machen –, das ist einfach so.»
Dieser Vergleich hat mich seither nicht mehr losgelassen, denn sosehr ich persönlich die Freundschaft dieser Isländerin schätzte, wollte es mir einfach nicht in den Kopf, dass man sich nicht sehr wohl auch gegen die von Menschen gemachte Gewalt zur Wehr setzen könne, dass es Möglichkeiten gibt, die Ursachen für menschliche Gewalttätigkeit herauszufinden und die Gewalttätigkeit einzuschränken.
Wie aber können sich einzelne Menschen vor Gewalt schützen, ohne selbst – z. B. in Bürgerwehren oder durch private Bewaffnung – am Rad der Gewalt mitzudrehen?
Lässt sich Gewalt, egal auf welcher Ebene, eventuell schon im Vorfeld erkennen und somit beeinflussen?
Offensichtlich haben die vielen wissenschaftlichen Untersuchungen wenig dazu beigetragen, das Ausmaß der Gewalttätigkeiten zu senken. Möglicherweise ist ein Grund dafür, dass die Medienapparate von Anfang an zu machtvoll und zu einflussreich waren, als dass sie sich durch die klugen Ergebnisse auch nur annähernd hätten einschränken lassen. Ganz im Gegenteil: Durch die Einführung privater Sender und Anbieter konnten sie sich in wesentlich stärkerem Maße der staatlichen Kontrolle entziehen als zuvor. Die Pressefreiheit ist eine «heilige Kuh» – aber auch heilige Kühe können großen Schaden anrichten, wenn in ihrem Namen Bilder und Inhalte geliefert und verbreitet werden, die zu Mord und Vergewaltigung aufrufen, oder Foren angeboten werden, in denen junge Leute beispielsweise darüber diskutieren, was die Attentäter von Littleton oder Erfurt hätten «besser» machen können!
Früher verbreiteten die christlichen Kirchen in ihren Bildern, die sie auf die Kirchenwände malen ließen, Aufforderungen zu Gewalt, Totschlag, Diskriminierung oder Märtyrerverherrlichung.
In einer kleinen Kirche im Schweizer Hochtal der Surselva findet man beispielsweise das Altarbild des heiligen Zeno, der in jener Gegend missionierte, auf dem er – übermächtig im weißen Gewand – eine lange Lanze in den Körper eines dunkelhäutigen, lockenköpfigen Menschen rammt, der sterbend und blutend aus dem Bild dem Betrachter entgegenstürzt. Signalisiert die Dunkelhäutigkeit «Heidentum», so weist der Bocksfuß der Figur darauf hin, dass es sich eigentlich gar nicht um einen Menschen sondern um den Teufel handelt, den man ja bekanntlich straflos erschlagen darf! Generationen haben vor diesem beängstigenden und sehr dynamischen Bild gesessen, gekniet. Während langweiliger Predigten gab es Zeit genug, es in sich aufzunehmen und zu verarbeiten – seelisch offen, wie es bei spirituellen Zuständen üblich ist.
Die Kirchen nahmen jahrhundertelang jene Position ein, die wohl heute die Medien haben: Man glaubte ihnen. Und jahrhundertelang propagierten diese Kirchen Mord und Totschlag an Andersgläubigen, zettelten Kreuzzüge an, deren Nachwirkungen bis heute das Verhältnis zwischen Orient und Okzident belasten, brachten unzählige Frauen und Männer unter den obskursten Vorwänden auf die Scheiterhaufen, was zumindest die Einstellung gegenüber Frauen und ihrer Sexualität bis heute nachhaltig beeinflusst, und förderten die Verfolgung der europäischen Juden – bis ins 20. Jahrhundert hinein, als der Papst sich schweigend vom Massenmord unter den Nationalsozialisten abwandte.
Erst seit demokratische Kontrollen erstarkten – meistens mit dem Schlagwort «Trennung von Staat und Kirche» bezeichnet –, begannen sich die Großkirchen zu humanisieren und sukzessive an Macht zu verlieren.
Doch es gibt religiöse Gemeinschaften oder sogar global agierende Sekten, die sich letztlich sowohl nach innen wie nach außen noch immer so gebärden wie die europäischen Kirchen im Mittelalter und in der beginnenden Neuzeit. Außerdem zeigen Länder, die diese Trennung zwischen Politik und Religiosität nicht vollzogen haben, wie beispielsweise viele moslemische Staaten, ähnliche Erscheinungen wie das christliche Europa vor der Aufklärung. Ob ich nun «den Teufel» in Menschengestalt an die Wand male oder Leute, deren Lebenseinstellung mir nicht in den Kram passt, so nenne, bleibt sich gleich.
An die Stelle der Kirchen sind heute, vereinfacht gesagt, die Medien gerückt: Sie liefern Bilder und Gefühle, Geschichten und Erklärungsmuster. Es ist ganz sicherlich so, dass diese mächtigen Institutionen einen ähnlichen Aufklärungs- und Domestizierungsprozess zu durchgehen haben, wie ihn weiland die christlichen Großkirchen in Europa durchliefen und wie er für einige andere Großreligionen immer noch dringendst erforderlich ist. Dieses Thema einer politischen und staatlichen Gewaltprävention ist ein besonders umfangreiches und erfordert eine spezielle Behandlung.
Mein Buch befasst sich mit dem Umgang mit Gewalt auf der zwischenmenschlichen Ebene. Doch ich denke, dass es wohl höchste Zeit ist, auch einmal eine «heilige Kuh» zu schlachten – oder ihr wenigstens ein zähmendes Geschirr anzulegen. Auch echte Kühe lassen sich nur melken, sind also von Nutzen, wenn sie zahm sind und ruhig stehen. Gewaltdarstellungen zu verbieten muss ja nicht gleichzeitig heißen, dass Demokratie und Aufklärung keinen Platz mehr im Journalismus haben können, die Gewalttätigkeiten in den Religionen anzuprangern nicht, grundsätzlich spirituelle Bekenntnisse abzulehnen.
Was können also einzelne Personen oder auch kleinere Gruppen gegen Gewalt tun?
Wie lernt man, gewalttätige Strukturen so zeitig zu erkennen, abzubiegen und zu verhindern, dass sie gar nicht mehr «bekämpft» werden müssen? Wenn man wirklich Presse- und andere Freiheiten bewahren will, woher bekommt man die Kriterien, um legitime Grenzen zu ziehen? Woher nehme ich die Selbstgewissheit, um einen Menschen anzubrüllen, wissend, dass er mir tatsächlich etwas antun und nicht nur um Feuer für seine Zigarette bitten wollte? Aus welcher Ecke seines Bewusstseins nahm der mutige Lehrer in Erfurt die Energie, den jugendlichen Mörder zu stoppen?
Seit etwa dreißig Jahren gibt es die politische und praktische Beschäftigung mit der sexuellen Gewalt an Frauen und Mädchen. Sie war überhaupt das Grundthema, mit dem die sogenannte Neue Frauenbewegung in den Siebzigerjahren startete, als tausende von Frauen auf die Straßen gingen und skandierten: «Wir haben abgetrieben» und somit auf den Zusammenhang zwischen der scheinbar privat gelebten Sexualität und der politischen Machtlosigkeit der Frauen hinwiesen. In ungezählten Aufsätzen und Büchern wurde auf den Zusammenhang zwischen sexueller Ausbeutung und politischer Rechtlosigkeit hingewiesen. «Das Private ist politisch!» war der zentrale Slogan der Frauen-, aber auch teilweise der linken und Alternativbewegungen.
Die Analyse der sexuellen Gewalt kann eine Art Grundmuster für alle möglichen anderen Arten der Gewaltanwendung liefern. Insbesondere ist sie dann von Nutzen, wenn man sich nicht nur unbedingt mit den Gründen für die Gewaltanwendung in der Psyche des Täters befasst, sondern sich schlicht auf die eigentliche Konfrontationssituation bezieht.
Ich gehe nicht auf die seelischen oder sonstigen Ursachen von Gewaltanwendung ein und wage den politisch vielleicht höchst unkorrekten Satz, dass diese mich schlichtweg nicht interessieren. Mich interessieren die Opfer und die Frage, wie sie sich schützen können. Der weinenden Frau, die vergewaltigt wurde, gilt meine Sympathie, dem stotternden Mädchen, das von der sexuellen Gewalt an ihrem Körper durch den Stiefvater berichtet. Mich berühren die letzten Telefonate aus den Flug zeugen beim Attentat auf das World Trade Center und die Gefühle der Hinterbliebenen jener farbigen Mitbürger, welche von rechten Skinheads erschlagen wurden. Wenn ich versuchte, mir vorzustellen, wie ein Drittel meiner Kolleginnen und Kollegen mitten im Frieden von einem neunzehnjährigen Kerl abgeknallt würden, müsste ich verstummen. Wenn Sektenopfer in Aussteigegesprächen ihre Gurus und Guras[1]als brüllende, geifernde, schlagende oder sonst wie terrorisierende Menschen beschreiben, interessiert es mich nicht im geringsten,warumder Guru, die Gura so ist, wie er oder sie ist. Es ist für mich auch nicht von Belang, welche möglichen Kindheitstraumata beispielsweise einen Skinhead dazu brachten, seinen farbigen Mitbürger aus der Straßenbahn zu werfen, und ob es möglicherweise einen Zusammenhang zwischen Selbstmordattentätern und globaler Wirtschaftsweise gibt.
Ich möchte, dass potentielle Opfer eine Chance bekommen, der Gewalt zu entgehen oder sich zu wehren.
Das Buch soll ein Versuch sein, eine Art Erste-Hilfe-Kasten für Betroffene, eine Anleitung, mit der man lernen kann, gewalttätige Situationen rechtzeitig zu erkennen, ihnen auszuweichen oder sich gegen sie zu wehren.
Konservative und rechtspopulistische Politiker propagieren einen starken Staat, vermehrte Polizeipräsenz, Kontrollen jeglicher Art usw. – kurz: eine Einschränkung demokratischer Freiheiten und liberaler Errungenschaften moderner Gesellschaften. Schon jetzt sind als Reaktion auf die großen Attentate der letzten Jahre ein vermehrtes Kriegstreiben und ein Anziehen autoritärerer Gesetzgebung zu verspüren. Man kennt das auch aus den Zeiten der Roten-Armee-Fraktion in den Siebzigerjahren, als die Gewalt einer Handvoll Leute genügte, die sogenannten Notstandsgesetze aus der Taufe zu heben.
Ich bin nicht der Meinung, dass eine restriktive Gesetzgebung allzu viel gegen Gewalt ausrichtet. Sie führt letztlich wieder zu autoritativen Regierungen und unkontrollierbarer Staatsgewalt.
Niemand wird behaupten, dass es zur Zeit des Nationalsozialismus weniger Gewalt gegeben hätte als heute – außer jenen, die Völkermord und Holocaust nicht als Gewalt erkennen können!
Um zu vermitteln, wie manGewaltsituationen rechtzeitig einschätzenkann, werdenim ersten KapiteldieGrundmuster einer sexuellen Gewaltsituationdargestellt und jene Verhaltensregeln, Tricks und Abwehrmöglichkeiten beschrieben, mit denen sich eine sexuelle Gewaltattacke rechtzeitig erkennen und eventuell im Vorfeld schon mit Worten verhindern lässt.
Seit etwa fünfundzwanzig Jahren lernen Frauen, Mädchen und Menschen aus besonders gefährdeten Gruppen wie beispielsweise Körperbehinderte solche Selbstverteidigungs- und Selbstbehauptungsstrategien. Das Konzept mit der längsten Erfahrung wurde vor etwa dreißig Jahren von kanadischen Feministinnen entwickelt und nach Europa gebracht. Sein Name ist Wen-Do, was so viel heißt wie «Weg der Frau». Schon dieser Name impliziert, dass es dabei um mehr geht als nur um ein paar simple Abwehrschläge oder faule Überraschungstricks.
Anfang der Achtzigerjahre wurde ich in dieser Methode ausgebildet. Seit dieser Zeit haben viele Wen-Do-Lehrerinnen das Konzept unaufhörlich ausgebaut und insbesondere um psychologische und verbale Strategien erweitert.
Sind Frauen und Mädchen meistens durch die «private» sexuelle Gewalt im Rahmen von Gruppen bedroht, denen sie nicht ausweichen können, weil sie Teil der Stationen eines Lebenslaufs sind – Familie, Schule, Arbeitsplatz usw. –, fürchten beispielsweise behinderte und ausländische Menschen auch jene Gewalt, die ihnen an öffentlichen Orten begegnet: auf der Straße, in Parkhäusern, in öffentlichen Verkehrsmitteln.
Im zweiten Kapitel werden die Unterschiede und Parallelen zwischen eher privater und eher öffentlicher Gewalt dargestellt, wobei das Hauptaugenmerk auf den Unterschied zwischen vermeidbaren und unvermeidbaren Gruppen/Situationen gelegt wird.
Im dritten und vierten Kapitel beschreibe ich die Strukturen zweier Gruppen, denen man im Leben nicht notwendigerweise beitreten muss, in denen aber sehr häufig sexuelle und andere Gewalt vorkommt und die selber sehr oft auf die eine oder andere Art Gewalt gegen andere Menschen anwenden: rechtsradikale Gruppen/Parteien und sektenartige, fundamental-religiöse Gemeinschaften. Hier kann es geschehen, dass man verführt wird, oder man gerät aus anderen Gründen – von denen beispielsweise Sehnsucht nach Geborgenheit und Dazugehörigkeit ja eigentlich nicht die schlechtesten sind – in einen solchen Zusammenhang und unterschätzt das Gewaltpotential einer solchen Gruppe anfänglich.
Da ist dann erst einmal die wichtigste Frage, wie man innerhalb einer solchen Gruppe vermeidet, zum Opfer oder gar zum Mittäter zu werden, eventuell auch Freunden oder Liebsten hilft, und wie man schlussendlich, ohne allzu viel Schaden zu nehmen, dort wieder herauskommt, vielleicht sogar den Mut aufbringt, die Gewalttätigkeiten öffentlich anzuprangern.
Kapitel fünf behandelt die Vorgehensweisen der selbsternannten und gewaltgierigen Führer derartiger Gruppen und die Strategien, wie man sich gegen ihre Machtanmaßung und Gewalt wehren kann.
Dieses Buch soll eine Anleitung dazu sein, wo und wie auch immer, Gewalt, sexuelle Ausbeutung, politische Unterdrückung und finanzielle Entrechtung rechtzeitig zu erkennen sowie abwehren zu lernen, im Zweifelsfalle aber auch das manchmal Klügste zu tun, was einem übrig bleibt: abhauen! Denn Flucht kann in vielen Situationen immer noch die beste Verteidigung sein.
1.Gewalt hat ein GesichtSexuelle Gewalt in unvermeidbaren Gruppen – Familie, Schule, Ausbildung, Arbeitsplatz
1.1 MeinParfüm und dein Geruch oder: Wie weit reiche ich? Von Raumkapseln, Flügelspannweiten und Duftwolken
Gewaltbereitschaft kann man erkennen. Natürlich laufen gewaltbereite Menschen nicht mit einem Schild um den Hals herum, das die Aufschrift trägt: «Ich bin ein Schläger!» Doch sie zeigen Verhaltensweisen und haben Angewohnheiten, die auf eine niedrigere Hemmschwelle, andere Menschen zu attackieren, schließen lassen. Sie sprechen eine bestimmte Sprache und leben Gefühle aus, die ihre Freude an der Gewalt, an Macht, am Tyrannisieren Schwächerer oder Abhängiger signalisieren.
Warum sie sich so verhalten, kann einem im Grunde genommen ganz gleichgültig sein, besonders dann, wenn man selber in eine unangenehme Situation mit ihnen gerät. Da kann eingehendes Hinterfragen sogar hinderlich sein. Es ist der Geistesgegenwart abträglich, wenn man allzu lange darüber nachdenkt, warum der Herr, der doch an der Bushaltestelle anscheinend nur um Feuer bitten wollte, plötzlich nicht mehr loslassen will.
Über zwei Drittel aller Gewalttaten sind sogenannte Beziehungstaten, das heißt: Täter und Opfer kennen sich. Das trifft insbesondere auf die sexuelle Gewalt zu. Selten springt eine Art wildgewordener Tarzan in einem einsamen Park hinter einem Busch hervor und stürzt sich auf sein Opfer. Auch sonst lauern Täter weniger in der Einsamkeit der Bergwelt oder «im Wald». Das wäre ja auch eigentlich unlogisch, denn wer weiß, wie lange sie dort warten müssten, bis eine Wanderin vorbeikommt!
Das führt gleich zu einer weiteren Eigenschaft von Gewalt, insbesondere der sexuellen Gewalt: Entgegen landläufigen Auffassungen, die immer noch durch die Medien geistern, geschehen die meisten Sexualstraftaten nicht aufgrund spontan aufgetretener, unbeherrschter Triebe, die sich da plötzlich, beim Anblick eines Kindes, einer Frau, Bahn brachen – vielleicht gar, weil der «arme Täter» seit Wochen keinen sexuellen Kontakt mehr hatte, seine Frau nicht mit ihm schlafen will oder er als Priester im Zölibat lebt.
Solche Vorstellungen verlagern die Schuld an der sexuellen Attacke erstens auf die Umwelt des Täters, beispielsweise die «böse Gattin», die ihren «ehelichen Pflichten» nicht nachkommt, oder eine altbackene Kirchenregel, welche die Priester oder Mönche unter ihre Knute zwingt; zweitens auf irgendein diffuses Innenleben, das Unbewusste, die Triebe oder Instinkte, die sich nach Art eines Naturereignisses entluden, wofür der Täter eigentlich gar nichts konnte – besonders, wenn er Alkohol getrunken hatte und seine bewussten Kontrollen noch niedriger lagen als sonst vielleicht.
Beide Erklärungsmuster sind anscheinend aus der seltsamen Angst entstanden, die Täter wirklich beim Namen zu nennen. Die Gruppe der Männer in Gestalt von Ärzten, Richtern, Gutachtern und anderen Fachleuten scheute sich jahrzehntelang, die einfache, aber schreckliche Tatsache zu benennen, dass Männer, geplant und ohne Wenn und Aber, zu Vergewaltigern werden können. Erst die Neue Frauenbewegung hat seit den Siebzigerjahren des 20. Jahrhunderts immer wieder darauf hingewiesen und das ganze Ausmaß der Verschweigerei öffentlich gemacht. Seitdem sind zumindest die männlichen Fachleute, Polizisten, Richter und Gerichtspsychiater usw. bereit, in dieser Sache Klartext zu reden.
Auch kleinere Gruppen scheuten und scheuen sich bis heute, offen über Gewaltanwendung durch ihre Mitglieder zu sprechen: Die Kirchen waren groß im Verschweigen, als nach und nach die sexuellen Übergriffe einiger ihrer Priester an Kindern zum Vorschein kamen; Lehrer wurden jahrzehntelang einfach von Gemeinde zu Gemeinde strafversetzt, wenn dergleichen publik wurde; Standesorganisationen versuchten, Anklägerinnen mundtot zu machen.
Ich werde weiter unten noch einige Male auf dieses Phänomen des Abwehrens und Verschweigens zurückkommen, über welches auch viele Menschen ein trauriges Lied singen können, die innerhalb ihrer Familien sexueller Gewalt ausgesetzt waren und sie Jahre später anzuklagen versuchten.
Doch die Täter sind auf jeden Fall die Schuldigen, denn Anmache, sexuelle Übergriffe und Vergewaltigungen sind meistens geplant. Der Täter hat sich sein Opfer, das ihm im Bekannten oder Verwandtenkreis begegnet ist, längst ausgesucht. Er entwickelt eine Strategie, sich der Frau zu nähern oder das Kind in seine Nähe zu holen. Meistens ist er eine vertraute Person, vor dem das potentielle Opfer erst einmal keine Angst hat. Und meistens befindet sich dieses in irgendeiner Art Abhängigkeit vom Täter – emotional, weil er ein Mitglied der Familie ist, finanziell, weil er die Ausbildung bezahlt, leistungsmäßig, weil er ein Lehrer oder anderer Ausbilder ist, spirituell, weil er der Beichtvater ist, usw.
Wenn aber die Täter aus dem eigenen, nahen Umfeld stammen, stellt sich die Frage: Woran kann ich sie erkennen? Denn ganz sicherlich sind ja nicht alle Männer Vergewaltiger, sexuelle Anmacher oder sonstwie glibberige Personen. Das Erkennen eines potentiellen Täters ist vor allen Dingen immer noch eine Sache des Gefühls, der Intuition – weniger kühl-sachlicher Überlegungen.
Jeder hat wahrscheinlich schon einmal Stare oder andere Vögel auf einem Draht, einer Stange oder einer Überlandleitung sitzen sehen. Sie halten voneinander einen ziemlich gleichmäßigen Abstand, der mit ihrem eigenen Körperumfang, der Länge der Flügel, des Schnabels und noch anderen Äußerlichkeiten korrespondiert.
Manchmal, wenn sich jeder Vogel in seinem Revier aufhält, wird die Stimme eingesetzt, um den Umfang dieses Reviers zu markieren, der in irgendeiner Weise mit der Reichweite dieser Stimme zusammenhängt.
Wenn man sich einem Spatzen nähert, der auf dem Boden hockt, so wartet dieser einen ganz bestimmten Moment ab, um aufzufliegen. Auch Wildtiere verhalten sich so, Katzen, die in der Sonne liegen, oder Frösche, die sich am Rande eines Teiches auf Seerosenblättern sonnen.
Jedes Tier hat eine ganz bestimmte Fluchtdistanz – und diese wiederum bestimmt sich aus der Art und Reichweite seiner eigenen Körperwaffen, aus seiner Schnelligkeit und dem Ausmaß der Bedrohlichkeit des sich nähernden anderen Tieres oder des daherkommenden Menschen. Menschengewohnte Vögel wie der Kulturfolger Spatz haben eine erstaunlich geringe Fluchtdistanz, sie scheinen aber auch genau zu wissen, dass wir nicht fliegen können. Ein Löwe wiederum hat uns gegenüber gar keine Fluchtdistanz, und jene des Menschen ist gegenüber einem größeren Raubtier eigentlich unendlich: Es ist das Beste, wenn der Löwe den Menschen, der da durch die Savanne läuft gar nicht erst sieht.
Die Flucht- oder Beißdistanz eines Hundes, der ein domestiziertes Raubtier, ein ehemaliger Wolf ist, ist uns Menschen gegenüber sehr gering, im Ernstfall befindet sie sich irgendwo in der Nähe seiner Haarspitzen. Ein Hund gilt als unberechenbar, wenn man ihn nicht ungestraft anfassen darf. Manchen Hunden hat man das Revierverhalten aber gelassen oder neu anerzogen. Sie dienen als Wachhunde und verbellen oder beißen jeden, der das Revier unerlaubt betritt. In freier Wildbahn markieren hundeähnliche Tiere ihre Gebiete mit ihrem Sekret, das sie an Bäumen, Steinen und anderen markanten Stellen in der Landschaft deponieren. Wehe, ein anderes Tier dringt in dieses zwar unsichtbare, aber riechbare Revier ein!
Auch wir Menschen haben im Grunde genommen noch solche Reviere. Unsere Vorfahren, die Australopithecinen in der afrikanischen Savanne oder die ersten Lagerfeuermacher im eiszeitlichen Europa, hatten sicherlich noch ein stärkeres Sensorium dafür als wir Menschen der Gegenwart. Aber wenn wir uns selbst ein bisschen genauer beobachten, können wir an uns selber durchaus noch solche Eigenarten wie eine Fluchtdistanz feststellen. So ist es beispielsweise den meisten Leuten sehr unangenehm, mit fremden Menschen irgendwo im Bus oder in der Straßenbahn zusammengepfercht herumstehen zu müssen; rappelvolle Kaufhäuser senken die Lust am Einkaufsbummel rapide, und das Gedrängel in einer Disco hält man eigentlich nur aus, weil in der Nähe die eigenen Leute herumtanzen, die Freundinnen und Freunde aus der Clique, mit der man losgezogen ist.
Eine Art von Revier ist also wohlungefähr die Länge der eigenen Arme, die auch gewissermaßen unsere Körperwaffen sind. Man hält unvertraute und fremde Menschen am liebsten mindestens eine Armlänge weit von sich. Aus dieser Distanz kann man übrigens auch am besten ihr Gesicht betrachten, ihre Mimik beobachten und daraus ihr Verhalten einschätzen. Auf der anderen Seite lässt man die Freundinnen, vertraute Menschen in diesen Bereich hinein.
Eine andere Möglichkeit, die in unserer Kultur vor allem Frauen nutzen, ist die Verstärkung des eigenen Körpergeruchs. Mehr oder weniger dezente Parfüms signalisieren: Mein Raum reicht so weit wie mein Geruch! Umgekehrt gibt es eine ganze Menge Menschen, die man «irgendwie» nicht riechen kann und von denen man dann sicherlich einen größeren Abstand braucht als nur eine Armlänge. Wenn Menschen mit ihrem Parfüm, ihrem Geruch einen ganzen Raum füllen, so empfinden wir das als dominant, nervig, unhöflich, vielleicht sogar ein bisschen nuttig. Ich hatte eine Tante, die drückte das, zum Schrecken meiner wohlerzogenen Frau Mama, so aus: «Diese Dame da stinkt wie ein ganzes Freudenhaus!» Meine Armlänge – die Flügelspannweite – ist also eine Distanz, der Körpergeruch eine weitere.
In Kursen erlebe ich häufig, wenn ich mit Frauen oder Mädchen Übungen zu diesem Thema durchführe, dass es noch eine mittlere Distanz zwischen der Geruchsentfernung und der Armlänge gibt: Sie ist länger als der etwa eine Meter der Flügelspannweite und kürzer als die drei bis fünf Meter des Geruchsreviers und befindet sich irgendwo dazwischen, etwa fünfzig bis achtzig Zentimeter außerhalb der Fingerspitzen der ausgestreckten Arme.Diese Entfernung nenne ich in Kinderkursen «Gartenzaun». Sie entspricht der Armlänge plus einem kleineren Schritt nach vorne. Der unmittelbare Meter der Armlänge ist das «Haus», manchmal gebrauche ich auch das Bild der «Raumkapsel » oder der «Adlerfittiche».
Man teilt die Menschen seiner Umgebung letztlich mehr oder minder bewusst danach ein, wie nahe man sie an sich herankommen lassen will: Wen lasse ich in mein «Haus», wen eigentlich lieber nur bis zum «Gartenzaun», und wen kann ich überhaupt nicht riechen und hätte am liebsten, dass er oder sie den Raum verlässt?
Das Problem ist aber, dass man insbesondere in abhängigen Situationen, in Gruppen/Situationen, die man nicht vermeiden kann, wie beispielsweise Schule und Ausbildung – aber eigentlich doch schon morgens im Bus auf der Fahrt zu dieser Schule oder diesem Ausbildungsplatz –, immer wieder Menschen über seine persönlichen Distanzschwellen treten lassen muss: Lehrer bauen sich hinter dem Rücken auf, weil sie ins Heft oder auf den Computermonitor schauen müssen, Meister schauen einem an der Drehbank auf die Finger, wildfremde Leute quetschen sich im Bus neben einen auf die Bank.
Wir könnten diese ständige Nähe gar nicht aushalten, wenn wir nicht davon ausgingen, dass sich all diese zusammengepferchten Menschen eigentlich nichts Böses antun wollen, dass der Lehrer helfen, der Meister Tipps geben will und der Dicke auf der Bank nur müde Füße hat. Ohne ein grundsätzliches Vertrauen in die Gutwilligkeit unserer Mitbürger könnten wir gar nicht auf dem engen Raum zusammenleben, den uns eine moderne Gesellschaft aufzwingt.
Neben dem Vertrauen weiß man aber auch, dass es Regeln gibt, wie jeder Mensch sich anständig und unaufdringlich zu verhalten hat. Diese Regeln sind teilweise als Gesetze niedergelegt, teilweise auch unausgesprochene Gewohnheiten. Man hält sich selber daran und setzt deshalb voraus, dass andere das auch tun. Außerdem gibt es Beschwichtigungsrituale, um die engen Situationen erträglich zu machen: Der müde korpulente Herr lächelt uns entschuldigend an, wenn er sich in die Bank zwängt; der Lehrer räuspert sich und taucht nicht auf leisen Sohlen plötzlich hinter einem auf; der Meister fragt, ob er das mal genauer zeigen dürfe, und bittet einen, von der Werkbank zurückzutreten.
Da höre ich auch schon einige der – insbesondere jüngeren – Leserinnen lachen! Das sei eine Utopie, die da beschrieben werde, sagen sie. Der dicke Herr lächelt nicht, sondern schnauft nur empört, wenn man sich nicht sofort zusammenfaltet; der Lehrer schleicht sich durchaus heimlich an; und der Meister schiebt einen einfach ohne große Worte zur Seite. Man ist in dieser Hinsicht allerlei gewohnt und lässt es geschehen. Genauer gesagt: Man ist abgestumpft – aber ohne eine solche Abstumpfung müsste man, insbesondere als Frau, permanent schreiend durch die Gegend laufen.
Die Utopie des vollendeten, höflichen und rücksichtsvollen Verhaltens kann sich gar nicht total durchsetzen. Aber jeder kennt die angenehmen Verhaltensweisen von Menschen, die aus kleinen und dichtbesiedelten Ländern kommen, die noch dazu bereits seit Jahrhunderten wegen hoher Berge, tiefer Täler oder schmaler Insellandschaften auf engstem Raum zusammengedrängt leben mussten: die Höflichkeit der Schweizer und Japaner beispielsweise.
Dass der Meister seinen Lehrling ungefragt beiseiteschieben darf, hat natürlich auch etwas mit dem Machtgefälle zwischen den beiden zu tun: Der Lehrling ist von seinem Ausbilder abhängig, die Schülerin in ähnlicher Weise vom Lehrer. Nur von dem korpulenten Herrn auf der Bank ist man nicht abhängig, weshalb man sich sehr gut vorstellen kann, diesen eventuell anzuschnauzen, wenn er einen gar zu heftig in die Ecke quetscht, denn außer dass dieser zurückschnauzt, kann nicht viel passieren. Lehrer und Meister könnten dagegen auch eine höfliche Bitte um Rücksichtnahme in den falschen Hals bekommen, die Noten herabsetzen oder das Fegen der Werkstatt nach Feierabend verordnen.
Neben der Grenzüberschreitung – hier das Niederwalzen des «Gartenzaunes» – ist also die Abhängigkeit das große Problem. Es geht um die Bereitschaft des Lehrers, des Meisters, trotz seiner vorgesetzten Position die Distanz zu seiner Schülerin zu achten und die Regeln der Höflichkeit und Rücksichtnahme auch im Rahmen einer hierarchischen Beziehung einzuhalten.
Wir werden sehen, dass es natürlich durchaus solche Leute gibt. In meinen Augen zeichnet die Bereitschaft, Jüngeren und Schwächeren nachzugeben und ihre Integrität zu achten, sogar einen guten Lehrer und auch andere Menschen aus. Lehrherren, die man nicht einmal bitten kann, doch etwas weiter zur Seite zu treten, Lehrer die jovial-unbewusst permanent in den «Gärten» ihrer Schülerinnen und Schüler herumlatschen, ohne auf deren Abwehrmechanismen oder Bitten um Distanz zu reagieren, sollten lieber noch einmal eine Runde in ihrem Studium, ihrem Meisterkurs drehen.
Aber das gilt auch umgekehrt: Nicht jeder Erwachsene fällt begeistert in Ohnmacht, wenn sich kleine, manchmal etwas verdreckte Kids an seine Arme hängen; nicht jede Frau ist glücklich, wenn man ihr ungefragt einen Säugling in den Arm drückt; nicht jeder Pädagoge freut sich über hautnah herandrängende Jugendliche. Man muss immer die Möglichkeit haben zu sagen: «Gehen Sie bitte etwas zur Seite», ohne unangenehme Folgen für sich damit heraufzubeschwören. Leute, bei denen man sich das nicht getraut, aus welchen Gründen auch immer, und Leute, die nicht auf solch eine Bitte eingehen, sind keine angenehmen Zeitgenossen und sollten uns zu denken geben.
Schlagworte
Der Täter ist bekannt. Die Tat ist geplant. Das Opfer ist abhängig.
Regeln
Meine Raumkapsel gehört mir. Myhomeismycastle. Ich bestimme, wer unter meine Fittiche darf.
1.2Mehr als eine «Aura»: Die «Wolke» einer Frau reicht meterweit!
Therapeutinnen und Therapeuten, die mit der Vorstellung von «Energien» arbeiten oder spirituell eingestellt sind, nennen die im vorhergehenden Abschnitt dargestellten Distanzräume auch «Aura». Damit meinen sie diese Art «Wolke», dieses geistige «Ei», das uns umgibt.
Als Nächstes werde ich zeigen, dass solch eine «Wolke», solch ein «Raumschiff» oder «Haus» noch weiter reichen kann als der oben beschriebene «Gartenzaun» oder die wenigen Meter, die uns unsere Riechfähigkeit signalisiert. Man kann die Distanzschwellen einer anderen Person nämlich auch noch auf andere Weise überschreiten als nur durch bloßes Zur-Seite-Drängen oder «Von-hinten-Anschleichen».
Insbesondere auf dem Gebiet der sexuellen Attacken gibt es bekanntlich die Methoden, durch Blicke, durch einen bestimmten Gesichtsausdruck oder mit Bemerkungen aller Art diese Grenzen zu durchbrechen.
Im positiven Sinn haben wir das schon alle einmal ausprobiert, wenn wir mit einer Person, die uns gefiel oder sexuell anzog, flirteten. Begegnet man einer solchen Person, fangen irgendwo in der Gegend des Magens kleine Schmetterlinge an, wie wild herumzutanzen. Dann reißen wir als Erstes unsere Augen weit auf, wir lächeln der schönen Person auch aus weitester Entfernung zu, schauen sie an, freuen uns, wie schön sie aussieht, bemühen uns um Blickkontakt und werden – wenn wir Pech haben! – rot, falls diese Person den Blick tatsächlich erwidert! Kurz, wir signalisieren mit unseren Augen, dass wir hellauf von ihr begeistert sind.
Als Schülerin himmelte man vielleicht in dieser Weise den jungen Philosophie-Referendar an oder eventuell die verehrte Lateinlehrerin! Das soll es geben und sich übrigens auf die Schulleistungen ungeheuer gut auswirken.
Als Schülerin darf ich das. Ein guter Lehrer und eine vernünftige Lehrerin werden die Himmeleien ihrer Schülerinnen und Schüler nicht fördern und ganz sicherlich nicht auf sie eingehen – eben wegen der Abhängigkeit und des Machtgefälles. Schlechte Lehrer gehen darauf ein und nehmen sie als Vorwand, näher zu rücken. Später behaupten sie dann, dass sie nicht anders gekonnt hätten und die Schülerin sie «angemacht» hätte. Das ist ein Blödsinn, denn junge Leute haben ein Recht, ihre Kräfte auszuprobieren, und es ist eine Frage der Reife und der Vernunft der älteren Personen, diese Anschmachtereien in die richtigen Bahnen zu lenken.
In Chören, Sportvereinen und anderen Gruppen, die nicht unbedingt lebensnotwendig sind, ist der Flirt eine Art Essenz des mitmenschlichen Umgangs miteinander. Er verschönt das Leben, und wer nicht angeflirtet werden will, kann die Augen abwenden oder etwas dazu sagen. Flirten und Anlächeln sind die positiven Weisen auf eine weitere Distanz hin, Kontakt mit Menschen aufzunehmen, die einen körperlich anziehen.
Doch dieses Kapitel handelt von den unangenehmen Überschreitungen der Distanzgrenzen. Dazu gehört zum Beispiel die Anstarrerei, dieses «Mit-den-Blicken-Ausziehen», das viele Frauen und Mädchen schon einmal erlebt haben. Das kann über viele Meter hinweg geschehen und ist sehr unangenehm. Dem Starrer geht es offensichtlich auch nur um Teile der anderen Person, Körperteile, nicht um die ganze Person. Er starrt auf den Busen der jungen Frau oder leckt sich die Lippen angesichts ihrer Beine. Moderne Frauen behandeln heutzutage manchmal auch Männer so: Sie starren auf den Schritt eines Mannes oder lecken sich die Lippen angesichts seines Hinterns.
Das Starren signalisiert auch nicht, dass man Kontakt aufnehmen will, sondern dass man sich am angeschauten Teil selber schon aufgeilt – ganz unabhängig vom Wesen oder gar von den Interessen der angestarrten Person. Die Frau wird zu einem Objekt, der Anstarrer zum Jäger, der auf einen kleinen Ausschnitt zielt.
Auch wenn er viele Meter entfernt dasteht, hat die angestarrte Person das gleiche Gefühl wie bei dem korpulenten Herrn, der seine Mitfahrerin gegen die Fensterscheibe des Busses drängelt: ein Gefühl, nicht geachtet zu werden, als Gegenstand behandelt zu werden, eine körperliche Aufmerksamkeit zu bekommen, um die man sicherlich nicht gebeten hat. Auch wenn sich der Starrer nicht bewegt, scheint es, als würde der Gartenzaun niedergerissen und als würden die Hauswände mit Kot verschmiert.
Ungebetenes Anstarren ist eine der ersten Stufen sexueller Gewalt. Es dient unter anderem auch dazu, die angestarrte Person zu verunsichern und sie auf Objektstatus herunterzudrücken: Sie ist nicht mehr wert als ihr Po oder ihr Busen. Der Starrer bedient sich der Frau, des Mädchens, manchmal auch den Mannes oder Jungen, ohne sie zu fragen, und er tut dies im wahrsten Sinne des Wortes ohne «Ansehen der Person». Die Persönlichkeit und der Charakter des/der Angestarrten interessieren ihn auf keine Weise, schon allein deswegen, weil dahinter ein eigener Wille steht und die Person eventuell sagt: «Nein!», «Lass das!» oder «Glotz nicht so!» Dann stellt sie ihren eigenen Willen, ihre eigenen Wünsche denen des Starrers entgegen.
Die meisten Menschen können übrigens auch sehr sicher zwischen den bewundernden, liebevollen Blicken des Flirtens und den raubgierigen des Starrers unterscheiden. Im ersten liegt Lob und Anerkennung, Neugierde, was sich wohl hinter dem schönen Äußeren noch verbirgt. Im zweiten liegt gar nichts außer Macht. Nicht einmal ein Metzger schaut das zu schlachtende Tier so abfällig an wie ein geiler Starrer sein Opfer.
Hier genügt es nicht, nur ein paar Meter zwischen den Starrer und sein Opfer zu legen. Am besten wäre es, man könnte unmittelbar eine Wand hochziehen, die einen vor den Blicken des anderen verbirgt.