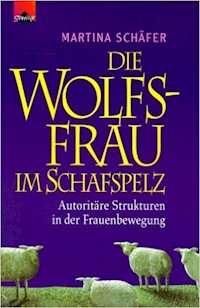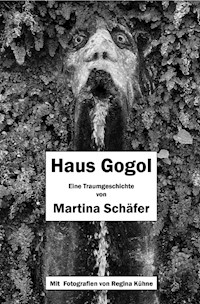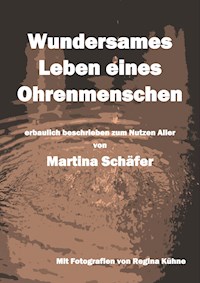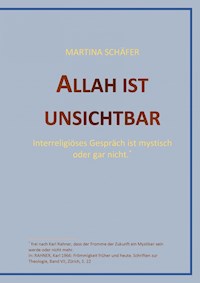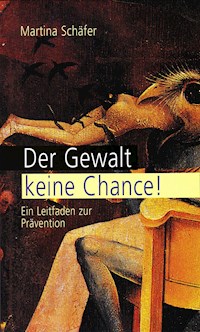Die Geschichte des Institutes für Ur- und Frühgeschichte an der Universität zu Köln E-Book
Martina Dr. Schäfer
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Eine Studie zur Geschichte des Instituts für Ur- und Frühgeschichte zu Köln. Der erste Teil behandelt die Jahre von 1925 - 1938 unter Herbert Kühn. Wie entwickelte sich die Vorgeschichte von einer eher "geisteswissenschaftlich" orientierten zu einer eher "naturwissenschaftlich" orientierten? Der zweite Teil behandelt die Zeit von 1938 - 1945 unter Walter Stokar von Neuforn. In welchem Verhältnis standen Naturwissenschaft und politische Ideologie? Im dritten Teil wird die Ära Schwabedissen von 1958 - 1985 darfestellt. Welcher Art waren die geistigen, institutionellen und personellen Kontinuitäten nach dem Krieg?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 638
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Geschichte des Institutes für Ur- und Frühgeschichte an der Universität zu Köln.
1925 bis zur Emeritierung von Hermann Schwabedissen
Schriftliche Hausarbeit im Rahmen der Prüfung zum Abschluss des Magister artium
vorgelegt von
Martina Schäfer
Hauptprüfer:
Professor Dr. Heinz – Werner Dämmer
Institut für Ur- und Frühgeschichte an der Universität zu Köln
Weyertal 125
Dr. Martina Schäfer, Multergasse 35, CH – 9000 St. Gallen
meiner Tante Doris Brandt, die ich mit meinen auf die Vergangenheit bezogenen Fragen allzu oft aus dem Gleichgewicht brachte
St. Gallen im Sommer 2002
I.Teil
Motto:
Gerade unsere Zeit am Ende einer rationalistischen Epoche, sieht wie keine Zeit vorher die Grenzen der Erkenntnis, weil sie die Vergeblichkeit aller Bemühungen seit Descartes, die Wirklichkeit zu beweisen, erfahren hat. ...Damit nähert sich die Weltanschauung unserer Zeit wieder der der Primitiven. (KÜHN 1932/1, 6)
1. Einleitung
1.1. Ziel
Die Umstände, unter denen Wissenschaft betrieben wurde und wird, die finanziellen und räumlichen Voraussetzungen für Forschung und Lehre, die gesellschaftlichen, politischen und individuellen Voraussetzungen sind Thema forschungsgeschichtlicher Arbeiten. Die wissenschaftlichen Inhalte sind Thema der Forschungsgeschichte insofern, als sie von diesen Voraussetzungen beeinflusst wurden. Darüber hinaus unterliegt der wissenschaftliche Diskurs innerhalb eines Faches aber auch innerhalb verschiedener Disziplinen und Forschungsrichtungen im Laufe seiner Geschichte Entwicklungen, welche das Selbstverständnis der wissenschaftlichen Vertreter eines Faches prägen. Forschungsgeschichte beschreibt das Umfeld, in welchem Wissenschaft entsteht, den gesellschaftlichen Diskurs, die politischen Verhältnisse und ihren Einfluss auf Fragestellungen und Inhalte von Wissenschaft.
Gleichzeitig stellt sie die methodischen Entwicklungen dieser Wissenschaft selber und die in ihr ablaufenden fachlichen Diskussionen dar.
Am Beispiel der Geschichte des Instituts für Ur- und Frühgeschichte an der Universität zu Köln soll ein räumlich und zeitlich begrenzter Teil der deutschen Ur- (bzw. Vor-) und Frühgeschichtsforschung dargestellt werden. Dabei liegt der Schwerpunkt dieser Arbeit zuerst einmal auf der Darstellung der Geschichte des Institutes selber.
Der Charakter des Institutes wurde zeitweilig sehr durch die wissenschaftlichen und politischen Interessen seiner Leiter geprägt, sodass die Geschichte des Institutes schwerpunktmässig ausserdem Personengeschichte ist.
Wissenschaft geschieht nicht unabhängig von ihren äusseren, politischen und gesellschaftlichen Gegebenheiten. Autoritäre Politik und Machtmissbrauch beeinflussen Forschung und Lehre und prägen die betroffenen Menschen. Das ist unter Anderem Thema des ersten Teils meiner Arbeit.
Schon die Gründungsgeschichte des Institutes in den späten Zwanzigerjahren als auch Initiativen aus den sechziger und Siebzigerjahren zeigen ein erstaunlich hohes Mass an individuellen Initiativen. Dieses hohe persönliche Engagement, wie es zum Beispiel den Neubegründer Hermann Schwabedissen auszeichnete, prägte die Geschicke des Instituts seit den fünfziger Jahren und ist schwerpunktmässig ein Thema des zweiten Teils meiner Arbeit. Meine eher beschreibende Darstellung der Institutsgeschichte wirft immer wieder Fragen auf, deren nähere Bearbeitung den Rahmen dieser Arbeit bei weitem überschreiten würde. Ich betrachte deshalb meine Abhandlung zur Geschichte des Institutes für Ur- und Frühgeschichte zu Köln als Basis für eine ganze Anzahl weiterer Arbeiten zu einzelnen Themen und Problemen, die im Rahmen meiner Arbeit aufscheinen und auf die ich an den jeweiligen Stellen hinweisen werde.
1.2. Methodisches Vorgehen
1.2.1. Quellen
Diese Studie beruht hauptsächlich auf Archiv- und Quellenmaterial, dass mir an der Universität Köln zur Verfügung stand.
Es wäre durchaus möglich gewesen, sich noch weiterer Archive, wie beispielsweise der Nachlässe der Institutsleiter, die teilweise im Bundesarchiv zu Koblenz (Herbert Kühn) oder in Schleswig-Holstein (Hermann Schwabedissen), teilweise an anderen Orten zu finden sind, zu bedienen.
Zum einen hätte das jedoch den zeitlich gesetzten Rahmen einer Magisterarbeit überschritten.
Zum anderen wäre dadurch der biografische Anteil stärker geworden, als ich es beabsichtigte. Ich möchte aber an dieser Stelle ausdrücklich darauf hinweisen, dass wissenschaftsbiografische Darstellungen zu allen Direktoren des Institutes sehr interessant sein könnten. Jeder von ihnen – Herbert Kühn, Walter von Stokar und Hermann Schwabedissen – steht, sowohl im positiven als auch im negativen Sinn, beispielhaft für die Wissenschaftsauffassung seiner jeweiligen Epoche.
Der wichtigste Quellenapparat für den ersten Teil meiner Arbeit, das Institut in den Jahren 1930–1948, ist das Universitätsarchiv zu Köln gewesen.
Hier hatte ich den Vorteil, mit inventarisierten Akten arbeiten zu können.
Für den zweiten Teil meiner Magisterarbeit, das Institut in den Jahren 1958 bis etwa 1980, stand mir nicht inventarisiertes Aktenmaterial des Institutes zur Verfügung. Das Material wurde, provisorisch nach seinen Stellplätzen geordnet (z. B. Fachschaftsordner, Lehrsammlung) und mit Notsignaturen versehen. Den grössten Anteil hatte ehemaliges Aktenmaterial aus dem Sekretariat des Instituts für Ur- und Frühgeschichte, etwa siebzig Aktenordner, welche zum Zeitpunkt meiner Recherchen in einer Garage gelagert waren (das sogenannte «Garagenarchiv») und mittlerweile, nach Beendigung meiner Recherchen, auf Veranlassung des Universitätsarchivars, in das Universitätsarchiv überführt wurden. Bei der endgültigen Inventarisierung dieses Materials wird die Notsignatur, nach der ich vorgegangen bin, berücksichtigt und aufschlüsselbar sein.
Laut §7 des Archivgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen darf Archivgut frühestens nach Ablauf von 30 Jahren seit Entstehung der Unterlagen genutzt werden. Bezieht es sich nach seiner Zweckbestimmung oder nach seinem wesentlichen Inhalt auf eine natürliche Person, so darf es frühestens 10 Jahre nach deren Tod genutzt werden.
Aus diesen Bestimmungen ergibt sich die Beschränkung des Zeitraumes der dargestellten Institutsgeschichte auf die Jahre von etwa 1925 bis etwa 1980 (= Ende der «Ära Hermann Schwabedissen»).
Die Schreibweise der Quellen, insbesondere der Akten aus den Jahren 1920 bis 1950, habe ich beibehalten. Weder veränderte ich die Grammatik noch die Orthografie noch sogar eventuelle, offensichtliche Schreibfehler. Auf bedeutsame Tippfehler weise ich hin. Für die Jahre nach 1950 fällt der Rückgang orthografischer Fehler in den Sekretariats- und anderen Akten auf. Ich habe mich auch da bei der Zitation an die damals übliche Orthografie gehalten, die seltenen Fehler ebenfalls beibehalten.
In das Ende der von mir recherchierten Phase fällt der Beginn des «Computerzeitalters», was sich noch einmal sehr entscheidend auf Aussehen und Orthografie der zitierten Quellen auswirkte. Verfügt man für die Jahre zuvor meistens über die sowieso weniger sorgfältig korrigierten Durchschläge der Briefe und Mitteilungen, so fallen diese zum grossen Teil nach Einführung der Computer fort, was zur Folge hat, dass man in den Akten nur mehr die eine Seite der Briefwechsel vorfindet, während man für die Jahre davor oft beide Seiten eines Briefwechsels abgelegt findet.
Ergänzend zur Materialaufnahme über die Archive führte ich eine Reihe freier Interviews mit ehemaligen Studierenden, Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Institutes sowie mit verschiedenen Dozenten, Dozentinnen und Laborleitern.
Die Interviews wurden in freier Rede und Gegenrede durchgeführt und nach Notizen sowie dem unmittelbaren Gedächtnisprotokoll niedergeschrieben.
Nach Vorlage dieser Niederschriften wurde ein weiteres, ergänzendes oder korrigierendes Gespräch durchgeführt.
Diese Form der Befragung entsprach den Wünschen der meisten Interviewten, denen ich verschiedene Befragungsmodelle (beispielsweise auch mit Aufnahmegeräten oder an Hand eines vorher festgelegten Fragenkataloges) vorgeschlagen hatte.
Darüber hinaus führte ich mit einigen Probanden Briefwechsel, teilweise gekoppelt mit telefonischen Befragungen. Diesen wurden die gleichen Fragen gestellt, wie den mündlich interviewten und sie erhielten die gleiche Gelegenheit zur korrigierenden Rückkoppelung durch eine Vorlage des Interviewtextes.
Ich möchte an dieser Stelle allen Befragten für ihre Bereitwilligkeit zu cooperieren und für ihr teilweise nicht unerhebliches Engagement danken!
In dieser Weise durchgeführte Interviews gehören in den methodischen Zusammenhang der sogenannten «oral history», wie sie in den Siebzigerjahren, insbesondere in Hinsicht auf die Befragung von zeitgenössischen Zeugen, entwickelt worden ist.
Im Zweifelsfalle – also beispielsweise bei Unsicherheiten bezüglich bestimmter Daten oder anderer harter Fakten – gilt die Regel: Schriftquelle gilt mehr als mündliche Quelle. Beide Quellenarten wurden vor allen Dingen unter dem Aspekt der beschreibenden Darstellung verwendet.
Einen dritten Quellenapparat bildeten die wissenschaftlichen Texte aus der Ur- und Frühgeschichtsforschung, z. B. die Aufsätze und Abhandlungen von Herbert Kühn oder Walter von Stokar zu verschiedenen Themen und Forschungsgebieten.
Neben der Darstellung der ideengeschichtlichen Entwicklung des Faches Ur- und Frühgeschichte, seiner verschiedenen Schwerpunkte, Fragestellungen und methodischen Entwicklungen im Laufe des zwanzigsten Jahrhunderts stand, insbesondere für den ersten Teil meiner Arbeit, der sich mit der Ur- und Frühgeschichte unter dem Nationalsozialismus befasste, die Frage nach der ideologischen Beeinflussung der Ur- und Frühgeschichtsforschung im Vordergrund.
Eine solche Frage ist, auf literaturwissenschaftliche Weise, durch Interpretation der vorliegenden Texte zu beantworten.
Im zweiten Teil meiner Arbeit verschob sich die literaturwissenschaftliche Analyse in Richtung auf die methodischen aber auch ideologischen Auseinandersetzungen zwischen eher restaurativen sowie geisteswissenschaftlichen Richtungen und den naturwissenschaftlichen Methoden und Vorgehensweisen in der Ur- und Frühgeschichtsforschung. Insbesondere für die Auseinandersetzung zwischen naturwissenschaftlicher und geisteswissenschaftlicher Schwerpunktsetzung bildete das Kölner Institut ein wichtiges Beispiel.
1.2.2. Zu literatur- und sprachkritischen Analyse wissenschaftlicher Texte
Die sprachkritische Analyse befasst sich nicht so sehr damit, ob ein Text wissenschaftlich richtige Aussagen macht. Sie geht davon aus, dass sowohl richtige als auch falsche Inhalte ideologisch verbrämt werden können.
Die sprachkritische Analyse behandelt zwar wissenschaftliche, belletristische, gesprochene, u. a. Texte gleich. Trotzdem sieht sie die jeweilige Textart auch als Kontext, in dem eine bestimmte sprachliche Wendung, Meinung, Behauptung, rhetorische Floskel auftaucht. Sie fragt nach Intention und gesellschaftlicher Wirksamkeit.
Im Zusammenhang mit der sogenannten «Milojcic-Diskussion» (10.1.3.2.) lässt sich der Unterschied zwischen sprachkritischer und inhaltlicher Analyse eines wissenschaftlichen Textes verdeutlichen. Die Sprachkritik an einem wissenschaftlichen Text hat nicht unbedingt zur Voraussetzung, dass man, über ein übliches Mass an wissenschaftlicher Vorbildung hinaus, fachlich in der jeweiligen Wissenschaft, aus der der Text stammt, geschult ist. Es gehört jedoch zur methodischen Intention meines Ansatzes, dass das Fachwissen, hier bezüglich der Ur- und Frühgeschichte, Instrumentarium der sprachkritischen Analyse ist. Vladimir Milojcics Aufzählung der verschiedenen prähistorischen Methoden (MILOJCIC 1957, 102) wären ein Beispiel dafür. Einem Nichtprähistoriker würde beispielsweise kaum auffallen, dass Vladimir Milojcic das zeitliche Hintereinander des Auftretens der Chronologiemethoden an einer entscheidenden Stelle umgedreht hat.
Da es sich bei meiner Arbeit um eine Studie im Rahmen der Ur- und Frühgeschichte handelt, möchte ich die literaturwissenschaftliche Terminologie mit Hilfe der prähistorischen Terminologie verdeutlichen: Dem «archäologischen Befund» entspricht in der Literatur die Text- oder Quellenart. Beispielsweise: Natur- oder populärwissenschaftliche Abhandlung, Vortrag, Akte, Zeitungsartikel, Gedicht.
Die Summe der Texte eines Autors könnte man als «stratigrafischen Fundort» bezeichnen, der für eine chronologische Abfolge steht. Innerhalb dieser Textsammlung ist eine Analyse der literarischen Entwicklung des Autors/der Autorin von Intereresse, der Vergleich mit zeitgleichen Texten anderer Autorinnen und Autoren, die hermeneutische Interpretation der Intentionen des/der Autors/Autorin u.A.m.
Auf der Ebene des «Fundgegenstandes» kann man e i n e n ausgewählten Text, z. B. Brief, Vorlesung oder Gedicht eines Autors unter den verschiedensten Gesichtspunkten betrachten. Worte, Wendungen, Begriffe eines Autors, einer Autorin bezeichne ich als «Artefakte». Sie sind interessant in Bezug auf die anderen Texte eines Autors, einer Autorin, im Kontext der Texte anderer Autoren, im historischen Verwendungs- und Bedeutungszusammenhang, entymologisch, etc. Die Auswahl einer bestimmten Textart, Quelle, die Arbeit an Begriffen, etc. entspricht der «Probenentnahme». Das setzt aber in diesem Fall schon eine bestimmte Bewertung der jeweiligen Quellenart voraus, diese Auswahl, diese Entscheidung ist in gewisser Weise bereits Teil der Interpretation. Beispielsweise entscheide ich im Vorhinein, eher einen Brief als charakteristisch für die Intentionen eines bestimmten Autors zu sehen als seine Habilitationsschrift, eher seine publizierte Erwiderung auf eine Kritik seiner wissenschaftlichen Auffassungen als seine Darstellung einer Grabung.
Die Text- oder Sprachanalysen können unter bestimmten thematischen Schwerpunkten durchgeführt werden: Eine literaturhistorische Analyse bearbeitet die Herleitung von Texten aus literarischen, wissenschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Traditionen, beispielsweise den Zusammenhang zwischen neuerer Esoterikliteratur der siebziger und Achtzigerjahre und nationalsozialistischen Texten aus der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts. (JAUSS 1970, SCHÄFER 2001).
Die literatursoziologische Untersuchung interessiert sich für Texte als Ausdruck sozialen Verhaltens von gesellschaftlichen Gruppen sowie deren sozialer Erfahrung und ihrer Intentionen, beispielsweise der klassischen englischen Kriminalliteratur als Ausdruck des gesellschaftlichen Selbstverständnisses des englischen Bürgertums um die Jahrhundertwende. (HANFLAND 1975, SCHÄFER 1986)
Sprachpsychologie sieht literarische Texte als Ausdruck unbewusster Intentionen und biografischer Erfahrungen eines literarischen Individuums. Die Analyse einer Art Tiefenstruktur eines Textes dient dazu, Informationen über Biografie, psychologische Befindlichkeit, etc. des/der Autors/Autorin zu erhalten.
Die politische Literaturkritik wächst aus einer politischen Bewegung oder Gruppierung heraus, z. B. der Arbeiterbewegung oder der Frauenbewegung. Deren Form der Gesellschaftskritik bildet das methodische Gerüst der Literaturanalyse. Das Interesse richtet sich zum Beispiel auf die Darstellungsweise ihrer Protagonisten in der Literatur: Frauen, Arbeiter, auf die Häufigkeit ihres Auftretens beispielsweise, die Art der Beschreibung, etc. oder auf die Literatur dieser Protagonisten selber: Literatur von Arbeitern, Literatur von Frauen. Die bekanntesten Arten politischer Literaturkritik des zwanzigsten Jahrhunderts sind die sozialistische aus der ersten Hälfte sowie die feministische (PUSCH 1984, TRÖMMELPLÖTZ 1982) aus der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts. (SCHÄFER 1986) Eine hermeneutische Textinterpretation zieht weniger Methoden anderer Wissenschaften zu Rate sondern befasst sich alleine mit einem Text, einer Textart selber. Diese werden nach einer Reihe festgesetzter Normen in Hinsicht darauf analysiert, ob sie jenen entsprechen oder nicht.
Hierzu gehört die Analyse von Texten nach ästhetischen und sprachästhetischen Gesichtspunkten. (ADORNO 1980).
Eine weitere hermeneutische Textanalyse ist jene nach den Kriterien wissenschaftlichen Schreibens. Hierzu gehören die Begriffspaare Objektivität contra Subjektivität, Trennung von Meinung und Fakten, Absetzung von Empirischem und Interpretation, etc. Einer meiner eignen Arbeitsschwerpunkte ist die hermeneutische Analyse von Texten in Hinsicht auf ihre Akzeptanz positiver gesellschaftlicher Werte wie Gewaltfreiheit, Öffentlichkeit, Transparenz, Akzeptanz gesellschaftlicher Minderheiten, etc. (ADORNO 1999, HACKER 1990, SCHÄFER 2001)
1.2.3. Inhalte
Ich musste, um einen einigermassen lesbaren Umfang der Arbeit zu gewährleisten, auch thematisch eine Auswahl treffen.
So liegt der Schwerpunkt in der Darstellung des jeweiligen, rein faktischen Institutsaufbaus, seiner Räume, Lehrsammlungen, Unterrichtsmaterialien, etc. sowie des finanziellen Hintergrundes, soweit er sich entschlüsseln liess.
Weiterhin richtete ich mein Augenmerk auf die wichtigsten Forschungsvorhaben und Projekte der jeweiligen Epoche. Dabei konnte ich, insbesondere was das Institut in den Sechzigerjahren betrifft, nur eine Auswahl der wichtigsten Projekte darstellen.
Neben den Forschungs- und Grabungsprojekten stellte der Aufbau der naturwissenschaftlichen Laboratorien und ihre Arbeitsweise einen wichtigen Schwerpunkt der Arbeit dar. In ähnlicher Weise befasste ich mich mit dem Aufbau der einzelnen Forschungsstellen und deren Intentionen.
Soweit es ging, wurden ausserdem die Menschen, ihre Arbeitsbedingungen und die jeweiligen Vorschriften (Studienordnungen, Arbeitsplatzbeschreibungen, etc.) unter denen sie arbeiteten berücksichtigt.
2. Kurzer Abriss der Entwicklung der allgemeinen Ur- und Frühgeschichte in Deutschland von 1900 bis 1945
1919 beklagten sich Anthropologen bei den Hochschulen über die Vernachlässigung der Fächer Anthropologie, Ethnologie und Vorgeschichte. (PAPE 1998) 1924 stellte Gustav Kossinna, den man wohl nach GRÜNERT (1998) zu Recht als einen der Wegbereiter einer völkischen und in Folge davon auch nationalsozialistischen Archäologie bezeichnen kann, den Antrag zur Begründung eines Institutes für Vorgeschichte an der Universität Berlin, dem 1927 statt gegeben wurde. Im gleichen Jahr wurde das erste unabhängige Institut in Wien begründet, es folgte 1927 die Gründung in Marburg durch Gero von Merhart.
Viele Institute für Vorgeschichte besassen inhaltliche und materielle Vorläufer in Form von Abteilungen bei historischen oder kunstgeschichtlichen Instituten, wie das beispielsweise auch in Köln, mit der Zuordnung zum historischen Seminar der Fall war. 1929 gründete Alfred Rosenberg den «Kampfbund für deutsche Kultur», dessen hauptsächliches Ziel es war, gegen die von den Nationalsozialisten sogenannte «entartete Kunst» vorzugehen. Eine Unterabteilung des «Kampfbundes» stellte die vom Tübinger Vorgeschichtler Hans Reinerth geleitete «Reichsfachgruppe für Vorgeschichte» dar, die sich in den folgenden Jahren einen heftigen Konkurrenzkampf mit dem «SS-Ahnenerbe» lieferte. (vergl. BOLLMUS 1970 und KATER 1997).
1935 wurde das «Deutsche Ahnenerbe. Studiengesellschaft für Geistesurgeschichte» auf Initiative Heinrich Himmlers, des Reichsführers der SS, begründet. Das später so genannte «Amt Rosenberg» strebte unter Hans Reinerth die totale Vereinnahmung der Vorgeschichte an. Die Charakteristika dieses geplanten «Reichsbund» wurden zunächst geheimgehalten:
1. das Überwachungsrecht aller Forschungen
2. die Ausübung des gesamten Denkmalschutzes
3. die Auflösung der Römisch-Germanischen-Kommission oder ihre Beschränkung auf römische Lokalforschung
4. Antisemitismus als akzeptierter Kulturbestandteil
5. Entzug des Vermögens der vier gleichzuschaltenden Verbände für Altertumsforschung in Deutschland sowie Herausgabe der Mitgliederlisten und Akten an den von Hans Reinerth beherrschten Reichsbund. (BOLLMUS 1998)
Doch auch das «Ahnenerbe» arbeitete fleissig an der Unterwanderung oder Vereinnahmung der Ur- und Frühgeschichte. Das «Ahnenerbe» ward einer riesigen Spinne gleich, deren Leib in Berlin ruhte, deren Glieder aber bis an die Grenzen des Reiches heranragten, in völliger Isolierung voneinander. (KATER 1997, 83)
Es kristallisierten sich zwei Lager heraus:
Der Süden und das Rheinland mit der Römisch-Germanischen Kommission, die mit dem «SS-Ahnenerbe» sympathisierten und die Prähistoriker im Norden und Osten Deutschlands, die eher Hans Reinerth und dem durch Gustav Kossinna geprägten «Reichsbund» nahe standen. (BOLLMUS 1998)
Die Süddeutschen Prähistoriker und die Römisch-Germanische-Kommission «verbündeten» sich mit dem «SS-Ahnenerbe» und entgingen so der geplanten Gleichschaltung im «Reichsbund».
Werner Buttler, kurzfristig Nachfolger von Herbert Kühn am Institut für Vorgeschichte in Köln, versuchte noch, die ruhig gestellten Prähistoriker um die Römisch-Germanische- Kommission zu vereinen, was aber nicht gelang. Werner Buttler fiel mit 32 Jahren.(BOLLMUS 1998)
In zwei Wellen traten Prähistoriker anfänglich in Hans Reinerths Abteilung ein, allerdings reduzierten sich ab 1933 die Beitritte zum Kampfbund und das «SS-Ahnenerbe» gelangte für einige Jahre zu grösserem Einfluss. Endgültig «gesiegt» hatte keine der beiden Organisationen. (KATER1997, 301)
Nachdem die Vernachlässigung vorgeschichtlicher Themen auch aus den Reihen der Schulen kritisiert worden war, stieg ab 1930 die Anzahl der Dozenturen und der Lehraufträge für Vorgeschichte an den deutschen Universitäten.
Nach der Machtergreifung 1933 versprach der neue Innenminister Hermann Göring, die Vorgeschichts-Forschung zu fördern. Dieses Jahr brachte einen rasanten Aufschwung des Faches, den PAPE (1998) als nicht zyklisch bezeichnete im Unterschied zu den anderen Studienfächern, er verlief antizyklisch zur allgemeinen Universitätsentwicklung. Der Beginn dieser Entwicklung lag nach PAPE (1998) bereits in den Entwicklungen vor 1933. Das Fach erfreute sich ab nun einer gestiegenen gesellschaftlichen Akzeptanz. Ab 1933 stiegen die Teilnehmerzahlen im Studium der Vorgeschichte auffallend an, 1934 die Anzahl der 14 Lehrstühle und es begann ein planmässiger Ausbau neuer Institute. (PAPE 1998) Durch vermehrte Promotionen in den frühen 30-iger Jahren ging es ab 1938 auch steil aufwärts mit Habilitationen (PAPE 1998).
1943 gab es 23 selbstständige Institute in Deutschland.
PAPE macht drei Zeitphasen der Entwicklung der Ur- und Frühgeschichte in Deutschland fest:
1900–1919, die völkische Vorphase, dann der allmähliche quantitative Ausbau 1920–1933 und die Hochphase von 1933–1945.
Etwa die Hälfte der angestellten Prähistoriker erhielt nach1945 wieder einen Posten. Die Nachkriegszeit unseres Faches ist geprägt durch eine ausgesprochene Kontinuität. (PAPE 1998)
PAPE referierte in seinem Vortrag den Autor Anselm Faust, der behauptet hatte, dass es in Deutschland keine politisch für den Nationalsozialismus anfälligen Fächer gegeben habe. PAPE (1998) ist da ganz anderer Meinung: Für ihn gehörte die Ur- und Frühgeschichte in Deutschland zu den anfälligen Fächern.
3. Die Universität zu Köln zwischen 1919 und 1933
3.1. Die Neugründung unter Konrad Adenauer
Am 11.3.1919 legte Christian Eckert, der Leiter der 1901 gegründeten Handelshochschule eine Denkschrift vor, in der der Plan, eine Universität in Köln neu zu begründen, den es schon in der Zeit vor dem 1. Weltkrieg gegeben hatte wieder aufgegriffen wurde. Zwei Jahre zuvor war Konrad Adenauer, der sehr an einer eigenständigen, Kölner Universität, im Gegensatz zum preussischen Zentralismus, interessiert war Oberbürgermeister von Köln geworden.
Zu diesen beiden Vertretern von Wissenschaft und Politik gesellte sich Louis Hagen, der Präsident der Kölner Handelskammer, um der Neugründung eine wirtschaftliche Basis zu gewährleisten.
Es gab in Köln zu diesem Zeitpunkt bereits einige Hochschuleinrichtungen: Die 1901 gegründete Handelshochschule, die 1904 gegründete Akademie für Praktische Medizin, eine Kölner Vereinigung für Rechts- und Staatswissenschaftliche Fortbildung seit 1906, die Hochschule für Kommunale und Soziale Verwaltung seit 1912 und das Forschungsinstitut für Sozialwissenschaften, das am 1. April 1919 errichtet wurde.
Aus diesen Elementen begründete sich am 29. Mai 1919 die Universität Köln, deren Gründungsrektor Christian Eckert wurde.
Köln war zu dem Zeitpunkt eine britische Enklave in den französisch besetzten Gebieten. Auf diesem Hintergrund sind Christian Eckerts Ansichten aus seiner Denkschrift zu bewerten, die die Universität zum Bollwerk des deutschen Geistes in den gefährdeten Rheinlanden und zum Gedankenvermittler der heutigen hassgetrennten Völker machen wollte. (GOLCZEWSKI 1988, 29)
Die oben erwähnten bereits bestehenden Hochschuleinrichtungen prägten das Klima der neuen Universität. Sie war eher liberal eingestellt, man feierte den Tag der Weimarer Verfassung und pflegte eine gleichberechtigte Berufungspraxis in Bezug auf jüdische Wissenschaftler. Die Kölner Universität zog eher fachlich orientierte, auf eine gute Ausbildung bezogene Interessenten an, man wollte sich ungestört der wissenschaftlichen Arbeit widmen. (GOLCZEWSKI 1988, 25 u. 31)
Die Studenten waren im Durchschnitt älter als anderswo, verwendeten mehr Zeit auf ihr Studium als auf andere Aktivitäten, gehörten meistens der Mittelschicht an und stammten aus der näheren Umgebung von Köln.(GOLCZEWSKI 1988, 29)
Wenn man sich auch um den gleichberechtigten Zugang bemühte, so weisst GOLCZEWSKI doch nachdrücklich darauf hin, dass sich diese «Gleichberechtigung» nur auf die Männer bezog, trotz der in der Weimarer Verfassung, formal verankerten Gleichberechtigung der Frauen, die das Frauenwahlrecht einschloss und Frauen die Zulassung zum Staatsexamen gewährte. (GOLCZEWSKI 1988, 26)
Zwar hatte Köln, im Gegensatz zu anderen Hochschulen ein besonders gefördertes Frauenstudium, doch ansonsten waren Frauen nicht vertreten. Die einzige Privatdozentin des Wintersemesters 1932/33 war auch noch beurlaubt. In Zeiten des kriegsbedingten Personalmangels erklärte man sich nur zweimal bereit, eine Frau lehren zu lassen. (GOLCZEWSKI 1988, 26)
Das Nichtvorhandensein von Frauen verweist auf eine tiefergehende Problematik, die im Zusammenhang mit Universitäten bisher nicht genügend berücksichtigt wurde. Wir sehen, dass «gesellschaftliches» Verhalten manchmal entscheidend für das Verhalten universitärer Instanzen war. Die Universitätslehrer folgten nicht selten der Dynamik von Männerbünden, die nicht allein das Verbindungswesen beherrschte. (GOLCZEWSKI 1988, 26)
Dieses «Nichtvorhandensein» von Frauen an universitären Institutionen ist nur e i n Beispiel für das «gesellschaftliche Verhalten» der Universität aber sicherlich nicht das einzige. In der Vertreibung jüdischer Wissenschaftler und Professoren stellte die Universität zu Köln ebenfalls einen Spiegel der um sie herrschenden gesellschaftlichen Verhältnisse dar. Die Universität zu Köln war zwar eine «Veranstaltung des Staates» (GOLCZEWSKI 1988, 30), wurde jedoch von der Stadt Köln finanziert. Ein Kommissar führte die staatliche Aufsicht, doch die wichtigsten Belange der Universität entschied das «Kuratorium», in dem die städtischen Vertreter mit 7 Sitzen die Mehrheit hatten. (GOLCZEWSKI 1988, 30) Das spiegelte den kommunalen Charakter der Einrichtung noch ganz besonders.
Der Oberbürgermeister von Köln war automatisch der Erste Vorsitzende des Kuratoriums. Konrad Adenauer, der entscheidenden Einfluss auf die Gestaltung der Hochschule nahm, hatte bis 1933 dieses Amt inne. Geschäftsführender Vorsitzender war bis 1933 Christian Eckert.
Ab 1933 hörte die Gremienarbeit auf, der jeweilige «Geschäftsführende Vorsitzende», abhängig von der nationalsozialistischen Partei, entschied nun mehr oder minder alleine, hin und wieder wurde er als «Kurator» bezeichnet. (GOLCZEWSKI 1988)
3.2. Die «Gleichschaltung» der Kölner Universität
Grundlage faschistischer Formierung des Bildungs- und Erziehungswesens, insbesondere von Schule und Hochschule, war eine Fülle von Gesetzen, Verordnungen und Erlassen mit repressivem, rechtsstaatliche Normen und Individualrechte weithin ausser Kraft setzendem Charakter. Sie übernahmen nicht nur eine Steuerungsfunktion im Gleichschaltungsprozess, sondern legitimierten ihn zugleich, wenn auch vielfach erst nachträglich. Sie lasteten als Zwang zu konformem Verhalten auf den für Bildung und Erziehung Verantwortlichen einerseits, als permanente Bedrohung auf den Opfern der Gleichschaltung andererseits. (KEIM 1997, 74f)
Die Notverordnung vom 4.2.1933 «Zum Schutz des deutschen Volkes» sowie jene vom 28.2.1933 als Reaktion auf den Reichstagsbrand setzten wichtige Grundrechte ausser Kraft und machten die Verfolgung von Kommunisten und Sozialisten rechtmässig. Eines der wichtigsten Werkzeuge der Nationalsozialisten in Bezug auf die Gleichschaltung des Bildungswesens war aber das «Gesetz zur Wiederherstellung des Berufbeamtentums» vom 7.4.1933 (KEIM 1997, 75), auf das ich hier, wegen des Berufsverbotes für Herbert Kühn, etwas ausführlicher eingehen möchte.
Zu diesem Gesetzespaket gehörten auf der Seite der Schülerinnen, Schüler und Studierenden die Verordnung vom 17.3.1933 und das Gesetz vom 25.4.1933, die den Zugang zu den Hochschulen und weiterführenden Schulen regelten. Letzteres schrieb vor, dass die Anzahl jüdischer Schul- und Hochschulbesucher an einer Schule nicht den jeweiligen Prozentsatz dieses Bevölkerungsteiles übersteigen dürfe, was vor allen Dingen für die jüdischen Bürger in den Grossstädten Deutschlands fatale Folgen hatte. In Preussen und anderswo mussten Immatrikulierende eine eidesstattliche Erklärung abgeben, dass ihre Eltern und Grosseltern «arisch» waren. (KEIM 1997, 78)
Als «nicht-arisch» galt im Sinne des «Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums», wer von nicht arischen, insbesondere jüdischen Eltern oder Grosseltern abstammt. Es genügt, wenn ein Elternteil oder Grosselternteil nicht arisch ist. Dies ist insbesondere dann anzunehmen, wenn ein Elternteil oder ein Grosselternteil der jüdischen Religion angehört hat. (Keim 1997, 78)
Diese Gesetze und Verordnungen schlossen ab nun mehr und mehr jüdische Bürger und andere gesellschaftliche Gruppen aus dem Rechtsleben aus. Auf ihre Entrechtung folgte sodann die Vertreibung und die systematische Vernichtung.
Das «Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums» enthielt zahlreiche Ergänzungen, Veränderungen und Durchführungsverordnungen. Die politischen und rassistischen Kriterien, aufgrund dessen jemand Amt und Stellung verlieren konnten waren sehr vage formuliert. § 2, nach der dritten Variante vom 6.5.1933, schloss Menschen aus, die sich im kommunistischen Sinne betätigt hatten, §3 behandelte Beamte «nicht-arischer» Abstammung, §4 bezog sich schlussendlich in seiner Auslegung auf Parteimitglieder der Weimarer Koalition aus SPD, DDP und Zentrumspartei sowie aus verschiedenen pazifistischen und republikanischen Organisationen. Ausserdem konnte auch sonst jeder Beamte, laut §5 und §6, jederzeit damit rechnen zurückgesetzt zu werden, in seinen Bezügen gekürzt oder gar zwangsweise in den Ruhestand geschickt zu werden.
Verallgemeinerungen und Beliebigkeiten in Wortlaut und Durchführung von Gesetzen sind Kennzeichen totalitärer Gesetzgebung. (HACKER 1990) Hinzu kommt die Unmöglichkeit, die Ausgrenzung auf rechtstaatlichem Wege zu überprüfen oder ihr zu widersprechen. §7 des Gesetzes regelte den Ausschluss des Rechtsweges bei Entlassungen und Versetzungen. Gleichzeitig wurde am 20.5.1933 die Beamtenvertretung aufgehoben und 1934 kam noch das Verbot dazu, Einsicht in die eigene Personalakte nehmen zu dürfen. (KEIM 1997, 80f) Die Bedeutung des GWBB beruhte zweifellos nicht nur auf seinen Konsequenzen für die unmittelbar und sofort von ihm Betroffenen, sondern mindestens im gleichen Masse darauf, dass ein sehr grosser Personenkreis dadurch eingeschüchtert wurde. (KEIM 1997, 83)
Das Gesetz diente zuerst einmal der politischen «Säuberung» nach 1933. So verloren beispielsweise sämtliche Kultusminister ihre Stellung, dazu in manchen Ländern die unterstellten Staatssekretäre, Ministerialdirektoren und Ministerialräte. Es versteht sich von selber, dass parallel dazu, insbesondere an den Schulen, die ideologische Ausrichtung auf die nationale Ideologie stattfand. Lehrinhalte, insbesondere von Geschichte und Biologie, wurden landesweit vereinheitlicht, «Vererbungslehre und Rassenkunde» erhielten ein besonderes Schwergewicht im Unterricht und in den Abschlussprüfungen. Das «Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses» erlaubte dem Staat die Sterilisation von Menschen, die daraus resultierende Euthanasie ist eines der dunkelsten Kapitel der nationalsozialistischen Herrschaft, denn diese war nicht einmal durch Gesetze abgesichert. (KLEE 1999)
Am 30.1.1934 wurde die Zentralisierung des Erziehungs- und Bildungswesens mit dem «Gesetz über den Neuaufbau des Reichs» abgeschlossen.Man richtete ein «Minsterium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung» ein, verschmolz das mit dem Preussischen Kultusministerium, die ausserpreussischen Kultusministerien schrumpften in ihrer Bedeutung zu nachgeordneten Verwaltungsbehörden zusammen. (KEIM 1997, 86)
Bernhart Rust, ein ehemaliger Studienrat aus Hannover, Gauleiter für den Raum Hannover- Braunschweig, seit 1930 Mitglied im Reichstag, hatte bereits seit dem 6.2.1933 die Geschäftsführung des Preussischen Kultusministeriums inne und wurde am 1.5.1933 Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung. Das blieb er bis zum April 1945.
Die liberal-katholische Universität zu Köln war eigentlich gar nicht dafür prädestiniert, als erste Universität in Deutschland die «Gleichschaltung» durch die Nazis mitzutragen. Noch am 10.2.1930 hatte man den «Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbund» für ein Jahr verboten, ein Verbot, dass auch im Februar 1931 nicht gleich aufgehoben wurde. (GOLCZEWSKI 1988, 45)
Das Klima gegenüber den Nationalsozialisten veränderte sich erst, als der dem Nationalsozialismus kritisch gegenüber stehende Rektor Josef Kroll durch den Wirtschaftshistoriker Bruno Kuske abgelöst wurde. Zwar war Bruno Kuske Sozialdemokrat, aber anscheinend, den Nationalsozialisten gegenüber, eher «naiv», wie GOLCZEWSKI (1988) es ausdrückt. Bruno Kuske fand es vorteilhafter, die Nationalsozialisten durch Organisation einzubinden, denn sie würden sich sowieso, und dann eben unkontroliert, auf den Universitätsfluren versammeln. Also wurde der NSDStB wieder zugelassen. GOLCZEWSKI (1988) ist der Meinung, dass durch die generell eher unpolitische Haltung der Kölner Universität auch die Liberalität der Weimarer Republik nicht so recht Fuss fassen konnte. (GOLCZEWSKI 1988, 47)
Der erste Wissenschaftler, der durch Erpressung, blanke Gewaltandrohung gegen seine Angehörigen sowie massive Einschüchterungen und Drohungen, den Lehrbetrieb lahm zu legen, von den Nationalsozialisten von einer Kandidatur für das Rektorenamt im akademischen Jahr 1932/33 abgehalten wurde, war der jüdische Psychiater Gustav Aschaffenburg.
Zwar wurde der Vorlesungsbetrieb nicht gestört, aber die Androhung alleine hatte genügt, dass die Universität nachgab. (GOLCZEWSKI 1988, 47f)
Ein solcher Grabenkampf wiederholte sich noch einige Male: Die Nationalsozialisten zwangen die Hochschullehrer, teilweise recht handgreiflich, ihnen zu Willen zu sein, wollten sie friedlich und ungestört in ihrem Fach weiterarbeiten und -lehren. Aus ethischen Gründen Widerstand zu leisten, war kaum einer bereit. (GOLCZEWSKI 1988, 49)
Die Konfliktscheu, die die Universität demonstriert hatte, ist der Schlüssel, um die Leichtigkeit der «Gleichschaltung» zu erklären. (GOLCZEWSKI 1988, 49)
Hätte man es noch kurze Zeit zuvor niemals für notwendig erachtet, auf einer ausserordentlichen Senatssitzung eine studentische Veranstaltung zu diskutieren, so geschah das nun das erste Mal am 14.2.1933. Es ging um eine Kundgebung der nationalen Studenten. Mit knapper Mehrheit einigte man sich, die Lehrveranstaltungen im Hauptgebäude der Universität an der Claudiusstrasse ausfallen zu lassen, ausser Prüfungskandidaten und Beamten sollte niemand Zutritt zur Universität haben, Bibliotheksangestellte wurden gebeten, während der Kundgebung nicht an den Fenstern zu stehen.(GOLCZEWSKI 1988, 51f) Das heisst, man konnte sich nicht dazu durchringen, die Kundgebung einfach zu untersagen, versuchte ihr aber das Publikum zu entziehen. Alles in allem eher ein taktisches, salopp ausgedrückt, windelweiches Verhalten.
Das erste Mal mussten die Senatsmitglieder nun auch erleben, dass durch irgendwelche undichten Stellen der vertrauliche Senatsbeschluss nach Aussen durchgesickert war. Bei der nächsten Sitzung musste der Rektor seine Kollegen bitten, in Zukunft mit unüberlegten Meinungsäusserungen zur Regierung, insbesondere gegenüber den Studenten, vorsichtig zu sein. (GOLCZEWSKI 1988, 53)
Laut GOLCZEWSKI (1988) stellt diese Bemerkung im Senatsprotokoll den Wendepunkt dar, an welchem die Universität zu Köln und ihre Gremien die Souveränität verloren hatten. Basiert doch das grundlegende Selbstverständniss einer Universität gerade auf der Freiheit des Wortes. (GOLCZEWSKI 1988, 54)
Zwar war man anscheinend, wie das NSDStB-Verbot von 1930 oder der «Flaggenstreit» zeigte durchaus auf dem rechten Auge nicht blind (GOLCZEWSKI 1988, 59), aber das seit 1920 praktizierte Streben, eine parteipolitische Ausgewogenheit im Wissenschaftsbetrieb herzustellen, trug ebenfalls zu dieser Problemsituation bei. (GOLCZEWSKI 1988, 59)
Mit der Abwahl Konrad Adenauers am 12.3.1933 verlor die Universität ihren Rückhalt in der Stadt. Unter Günther Riesen, dem Nachfolger Konrad Adenauers, wurde die liberaldemokratische Fraktion der Professoren mehr und mehr zurückgedrängt. Günther Riesen mischte sich sehr schnell in die Universitätsbelange ein, unter anderem mit dem Versprechen, Gelder einzusparen, was im Zeichen der herrschenden Wirtschaftskrise von der städtischen Verwaltung nur zu gerne gehört wurde. Günther Riesen denunzierte Konrad Adenauers Politik als «Misswirtschaft». (GOLCZEWSKI 1988, 59)
Günther Riesens Behauptung kann man aber ausgezeichnet durch einen Verweis auf die kompromisslosen Verhandlungen Konrad Adenauers um die Anmietung des Hauses Ubierstr.11 für das neu zu begründende Institut für Vor- und Frühgeschichte konterkarrieren. (s. u. Kapitel 5.1.)
Günther Riesen beantragte beim Wissenschaftsministerium, einen neuen Kommissar für die Universität ernennen zu dürfen. Das kam einer Entmachtung der kollegial gewählten Hochschulspitze gleich. (GOLCZEWSKI 1988, 60)
Eine weitere wichtige Rolle in diesem Intrigenspiel gegen die den Nationalsozialisten missliebige Professorenkollegen spielte der Mediziner Ernst Leupold, der sich sehr rasch zum «Laufburschen» des neuen Oberbürgermeisters degradieren liess. (GOLCZEWSKI 1988, 61) Günther Riesen hatte im März 1933 mit Bernhard Rust, dazumal noch Reichskommissar im Preussischen Wissenschaftsministerium abgemacht, dass Peter Winkelnkemper als Staatskommissar für die Universität zuständig sein solle. Peter Winkelnkemper war Hauptschriftleiter der NSDAP-Zeitung «Westdeutscher Beobachter», die der Universität sehr kritisch gegenüber stand.
In der ersten Aprilwoche 1933 hatten Ernst Leupold und Peter Winkelnkemper ihre erste Besprechung und die ersten Entlassungen jüdischer Assistenten oder mit Jüdinnen verheirateter Assistenten an der Medizinischen Fakultät wurden durchgeführt. (GOLCZEWSKI 1988, 63)
Ausser durch seine Beratungen bei der Durchführung des «Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums» tat sich Ernst Leupold auch darin hervor, den derzeitigen Rektor der Universität, den Kirchenrechtler Godehard J. Ebers, zu beseitigen. Godehard J. Ebers wehrte sich gegen das an ihn herangetragene Ansinnen, zurückzutreten.
Wohl um das Gesicht der Universität zu wahren, telephonierte der Prorektor Bruno Kuske nach Berlin, wenn man sich schon nicht der drohenden «Gleichschaltung» entziehen könne, so wäre es doch gut, dass alle Hochschulen gleichzeitig dem unterworfen würden. Das plante man natürlich schon längst in der Reichshauptstadt!
Eine weitere wichtige Figur in der «Gleichschaltungs-Seilschaft» war Christian Eckert, der Doktorvater Peter Winkelnkempers, der sich ihm direkt anbiederte. Christian Eckert war, im Unterschied zu den anderen Genannten, antisemitisch eingestellt. (GOLCZEWSKI 1988, 67)
Dem nationalismus-freundlichen Druck nachgebend, traten – gezwungener Massen die einen, freiwillig die anderen – am 11.4.1933 Rektor, Dekane und Senat geschlossen zurück und es wurden Neuwahlen durchgeführt, die nun ganz im Sinne der neuen Machthaber waren. Ernst Leupold wurde der neue Rektor der Universität zu Köln. (GOLCZEWSKI 1988, 70)
Die «Gleichschaltung» hatte damit ohne jeden Widerstand stattgefunden, wenn man die zeitweilige Weigerung Ebers` ausser Betracht lässt. ... Aber es bleibt die Frage, warum es die Professoren den neuen Machthabern so leicht gemacht haben. (GOLCZEWSKI 1988, 70f) GOLCZEWSKI (1988) sieht einen der Gründe in den mehr oder minder verhüllten Androhungen, bei nicht willfährigem Verhalten, die Universität ganz zu schliessen. Die «Gleichschaltung» der Kölner Universität hatte natürlich Auswirkungen auf jene der anderen Universitäten, stellte sie doch nun eine Art Vorbild für diesen Prozess dar. Eine Woche später erging der «Gleichschaltungserlass» für alle preussischen Hochschulen. (GOLCZEWSKI 1988, 72)
Auch wenn ein anderes Verhalten die «Gleichschaltung» der Universitäten nicht aufgehalten hätte – das Kölner Verhalten förderte sie und stellt so den damaligen Hochschulpolitikern ein deprimierendes Zeugnis aus. (Golczewski 1988, 73)
4. Die Vor- und Frühgeschichte an der Universität zu Köln 1923 – 1927
4.1. Herbert Kühns Vorlesungen am Kunstwissenschaftlichen Institut – Habilitationsverfahren und Ernennung zum a.o. Professor
Der erste Vertreter des Faches Vorgeschichte an der Universität zu Köln war Herbert Kühn, der im Rahmen des Kunstgeschichtlichen Institutes Vorlesungen zur Prähistorischen Kunst hielt, zuerst als Assistent am Institut für Kunstgeschichte, ab 1923 als Privatdozent.
Bild 1: Herbert Kühn
Herbert Kühn wurde 1890 als Sohn eines Postvorstehers im Ort Beelitz, in der Mark Brandenburg geboren. Er besuchte dort eine Privatschule und ab 1906 das Victoria- Gymnasium in Potsdam, wo er Anfang August 1914 das Reifezeugnis erwarb. (UAK Zug. 197/769)
Nach einem kurzen Gastspiel als Kriegsfreiwilliger im Leibgrenadier Regiment Nr. 8 in Frankfurt an der Oder, das Herbert Kühn nach einigen Monaten wegen seines Herzfehlers verlassen konnte, studierte er Kunstgeschichte, Philosophie, Geschichte und Germanistik in Berlin, München und Jena.
Am 28.2.1918 wurde Herbert Kühn in Jena mit der Arbeit über: «Die psychologischen Grundlagen des Stilwandels in der modernen Kunst.» promoviert. (UAK Zug.197/769)
Nach dem Weltkrieg arbeitete er für verschiedene Redaktionen, bereitete sich auf eine akademische Laufbahn vor und bereiste 1921 Italien. In seinem schriftlichen Lebenslauf führt er folgende Hauptarbeitsgebiete auf:
Mein Hauptarbeitsgebiet ist die prähistorische Kunst und die Kunst der Naturvölker, ferner die italienische Renaissance und die neuere Kunst seit dem Ende des 18. Jahrhunderts. Im Sommer dieses Jahres veröffentlichte ich im Delphin-Verlag in München ein Buch über: «Die Malerei der Eiszeit». (UAK Zug. 197/769)
Am 7.9.1922 bat Herbert Kühn die Philosophische Fakultät der Universität zu Köln um die Zulassung als Privatdozent für das Fach prähistorische Kunst und die Kunst der Naturvölker. Er legte, wie das üblich war, polizeiliche Führungszeugnisse vor sowie den oben zitierten, handschriftlichen Lebenslauf. Ausserdem seine Habilitationsschrift mit dem Titel: «Der Sensorismus der paläolithischen Kunst.»
Dr. A. E. Brinckmann, Professor für Kunstgeschichte, lieferte am 1.12.1922 ein kurzes, sehr positives Urteil zu Herbert Kühns Habilitations-Schrift ab. Zwar konnte er sich nicht mit bestimmten Stufen- und Stileinteilungen Herbert Kühns einverstanden erklären aber er schätzte an der Arbeit, dass Herbert Kühn das vorhandene paläolithische Material stilpsychologisch untersuchte, während es vorher nur ethnologisch und archäologisch bearbeitet wurde. (UAK Zug. 197/769) A.E. Brinkmann beendete sein Gutachten: Die gesamte Arbeit macht auf mich einen wissenschaftlich ausgezeichneten Eindruck, und ich begrüsse es sehr, das gesamte Material unter Gesichtspunkten verarbeitet zu sehen, nach denen sich die neuere Kunstwissenschaft richtet. Gerade eine solche Auffassung macht die Behandlung dieser Epoche für den neueren Kunsthistoriker wertvoll, und so würde ich eine Habilitation des Herrn Kühn zur Unterstützung des Lehrstuhls für neuere Kunstgeschichte sehr begrüssen. (UAK Zug. 197/769)
Gustav Kossina hatte Herbert Kühns Schrift bereits für die Veröffentlichung in der Mannus- Bibliothek erworben, was wohl auch zu A.E. Brinckmanns positiver Einstellung beitrug.
Ganz anders Professor Willy Foy, der am 11.1.1923 Herbert Kühns Habilitations-Schrift vernichtend begutachtete. (UAK Zug. 197/769)
Willy Foy war der Direktor des städtischen Rautenstrauch-Joest-Museum, das städtische Museum für Völkerkunde von Köln am Ubierring. Er war Ethnologe und Honorarprofessor an der Universität zu Köln.
Willy Foy warf Herbert Kühn massive chronologische und typologische Fehler vor. So, beispielsweise, dass Herbert Kühn, entgegen dem zeitgenössischen Forschungsstand, das Jungpaläolithikum zu einer Einheit zusammenfasste. Das führe dazu, so Willy Foy, dass Herbert Kühn Tierzeichnungen, die in allen drei jungpaläolithischen Kulturperioden vorkämen, direkt mit den «weiblichen Rundfiguren» in Zusammenhang sähe, die ja nur in einer der Kulturperioden vorkämen. (UAK Zug. 197/769)
Die genaue historische Einordnung und Abgrenzung der einzelnen Kunstform ist aber für ihre Auffassung und Erklärung nicht ohne Belang. ... Man hat daher keinen Anlass sie (die «weiblichen Rundfiguren» Anm. der. Verf.in) nach den Tierdarstellungen zu beurteilen und etwa in der sinnlichen Begierde den schöpferischen Anlass zu sehen. (UAK Zug. 197/769) Auch auf ethnologischem Gebiet warf Willy Foy Herbert Kühn Unrichtigkeiten vor. Sowohl in ethnologischen als auch in prähistorischen Zusammenhängen seien Tierplastiken immer den jüngeren und vor allen Dingen totemistischen Kulturstufen zuzuordnen. Da Herbert Kühn eben diese Stufen nicht sauber trenne, würde er auch das durcheinander werfen. (UAK Zug. 197/769)
Es geht also nicht an, mit Kühn die Tierplastik in ihrer Entstehung oder Bedeutung nach ohne Weiteres als gleichartig mit den Tierzeichnungen zu betrachten. Während letztere wohl wirklich als Mitteilung und Erinnerungsbild geschaffen sind, könnte bei der Ausbildung der Tierplastik der Totemismus mit ihm Spiele sein, da sie ja, wie die aussereuropäischen Vorkommnisse lehren, mit dem Totemismus zusammen einer und derselben Kulturschicht angehört. (UAK Zug. 197/769)
Wo Herbert Kühn stilpsychologische, überall geltende Gesetzmässigkeiten sah, versuchte Willy Foy mit Gegenbeispielen nachzuweisen, dass das nicht der Fall sein könne. Er warf Herbert Kühn neben allem Anderen auch noch eine eingeschränkte, «recht einseitige», Materialauswahl vor. (UAK Zug. 197/769)
Der wissenschaftliche Boden wird dort verlassen, wo in die Ornamentik, in das Dreieck, den Kreis, die Spirale viel zu viel hineingeheimnisst wird. Die dabei zu Tage tretende Phrasenhaftigkeit ist besonders deutlich aus dem ersten Abschnitt auf S. 163 zu ersehen. (UAK Zug. 197/769)
Besonders letztes Zitat wird uns noch einmal unter Punkt 5.5. beschäftigen, der Herbert Kühns wissenschaftliches Werk begutachtet.
Genauso vernichtend wie seine Habilitationsschrift beurteilte Willy Foy Herbert Kühns Buch: «Die Kunst der Primitiven».
Nachdenklich allerdings macht das letzte Argument Willy Foys, in dem er ausführte, dass Herbert Kühn überall auf der Welt unabhängige Entwicklungen und autochthone Entstehung von Kunststilen sähe. (UAK Zug. 197/769)
Kein Wort von den neuerdings festgestellten intimen Übereinstimmungen des altamerikanischen Kalenders mit den asiatischen Hochkulturen! ... oder wenn eine holzgeschitzte Figur der nordwestamerikanischen Indianer ..., die schon in der Kleidung und im Faltenwurf unweigerlich fremden Einfluss verrät, als eine ausserordentliche Leistung der Indianerkunst gepriesen wird. (UAK Zug. 197/769)
Willy Foy glaubte nicht, dass Herbert Kühn der primitiven Kunst gegenüber nüchtern und wissenschaftlich sein könne und rät von der Habilitation ab.
Aufgrund dieses negativen Gutachtens, schlugen die Mitglieder des Ausschusses, unter anderen: Friedrich van der Leyen, Professor für Deutsche Philologie, Ältere Germanistik, Altnordisch und Deutsche Volkskunde, Justus Hashagen, Professor für Mittlere und Neuere sowie Rheinische Geschichte vor, weitere Gutachter heranzuziehen. Man empfahl insbesondere auch ein Gutachten von Gustav Kossinna einzuholen.
Der ordentliche Professor für Geographie, Franz Thorbecke verfasste am 11.2.1923 ebenfalls ein sehr kritisches Gutachten zu Herbert Kühns Habilitations-Schrift und schrieb in einem Begleitbrief dazu einen Tag später: Ich bin nicht dafür, dass Dr. Kühn die venia auch für Kunst der Naturvölker erhält. – Über prähistorische Kunst steht mir kein Urteil zu, das ist Sache vom Kollegen Foy.
Gustav Kossinnas Gutachten scheint dann die Waagschale für Herbert Kühn gewendet zu haben. Er schrieb am 17.2.1923 in seinem sehr kurzen Gutachten: Alles in Allem eine hervorragende Arbeit, würdig von der philosophischen Fakultät und der Universität Köln unbedingt angenommen zu werden. (UAK Zug. 197/769)
Auch Carl Schuchhardt kam in einem Gutachten vom 16.3.1923 zu einem positiven Ergebniss. (UAK Zug. 197/769)
Dazwischen, Anfang Februar 1923, hatte sich der Dekan in Jena nach der Note von Herbert Kühns Promotion erkundigt, da die auf seinem Doktordiplom nicht ersichtlich sei. Herbert Kühn hatte seinen Doktorhut in Jena nur mit der Note `rite` erlangt, wie ihm der Dekan der Philosophischen Fakultät von Jena eine Woche später antwortete. (UAK Zug. 197/769) Gleichzeitig zu diesem sehr kontroversen Gutachterverfahren, in dessen Schriften sich meiner Meinung nach der Dissens zwischen einer eher geisteswissenschaftlich orientierten Prähistorie, nach dem Vorbild Oswald Menghins und einer systematischeren Richtung spiegelte, findet sich noch eine Beschuldigung gegen Herbert Kühn in den Akten: Konrad Theodor Preuss, Ethnologe, Professor und Direktor am Staatlichen Museum für Völkerkunde schrieb am 1. Mai 1923 an Willy Foy einen Brief, in dem er Herbert Kühn der Unredlichkeit im Umgang mit einer mexicanischen Steinfigur bezichtigte. Er beschuldigte Herbert Kühn, eine Steinfigur aus Mexico widerrechtlich mitgenommen und in einem Antiquitätengeschäft zum Verkauf angeboten zu haben. Willy Foy gab den Brief zur Kenntnissnahme an den Dekan der Philosophischen Fakultät, Dr. Schneider, weiter.
Herbert Kühn musste dazu Stellung nehmen und sich verteidigen, was er Anfang Juni in einem sehr ausführlichen Schreiben über viele Seiten hin tat. Umgehend, am 20. Juni, wiederholte Konrad Theodor Preuss seine Vorwürfe noch einmal ausführlich sowie am 30. Juni.(UAK Zug. 197/769)
Letztlich scheinen die positiven Stimmen zu Herbert Kühns Habilitationsschrift doch den Ausschlag gegeben zu haben. Er habilitierte sich in Köln mit seiner Arbeit: «Der Sensorismus der paläolithischen Kunst». Was dem Minister für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung durch Kuratorium und Rektor der Universität am 29.9.1923 mitgeteilt wurde. Aufgrund seiner Habilitations-Schrift und des am 23.7.1923 gehaltenen Vortrages: «Entwicklungsstufen der paläolithischen Kunst» erhielt Herbert Kühn die venia legendi für das Fach Paläolithische Kunst. Am 24.11.1923 hielt er seine Antrittsvorlesung: «Die Bedeutung der praehistorischen Kunst für die Kunstgeschichte.»(UAK Zug. 197/769).
Auf ihrer 5. Sitzung vom 11.2.1924 beschloss die Fakultät, dass prähistorische Kunst kein Prüfungsfach ist.
Im Vorlesungsverzeichnis des Sommersemesters 1924 steht Herbert Kühn mit der Vorlesung: «Früheuropäische Kunst. (Eiszeit bis Völkerwanderung) (publice u. Allg. Vorl.) 1 St. Do. 7-8 abends in VII». Sowie mit: «Kunstgeschichtliche Übungen für Vorgeschrittene. (privatissime et gratis) 2 St. Di., Mi. 11-12 in XV»
Die Universitätslehrenden der zwanziger Jahre erhielten von den Studenten, je nach Veranstaltung finanzielle Beiträge, die ich hier nicht näher auflisten will. Im Wintersemester 1924/25 las Herbert Kühn über «Die Kunst der Bronzezeit in Europa» sowie über «Die Kunst der Naturvölker.»
Seit dem Sommersemester wurde er als Privatdozent der Philosophischen Fakultät geführt, mit Veranstaltungsnummern, Sprechstunde und Adresse. Allerdings ist er im Wintersemester 1924/25 in Davos zur Kur und meldet sich in einem Schreiben vom 21.10.1924 aus dem Eden-Hotel in Davos für die Vorlesungen ab. (UAK Zug. 197/769)
Dieser Brief ist ausserdem das erste Dokument, welches im Briefkopf das Signet der 1925 gegründeten IPEK trägt: «Jahrbuch für prähistorische und ethnographische Kunst». Herausgeber ist Herbert Kühn. Das Schwergewicht der Themen dieser Reihe lag ganz sicherlich im Bereich der Kunst, so das beispielsweise relative Chronologien häufiger in den IPEK-Jahrbüchern dieser Zeit auftauchen. Beispielsweise in einem Aufsatz über die paläolithischen Kulturen im Lontal (RIEK1934, 1ff.). Statt Zeichnungen oder Abbildungen charakterisieren sehr detaillierte Beschreibungen das Jahrbuch.
Herbert Kühns Veranstaltungen fiel das ganze Wintersemester aus, im Sommersemerster 1925 las er «Die Methoden der Kunstgeschichte und ihre Anwendung auf die prähist. Kunst.» sowie «Die älteste Kunst Deutschlands.» Im darauf folgenden Semester thematisierte er «Die Kunst der Völkerwanderungszeit bis zur romanischen Epoche» sowie «Die Kunst der Vorzeit Afrikas.»
Er war weiterhin Privatdozent am Institut für Kunstgeschichte, unter Direktor A.E. Brinckmann. Auch im Sommersemester 1926 gab es eine Veranstaltung Herbert Kühns zur Eiszeitkunst und eine ethnologische zur Kunstgeschichte von Peru und Mexico. Zweimal bot er auch Vorlesungen zu einem metallzeitlichen Thema an. Die Schwerpunkte von Herbert Kühns Lehrtätigkeit lagen aber eindeutig im völkerkundlichen Bereich sowie im Bereich des Paläolithikums: Viermal Paläolithikum und dreimal völkerkundlich, zweimal metallzeitlich. Dazu kam noch eine rein kunstgeschichtliche Übung.
In den nächsten beiden Jahren erweiterte Herbert Kühn seine Lehrveranstaltungen: Stilistische Themen wie Ornament und Geometrie kamen hinzu, Übungen zur Kunst des Neolithikums sowie «germanische» Fragestellungen: Im Wintersemester 1926/27 als Übung: «Frühgermanische Elemente in mittelalterlicher Kunst» und «Nordische Kunst der Eddazeit» im Sommersemester 1927. Die völkerkundlichen Themen fallen nun fort.
Wahrscheinlich spiegelte sich hierin Herbert Kühns Bestrebung wieder, seine venia legendi auf Vorgeschichte auszuweiten sowie ein Institut für Vorgeschichte an der Universität zu begründen.
Voraussetzung dafür war wohl die Erweiterung seiner venia legendi zu «Prähistorische Kunst und Vorgeschichte». Im grossen und Ganzen beurteilten die Historiker dieses Ansinnen positiv.
Auf der Fakultätssitzung vom11.6.1928 wurde über die Änderung der venia legendi von Herbert Kühn verhandelt: Der Dekan berichtete über die umfangreichen Veröffentlichungen Herbert Kühns und über seine Herausgebertätigkeit. Er verteidigte Herbert Kühns wissenschaftliche Leistungen sowie seine Lehrtätigkeit. Die Frage war, ob die venia legendi erweitert werden solle auf a) Prähistorische Kunst, b) Prähistorische Geschichte oder einfach auf c) Prähistorie. Der Dekan betonte in dieser Sitzung, dass ein Fach Prähistorie gar nicht bestünde, weshalb eine venia legendi auch nicht üblich sein könne.
Die Professoren Gerhard Kallen und Hasebroek äusserten sich mit beiden Alternativen einverstanden, Professor Phillip äusserte Zweifel an der wissenschaftlichen Sicherheit Herbert Kühns. Auch van der Leyen bezweifelte den Umfang der allgemeinen Kenntnisse Herbert Kühns. Professor Thorbecke plädierte für eine geteilte venia legendi und zusammen mit den Professoren Hartmann, Hasebroek, Breslau und Philipp wies er darauf hin, dass Prähistorie allgemein die Fächer Geologie, Zoologie, Anthropologie, Geschichte, Mineralogie und Botanik umfasse. Daher plädierten diese fünf für Vorsicht bei einer Ernennung.
Als Variante wurde von einem Teilnehmer der Fakultätssitzung vom 11.6.1928 noch die Bezeichnung Prähistorische Kulturgeschichte vorgeschlagen.
A. E. Brinkmann stellte im weiteren Verlauf dieser Sitzung den Antrag an die Fakultät, ob man nicht die venia legendi für Prähistorie (Vorgeschichte) allgemein erteilen könne, vorausgesetzt, dass günstige Gutachten dafür hereinkämen. Gegen acht zustimmende Stimmen wurde A. E. Brinkmanns Antrag abgelehnt.
Ein weiterer Antrag schlug vor, die venia legendi unter die Fächer a) Kunst, b) Geschichte aufzuteilen als a) Prähistorische Kunst und b) Vorgeschichte. Dieser Antrag wurde mit dem Zusatz angenommen, dass die Erteilung von den Gutachten des Ordinariats für Geschichte abhängig gemacht würde.
Selbst Professor Johannes Ziekursch, wie Gerhard Kallen ein weiterer Inhaber eines historischen Lehrstuhles in Köln, der Herbert Kühns Arbeiten kritisch gegenüber stand, da er ihm einige Ungenauigkeiten vorwarf, war auf der Fakultätssitzung vom 11.6.1928 doch mit einer venia legendi für allgemeine Prähistorie einverstanden und plädierte am Ende seines Kurzgutachtens am 26.6.1928 dafür: ... dass ich der Fakultät empfehle, dem bestehenden Zustande, dass Kühn tatsächlich über allgemeine Vorgeschichte liest, nachträglich den notwendigen Rechtsboden durch die Erweiterung seiner venia zu verschaffen. (UAK Zug. 197/769)
Im unmittelbaren Anschluss an die fakultätsinterne Erweiterung der venia legendi Herbert Kühns lief auch das Antragsverfahren durch die Fakultät, Herbert Kühn zum nichtbeamteten, ausserordentlichen Professor zu ernennen.(UAK Zug. 197/769) Der Antrag eines Studenten vom November 1928 an die Fakultät, Prähistorie als Promotionsfach wählen zu können wurde auf der Sitzung vom 12.11.1928 abgelehnt. Am 13.2.1929 ernannte die Fakultät eine Kommission aus den Professoren Brinkmann, Hasebroek, Kallen, Lipp und Breslau, die sich mit den anstehenden Fragen im Zusammenhang mit dem zu errichtenden Institut für Vorgeschichte zu befassen hatten. Nachdem die Begründung des Institutes durch Stiftungen und das Kuratorium möglich wurden, schlug der Dekan der Philosophischen Fakultät auf der Sitzung vom 9.12.1929 vor, diese als Abteilung des Historischen Seminars zu bezeichnen. Dieser Antrag wurde angenommen.
Einstimmig nahm die Fakultät am 17.2.1930 Gerhard Kallens Antrag an, Herbert Kühn zum ausserordentlichen, nicht beamteten Professor zu ernennen.
Am 11.5.1930 wurde ihm die Ernennungsurkunde zum a.o. Professor übersandt, der Kölner Stadt-Anzeiger berichtete darüber in seiner Ausgabe vom 29.5.1930. (UAK Zug. 17/3213)
Nichtbeamteter, ausserordentlicher Professor bedeutete, dass Herbert Kühn weiterhin auf die Zuweisung von Lehraufträgen angewiesen war und keinen Anspruch an den Staat auf die Übertragung eines planmässigen Lehrstuhles hatte. Allerdings war die a.o. Professur mit «Rechten im Rahmen akademischer Korporationen» verbunden. (UAK Zug. 17/3213)
4.2. Vorbereitungen zur Institutsgründung
Am 20. Juni 1928 schrieb Herbert Kühn an den geschäftsführenden Vorsitzenden des Kuratoriums der Universität zu Köln: Beiliegend erlaube ich mir dem Kuratorium eine Denkschrift über die Begründung eines Institutes für Vorgeschichte zu überreichen. Ich bitte das Kuratorium ergebenst, das Institut zu begründen und die notwendigen Beträge zu bewilligen. (UAK Zug. 9/281 V 47a)
Anderthalb Wochen vorher, am 11.6.1928 war die venia legendi Herbert Kühns erweitert worden zu: «Prähistorische Kunst und Vorgeschichte».
Wie ein solches Institut beschaffen sein müsste und welche Kosten dabei auf das Kuratorium der Universität zukämen, stellte Herbert Kühn in der Denkschrift dar: Das Studium der Vorgeschichte setzt sich aus zwei Elementen zusammen, einmal der Arbeit am Fundmaterial, zweitens aus der Arbeit an der Literatur. (UAK Zug 9/281)
Deshalb benötige man einen Raum für die Abgusssammlung, einen zweiten für die Bibliothek und den dritten Raum für den Leiter des Instituts und den Assistenten.
Auf einen Lichtbilderraum verzichtete Kühn vorläufig, da die 5000 Lichtbilder sein Privateigentum waren und bei ihm zu Hause lagerten. (UAK Zug 9/281)
Herbert Kühn bat darum, den erforderlichen finanziellen Grundstock anzulegen, zu dem dann die laufenden Ergänzungen hinzuträten. Er wies darauf hin, dass der zur Gründung des neuen Institutes in Marburg extra berufene Ordinarius, Professor Merhart-Bernegg 60.000 Mark zur Verfügung hatte. Herbert Kühn ging von 20.000 bis 25.000 Mark aus, von denen er für das erste Jahr 10.000 bis 15.000 Mark für Anschaffungen benötigen würde und in den folgenden Jahren jeweils möglichst 5000 Mark pro Jahr. Das wirkte bescheidener, als es in Marburg veranschlagt wurde. (UAK Zug 9/281)
Am 4. November 1929 reichte Herbert Kühn dem Kuratorium eine Auflistung der benötigten Gegenstände, sowie den Kostenvoranschlag für den Aufbau der Bibliothek ein. Der Kostenvoranschlag für die Bücher- und Zeitschriftenanschaffungen belief sich auf 14.389 Mark, zur Möblierung des Seminarraumes und des Leiterzimmers wurden ein Schreibtisch, ein Tisch, ein Aktenschrank, achtzehn Stühle, ein Bücherbrett, 2m hoch und ein grosser Tisch von etwa 2,5m mal 1,5m. benötigt. (UAK Zug 9/281)
Ausserdem schien Herbert Kühn ziemlich rührig im Eintreiben von Stiftungsgeldern zu sein, denn in den Akten zu den entsprechenden Monaten der Jahre 1928 und 1929 häufen sich die Dankesschreiben und Bestätigungen an die verschiedensten Stifter aus Wirtschaft, Industrie und an private Mäzene. So findet sich, auch das Rheinische Braunkohlen-Syndikat, eine Vorgängergesellschaft der Firma Rhein-Braun, unter den Stiftern des Instituts. (UAK Zug. 9/281)
Am 2.12.1929 wurde Herbert Kühn gebeten, die gestifteten Geldbeträge an die Quästur, auf das dort eingerichtete Sonderkonto «Institut für Vorgeschichte» einzuzahlen, damit das Kuratorium darüber verfügen könne. (UAK Zug 9/181 V 47a)
Es bestehen keine Bedenken, dass Sie die 3 dem Institut zugewiesenen Räume insoweit ausstatten lassen, als die gestifteten Beträge ausreichen, die entstehenden Kosten zu decken. gez. Ziekursch (UAK Zug 9/181 V 47a)
Vorübergehend wurde Herbert Kühn, für den Aufbau der Abteilung, auch eine Assistentin bewilligt. Die gestifteten Beträge sollten, so Johannes Ziekursch, lediglich der Einrichtung der vorgeschichtlichen Abteilung dienen. (UAK Zug 9/181 V 47a)
Aus einem Schreiben von Herbert Kühn an das Kuratorium vom 11.7.1932 geht hervor, dass er die Assistentin aus eigenen Mitteln bezahlte. In den ersten zwei Jahren mit 70.-Mark monatlich. Ausserdem hatte er selbst 3000.- Mark den Stiftungsgeldern, welche 15.653, 30 Mark betrugen beigesteuert. (UAK Zug 9/181 V 47a)
Über Herbert Kühns persönliche Vermögensverhältnisse geht aus den Akten des Universitätsarchives zu Köln Nichts hervor. Um diese Frage zu beantworten, müsste man sich an seinen Nachlass, der im Bundesarchiv von Koblenz verwahrt wird, wenden. Das neu zu begründende Institut für Vorgeschichte ...die geplante Schöpfung des Herrn Privatdozenten Dr. Kühn... Ziekursch am 10. 12. 29 sollte als Abteilung dem historischen Seminar angegliedert werden. (UAK Zug. 9/281)
5. Von der Gründung des vorgeschichtlichen Institutes 1927–1935 – Die Zeit als «vorgeschichtliche Abteilung des historischen Seminars» bis zum Ende von Herbert Kühns Amtszeit
5.1. Die ersten Institutsräume in der Ubierstrasse 11
Am 12.11.1928 schrieb Herbert Kühn an den geschäftsführenden Vorsitzenden des Kuratoriums, Geheimrat Prof. Dr. Christian Eckert: Das Kuratorium der Universität Köln bitte ich hierdurch ergebenst, zum Aufbau eines Institutes für Vorgeschichte Räumlichkeiten – möglichst zwei Räume, sonst vorläufig einen Raum – zur Verfügung zu stellen. (UAK Zug. 9/45)
Die Köln-Bonner-Eisenbahngesellschaft musste ein neues Verwaltungsgebäude bauen, sodass die Villa, in der bis dahin die Verwaltung untergebracht war, frei wurde. Am 19.7.1928 bot man sie der Universität als Mietobjekt an. (UAK Zug. 9/45) Das Gebäude war ein sogenanntes «herrschaftliches Etagenhaus» (UAK Zug. 9/45) und sollte für eine Monatsmiete von 1500 Mark ab dem 1. April 1929 frei sein, wie der Makler Burkhart am 8.11.1928 der Universität mitteilte.
Allerdings sah es am 10.11.1928 erst einmal so aus, als habe die Universität doch keine neuen Räume nötig, Makler Burkhart zog sich zurück.
Der Kuratoriumsvorsitzende Geheimrat Prof. Dr. Christian Eckert war jedoch anderer Auffassung und schrieb schon am 13.11.1928 an den Oberbürgermeister, dass neue Räume dringend erforderlich seien und dass man doch mit dem Immobilienmakler Verhandlungen aufnehmen solle. (UAK Zug. 9/45) Er bat darum, eine andere Maklerfirma «abzustossen» (UAK Zug. 9/45), um mit Burkhart wegen der Anmietung verhandeln zu können ... ohne zu fürchten, mit den anderen Makler-Firmen Provisionsschwierigkeiten zu bekommen. (UAK Zug. 9/45)
Die andere Immobilienfirma Bodewig und Schütz hatte das Haus Ubierring 11 zum Verkauf angeboten, so das keine Bedenken bestanden, nun mit der Firma Burkhart zu verhandeln. Die Universität selber hatte kein Kaufinteresse.
In seiner Offerte vom 30.11.1928 beschrieb Burkhart das Haus am Ubierring: Es handelte sich um ein, für damalige Zeiten, modernes Etagenhaus mit vier Etagen zu jeweils acht Räumen, Küche und Bad sowie einer Etage mit fünf Räumen. Die Heizung war im Souterrain. An monatlicher Miete wurden 1500 Mark verlangt. Die Mietdauer sollte für 26 Monate sein ab April 1929.
Die Maklergebühr wurde mit drei Prozent vom Mietzins für diesen Zeitraum angesetzt, was 1170 Mark betrug. Diese Gebühr stellte Burkhart am 18.April 1929 der Universität in Rechnung. (UAK Zug. 9/45)
Das Hochbauamt der Stadt Köln besichtigte das Haus Ubierring 11 am 22.12.1928 und kam zu dem Schluss: Die Konstruktionsart des Hauses lässt den Ausbau einer Reihe von nichttragenden Wänden in den einzelnen Stockwerken zu, sodass gemäss beiliegender Planskizze in den einzelnen Stockwerken einige grössere Räume geschaffen werden können. (UAK Zug. 9/45)
Drei Räume konnten so zu einem von 61qm Grundfläche zusammengefasst werden, daran schloss sich ein Dozentenzimmer mit 30qm und ein Assistentenzimmer mit 16qm an. Eine Hausmeisterwohnung im Anbau von sechs Räumen konnte in einen grösseren Raum ‡ 34qm, ein Dozentenzimmer mit 20qm und ein Assistentenzimmer mit 11qm umgewandelt werden. Die Decken waren mit 500–540 kg Nutz- und Eigenlast berechnet und für Institutszwecke, gleichzeitiger Aufenthalt mehrerer Menschen, Bücherregale, geeignet.
Das Hochbauamt wies jedoch auch darauf hin, dass die Räume stark verwohnt seien und die Instandsetzung sowie der Ausbau der Wände zu ziemlich hohen Kosten führen könnte. Ausserdem gab es zu bedenken, dass nach Beendigung des Mietverhältnisses, laut Mietvertrag, die Räume wieder in den vorherigen Zustand zu versetzen seien, was wahrscheinlich noch höhere Kosten verursachen würde, wie jetzt die Herrichtung für Universitätszwecke.(UAK Zug. 9/45) Der Kostenvoranschlag des Hochbauamtes für die Einrichtung der Räume im Haus Ubierring 11 im Sinne der Belange der Universitätsinstitute belief sich auf 25.000 Mark. Die Zurückversetzung in den ursprünglichen Zustand bei Auszug der Universitätsinstitute wurde mit 10.000 Mark veranschlagt. (UAK Zug. 9/45)
Am 23.2.1929 erklärte sich der Hausbesitzer J.C. Renckens bereit, das Haus auf drei Jahre fest der Universität zu vermieten.(UAK Zug. 9/45)
Am 8.3.1929 teilte das Kuratorium J.C. Renckens unter Anderem mit, welche Institute im Haus untergebracht werden sollen: Das Institut für internationales Recht und das Kriminalwissenschaftliche Institut im Erdgeschoss. Das Industrie-Seminar sollte das erste Obergeschoss erhalten, das musikwissenschaftliche Seminar das zweite Obergeschoss, das dritte Obergeschoss stand noch zur Verfügung und für das neu zu begründende Institut für Vorgeschichte war das Dachgeschoss vorgesehen. (UAK Zug. 9/45)
Am 2.4.1929 wurde der erste Vorsitzende des Kuratoriums der Universität, der Oberbürgermeister Dr. Konrad Adenauer, gebeten, der geplanten Anmietung zuzustimmen: In dem Haus Ubierring 11 sollen untergebracht werden: ...5.) das Institut für Vorgeschichte, das neu gegründet werden soll, und mit einer halben Etage des Dachgeschosses auskommt... Die Kostenfrage wäre so zu lösen, dass der im abgelaufenen Jahre am städtischen Zuschuss ersparte Kredit, in Anwendung des §102 Z 2 der Universitätssatzung, ... einem Ausgleichsfond zugeführt würde. Dieser am städt. Zuschuss ersparte Betrag würde ausreichen zur Bestreitung der Miete für 1929, der Instandsetzungskosten und der Kosten für die Übersiedelung der Institute aus dem Universitätsgebäude nach Ubierring 11, die mit 45.000 RM anzusetzen sind. (UAK Zug. 9/45)
Adenauer war am 6. April 1929 einverstanden, am 16. Mai 1929 unterschrieben die Parteien den Mietvertrag. Für die Universität der geschäftsführende Vorsitzende des Kuratoriums, Geheimrat Prof. Dr. Christian Eckert, als Vermieter der neue Hauseigentümer Batteux. Am 18.7.1929 trafen sich die Leiter der Seminare und Institute im Arbeitszimmer von Eckert, um die Raumaufteilung im Hause Ubierring 11 zu besprechen. Auch Herbert Kühn war dabei. Das dritte Obergeschoss war nun für das Romanische Seminar, das Seminar für Fabrikbetrieb und das Musikwissenschaftliche Seminar, die im Laufe der folgenden Wochen ihre Einrichtungswünsche einreichten, vorgesehen. (UAK Zug. 9/45)
Bild 2: Haus Ubierring 11