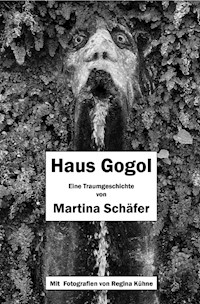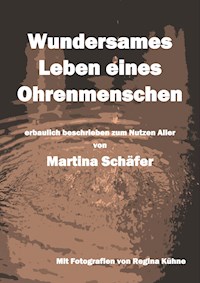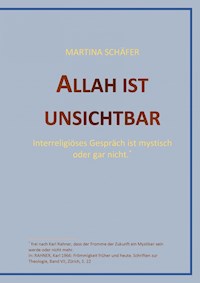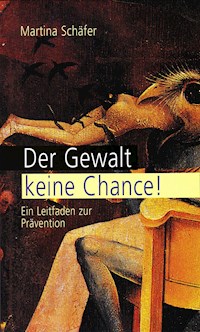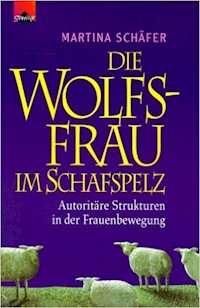
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Der Mythos von der friedfertigen Frau hat die Frauenbewegung lange an einem kritischen Blick auf sich selbst gehindert. Dabei hätte sie ihn dringend nötig gehabt. Denn auch in ihren Reihen werden autoritäre Bilder und Strukturen propagiert. Die Germanistin Martina Schäfer hat die Highlights der spirituellen Frauenliteratur einer kritischen Analyse unterzogen Ihr Fazit: "Die Wolfsfrau" fasziniert nicht von ungefähr so viele Frauen, beschwört sie doch ein ähnliche einfaches Bild von der weiblichen Natur und der Rolle der frau wie die Matriarchats- und Göttinnenliteratur. Darin behaupten weibliche Gurus nicht nur, die Frau sei von Natur aus der bessere Mensch. Einige unterschieden auch in "schlechte" Männer- und "gute" Frauengewalt und schüren Bilder voller Menschenverachtung. Und die haben sie teilweise von zweifelhaften Autoren aus er Zeit des Nationalsozialismus übernommen. Mit spitzer Feder weist die Insiderin Martina Schäfer nach, warum viele spirituelle Bestseller den Frauen einen Bärendienst erweisen und einen Fortschritt für sie eher verhindern als fördern.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 316
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Martina Schäfer
Die Wolfsfrau im Schafspelz
Für Kalinka
Die Deutsche Bibliothek CIP-Einheitsaufnahme
Schäfer, Martina
Die Wolfsfrau im Schafspelz: autoritäre Strukturen in der Frauenbewegung
ISBN 978-3-7375-8451-7
Texte: © Copyright by
http://www.martinaschaefer.ch/
Alle Rechte vorbehalten.
Lektorat: Claudia Göbel
ISBN 978-3-7375-8451-7
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Wolfsfrauen im Mainstream ihrer Zeit
Frauenbewegung und Selbstkritik
Lesen lernen
Texte beim Wort nehmen
Settings beachten
Das Matriarchat als rückwärtsgewandte Utopie
Ein Mord ist ein Mord ist ein Mord – das Werkzeug
Vom autoritären Charakter
Der »Erlöser« naht
Das Faschismus-Syndrom
Sektenkritische Ansätze
Gespenster der Vergangenheit
Die Wissenschaft von der Rasse
Gobineau und die Verdünnung des Blutes
Chamberlain und der Schutz der edlen Minorität
Das Mutterrecht und die Indogermanen – nationalsozialistische Vorgeschichtsideologien
Waren die Indogermanen matriarchal?
Mutterrecht und Kindstötungen
Die Kannibalismustheorie
Das lunar-symbolisch-matriarchale Hakenkreuz
Indogermanische Patriarchen und orientalisch-bandkeramische Matriarchate
Mütter, Mond und Kontinuität
Die geistige Kontinuität innerhalb der Universitäten
Der monotheistische Neandertaler
Wer hat bei wem abgeschrieben?
Der Größenwahn der Mystagogen
Heros und Matriarchatsforschung – Joseph Campbell
Rasse, Mythos und Ideal
Größenwahn
Utopia
Der Mythen-Import
Die Fehler der Mütter
Der Mythos von der jungfräulichen Amöbe – Bertha Eckstein-Diener (Sir Galahad)
Parthenogenese und matriarchale Genies
Intuition statt Wissenschaft
Rassen, Symbole und das lunare Weltbild
Magie und Manipulation
Wo sind die Amazonen?
Die zeitlose Frau
Frauen als höhere Rasse – Josefine Schreier
Die Ahnen und die Mythen
Göttinnen
Vom Schädelbau der Frau
Kannibalen und der »totale Krieg«
Mutation Mann – Elizabeth Gould-Davis
Die Katastrophe der Gegenwart und die minderwertigen Männer
Chaos-Chronologie
Gene und Urkultur
Die Traditionen der Väter
Die frauenbestimmte Altsteinzeit – Marie König
In den Wirren der Forschung
Mensch bleibt Mensch
Am Anfang war die Einheit
Eurozentrismus
Die Schattenseiten des Autodidaktentums
A Star was born – Marija Gimbutas
Ein »wechselvolles« Leben
Der Einfall der maskulinen Welt der Indoeuropäer
Das matriarchale Alte Europa
Mythen, Symbole und Kontinuität
Methode von Zickzack zu Zickzack
Die sieben heiligen Fragen
Das Setting
Die Sünden der Töchter
Vom Matriarchat zum Frauenprojekt – Heide Göttner-Abendroth
Ökologie und Matriarchatsforschung
Kritik und Popularität
Das Paradigma
Die »anderen« I
Das Göttin-Heros-Muster
Das große Referat
Wissenschaftlicher Anspruch und profane Realität
Die »anderen« II
Die Mythologie und der freiwillige Tod des Mannes
Magie und Manipulation
Von der Theorie zur Praxis: Das Setting
Das Ritual-Setting
Das Sozial-Setting
Der Coven
Folter, Beschneidung und das Matriarchat – Carola Meier-Seethaler
Antworten schuldig bleiben
Klitorisbeschneidung als matrizentrisches Ritual
Folter an Männern als matrizentrisches Ritual
Die Nähe des Mannes zum Tod
Der Größenwahn der Enkelinnen
Von der Überlegenheit der Frau – Christa Mulack
Outgroup Nr. 1: Die Männer
Outgroup Nr. 2: Bestimmte Frauen
Die weibliche Wahrheit
Matriarchatsforschung und Frauensolidarität
Geschlechterdifferenz als Welterfahrung
Die Überlegenheit der Eizelle
Hassen lernen
Der Mythos von der friedfertigen Frau
Man ersetze das Wort »Mann« durch das Wort »Ausländer«
Das große Wolfsgeheul – Clarissa Pinkola Estés und andere Wölfinnen
Interpretation und Nabelschau
Prototypische Urfrau und feminine Wildnatur
Der innere Zoo
Einleitung
Schon immer habe ich mich für Wörter interessiert:
Wie Wörter innere Bilder erzeugen, wie diese Bilder Emotionen wecken und weitere Ideen und Gefühle hervorrufen und wie Menschen Wörter benutzen, um sich zu unterhalten, sich zu bilden und einander zu beeinflussen.
Wolfsfrauen im Mainstream ihrer Zeit
Das Buch Die Wolfsfrau. Die Kraft der weiblichen Urinstinkte von Clarissa Pinkola Estés ist seit seinem Erscheinen 1993 eines der erfolgreichsten Bücher auf dem Esoterikmarkt geworden.1 Was begeisterte die Leser – und vor allem die Leserinnen – so an diesem Buch? Was hatte es den Frauen Wichtiges mitzuteilen? Welche Sehnsüchte, Träume und Ziele versprach es zu erfüllen, die nicht schon an anderer Stelle aufgenommen worden waren? Was unterscheidet den Inhalt dieses Buches von den Inhalten und Forderungen der Frauenbewegung?
Es hat sich in unserer Gesellschaft einiges zum Positiven für Frauen verändert seit jener Tomate, die eine enttäuschte Genossin in den frühen siebziger Jahren einem der linken Studentenführer an den Kopf warf und damit die Neue Frauenbewegung einläutete. Doch nach wie vor besteht beim Großteil des weiblichen Geschlechts das Gefühl, zurückgesetzt zu sein und ungleich behandelt zu werden. Ein vages Unbehagen.
Oft ist es das Gefühl, über- oder unterfordert zu sein, zerrissen zwischen Haushalt, Beruf und eigenen Vorstellungen, wie man als Frau sein Leben heutzutage leben könnte. Oder aber auch gefangen zu sein im immer gleichen Trott: die ewige Wiederholung von Waschen – Einkaufen – Kinderpflege respektive Schreibtisch-Herd-Wohnzimmer. Draußen vor dem Fenster oder im Fernseher aber pulsiert das wahre, das wilde Leben: die Abenteuer langmähniger Blondinen, weise-fülliger Kommissarinnen oder allseits geforderter Managerinnen. Dabei fühlt sich frau doch selbst noch wild und noch gar nicht so alt.
Bei allen politischen und gesellschaftlichen Veränderungen bleiben Sehnsüchte und Hoffnungen weiter bestehen: Hoffnungen auf selbst bestimmte Lebensformen, Sehnsüchte nach der perfekten Beziehung oder der großen, das gesamte Leben umkrempelnden Liebe. Lust, selbst mehr Einfluss ausüben zu können, Lust, mehr zu erleben, mehr Aufregung, mehr Spannung, also irgendwie bedeutsamer sein zu können, wichtiger für das unmittelbare soziale Umfeld, aber auch in Bezug auf den Beruf oder noch darüber hinaus.
Viele Frauen haben das Gefühl, dass sie – ganz gleich ob sie Mutter und/oder Sekretärin, Lehrerin oder Verkäuferin sind – immer noch den Fußabstreifer für alle Welt abgeben müssen oder aber auf jeden Fall an allem schuld sein sollen. Ihr Wunsch nach Akzeptanz, nach Achtung ihrer Persönlichkeit und Würde wird sicher in weit geringerem Maße erfüllt, als das bei den meisten Männern der Fall ist.
Auch die Männer entsprechen selbst nach dreißig Jahren Frauenbewegung – noch nicht dem erträumten Ideal des familiär engagierten Rundumgenies zwischen Selbstständig-einkaufen-Können, Sonntagsmahl-für-sieben-Personen-Planen und -Realisieren und ewig rüstig-faszinierendem Bettgenossen.
Es sieht so aus, als habe Die Wolfsfrau für alle Aspekte dieses »Unbehagens« eine Lösung parat: Da erscheint das Wolfsrudel als egalitäre, höchst frauenfreundliche Erziehungsgemeinschaft. Die Leitwölfin sucht sich ihren Oberliebhaber und Kindszeuger aus einer Gruppe anderer Liebespartner aus – und alle anderen erhörten Rüden helfen bei der Aufzucht der Jungen mit. Ganz anders als bei uns Menschen, wo irgendwann das freie Flottieren zwischen den Liebhabern, zumindest für Familie »Normalo«, vorbei ist, was auch immer uns die Medien da suggerieren wollen.
Das wilde Wolfsrudel als Utopie, in der es vor allen Dingen den Frauen, den Wölfinnen, besser geht. Estés schreibt, diese Utopie sei eben auch für die Menschenfrau möglich, wenn sie nur einen Ur-Instinkt wecke, der tief verborgen in ihr schlummere. Dieser Ur-Instinkt, diese weise Alte, sei eben die Wolfsfrau. Sie wieder zu entdecken bedeutet laut Estés, dass Frauen zurück finden zu Leidenschaft, Kreativität, Instinkt und Selbstbewusstsein. Und wer möchte nicht all diese Eigenschaften in sich wecken und weiterentwickeln?
Der Text liest sich auch sonst wie ein Geschenkkorb, alle weiblichen Sehnsüchte und Träume erfüllend: Als selbstbewusste Frau wusste ich doch schon längst, dass es mir nicht vom Schicksal bestimmt worden ist, mein »Dasein als kümmerliches, unauffälliges Nagetier zu führen, als dressiertes Mäuschen, das es nicht fertig bringt, einen mächtigen, wolfsartigen Satz nach vorn zu machen, sich auf die Jagd zu begeben und das Unbekannte zu erforschen«.2
Es ist tröstlich zu lesen, dass da eine solch mächtige Urfrau in uns lebt, schon immer da war und nur darauf wartet, aufgeweckt zu werden. Das tut gut, das macht Mut. Das gibt straffe Schultern und einen geraden, frechen Blick – auch gegenüber dem ekligen Chef, der gemeinen Vorgesetzten. Egal, wie die Welt draußen aussieht, in einer selbst als Frau lebt das Wilde, Ursprüngliche, das Ungebrochene, niemals Geschlagene oder um ein gerechtes Gehalt Betrogene. Trief drinnen gibt es doch eine, die sich nicht alles gefallen lässt.
Warum nur läuft es mir dennoch beim Lesen der Wolfsfrau und ähnlicher Bücher so unbehaglich den Rücken herunter? Warum fällt es mir schwer, trotz aller liebreizenden Suggerierung innerer Kräfte, Göttinnen und Fraueninstinkte, begeistert darauf einzusteigen? Weshalb ist mir »die Rückkehr zu den Quellen weiblicher Macht und Energie«, wie sie die österreichische Autorin Angelika Aliti in ihrem Buch Die wilde Frau ankündigt, höchst suspekt? Was habe ich dagegen, »steinreich« zu werden, »blaue Wunder« zu erleben, mich selbst heilen zu lernen oder gar zu zaubern, wie es die Bücher von Luisa Francia versprechen? Glaube ich etwa nicht, mit Hilfe dieser esoterischen Frauenbücher »die Welt zu verändern«, will ich nicht als Frau »das Sagen haben«, wie es mir Angelika Aliti anbietet?3 Scheinbar verkörpern all diese Bücher doch nichts anderes als die ursprünglichen Ziele der Frauenbewegung, die Wünsche der Frauen nach Selbstbehauptung, politischer Einflussnahme und Freiheit.
Man nennt diese Werke »Lebenshilfeliteratur« – zu welchem Leben aber verhelfen sie den Frauen? Ich meine: zu keinem besseren. Denn um die Ziele der Frauenbewegung zu erreichen, braucht es Strategien, Durchsetzungsvermögen und inhaltsbezogene Kompetenz. Nicht »Magie« verändert die Welt, wie es in einem Buchtitel von Angelika Aliti heißt, sondern Arbeit, nicht ein »wilder Blick«, wie es Luisa Francia vertritt, sondern Wissen, klares Durchschauen der Machenschaften anderer, Solidarität und gemeinsames Vorgehen.4 Doch in all diesen hochgelobten, auflagenstarken »Bauchnabelbüchern« findet sich kein Gedanke, der den Frauen heute bei diesen längst nicht abgeschlossenen Kämpfen hilft.
Manche Bücher scheinen weniger dafür geschrieben worden zu sein, das Denken zu fördern, als es vielmehr zu verhindern. Sie führen teilweise direkt in reaktionäre, magisch-autoritäre Vorstellungen. Die Wolfsfrau ist in diesem Zusammenhang eine Art undefinierbare »Gefühlswolke«, die den dazu nötigen Boden bereiten kann – möglicherweise sogar ohne dass sich die Autorin dessen bewusst ist. Die spirituelle Frauenliteratur, von Die Wolfsfrau über weniger auflagenstarke Titel von Angelika Aliti oder Luisa Francia bis hin zu Jean Shinoda Bolens Göttinnen in jeder Frau, ist aus bestimmten Traditionen heraus entstanden. Selbst nicht immer als autoritär zu bezeichnen, ist sie doch in vielen Fällen Teil einer autoritären Tradition, die allgemeine Grundrechte, wie die Selbstbestimmung des Individuums, gleiche Rechte für alle Menschen und durchschaubare, demokratische Strukturen, auf vielen verschiedenen gesellschaftlichen Ebenen in Frage stellt oder gar negiert.
Die Unzufriedenheit von Frauen, aus der Wünsche, Träume und Sehnsüchte erwachsen, ist vollkommen legitim und begründet. Viele spirituelle Frauenbücher fördern mit ihren mythologischen Egotrips jedoch das, woran die meisten modernen Menschen bereits leiden: Einsamkeit, Isolation, Verlorenheitsgefühle angesichts unüberschaubarer Verhältnisse, eines rasanten Wertewandels und einer immer stärkeren Informationsüberflutung. Sie propagieren unverbunden nebeneinander her lebende Individuen, die das Heil im eigenen Bauchnabel suchen.
Die Geschichte solchermaßen missbrauchter Sehnsüchte ist lang. Auch wenn sie so tun, als seien sie gleich einer schaumgeborenen Venus aus dem ideologischen Nichts aufgetaucht – die Texte von Autorinnen wie Clarissa P. Estés, Angelika Aliti oder auch Zsuzsanna E. Budapest und anderen sind nur die Eisbergspitze einer langen Tradition, die etwa in der Mitte des 19. Jahrhunderts ihren Anfang nahm. Sie sind Ausdruck der modernen Industriegesellschaft und suggerieren in ähnlicher Weise Orientierungshilfe in deren Unüberschaubarkeit wie das damals aufkommende »Neuheidentum«, alternative Lebensentwürfe aller Art oder Zurück-zur-Natur-Bewegungen. Nicht alles daran war schlecht oder führte gar direkt in die Fänge des gewaltbereiten und rassistischen Nationalsozialismus.
Schon im 19. Jahrhundert versuchten rassistische Autoren, den Menschen ihre existenziellen Ängste auszureden. Etwa ein halbes Jahrhundert später begriffen die Nationalsozialisten, dass die Sehnsüchte und Ängste von Frauen einer anderen Behandlung, einer anderen Verführung bedürften als die der Männer, wollte man sie zu dem kruden, menschenverachtenden und antisemitischen Weltbild bekehren. Um auch die Frauen auf das »großdeutsche Wesen« einzuschwören, bauten die nationalsozialistischen Ideologen die mutterrechtlichen Theorien für die »germanische« Frau aus. Auch Bücher wie Die Wolfsfrau gehen in ihren Vorstellungen eines überzeitlichen, mythischen Wesenskerns letztlich auf solche Traditionen zurück.
Nach dem Zusammenbruch des nationalsozialistischen Regimes entwickelte sich eine seltsame Art geistiger Kontinuität: von Professoren der Ur- und Frühgeschichte, die sowohl einem diffus-allgemeinen als auch einem mondselig-frauenbezogenen »Wesen« der Dinge das Wort redeten, zu den »Wolfsfrauen«- und Matriarchatsautorinnen, die in deren Tradition schrieben. Wahrscheinlich lag manchen Schreibenden das Wohl von Frauen wirklich am Herzen. Doch in ihren Texten stillten sie die Sehnsucht nach Einmaligkeit, heizten sie Überlegenheitsgefühle weiter und wieder neu an. Der Erfolg des Buches Die Wolfsfrau wiederum ist ohne die Vorarbeit der Matriarchatstheoretikerinnen aus den siebziger Jahren nicht zu verstehen. Clarissa P. Estés ist eine Epigonin, die sich einfach besser verkauft als die ideologischen Riesinnen, auf deren Schultern sie steht.
Die hier besprochenen Autorinnen scheren sämtliche Übel dieser Welt über einen Schuldzuweisungs-Kamm: Mal sind es »die Männer«, die an allem schuld sind, wie bei der »Ur-Autorin« der Matriarchatsforschung, Elizabeth Gould Davis, mal ist es die »Unterdrückung der Urinstinkte ... generell ... in allen Kulturen«, wie bei Estés.5
Doch Unterdrückung, Gewalt und Ausbeutung haben viele Ursachen. Sie alle aus einem Grund heraus erklären zu wollen ist Mystifizierung. Auf diese Art werden kritisches Nachfragen, aktives Handeln und Eingreifen – und vor allem gezieltes Nachdenken – unterbunden. Auch rechtsgerichtete Parteien und Einzelpersonen scheren alle Übel ihres Landes über einen Kamm. Da sind halt dann die »Ausländer« oder »Asylanten«, waren »die Juden« die Wurzel allen Übels, auf jeden Fall immer »die anderen«.
»Böse andere« finden sich – in unterschiedlicher Ausprägung – jedoch zuhauf in der Spiritualitäts- und Matriarchatsforschungs-Literatur wieder. Neben »den Männern« sind es oft »Linke« oder »linke Feministinnen«, wie bei der Theologin Christa Mulack. Clarissa P. Estés greift weniger auffallend zu solch ausgrenzenden Mustern, aber auch sie hat einige Feindbilder entwickelt. Dazu gehören auf jeden Fall all die Menschen, die zu viel nachdenken, die sich nicht über ihren »Bauch« oder gar über ihre »Urinstinkte« definieren lassen.
Autorinnen wie Heide Göttner-Abendroth, Elizabeth Gould Davis und Clarissa P. Estés schreiben uns buchstäblich in die Steinzeit zurück. Schlimmer noch: Sie schreiben uns auf eine vormenschlich-tierische Stufe herab, ohne Sinn und Verstand. Nicht von ungefähr taucht bei Clarissa P. Estés mehrfach das Bild der Bauchfrau ohne Kopf, der Baubo, auf.6 Ganz Geschlechtsorgan und Verdauungstrakt. Mehr nicht.
Gab es bei den Nazis ein »Wesen« der Germanen, so bei Clarissa P. Estés, Angelika Aliti und anderen Autorinnen ein »Wesen« der Frau, eng verbunden mit den als ideal fantasierten »Zyklen der Natur«. Ein Instinktwesen, das wahrscheinlich nicht mal in der Lage wäre, einen Einkaufszettel zu lesen oder an der Kasse sein Wechselgeld nachzuzählen. Diese Ur-natur folgt immer und überall ihren – meist weiblichen – Instinkten, und die wohnen bei Estés’ Wolfsfrau oder Luisa Francias jahreszyklischen Ergüssen irgendwo zwischen Lungenspitze und Urinblase »in den Eingeweiden«7, zwischen den Gedärmen.
Auch andere Intellektuelle der letzten zwei- bis dreitausend Jahre – Männer wie Frauen – sind nicht etwa qua erworbener Geistesfähigkeiten große Dichter, Philosophen oder Entdecker geworden. Auch in ihnen toben nur »Naturinstinkte«.8 (Was für ein Wort übrigens: »Instinkte« sind schließlich immer Teil der Natur.) Nicht Köpfe inspirierten nach Clarissa P. Estés die Künste dieser Welt, brachten Wissenschaft, Philosophie, Malerei und Musik hervor, sondern »der Bauch«.
Im Grunde wäre es zum Lachen, wenn es nicht so gefährlich wäre: Hinter dem Instinktbegriff von Clarissa P. Estés und anderen steckt eine Naturvorstellung, die man auch als Biologismus bezeichnet. Sie besagt, dass alles menschliche Verhalten angeboren ist, vererbt und nicht veränderbar. Nach dieser Auffassung kann man nur bedingt Neues dazulernen und kaum über seinen genetischen Schatten springen. Die Biologisten behaupten in ihren Kernaussagen, dass Intelligenzunterschiede angeboren sind, die Denkfähigkeit an Gene gebunden und dass wirtschaftliche und wissenschaftliche Entwicklung durch Hautfarbe und ethnische Herkunft bestimmt würden. So dumm, in dieser Diskussion das in weiten Kreisen inzwischen diskreditierte Wort »Rasse« zu verwenden, ist heute kaum einer von ihnen mehr. Sie sehen das Menschsein nicht in seiner Auseinandersetzung mit der Umwelt und seinen Anlagen, sondern als vorherbestimmt durch ererbte Eigenschaften, ethnische Zugehörigkeiten und die genetische Ausstattung jedes Einzelnen.
Auch bei der Archetypenlehre des Psychologen C.G. Jung handelt es sich um dieses Prinzip, nur statt in biologistischer Argumentation in einer psychologistischen. Von seinen Kritikern wird C.G. Jung als einer der Autoren angesehen, die den geistigen Nährboden für den Nationalsozialismus in den dreißiger Jahren mit vorbereiten halfen.
Beinahe alle im Folgenden dargestellten Autorinnen und Autoren sind Anhänger von C.G. Jung. Joseph Campbell, der New-Age-Inspirator, übertrug C.G. Jungs Arbeiten ins Englische, Clarissa P. Estés ist Psychologin nach der Jung'schen Methode, und auch viele andere New-Age-Autoren, Matriarchatsforscherinnen und Lebenshilfe-Schriftstellerinnen halten mystische, überzeitliche Qualität aus Kosmos oder Innenleben für wichtiger als die individuellen, konkreten Leiden und Freuden realer Menschen.
Bücher wie Elizabeth Gould Davis’ Am Anfang war die Frau wurden von begeisterten Anhängerinnen oft als »Bibel« bezeichnet. Endlich eine Autorin, die formulierte, dass Frauen die ersten Menschen waren, vor allen Dingen die besseren. War das nicht notwendig? Vielleicht. Es war aber auch der erste Schritt zum Verrat an den feministischen Idealen.
Fragt man heute nach, was sich diese faszinierten Leserinnen außerdem von diesem Buch gemerkt hätten, schlagen sie verlegen die Augen nieder. Dass wir »überlegenen« Frauen bei Elizabeth Gould Davis vom anderen Stern kamen, ist ihnen nach der Lektüre genauso entfallen wie das Aussehen dieser edlen Damen: rotblond, schlank und hoch aufgeschossen. Auch dieses Bild hat seine braunen Wurzeln.
Bei meinen Recherchen befragte ich viele Frauen zur Matriarchatsforschung oder zur Lebenshilfeliteratur à la Die Wolfsfrau. Interessant war, wie viele Frauen nahezu »gestanden«, sie hätten »das alles« nie zu Ende gelesen, und die »Schuld« dafür gleich bei sich suchten: »Wahrscheinlich bin ich nicht belesen genug, um das alles zu verstehen.«
Schriftstellerinnen wie Estés, Gould-Davis oder der New-Age-Guru Campbell verunklaren. Sie schläfern die Aufmerksamkeit mit Hilfe ihrer mystifizierenden Redseligkeit ein. Sie sind wie der Fischer im Lied von der Forelle: Sie trüben das Wasser, damit das Fischlein besser gefangen werden kann.
Frauenbewegung und Selbstkritik
Beinahe jede der gegenwärtigen politischen Parteien oder Bewegungen in Deutschland – aber auch anderen Ländern – hat sich im Laufe ihres Bestehens einmal mit der eigenen Stellung zu und möglicherweise sogar der Herkunft ihrer Ideen aus autoritärem und rassistischem Gedankengut früherer Zeiten auseinander setzen müssen. Dazu gehörte auch die Einstellung zu Gewalt und zur Legitimierung von Terror.
Die christlichen Großparteien verdankten es ihren führenden Köpfen, allen voran Kurt-Georg Kiesinger und Franz Josef Strauß, dass sie mit ihrer tatsächlichen braunschwarzen Dienstkontinuität nicht ungeschoren davon kamen. Auch die »roten Brüder und Schwestern« – sowohl in der BRD als auch in der DDR – teilten dieses unkommode und doch so wichtige Schicksal, gezwungen zu sein, die eigenen Verstrickungen mit der Vergangenheit zu hinterfragen. Die Kirchen müssten eigentlich heute noch schamvoll erröten, und auch die grüne Partei war eines Tages gezwungen, die braunen Flecken im eigenen Bio-Apfel zu erkennen. Auch die Anthroposophen, eher bekannt als Waldorfschul-Begründer und Erfinder einer akzeptierten Heilpädagogik, werden immer mal wieder gegen den Strich ihres frauenfeindlichen, rassistischen und antisemitischen Gedankengutes gebürstet. Die Liste derjenigen, die kritisch auf ihre eigene Geschichte schauen mussten, ließe sich noch endlos fortsetzen.
Einzig die Frauenbewegung scheint bis heute – zumindest was ihr Image in der Öffentlichkeit angeht – von diesen Vorwürfen verschont geblieben zu sein. Doch auch in der feministischen Bewegung gibt es »unangenehme«, aber von vielen Frauen bis heute ignorierte autoritäre, rassistische, antisemitische und chauvinistische Elemente.
So leitet sich ein großer Teil der Bilderwelten und Theorien, die mit dem Schlagwort »Matriarchatsforschung« umrissen werden, aus dem völkischen und Herrenmenschen-Gedankengut der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert ab. Einige Ansätze der Matriarchatsforschung haben Aspekte mit den ideologischen Schriften der Nationalsozialisten selbst gemein. Ihre praktische Umsetzung in Frauenritualen oder Lebenshilfe- und Erbauungsliteratur weist allzu oft eine große Nähe zu rechtslastiger mythischer Stümperei oder dilettantischer Geschichtsklitterung auf und frönt einer eitlen weiblichen Nabelschau.
Die Matriarchatsforschungs-Theorien kolportieren zwar zum Teil auch eine emanzipatorische – rückwärtsgewandte – Frauenutopie. Gleichzeitig tragen sie aber den antiemanzipatorischen Ballast aller möglicher Ideologien des 19. und 20. Jahrhunderts mit sich. Sie verstecken Übermenschenansätze oder rassistische Vorstellungen in ihren bekanntesten Darstellungen weiblicher Überlegenheit, und sie zeigen ein erschreckendes Ausmaß von Antisemitismus in den Matriarchatstexten, die sich mit dem Alten Testament auseinander setzen. Letztlich vermitteln sie in ihren angeblich sogar wissenschaftlichen Ansprüchen standhaltenden neueren Ansätzen autoritäre und extrem menschenverachtende Bilder und Gedanken.
Bücher kann man verbrennen, ignorieren, nicht wieder auflegen, als Märchen abtun oder als unwissenschaftlich disqualifizieren. Doch Worte haben ihre Wirkung in der Praxis. Hinter den Büchern kommen nämlich Rituale zum Vorschein, Frauenprojekte auf der grünen Wiese oder in Altbausanierungsvierteln ostdeutscher Großstädte. Bücher werden gelesen, und die Frauen, die sie lesen, setzen ihre erträumten Utopien in die Wirklichkeit um, senken Hemmschwellen in spirituellen Festen, gleichen sich bestimmten Vorstellungen an, baden im göttinnenhaften Größenwahn oder delegieren ihre Spendenbeiträge um vom »Roten Kreuz« zur »Einpersonen-Frauenakademie«, vom »Kap Anamur« zum »Hexentreffen«. Sie verwechseln innerliches Wachstum mit äußerer Politik, meditative Passivität mit aktiver Verantwortung für andere und melodisches Summen von Göttinnenchants mit lautem Aufschrei vor Entsetzen oder Scham. Insofern ist Literatur eben durchaus wirksam, hat sie eine politische Kraft und Einflussnahme, sollte sie kritisch bedacht werden.
Es geht mir nicht darum, Spiritualität oder inneres Wachstum und aktives Eingreifen in politische Gegebenheiten gegeneinander auf- oder abzuwerten. Vielmehr liegt mir daran, die mangelnde Unterscheidungsfähigkeit und die Unsicherheit, wann welche Tätigkeit am geeigneten Platz ist, zu kritisieren. Die Entpolitisierung weiter Teile der Frauen- und auch der Alternativbewegungen ist nicht eine Folge von Verinnerlichung oder Spiritualität, sondern eine Folge der Verwechslung von Spiritualität und Politik. Solche Verwechslungen werden durch verwaschen formulierte und autoritäre Texte gefördert. Und Ungenauigkeiten verhindern, dass Täter oder Ursachen benannt werden können. Werden beispielsweise »Rasse«, »Klasse« und »Geschlecht« in einen Topf geworfen, entsteht genau jene Unschärfe, die einen guten Nährboden für autoritäres Denken und Verhalten abgibt. Die Nacktheit des Kaisers zu benennen ist der erste Schritt, um ihn abzusetzen. Sie zu beschönigen aber, wie man in Andersens Märchen nachlesen kann, verfestigt seine Macht.
Ist die Frauenbewegung an der »Frauenbewegung« spurlos vorübergegangen? Zumindest, was die Forderungen nach Eigenreflexion und kritischer Aufarbeitung der eigenen Standpunkte betrifft, könnte man in zahlreichen Punkten zu diesem Schluss kommen. Schließlich sind dies Ansprüche, die der Feminismus selbst an eine patriarchale Wissenschaft, Literatur und Lebensweise immer wieder gestellt hat. Wir Frauen haben übersehen, dass wir nicht von einem anderen Stern jungfräulich in diese verdorbene Welt gepurzelt sind, sondern dass wir selbst Teil und Inhalt des Systems sind. Wir sind Töchter – in jeder Hinsicht.
Die Texte der Matriarchatsforscherinnen hatten, zu ihrer Zeit, durchaus einen politischen Stellenwert. Sie gehören in den Bereich therapeutischer oder agitatorischer Politschreiberei. Die Matriarchatsforscherinnen trauten sich, nie Gedachtes anzudenken und gegen die Bastionen männlicher Definitionsmacht bei der Frage, was denn nun natürlich sei an den Geschlechtern, das erste Mal anzugehen. Sie begannen, ohne sich dessen bewusst zu sein, zu zerstören, mit der bedauernswerten Folge, dass sie aus den alten Bruchstücken neue Mythen konstruierten und neue Feindbilder bastelten.
Warum schrieben Frauen und Männer knapp eine Generation nach dem Ende des Nationalsozialismus unter der Überschrift »Matriarchatsforschung« rückwärtsgewandte Utopien, die sowohl inhaltlich als auch strukturell zutiefst in diesen braunen Sümpfen verankert waren? In Zeiten einer linken Aufbruchsstimmung, vager, zaghafter Faschismuskritik und eines beginnenden Austausches von Worten wie »Rasse« gegen »Kultur« oder »Germanen« gegen »Europäer« war es sicher nicht opportun, eurozentrisches Überlegenheitsdenken, rassistische Arroganz und latente Gewaltbereitschaft wieder zu Papier zu bringen. Die braunen Söhne und Enkel überspringend, plumpste das »Matriarchat« scheinbar ohne Vorläufer und Herkunft in die feministische Debatte hinein. Und konnte sich deshalb auch alles leisten.
Linke wandten sich sehr rasch von Texten ab, die gerade dem intellektuellen und sozialkritischen, manchmal auch recht anspruchsvollen Diskurs ihr Credo einer intuitiven Wissenschaft, durchgeführt vom einsamen Genie entgegensetzten. Das mag manchem Hirn, zermürbt in den zahlreichen Uni- und Wohngemeinschafts-Debatten, erholsam angemutet haben. Und statt anstrengender Demos oder gar leichter Straßenkämpfe gab es da die Idee der Magie, mit der man leichthin sowohl die Natur als auch die Menschen manipulieren konnte. Ganz ohne Anstrengung und Pflastersteine und ohne sich die Finger schmutzig machen zu müssen – in jeglicher Hinsicht. Die Frauen blieben unschuldig, rein: das ewig friedliche Geschlecht. Tatsächlich?
Die wieder hervorgeholten Texte früher matriarchaler Theoretikerinnen bedienten auch eine gewisse Faulheit. Die Leserinnen konnten – dies lässt sich durch Josefine Schreiers Buch Göttinnen belegen – von sich selbst als eventuell gar nicht ihrem Ideal entsprechenden Wesen absehen. Da stand es schwarz auf weiß und auch nicht so kompliziert geschrieben wie bei all diesen links-feministischen Sozialanalysen: dass alles Übel dieser Welt vom angeblich »rassisch« minderbemittelten Mann ausgeht. Ohne ihn – so die Aussage – wären alle Frauen qua Geburt »Göttinnen«.
Die Lust daran, sich auf Kosten anderer Menschen selbst zu erhöhen und die geistige Trägheit – lange hätte man dies nicht so weitertreiben können, denn die Leserinnen begannen auf einmal zu fragen: Stimmt das alles überhaupt? Man brauchte allmählich wissenschaftlichere Werke.
Die 1988 verstorbene Vorgeschichtsforscherin Marie E.P. König wickelte ihren mythischen Eurozentrismus in ein Vorgeschichtskonzept, das sie direkt von der Wiener Schule der letzten Jahrhundertwende importiert hatte. Die Arbeiten der Archäologin und Ethnologin Marija Gimbutas machten endlich Schluss mit der schuldbeladenen Vergangenheit unserer Eltern: Aus Amerika bekamen wir die schuldlose Großmutter inklusive archäologisch fundiertem Neolithmatriarchat gleich mitgeliefert. Beide Autorinnen sind Beispiele dafür, dass ein wissenschaftlicher Anspruch allein noch längst nicht ein vorurteilsbehaftetes Schreiben verhindert.
Das gilt auch für die Arbeiten von Heide Göttner-Abendroth, die in diesem Genre noch einmal einen besonderen Fall darstellen. Ihr Werk steht für ein lückenloses, beinahe hermetisches System, das über intellektuelle Argumente, emotionale Bilder, ausagierte Rituale und eine Projektstruktur scheinbar wissenschaftlich abgesichert und historisch perfekt ist.
Es ist erstaunlich, mit welcher Behutsamkeit die Kritiker den verschiedenen Protagonistinnen einer Matriarchatstheorie entgegentraten. Das Äußerste an kritischer Beschreibung scheinen Bezeichnungen wie »Umsturzbewegung« gewesen zu sein, die Darstellung der Frauenbewegung als »ein durch überlegene Fremdkultur erschüttertes Gruppenselbstgefühl, das sich wiederherzustellen versucht«.1 In Teilen war sie mehr als das: nämlich ein autoritärer Verbalradikalismus, den anscheinend niemand erkannt hatte.
So zum Beispiel die Texte von Carola Meier-Seethaler, die die Beschneidung von Frauen und das Foltern von Männern als matrizentrische Rituale verkauft.2 Diese Gefühllosigkeit und mangelnde Empathie eint sie mit dem antisemitischen Mythologen Joseph Campbell, für den die individuellen Gefühle von Menschen auch nur Hemmnisse auf dem wahren, kosmischen Entwicklungsweg des männlichen Helden darstellen.3
Das Erschrecken darüber, wie eine Autorin dergleichen schreiben kann, berührt auch die eigene Selbstreflexion: Warum haben wir frauenbewegten Frauen – und ich zähle ich mich explizit dazu – dies in all den Jahren nicht bemerkt? Es ist jene Frage, die man an totalitäre Systeme gleich welcher Art stellen muss: Merkt denn niemand, was hier los ist – rechtzeitig, so dass man etwas dagegen unternehmen kann?
Die Arbeiten der Matriarchatsforscherinnen bedienten die Sehnsucht nach einer heilen Welt, einer für Frauen heilen Welt. Wenn schon nicht in der Gegenwart, dann in der mythischen Vergangenheit. Solche rückwärtsgewandten Utopien haben die meisten politischen Ideologien und Weltanschauungen entwickelt. Und die Sehnsucht nach einer »heilen Welt« ist eine berechtigte Sehnsucht, nämlich ein Traum in einer »unheilen Welt«. Es geht hier nicht darum, die Träume und Sehnsüchte von Frauen zu diskreditieren. Nicht dem Traum vom Schlaraffenland gehört der Boden entzogen, sondern dem Hunger, der dahinter steht. Denn Hunger und Ungenügen machen korrumpierbar.
Im Laufe meines Engagements in der Frauenbewegung konnte ich eine Reihe eindrücklicher Erfahrungen sammeln, die mich die Strukturen, Bilder und Gedankenwelten der Matriarchatsforschungs-Literatur und spiritueller Frauenbücher kritisch hinterfragen ließen. Deren Inhalte hatte schließlich auch ich einmal recht unkritisch »geglaubt« und weitervermittelt.
Ich entwickelte eine Art Leseseminar zu den Texten einiger Matriarchatsforscherinnen, das ich in verschiedenen Frauenzusammenhängen einige Jahre lang abhielt. Sein Inhalt bildete später die Grundlage für dieses Buch.
Die Wolfsfrau im Schafspelz soll dazu beitragen, dass sich bestimmte Teile der Frauenbewegung mehr an ihren eigenen Maßstäben messen – um so deren Zielen wieder ein Stück näher zu kommen.
Lesen lernen
Inwiefern »Wolfsfrauenliteratur« die Sehnsüchte von Frauen nicht erfüllt, sondern missbraucht, lässt sich nur verstehen, wenn man sich die Geschichte dieser Literatur vor Augen führt. Ganz besonders die Geschichte der Matriarchatsforschungsliteratur, auf der die feministische Esoterik aufbaut.
Diese Art Literatur hatte – im übertragenen Sinn gesprochen – ihre früheste Kindheit, ihre Babyphase, etwa in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Die alles zerstörende, destruktive Kinderphase findet sich während des Nationalsozialismus, und die Bekehrung zur braven, alles fressenden, lesenden und wiederkäuenden Studentin dann in der restaurativen und konservativen so genannten Adenauer-Ära, die Zeit des Fleißes und der Anpassung. Die Flegeljahre der Wolfsfrau waren die Zeiten der Studentenrevolte in den USA und in Europa sowie die Anfangsjahre der europäischen Frauenbewegung.
Es bestehen Traditionen und Ableitungszusammenhänge zwischen den in diesem Buch bearbeiteten Texten: Sowohl Clarissa P. Estés als auch zum Beispiel Heide Göttner-Abendroth oder Christa Mulack gehen mit ihren Büchern auf Traditionen zurück, die sehr weit – nicht nur ins 20., sondern sogar ins 19. Jahrhundert zurückreichen. Das Verständnis dieser Traditionen oder Wurzeln ist wichtig, wenn man auf die Schwäche der Esoterik- oder Matriarchatsliteratur hinweisen will oder sogar nachweisen möchte, inwiefern sie kontraproduktiv für die Probleme und Wünsche von Frauen am Ende des 20. und Anfang des 21. Jahrhunderts sind.
Ziel dieses Buches ist es, der Leserin und dem Leser Kriterien an die Hand zu geben, wie sie selbst auch andere Bücher aus der Esoterik- oder Matriarchatsszene auf solche verborgenen rechtslastigen Fußangeln untersuchen können. Auch einige der in den letzten Jahren geschriebenen, mythenschwangeren Bücher zur »inneren Wandlung« des Mannes leben teilweise von solch unterhinterfragtem Gedankengut aus den letzten 150 Jahren.
Texte beim Wort nehmen
Als Literaturwissenschaftlerin untersuche ich wissenschaftliche Texte auf autoritäre Strukturen. Dieses Verfahren geht auf die kritischen Ansätze der feministischen Literaturkritik und feministischer Wissenschaftstheorien aus den siebziger Jahren zurück sowie auf einige kritische Studien zum Nationalsozialismus, allen voran Theodor W. Adornos Studien zum autoritären Charakter.
In einem ersten Schritt analysiere ich aggressive, frauen- und fremdenfeindliche Textstellen, Bilder, stilistische Eigenheiten der Autorin oder des Autors aus dem Umfeld des nationalsozialistischen oder früheren Gedankenguts. Nach der Beschreibung solcher Elemente und Strukturen kann man sich Texten zuwenden, die nicht derart eindeutig aus einem totalitären Umfeld stammen, aber doch Irritationen wecken. Ich untersuche nun, ob auch dort aggressive Textstellen zu finden sind, ähnlich, wie man Obst auf faule Stellen untersucht. In gleicher Weise verfahre ich daraufhin mit den Texten der Autorinnen aus dem Umfeld der so genannten Matriarchatsforschung.
Die bisherigen Kritiken an der so genannten Matriarchatsforschung haben sich an ihrem wissenschaftlichen Wahrheitsgehalt abgearbeitet.1 Es gibt Versuche, ihr mit psychologischen und strukturphilosophischen Analysen beizukommen2, ebenso existieren Abhandlungen zu einem, wie dort dargestellt, »versteckten« Antisemitismus in den Arbeiten von Heide Göttner-Abendroth, Gerda Weiler u.a.3 Antisemitismus »versteckt« sich beispielsweise direkt in den Werken anerkannter und berühmter Mythologen. So schreibt Joseph Campbell in Der Flug der Wildgans in Bezug auf alle drei großen monotheistischen Religionen des Vorderen Orients, die für ihn eindeutig negativ besetzt sind: »Alle, wie man bemerken wird, Semiten!«4 Die Matriarchatsforscherin Heide Göttner-Abendroth soll juristisch gegen eine Studentin vorgegangen sein, die den Antisemitismusvorwurf gegen sie und andere Matriarchatsforscherinnen auf einer ökumenischen Frauentagung erhob.
Aus den Reihen sozialistisch orientierter Feministinnen kam dezidierte Kritik an den restaurativen Inhalten der Matriarchatsliteratur bereits in der Mitte der siebziger Jahre auf. Sie fürchteten, dass konservative Vorstellungen von den Geschlechterrollen fröhliche Urständ feiern könnten und fragten pragmatisch nach dem politischen Nutzen solcher Theorien. Bei den »Vätern« der Matriarchatsforschung, wie Johann J. Bachofen konstatierten sie: »Die Moral des Bachofen’schen Mythos ist die Unüberwindbarkeit der männlichen Herrschaft.«5
Aber um es noch einmal zu wiederholen: In der vorliegenden Analyse geht es nicht um das »Stimmt’s oder stimmt’s nicht?« der Matriarchatsforschung, sondern um die darin vorkommenden autoritären und menschenverachtenden Elemente.
Das Analyseverfahren, dem ich die Texte dieser Studie unterziehe, ist in den allermeisten Fällen ein hermeneutisches, das heißt, es bezieht sich rein auf Bedeutungen der gebrauchten Wendungen und Textstrukturen. Mein Zurückgehen auf diese Methode verlangt, wieder einmal genauer hinzusehen, hinzulesen und – so weit dies überhaupt möglich ist, ohne Ideologien, Theorien und Vorstellungen im Kopf, die den Blick trüben könnten – Texte wörtlich zu nehmen. Die Stufen einer solchen Interpretation umfassen das hermeneutische Herangehen und die Suche nach direkten Aussagen. Ich führe keine Deutungen von Metaphern durch, interpretiere keine Bilder, mache keine biografischen oder psychologischen Interpretationen des Geschriebenen. Am Anfang steht allein die Bereitschaft, sich von bestimmten Textstellen irritieren zu lassen, so, wie einen beispielsweise bestimmte Rede- oder Verhaltensweisen irritieren, nachdenklich machen. Solche irritierenden Textpassagen nehme ich heraus, beschreibe und zitiere sie ausführlich, stelle ihren Kontext dar und deute sie in diesem Zusammenhang. Zu dieser Art Interpretation kommen Wortanalysen, Begriffsdefinitionen und die Darstellung der einzelnen Wortbedeutungen hinzu, wie zum Beispiel bei der Analyse des Wortes »Hass« im Abschnitt zu Christa Mulacks Buch Natürlich weiblich. Dabei darf man nicht übersehen, dass Worte im Laufe der Zeit ihre Bedeutung verändert haben. Diese Überlegung trifft insbesondere auf die Kapitel zu, die sich mit älteren Texten befassen.
Ich beginne im Kapitel »Die Fehler der Mütter« mit der Analyse von Matriarchatstheoretikerinnen aus den zwanziger und den fünfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts. Danach betrachte ich in dem Kapitel »Die Traditionen der Väter« zwei Autorinnen, die sich nach den wissenschaftlichen Ansprüchen der Ur- und Frühgeschichte richteten. Dass auch wissenschaftliche Verfahrensweisen nicht vor eurozentrischem Überlegenheitsgefühl respektive der Rezeption völkischer Inhalte schützt, wird in den Abschnitten zu Marija Gimbutas und Marie König aufgezeigt.
Im Teil »Die Sünden der Töchter« wählte ich als Beispiele zwei der auffallendsten autoritären Texte aus. In diesem Zusammenhang interessierte mich auch die Rezeptionsgeschichte einiger Autorinnen, denn ein Guru kommt bekanntlich selten allein. Die Rolle seiner Anhänger in diesem Spiel ist mindestens ebenso wichtig.
Das Kapitel »Der Größenwahn der Enkelinnen« befasst sich dann mit zwei Autorinnen, die eher dem Umfeld spiritueller Lebenshilfe zuzurechnen sind.
Textkritisch wurden die Matriarchatstheorien bisher noch nicht untersucht. Lag es am Mythos von der »friedfertigen Frau«, dass man den Autorinnen, noch dazu feministischen, keine aggressiven Texte, totalitären Bilder und inhumanen Vorstellungen zutraute?
Settings beachten
Neben der rein textkritischen Analyse soll das Augenmerk auf das »Setting« einer Situation gerichtet werden, in der Vortrag gehalten, ein Ritual veranstaltet wird. Dieses Setting wird in der Regel bewusst gestaltet, um kritische Fragen, klare Abgrenzungen und Widerstand gegen seltsame Formen eines Rituals zu verhindern.
Die Auswahl der Settings richtete sich nach ihrem Zusammenhang mit den hier besprochenen Texten. Texte und Settings ergänzen sich. Mal wurde ich durch ein bestimmtes Setting auf die Texte aufmerksam, mal aber auch umgekehrt. Als früher selbst »Matriarchatsbegeisterte« und Zeitgenossin einiger Matriarchatsautorinnen nahm ich über längere Zeiträume hin auch an ihren Ritualen teil, von denen einige im Kapitel »Die Sünden der Töchter« Erwähnung finden.
Es gibt bis heute keine statistischen Erhebungen oder gruppensoziologischen Untersuchungen zu Struktur, Aufbau und Verlauf abgehaltener Rituale und zu autoritären Strukturen, wie sie sich innerhalb eines solchen Ritualzusammenhanges manifestieren. Trotzdem schildern Menschen im Rückblick ihre Gefühle, ihre Ängste, ihre seelischen und körperlichen Abhängigkeiten im Rahmen solcher Abläufe. Die Darstellung von Ritualsettings kann als Vorwurf gegenüber den anleitenden Frauen verstanden werden. Hierbei darf die Rolle der »nur mitmachenden« Teilnehmerinnen jedoch nicht übersehen werden. Es ist mir bewusst, dass auch jede andere beteiligte Person – und dabei nehme ich mich nicht aus – dem Prinzip der Eigenverantwortlichkeit gemäß ihre Rolle bei der Unterstützung oder Billigung hier beschriebener Strukturen hinterfragen muss.
Das Ritualefeiern mündet in vielen Fällen in eine Form von Suchtverhalten. Man sollte froh sein, dergleichen überwunden zu haben. Die Aufnahme dieser durchaus brisanten Thematik in das vorliegende Buch ist als ein Beitrag zur Prävention gedacht, ein Versuch, Kriterien zu erstellen, die für Frauen in frauenbestimmten Ritualen hilfreich sein sollen, aber durchaus auch verallgemeinert, auf religiöse, sich psychotherapeutisch gerierende Gruppen oder anderweitig spirituelle Aktivitäten, auch in gemischtgeschlechtlichen Zusammenhängen, übertragbar sind.
Das Matriarchat als rückwärtsgewandte Utopie
Matriarchatstheorien sind Interpretationen archäologischer Funde aus der Vorgeschichte und archaischer Mythologietexte aus der Frühgeschichte. Insofern transportieren sie Werte und Menschenbilder, die Ausdruck der Gedanken und Obsessionen des 19. bis 20. Jahrhunderts im aufgeklärten Europa sind: allen voran das Bild der auf allen gesellschaftlichen Ebenen überlegenen Frau in Verbindung mit hierarchiefreien Gruppen- oder Gesellschaftsstrukturen, eingebettet in die pflegliche Kommunikation mit der Natur. Die Überlegenheit der Frau wurde spirituell oder – später – biologisch erklärt. Aus ihr resultierte sowohl der pflegliche Umgang mit anderen Menschen als auch mit der Natur.
Aus diesen Kernbehauptungen heraus entwickelten sich die verschiedensten matriarchatstheorischen Strömungen, die sehr unterschiedliche Schwerpunkte hatten und haben. So liegt allen diesbezüglichen Texten, die im Rahmen der Neuen Frauenbewegung ab 1970 verfasst wurden, ein grundsätzlich positiv besetztes Frauenbild zugrunde.
Wie aber wird es interpretiert? Wie wird die Rolle von Frauen gesehen, wie ihr Wesen? Wie wird es bewertet? Was nur wenig bekannt ist: Sowohl während als auch vor der Zeit des Nationalsozialismus befassten sich einige Autoren ebenfalls mit diesem Thema. Und in ihren Texten finden sich andere Vorstellungen und Bewertungen zur Rolle der Frauen und ihrem genuinen Wesen. Außerdem gibt es eine Art Matriarchatsliteratur des ausgehenden 19. und des beginnenden 20. Jahrhunderts. Hier sind die Namen Johann J. Bachofen und Sir Galahad die geläufigsten. Bei ihnen findet sich abermals ein anderes Frauenbild.
Es geht hier um die tradierten autoritären und menschenverachtenden Textstrukturen und Inhalte, die auch in der modernen Matriarchatsliteratur auftauchen. Die Auseinandersetzung mit wissenschaftlicher, philosophischer und auch belletristischer Literatur des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts zeigt, in welch erschreckendem Ausmaß rechtslastige, völkische, antisemitische und imperialistische Gedanken Allgemeingut waren. Davon blieben die ersten Matriarchatstheorien ebenso wenig verschont wie beispielsweise die Ethnologie, die Mythen- und Volkskunde sowie die Ur- und Frühgeschichte.
Die Idee eines Matriarchats als Gesellungsform und weiblicher Überlegenheit als individueller Eigenschaft umfasst ein paar Grundgedanken, die sich im Laufe von etwa 150 Jahren herausbildeten. Man kann diese Aussagen, was Matriarchate sein sollen, in etwa prähistorischen Epochen zuordnen. Aus dieser Zuordnung ergeben sich dann verschiedene wissenschaftliche Methoden, mit denen man diese Aussagen auf ihren Wahrheitsgehalt hin prüfen kann. Im Folgenden werde ich diese Grundgedanken der Matriarchatstheorien überblicksmäßig darstellen, um während der Lektüre der weiteren Kapitel eine bessere Orientierung bezüglich der immer wieder erwähnten Inhalte der Matriarchatstheorien zu ermöglichen:1
1. Geschlechtsunterschiede
- Es gibt eine natürliche Überlegenheit der Frau.
- Frauen können/konnten sich durch Parthenogenese fortpflanzen. Methoden der Überprüfung: Physiologie, Biologie, Primatologie, Anthropologie
2. Paläolithikum
3. Neolithikum
- Schon in frühester Zeit hat es Matriarchate oder frauenzentrierte Zusammenhänge gegeben.
- Es gibt eine ungebrochene Kontinuität von Symbolen, sie gelten immer und zu allen Zeiten.
- Überprüfung durch: Anthropologie, Paläontologie, Verhaltensforschung, Primatologie, Urgeschichte
- Rituale waren ganzheitliche Erkenntniszusammenhänge und spiegelten die historische Gesellschaftsstruktur.
- Matriarchate waren stets egalitär und demokratisch organisiert.
- Matriarchate pflegten eine naturverbundene Lebensweise.
- Überprüfung durch: Ur- und Frühgeschichte, Archäologie, Ethnopsychoanalyse, Agrarwissenschaften
4. Metallzeiten
- Es gab ein weltweites Matriarchat.
- Es gab Amazonen.
- Überprüfung durch: Archäologie, Kunstgeschichte, Altphilologie, Ur- und Frühgeschichte, Montanwissenschaften
5. Frühgeschichte, Mittelalter
- Spuren vom Matriarchat finden sich in Sagen und Märchen wieder.
- Überprüfung durch: Philologie, Mediävistik, Geschichte, Kunstgeschichte
6.