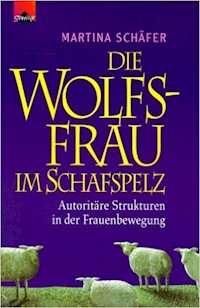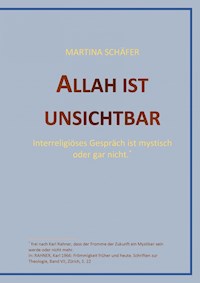
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
"Allah ist unsichtbar", Jehovas Namen unaussprechlich, Gott verborgen. Dieses "Überunaussprechliche", wie es der griechische Philosoph Dionysius Areopagites ausdrückte ist die wichtigste Gemeinsamkeit der drei grossen Weltreligionen, was oft übersehen wird. Auch der Prophet Mohammed war kein unbeschriebenes Blatt, sondern lebte im weltläufigen, gebildeten, städtischen Umfeld seiner Frau, in dem sowohl Inhalte anderer Religionen als auch die gängigsten Philosophien seiner Zeit studiert wurden. Auf einer solchen Basis jüdischer, christlicher und anderer monotheistischer Strömungen seiner Zeit empfing er seine Offenbarungen und begründete den Islam. Aus diesen Erkenntnissen heraus entwickelt die Autorin inhaltliche und methodische Hinweise für einen nachhaltigen, interreligiösen Dialog zwischen Islam und Christentum, der auch praktische Überlegungen mit einschliesst, wie z.B. die Empfehlung einer doppelten Religionszugehörigkeit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 352
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Master-Arbeit
Apophatische Theologie und Poesie bei Dionysius Areopagites als Basis eines interreligiösen Dialogs mit dem Islam
unter der Leitung von Prof. Dr. Dr. Mariano Delgado
Institut für das Studium der Religionen und den interreligiösen Dialog
Prof. Dr. Franz Mali
Assoziierter Professor für griechische Patristik und Sprachen des christlichen Orients
Departement für Patristik und Kirchengeschichte
P. Dr. Christian M. Rutishauser SJ
St. Gallen, Februar 2014
Eingereicht an der Theologischen Fakultät Freiburg / Schweiz von Dr. Martina Schäfer
Multergasse 35
9000 St. Gallen
Telefon: 071 223 31 53
Mail: [email protected]
Dieses Werk ist in all seinen Teilen urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Ungeachtet der Sorgfalt, die auf die Erstellung von Text, Abbildungen und Programmen verwendet wurde, können weder Verlag noch Autor für mögliche Fehler und deren Folgen eine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung übernehmen.
Die in diesem Werk wiedergegeben Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. können auch ohne besondere Kennzeichnung Marken sein und als solche den gesetzlichen Bestimmungen unterliegen.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter https://portal.dnb.de abrufbar.
© Martina Schäfer 2018
ISBN 978-3-7450-8284-5
Verlag:
KIRK
Krisenintervention für interreligiöse und interkulturelle Konflikte
www.martinaschaefer.ch
Druck: epubli – ein Service der neopubli GmbH, Berlin
Widmung
In dankbarer Freundschaft für Dr. Hisham Maizar
Präsident des Schweizerischen Rates der Religionen
Präsident der Förderation Islamischer Dachorganisationen in der Schweiz (FIDS)
Präsident des Dachverbandes Islamischer Gemeinden der Ostschweiz und des Fürstentums Liechtenstein (DIGO)
10. November 1941 – 14. Mai 2015
Morgens ging ich in den Garten,
eine Rose mir zu pflücken,
heimlich und in Furcht,
der Gärtner könnte mich dabei erblicken.
Doch es waren seine Worte
köstlich über mein Erwarten:
«Nicht die Rose nur allein, ich
schenke dir den ganzen Garten!»
Mevlana Rumi (1207–1273)
0 Einleitung
Interkulturelle Kommunikation muss mit den Werten umgehen, welche hinter dem Reden und Verhalten von Menschen, mit denen ein Gespräch geführt werden soll, stehen.
Die meisten dieser Werte sind unbewusst, vom Gegenüber nicht so leicht zu durchschauen und oft hoch emotional besetzt. Insofern kommt im Rahmen interkulturellen Bemühens der interreligiösen Kommunikation eine ganz besondere Bedeutung zu: Sind doch die Religionen im guten wie im schlechten Sinne Quelle und Legitimation von Werten, ethischen Vorstellungen und moralischen Anforderungen.
Man kann die andere Kultur, die andere Religion nun als das ganz Andere, Fremde, gar Bedrohliche sehen, was sicherlich für eine befriedigende Kommunikation nicht sehr sinnvoll ist, wie ich im Kapitel 5, das den Methoden interkultureller Kommunikation gewidmet ist, aufzeigen werde. Man kann aber auch von möglichen oder erhofften Gemeinsamkeiten ausgehen, was allerdings die Gefahr der Vereinnahmung des/der anderen in sich birgt, was ich ebenfalls in diesem Kapitel ausführen werde.
Eine dritte und sicherlich sehr fruchtbare, Möglichkeit wäre, sich auf die gemeinsamen Wurzeln verschiedener Religionen zu beziehen, die dann mit den bearbeiteten Religionen etwa so viel und so wenig zu tun haben, wie das eiszeitliche Prszewalskiperd mit einem Arabischen Vollblut oder einem Zebra. Aber auch die Differenz zwischen Zebra und Vollblut bleibt auf diese Weise erkennbar, wobei im Rahmen der vorliegenden Arbeit Zebra und Vollblut für das Christentum und den Islam stehen, das Urpferd für die beiden Religionen gemeinsame Inspiration durch die griechische Philosophie.
Eine solche Vorgehensweise orientiert sich also eher an Strukturen, denn an Inhalten, sie fragt beispielsweise nicht so sehr danach, WAS denn nun z.B. offenbart wird, sondern eher, ob überhaupt und wenn ja, WIE sich diese Offenbarungsformen voneinander unterscheiden.
Während religiöse Inhalte oft sehr emotional besetzt und in einem Glaubenskanon festgelegt sind, der nicht hinterfragt werden darf (z.B. das christliche Glaubensbekenntnis «Ich glaube an Gott … und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn …», ist es eine Struktur weniger.
Insofern liegt dieser Arbeit z.B. der strukturelle Unterschied zwischen der Art, wie man über das Transzendente reden könnte, zugrunde: Der zwischen negativer (apophatischer) und positiver (kataphatischer) Theologie, wobei hier nicht nur eine christliche Theologie gemeint ist, sondern auch die vor- oder nichtchristlicher Religionen, respektive Spiritualitäten. Eine kurze Einführung und Begriffsbestimmung in apophatische und kataphatische Theologie ist von daher das Thema des 1. Kapitels.
Bereits bei einer oberflächlichen Beschäftigung mit Philosophien und Religionen des östlichen Mittelmeerraumes fällt ihre allgemeine strukturelle Ähnlichkeit ins Auge. Am stärksten die Tatsache, dass es sich z.B. in der Zeit der ersten Jahrhunderte n.d.Z. vor allen Dingen um monotheistische Religionen handelt. Doch auch beim näheren Hinsehen folgt ein «Aha-Erlebnis» dem anderen. Mir persönlich ging es so, als wir im Rahmen der lectio spiritualis Übungen unseres Studienganges zur Christlichen Spiritualität Origenes und die Wüstenväter lasen, denn seit einigen Jahren engagierte ich mich insbesondere im Rahmen des interreligiösen Dialogs mit dem Islam und kannte die wichtigsten Inhalte dieser Religion sowie den Koran und was gläubige Muslime mit ihm verbinden.
So wurde ich also auch auf die neueren Forschungen von z.B. NEUWIRTH und anderen hingewiesen und referiere im 2. Kapitel dieser Arbeit die gemeinsamen Traditionen und Auseinandersetzungen der monotheistischen Religionen des Vorderen Orients mit neuplatonischer Philosophie, mit der sich alle monotheistischen Religionen des letzten halben Jahrtausends vor und des ersten halben Jahrtausends n.d.Z. auseinandersetzten.
Ein zweites «Aha-Erlebnis» hatte ich, als wir während des besagten Studienganges in Biografie und Texte des Dionysius Areopagites eingeführt wurden. Hier lernte ich, dass die mir sehr bekannte Haltung islamischer Gläubigkeit, jegliche Personalisierung Gottes und auch die Idee zweiseitiger Gespräche mit diesem Gott, wie das Judentum sie kennt, abzulehnen, in der christlichen Theologie «apophatisch» genannt wird.
Da ich ausserdem gerne Kriminalromane lese (die Struktur von Kriminalromanen war sogar ein Thema meiner germanistischen Dissertation), faszinierte mich natürlich diese unbekannte Biografie des Dionysius Areopagites – auch als gutes Zeichen für die Begrenztheit von Wissenschaft, als Appell, niemals alles wissen zu können und diese Grenzen unseres Erkenntnisvermögens zu achten – ebenfalls eine Art «apophatische» Haltung der Bescheidenheit.
Zum Dritten faszinierte mich als Literaturwissenschaftlerin der Aspekt des Poetischen und der Sprachübersteigerung, der ja unweigerlich mit apophatischem Denken verknüpft ist.
Dionysius Areopagites Leben und Werk ist das Thema des 3. Kapitels, wobei in der Beschäftigung mit ihm noch die Frage nach den Werten, welche ein Philosoph, eine Autorin, ein Religionsstifter, etc. vertritt, aufkam und in welchem Verhältnis diese Werte zur umgebenden Kultur stehen: Widersprüchlich? Antwort auf generelle Fragestellungen der Umgebung? Ein Dorn im Auge der Mächtigen? Opium für das Volk?
Nachdem mit diesen ersten drei Kapiteln die Grundlage für das Aufeinanderbeziehen von Islam und Christentum unter dem Aspekt einer apophatischen Theologie und eben auch Poesie gelegt wurde, ist das 4. Kapitel dann Leben und Werk des Propheten Mohammed gewidmet, wobei ich in diesem Kapitel auch die Gelegenheit ergriff, ein allgemeines historische Bild etwa der ersten Jahrtausendhälfte im Nahen Orient darzustellen sowie den Versuch zu starten, eine mögliche chronologische Abfolge für die orale Tradition von frühen Hymnendichtern bis Mohammed zu erstellen. Letzteres bitte ich als Gedankenanregung für vertiefte altphilologische und orientalistische Forschungen zu nehmen und nicht als wissenschaftlich abgesicherte Theorie.
Aus den Kapiteln 2–4 konnte ich Inhalte und Strukturelemente herausdestillieren, passende Elemente für einen interreligiösen Dialog auf Basis apophatischer Einstellungen, die mir als Grundlage für die weitere Arbeit dienten.
Kapitel 5 befasst sich also, wie bereits gesagt, mit Methoden und Instrumenten interkultureller und interreligiöser Kommunikation und einer daraus resultierenden Auswahl aus den Inhalten und Strukturelementen der vorherigen Kapitel, da ich natürlich, aus Gründen des Umfangs einer solchen Masterarbeit, nicht sämtliche Aspekte besprechen konnte.
Kapitel 6 befasst sich dann mit einigen dieser Themen und wie sie für den interreligiösen Dialog zwischen Islam und Christentum nutzbar wären.
Im 7. Kapitel weite ich in abschliessender Weise noch einmal den Blick über das engere Thema meiner Arbeit hinaus und propagiere die «apophatische» Empfehlung für eine allgemeine, gesellschaftlich-kommunale Ebene der Auseinandersetzung zwischen verschiedenen Religionsgemeinschaften: Lieber gemeinsam zu feiern statt zu reden und für die individuelle Ebene der interreligiösen Begegnung eine «doppelte religiöse Staatsbürgerschaft».
1 Apophatische und kataphatische Theologie – Begriffsbestimmung
1.1 Apophatische Theologie
Apophasie bedeutet, dass «Gott» oder «das Eine» des Platonismus letztlich nicht zu erkennen oder zu begreifen ist. Woraus folgt, dass «Gott» eben auch nicht beschreibbar, nicht darzustellen ist.[1]
Eine Erkenntnis, welche die zahllosen Abbildungsverbote im Laufe der Geschichte monotheistischer Religionen konsequent umsetzten.
Gleich zu Anfang wage ich aber auch, zu behaupten, dass apophatische Theologie per definitionem das Wesen von Mystik und Spiritualität ausmacht – ganz im Sinne McGINNs, der in seinem ersten Band der Geschichte der «Mystik im Abendland» schreibt: «Negative bzw. apophatische Theologie wird historisch wie systematisch den Hauptteil unserer Geschichte der Spiritualität ausmachen.»[2]
Wie ich weiter unten ausführlicher darstellen werde, treten gedankliche Vorläufer für die Idee des Apophatischen, das heisst, ein Bewusstsein der letztlichen Unbeschreibbarkeit von Transzendenz, bereits in der griechischen Philosophie etwa ab dem 4. Jahrhundert v.d.Z. auf.
Sie ist ausserdem, meiner Meinung nach, der logische Schritt, welcher sich aus der Entwicklung von polytheistischen Religionssystemen zu monotheistischen ergibt.[3]
Apophatische Theologie ist, zum Dritten, die klösterliche Schwester der weltlichen apophatischen Philosophie des Neuplatonismus oder, wenn man so will, die sakrale Variante, ein spiritueller Ausweg aus den rationalistischen Höhenflügen, welche ansonsten zum Agnostischen oder gar Atheistischen führen würden – was ja nun mal nicht Jedermanns oder Jederfraus Sache ist.
Ebenso wie umgekehrt: Philosophie als Rettung aus einem entweder kindlich-naiv, beschreibenden oder sogar allzu abstrakt ab geschwebten Gottesbild. [4]
Spiritualität oder Mystik (ich erlaube mir, der Einfachheit halber diese beiden Begriffe, wie McGINN in seiner Einleitung[5] synonym zu verwenden[6]) ist dann in einem solchen Zusammenhang eigentlich der Versuch, sich dem Unnennbaren und Unbeschreibbaren doch irgendwie und irgendwann annähern zu können, wenn nicht sogar, sich mit diesem «Einen», mit «Gott» vereinen zu können. Mystik zu betreiben bedeutet also, Wege zu begehen, «Lebenswege»[7], Stufen, «Himmelsleitern»[8] zu ersteigen oder weitere Bemühungen des Erreichens dieses Unnennbaren, sich mit dieser sakralen Unbegreiflichkeit zu verbinden.
Gott ist das nicht Erkennbare, niemals vollständig zu Erfassende, woraus dann folgt, dass Gott auch nicht beschreibbar ist, nicht auszudrücken.
McGINN unterscheidet nun noch, ob das für alle Menschen gilt oder nur für bestimmte, nur zu einer gewissen Zeit oder jederzeit, usf.,[9] was ich hier aber einmal dahin gestellt lasse.
Wenn Gott also nicht beschreibbar ist, denn jede Beschreibung würde dieses besondere zu Beschreibende Unendliche wieder einschränken, nicht definierbar, kann ich mich ergo einer Erkenntnis über Gott nur annähern, indem ich ausdrücke, was Gott n i c h t ist. Die mögliche Annäherung geschieht durch die Negation von Eigenschaften, weshalb man in Verbindung mit der Apophasie auch von Negativer Theologie spricht.
Auch diese Negation muss sich allerdings in sich selber wieder durch ihr Gegenteil auflösen, sonst wäre eine Negativbeschreibung (quasi durch die Hintertüre des Ausschlussverfahrens) doch wieder eine positive.
Also beispielsweise: «Gott ist weder Mann» – notwendig muss nun folgen: «noch Frau noch Kind». Sonst wäre er ja das Ausgeschlossene.
Oder auch: «Gott ist nicht in der Welt» – das würde den Begriff wieder beschränken, also muss es zwingend weiter heissen: «und auch nicht ausserhalb».
«Gott ist weder endlich noch unendlich, übermächtig noch ohnmächtig, weder Geist noch Materie, … usw.».[10]
Das bedeutet weiterhin, dass paradoxe Sprachspielereien, poetische Übersteigerungen oder eben das Verstummen zum sprachlichen Repertoire der Apophasie dazu gehören und übrigens Musik für apophatische AutorInnen ebenfalls ihre besondere Bedeutung hat.
Apophatisches Sprechen ist per definitionem Auflösung von Sprache und vom Misstrauen gegen ihre Ausdrucksfähigkeit getragen.
Apophatisches Sprechen ist ergo auch ein sehr modernes Sprechen – modern im Sinne der literarischen Strömung des Expressionismus, dessen Zweifel an der Sprache dann im Extrem zum Silbenstottern oder Dadaismus führte. Oder in einer anderen Expressionismusrichtung zu eruptiven Ausdrücken reiner Gefühle und Leidenschaften in Wort, Bild und teilweise auch in der Musik.
1.2 Kataphatische Theologie
Das Gegenteil der apophatischen, der negativen Theologie ist sodann die kataphatische oder positive Theologie. Diese erscheint auf den ersten Blick dem Denken einfacher, denn mit ihrer Hilfe wird versucht, sich durch das Anhäufen von Beschreibungen, Zuschreibungen, substantivierten Tätigkeiten, etc. einem Verständnis dessen, was Gott sein könnte, anzunähern.
Allerdings ist dieses Projekt natürlich von vorne herein mehr oder minder ebenso zum Scheitern verurteilt wie die negative Theologie, denn das Transzendente zeichnet sich ja nun gerade durch das Überschreiten, das Jenseitig-von-Allem-Sein, aus. Eine fast mathematische Frage wäre dann, ob denn eine unendliche Aufzählung positiver Beschreibungen oder negativer Paradoxien Gott darstellen könnte?
Ein Gedanke, der sich beispielsweise im Islam durch die Aufzählung der 99 Namen Allahs ausdrückt. Wobei die Zahl «99» symbolisch gemeint ist und für die eigentliche Unendlichkeit beschreibbarer Möglichkeiten steht: Es könnten auch 999 Namen sein oder 9999 – eine vollständige Beschreibung Gottes kann nie erreicht werden.
Positive Theologie ist jedoch in allen Religionen da von Nöten, wo Gott ansprechbar sein soll, wo die Gläubigen die Möglichkeit brauchen, eine vorstellbare Gestalt zu preisen oder um Gnaden zu bitten. Göttlichkeit zum Anfassen, zur Vorstellung, einen Gott der Phantasie … gleich kommen Heiligenbilder, Prozessionen, Statuen von Göttinnen und Göttern, Bilder, die «das Volk» sich machen muss, soll es glauben können – was immer auch das erste Gebot, die zweite Sure befehlen mögen. Weshalb man auch von «affirmativer» Theologie spricht.
Hier hinein gehört auch die Vorstellung eines persönlichen Gottes, wie es Christentum und Judentum pflegen, eine Vorstellung, welcher der Islam, wie ich weiter unten darstellen werde, eher ablehnend gegenüber steht oder die verschiedenen Vorstellungen von Offenbarung in den drei monotheistischen Religionen: Als konkrete Gesetzessammlung, als Mensch, als Buch.
Origenes (185 Alexandria–254 in Caesarea) setzte diese Erkenntnis sehr pragmatisch in seinen Anleitungen zum Gebet um[11] und entwickelte entsprechend verschiedene Arten der Gebetsweisen.[12]
Positive Theologie ist die Einschränkung des Göttlichen auf ein menschliches Mass – um der Menschen willen – sie ist Pastorale, nicht Philosophie, Impressionismus, lumen de lumine, l'art pour l'art wie die negative, apophatische Theologie.
Von daher verwendet kataphatisches Sprechen unterschiedliche Methoden des Ausdrucks: Vergleiche, Allegorien, Gleichnisse, weitere analoge Redeweisen, Vergleiche und Gleichnisse, Anhäufungen, Metaphern, etc. Kataphatische Texte, besonders wenn sie Erzählungen oder Berichte sind, ziehen Deutungen nach sich, brauchen den allegorischen Sinn, um so zu den Ausdeutungen der heiligen Texte zu gelangen.
Über die Jahrhunderte hinweg entwickelten sich z.B. im Christentum Theorien, Methoden der «geistlichen Sinne», mit deren Hilfe Texte stufenweise gedeutet werden konnten.[13] Da gibt es den reinen «Wortsinn», welcher das Geschriebene wort-wörtlich nimmt, hermeneutisch vorgeht in seiner Interpretation, philologisch den Ableitungen hinterher spürt, Origenes nennt ihn den «historischen Sinn», mit dessen Hilfe das Mythische in Geschichte und Tradition, also letztlich in Identität und Glaube umgewandelt wird. Eine weitere Deutungsmethode ist die «allegorische», für die eben «eine Rose» nicht unbedingt nur «eine Rose»[14] ist – usw.
Beginnt man – so RUH in seinem Kapitel zu Dionysius Areopagites – in apophatischer Rede von «unten», also bei denjenigen Zuschreibungen, welche «Gott» am fernsten sind, startet kataphatisches Sprechen «oben», bei jenen Eigenschaften, welche «Gott» am ähnlichsten sind [15]. Und wie sich zwei parallele Geraden doch im Unendlichen schneiden, geht auch kataphatisches Sprechen und Beten in apophatisches über.
Wie Dionysius Areopagites diese auf- und absteigende Bewegung als Methode des individuellen Weges darstellt und diesen gleichzeitig in die Ordnung himmlischer und irdischer Hierarchien hinein stellt, werde ich weiter unten erläutern.
2 1000 Jahre «apophatische Theologie» in der griechischen Philosophie
Wie bereits im Abschnitt 1.1. erwähnt, ist meiner Meinung nach apophatisches Denken und Reden eine logische Folge, besser ein zwingendes Ergebnis bestimmter philosophischer und religiöser Entwicklungen in einer Kultur.
In den folgenden Abschnitten werde ich deshalb am Beispiel der griechischen Philosophie solche Entwicklungsschritte hin zur Apophasie darstellen.[16]
2.1 Platon
Plato lebte von 429 bis 347 v.d.Z. in Athen. Er war Schüler, Begleiter und Biograf des grossen, illiterarischen Sokrates, welcher sein Wissen, seine philosophischen Methoden und die daraus resultierenden Erkenntnisse ausschliesslich mündlich weiter gegeben hatte.
Insbesondere in vier Texten hat Platon seine grundsätzlichen Voraussetzungen und Erwägungen zu dem, was man dann als Apophasie bezeichnen könnte, niedergelegt:
im so genannten «7. Brief»[17]
mit der «Rede an Diotima» im «Symposion»[18]
in der «2. Rede an Phaidros»
und im berühmten «Höhlengleichnis» aus der «Politeia».
In diesen genannten Texten entfaltet Plato die Voraussetzungen und Zustände einer apophatischen Theologie.
2.1.1 Der 7. Brief[19]
Ausgelöst wurde dieses Schreiben durch die Ermordung eines Freundes von Platon, der sich gegen die Tyrannenherrschaft in den griechischen Kolonien auf Sizilien gestellt hatte. Mehrmals hatte dieser Dion, welcher der Philosophenschule Athens nahe stand, Platon nach Syrakus gerufen, damit er dort seine philosophische und politische Ethik dem Tyrannen näher bringe.
Das Unterfangen scheiterte und die Akademie geriet sogar in den Ruf, mit Umstürzlern gemeinsame Sache zu machen.
All diese Ereignisse warfen die Frage auf, welche Voraussetzungen eine gute Regierungsform brauche und wie die polis dahingehend reformiert werden könne. Damit berührte Platons Fragestellung auch ethische und religiöse Aspekte, denn die Seele, so Platon, sehnt sich nach dem absolut Guten, denn sie ist in der Welt der realen Erscheinungen nur im Exil, ihr nous ein Element dieses Guten, der Welt der Ideen, das dorthin zurück strebt.
Der Weg zurück führt über Stufen der Erkenntnis – als theoria oder Kontemplation bezeichnet. Voraussetzung der Kontemplation ist die katharsis, die Reinigung oder Askese. Letzteres ein Begriff, welcher im griechischen Kontext immer eine sportliche Konnotation im Sinne eines «Trainierens» dieser Läuterung hat.
Platon trennt also streng zwischen der Welt der Erscheinung und der Welt der Ideen.[20]
2.1.2 Die «Rede an Diotima» aus dem «Gastmahl» (Symposion)[21]
Den Königsweg zurück in die Welt des absolut Guten beschreibt Platon insbesondere im Dialog zwischen Diotima und Sokrates, welcher auch oft «Von der Liebe» übertitelt wird.
Das absolut Gute ist natürlich auch das wahre Schöne, nach dem die Seele sich sehnt. Der Gegensatz zu dieser Idee der Schönheit ist die Idee der Hässlichkeit, die der Schönheit diametral entgegen gesetzt ist, so weit entfernt, wie die Erde dem Himmel, die Welt der Erscheinungen der Welt der Ideen/Formen, die der blossen Meinungen jener des wirklichen Wissens, der Zeitlichkeit der Unsterblichkeit, usf.
Die Mittlerin zwischen der Welt des Hässlichen und der der Schönheit ist die Liebe/eros, die die Seele sukzessive weiter zieht. Bereits die Liebe zu einem schönen Körper stellt eine Vorstufe dieses Weges dar.
Liebe bedeutet aber nicht alleine, Schönes besitzen zu wollen, sondern auch, Schönes schaffen zu können.
Auf den folgenden Stufen wendet sich das Streben abstrakteren Formen der Schönheit zu: Der schönen Seele, Schönheit der Erkenntnis oder ethischer, sozial umgesetzter (politischer) Tugend und Schönheit.
Schlussendlich – aber auch auf allen anderen Stufen zuvor schon – taucht wie ein plötzlicher Lichtstrahl die Idee des Schönen selber auf: Die liebende Seele kann die göttliche, vollkommene Schönheit sehen, sich wirklich tugendhaft verhalten oder im Angesicht des wahren Schönen Schönes schaffen.
Man könnte sich darüber streiten, ob man diesen Moment bei Platon als eine Art philosophische Vorstufe zum Gnadenbegriff der christlichen Theologie sehen könne. Mit der christlichen Vorstellung von Gnade hat dieser Moment den Charakter des plötzlichen Aufscheinens gemeinsam sowie die Erfahrung, dass alle Eigenaktivität der Seele auf ihrem kontemplativen Weg schlussendlich des «Funkens» von Aussen bedarf – sei der nun «göttlich» oder «inspirativ».
2.1.3 Die zweite Rede des Sokrates an Phaidros[22]
In dieser Rede entwickelt Sokrates im Bild eines von Rossen gezogenen Wagens mit dem Wagenlenker jene Vorstellung von Seele, wie sie in den folgenden Zeiten die Philosophie aber auch die Vorstellungen der Wüstenväter, beispielsweise die des Wüstenvaters Evagrios Pontikos (345 in Anatolien–399 in der Kellia), prägen sollte.
In diesem Bild ist die Seele ein Wagen, so Platon, den entweder die Vernunft souverän lenkt oder von dem sie gelenkt, mitgerissen, wird.[23]
Die Gesamtseele, das Selbst, ist unterteilt in «Seele» und «Intellekt» (Verstand oder Geist), die wiederum eine Dreiheit bilden aus Begehren – Gemüt/Gefühl (= Seelenanteile) – Vernunft (= Teil des «Intellekts»).
Laut Platon nun, wie er es Sokrates in der zweiten Rede an Phaidros darstellen lässt, gleicht die Gesamtseele des Menschen einem Wagen: Wagenlenker ist der Geist und lenkt zwei Pferde: Ein eher harmloseres Tier, das aber unter bestimmten Bedingungen durchaus seine Macken haben kann, das ist das Gemüt, die Welt der Gefühle und ein wildes, ungebärdiges Pferd, das leicht durchgeht und schwer zu zügeln ist, die Welt des Begehrens.
Pferde und Wagenlenker haben ihre legitimen Bedürfnisse die, bei Nichtbefriedigung, in ihr Gegenteil umschlagen können und zu überzogenen Leidenschaften, wilden Begierden werden.
Die legitimen Bedürfnisse des Geistes sind Selbstachtung und Anerkennung, heute würde man vielleicht sagen, es ist das grundlegende Menschenrecht auf Anerkennung der eigenen, innewohnenden Würde. Wird dieses legitime Bedürfnis nicht befriedigt, entsteht Wut, denn Stolz und Eitelkeit sind verletzt.
Legitime Bedürfnisse auf der Ebene des Begehrens sind das übliche Besitzstreben, Hunger, Durst, erotische und sexuelle Wünsche. Begehrt man aber auf Kosten anderer Menschen, so werden daraus Gier und, in unserer heutigen Ausdrucksweise: Sexuelle Ausbeutung und Süchte aller Art.
Zum Pferd des Begehrens und dem Geist des Wagenlenkers kommt gewissermassen als drittes Element das zweite, handlichere Pferd der Gefühle. Werden legitime Bedürfnisse und Gefühle nicht beachtet, dann verdrängt sie der Mensch, schiebt sie ab, was zur Folge hat, dass sie sich irgendwo anders Bahn brechen und in verdrehter Form wieder ans Tageslicht drängen.
Wird der Geist anerkannt, kann er sich selbst achten, wird er von Klugheit auf seinem Weg geschützt, Einsicht oder Verstehen organisieren und verwalten die Ziele und zum Schluss ist der Geist weise genug, das, was alles Sein begründet, ohne Leidenschaften anzuschauen. Werden die geistigen Bedürfnisse nicht gestillt, verwandelt sich Weisheit in dummen Hochmut, Einsicht in Arroganz, verletzte Würde in verletzte Eitelkeit, Stolz in Wut.
Mut, sich nicht vor GegnerInnen zu fürchten, Geduld, Widrigkeiten auf der Reise auszuhalten sind jene Gefühle, die den Erkenntnisprozess unterstützen, und beide Pferde in der richtigen Spur halten. Frustriert wandeln sie sich zu Kummer und Wut, «Jähzorn» oder Depression, Überdruss und beide Pferde gehen mit dem Wagen durch, stürzen in den Abgrund.
2.1.4 Das «Höhlengleichnis» aus der «Politeia»[24]
Die Seele ist also das bewegende Prinzip, welche Geist und Leben mit ihrem Begehren, dem eros, voran treibt – im Idealfall dem Begehren nach dem Wahren, Guten und Schönen, ihrer eigentlichen «Heimat».
Den Ausgangspunkt, die Form der Gefallenheit der Seele, beschrieb Platon als durchaus sehr tristen, traurigen Zustand, als eine Form der Vermitteltheit, des Indirekten, abgeschnitten und gefesselt, als einen Zustand der «Entfremdung», wie es moderner nicht sein kann: Wer sieht schon gerne die Schatten von daher getragenen Gegenständen an? Nicht einmal die Träger sind sichtbar, geschweige denn die Wirklichkeit des Schatten werfenden Feuers, des echten Sonnenlichtes draussen vor der Höhle, der duftenden Pflanzen, dem Singen, Rauschen und Rappeln des Lebendigen schlechthin?
Ich möchte an dieser Stelle einmal eine moderne Nacherzählung des «Höhlengleichnisses» versuchen, (einen gekürzten Text des Gleichnisses stelle ich unten in die Fussnote[25]) denn wir haben ja tatsächlich das Glück, nicht mehr in Höhlen zu hausen, woraus wir merkwürdigerweise schliessen, dass wir «weiter» seien als die Leute damals – aber sind wir das tatsächlich?
Man gehe also einmal so im Vorwinter zwischen 20 und 22 Uhr durch eine Stadt: Strassenlaternen, beleuchtete Geschäfte und Ampeln bieten Sicherheit, die Angst vor der Dunkelheit schmilzt in ihrem Licht dahin und das ist sicher auch gut so.
Doch wo sind die Menschen?
Blau flimmert es aus allerlei Fenstern; alleine sehr oft, manchmal zu zweien, seltener zu dritt oder mehr, sitzen sie gebannt da und starren auf einen mehr oder weniger grossen Kasten, in welchem sich bunte Schattengestalten und bonbonfarbene Gegenstände hin und her bewegen.
Die mögliche reale Grundlage dieser Schatten ist nicht im gleichen Raum mit diesen Menschen, z.B. hinter einer halb hohen Schrankwand oder Küchenzeile verborgen, sondern vermutlich längst vergangen, verschwunden, abgebaut – nicht nur einfach weit, weit weg in einem Studio, einer hollywoodesken Landschaft, von welcher aus die schattig-blauen Abbilder geworfen wurden, sondern ganz, ganz weit weg im Nirgendwo und Istnichtmehr und Längstnichtmehrwahr.
Das gilt natürlich auch für jene buntblütigen Schattensequenzen, welche «Nachrichten» genannt werden und mit einem absoluten Wahrheitsanspruch auftreten, wie es selbst Platons Schattenspiele niemals gewagt hätten. Dort wussten die Träger der Schatten werfenden Gegenstände zumindest, dass sie blosse Illusionisten, Puppenspieler, Taschentrickdiebe sind.
Welcher Art sind wohl die Ketten, die die Leute in ihrer merkwürdig starren Abhängigkeit vor den kleinen Kästen halten? Man sieht sie ja gar nicht.
Tatsächlich, die Gefangenschaft könnte schlimmer nicht sein, denn die Fesselung besteht in einer Art bonsaihaften[26] Illusion von Erfüllung: Die Pferde stehen still und starr, weil sie glauben, angekommen zu sein, befriedigt vom blauen Geflimmer, im Lichte der Wahrheit einer bunten Popcornwelt.
Die Gefesselten verhungern, ohne es zu merken, die Sehnsucht der Seele blutet nicht mehr in unerfülltem Verlangen aus (das kann es auch geben und ist ein geläufiger Zustand fürs Apophatische in der Romantik), sondern erstickt sich selbst, die Nase in einem illusionären Hafersack.
Gibt es überhaupt jemanden, der aufsteht und die Fenster öffnet, die Gerüche des nahen Parks einatmet, den Lärm der Stadt goutiert als Zeichen des Lebendigen, gar Sterne anschaut über den Strassenlaternen, später den Aufgang der Sonne hinter den Bahngleisen zu restlichen Welt?
Die eine Person, welche bei Platon die Ketten sprengt, tut es aus Sehnsucht, Hunger, Begierde, Eros – wie immer wir das feurige Tier benennen wollen. «Höhle» ist auch eine Allegorie des Unfertigen, Unbefriedigten, Ungemütlichen, sie ist kalt, zugig, die Steine rau und hart, Feuchtigkeit tropft von Überall her, muffiger Geruch oder kribbelndes, krabbelndes Viehzeug aus dem Dunkeln hervor. «Höhle» meint immer einen nicht befriedigten Zustand – und das ist, war die Chance … Das Wohnzimmer ist warm und weich, keimfrei freundlich, befriedet. – Die Sehnsucht stockt, der Philosoph hängt am Tropf aus Kartoffelchips und Bier. –
Schade, leben wir nicht mehr in Höhlen – schade, glauben wir alles, was wir seh'n!
2.2 Die Synthese jüdischer und griechischer Philosophie bei Philon von Alexandria (15/10 v.d.Z.– 40 n.d.Z.)[27]
Eine wichtige Voraussetzung der späteren christlichen apophatischen Theologie bildete die Verschmelzung der griechischen philosophischen Ansätze mit den Vorstellungen der jüdischen Religion, wie sie sich erstmals bei Philon aus Alexandria findet, der von 20 v.d.Z. bis 50 n.d.Z. lebte.
Wie liessen sich nun die Geschichten aus der Thora, die Riten und Gesetze des jüdischen Glaubens im Licht der Philosophie erklären und deuten?
Zuerst verortete Philon Platons Ideenwelt im Geist Gottes selber. Dieser Schritt lag schon seit einigen Generationen in der Luft[28] und war unter anderem auch eine Reaktion auf Aristoteles' Ablehnung der rein geistig irgendwo im Nirgendwo verankerten Ideenwelt.
Die Welt wird aus dieser göttlichen Vernunft heraus geschaffen. Zwar bleibt Gott das Unerfahrbare, Nicht-zu-Beschreibende aber er offenbart sich eben in dieser zweifachen Weise: Einerseits als real erfahrbare Welt, als das Universum und andererseits als logos, als die überall wirkende, schöpferische und erhaltende Kraft, die auch in der menschlichen Seele zu finden ist und ihr ermöglicht, Gott zu erkennen.
Sie ist das Abbild des logos, der zwei Gesichter hat: Eines ist der Welt zugewandt, das andere Gott und so erhält der Logos eine Vermittlerfunktion zwischen Mensch und Gott.
Nomos ist ein weiterer Begriff aus Philons Philosophie und bedeutet Gottes Gesetz, wie es in einzelnen Menschen, beispielsweise den Propheten, in Abraham oder Mose in Erscheinung tritt. Doch auch, wenn der nomos durch einzelne Menschen oder in bestimmten Ländern, Stämmen wirkt, ist er doch ein allgemeines, wenn man so will, Kulturen übergreifendes Gesetz, insofern es die Gesetzmässigkeiten Gottes in der Welt, ihre Wirkungen, abbildet.
Während die griechischen Philosophen, wie wir oben bei Platon lesen konnten, selber Geschichten und Gleichnisse entwickelten, um den Lesenden, Zuhörenden oder Mitdiskutierenden ihre Gedanken begreiflich zu machen, konnte Philon ausserdem auf einen vorhandenen Fundus, nämlich auf die Erzählungen aus der Thora, zurück greifen.
Diese Auslegung der heiligen Schriften, in denen der Logos zu finden ist und auch gefunden werden kann qua Teilhabe der Seele am Logos, kann auf verschiedenen Ebenen oder mit verschiedenen methodischen Ansätzen, wie wir heute sagen würden, mit verschiedenen «Sinnen», vollzogen werden.[29]
Die Vertreibung aus dem Paradies, beispielsweise, ist für Philon die Allegorie für die Vertreibung der Seele aus ihrem ursprünglichen Zustand. Die Erzählung wird so zur Darstellung eines «inneren Konfliktes in jeder Seele»[30] und sich immer wieder neu abspielt.[31]
Die «Biografien» grosser Figuren in der Thora wie z.B. des Mose, werden so zu generellen Beschreibungen kontemplativer Wege: Moses Aufstieg auf den Berg Sinai schildert für Philon sowohl die apophatische letztliche Unmöglichkeit des kontemplativen Weges (Gott erscheint nicht direkt sondern in einer Wolke) als auch andererseits die ganz «einfache» Lösung für jeden Menschen, es diesem individuell dargestellten Vorbild nach zu tun.[32]
Im Unterschied zur platonischen Position, ist die Liebe bei Philon kein automatisch in der Seele angelegtes Vermögen zu streben, sondern eine Form der Inspiration – also eher von Aussen durch einen Eindruck oder «Gnade» angeregt.
Die Seele ist für Philon ein Abbild des Logos, weshalb sie in ihrem Streben eher von sich selbst als Seele, absehen muss, sich «nichten», wie Philon es ausdrückt.[33] Diesen, durchaus auch ekstatischen Zustand nennt Philon «nüchterne Trunkenheit», was einer d e r apophatischen Begriffe schlechthin ist, wie wir dann bei Dionysius Areopagites lesen werden.[34]
2.3 Neuplatonische apophatische Theologie bei Plotin (205–270) und Proklos (410–485)
2.3.1 Plotin (205–270)
Plotins Schriften, die sein Schüler Porphyrius in 6 Büchern mit jeweils 9 Enneaden (Abhandlungen) heraus gab, werden von McGINN als «herausragende Meisterwerke der mystischen wie der philosophischen Literatur» bezeichnet[35].
Augenscheinlich konnte Plotin sogar auf eigene mystische Erfahrungen zurückgreifen und war im Stande die Psychologie solcher Erfahrungen überzeugend darzustellen.
Ohne hier detailliert auf seine Vorstellung verschiedener transzendentaler Stufen, Hypostasen (Eines, Geist, Seele) näher eingehen zu wollen, ist es aber doch wichtig für das Thema der vorliegenden Arbeit, seine Idee einer Bewegung des «Ausströmens» der einfachen Hypostasen aus den höheren Emanationen, proodos, und der Rückkehr, epistrophe, zu erwähnen: Es ist eine Art überzeitliches oder ausserzeitliches «Atmen», in welchem sich die Seele ihrer selbst bewusst werden kann. In einer steten processio und conversio bewegt sich die Seele zwischen Momenten der «Schau» und der Rückkehr zu sich selber[36].
Dieser stetige (Erkenntnis-)Prozess kann auch als Reise, Aufstieg, leidenschaftliche Sehnsucht oder in weiteren Metaphern dargestellt werden, welche natürlich eine gewisse Hierarchisierung oder Stufung dieses Prozesses implizieren.
Wie bei Platon ist die Ineinssetzung der obersten Hypostase des wahren Einen mit dem absolut Schönen auch bei Plotin zu finden, wobei die eigene Angleichung eine Voraussetzung dieses fort schreitenden Prozesses ist: «Es werde also zuerst einer ganz gottähnlich und ganz schön, wer Gott und das Schöne schauen will.»[37]
Ebenso ist es auch bei Plotin wieder der Eros, die Liebe, welche als treibende Kraft dieses Prozesses wirkt.
Wie es Platon in seiner Schrift «Parmenides» schon vorgemacht hatte und es ab da auch zum stilistischen Kriterium apophatischen Schreibens schlechthin werden wird, umkreist auch Plotin die unmögliche Darstellung des «Einen» in dialektischer Ausdrucksweise. «Dabei experimentiert er mit einer neuen Sprache auf der Grundlage unüblicher und häufig rätselhafter Wendungen und Ausdrücke, die durchgehend mit der Partikel hoion («quasi» oder «sozusagen») qualifiziert werden.»[38]
Die von ihm konstatierten drei transzendentalen Hypostasen verortet Plotin sowohl im Menschen als auch ausserhalb, «erwartend»,[39] das «Eine» ist in Allem, was existiert.
Die kontemplierende, philosophierende Seele ist in der Lage, die Schau, die Erkenntnis dieses «Einen», welches bei Plotin nicht personal zu denken ist, zu erreichen.[40]
2.3.2 Proklos (410–485)
Proklos bildet so etwas wie den terminus post quem in Bezug auf das corpus dionysiacum. Die These, dass Dionysius Areopagites Proklos rezipierte und somit auf jeden Fall w ä h r e n d oder n a c h ihm lebte, ist heute allgemein anerkannt.[41]
Der etwa 150 Jahre nach Plotin schreibende Philosoph Proklos entwickelte die Idee einer hierarchisch gestuften Welt auf der Basis der drei Hypostasen Plotins weiter, die durch den Wechsel zwischen Verharren in der Quelle, Hervorgang und Rückkehr verlebendigt wird.
Proklos entwickelte weiterhin die Lehre von den Henaden, einer Art, auch personifizierbarer, Form von Ideen, welche sowohl am «Einen» selber teilhaben als auch überall im Vielfältigen der Welt existieren.
Personifizierbar sind sie insofern, als Proklos sie mit der griechischen Götterwelt identisch sieht. Sie vermitteln zwischen dem Einen und der Vielfalt, haben aber eben auch religiöse Bedeutung und Funktion. Die höchsten Henaden heissen Glaube, Wahrheit und Liebe.
Ebenso aber, wie man zwischen personalen und nicht personalen Vorstellungen in Bezug auf die transzendenten Hypostasen in der griechischen Philosophie unterscheiden kann, so auch zwischen unterschiedlichen Vorstellungen des Eros: Mal ist «das Eine» selbstgenügsam und Eros ist die treibende Kraft der Seele «nach Hause» zurück oder dieser «Eros» geht von der Transzendenz, dem «Einen» aus und zieht die Seele an sich. [42]
Proklos, so McGINN, in seiner starken Betonung des vom Einen ausgehenden Impulses mystischen Strebens nach Erlangung der Einung zeigt dann wohl als erster in grosser Extremität auf, wie allein die Verneinung der Negation zumindest in die Nähe dieses unbegreifbaren oder – beschreibbaren Einen führen könne.[43]
Die Menschen können einzig ihr Streben selber darstellen, welches aus dem Abbild des Einen in der Seele, ihrer Anteilnahme daran, resultiert.
Im Beschreiben ihres Strebens, des Aufstiegs, wird so auch das Bild des Einen selber entworfen.[44]
Nun sind also die Weichen gestellt, Proklos setzt als erster den Wagen darauf, der uns zu einem christlichen Autor führt, welcher nicht nur das Dichten und Schreiben über das unnennbar Eine zu einem Höhepunkt führte, sondern selber in seiner besonderen historischen und religionswissenschaftlichen Ungreifbarkeit und Unbenennbarkeit ein Abbild jener grossen Unfassbarkeit lebte, dem alle Mystiker und Mystikerinnen von Stund an zustrebten.
Vorhang auf für Dionysius Areopagites!
3 Dionysius Areopagites
3.1 Der Nicht-Greifbare: Mythos und Biografie des Dionysius Areopagites
Was Dionysius Areopagites in einem seiner Briefe über den transzendenten Gott schreibt: «Was immer wir von ihm aussagen mögen, es bleibt unsagbar. Was immer wir von ihm ergründen mögen, es bleibt unergründlich.»[45] trifft ja in faszinierender Weise auch auf ihn selber zu: Was immer auch in den vergangenen anderthalb Jahrtausenden über sein Leben ausgesagt wurde, blieb letztlich «unergründlich» bis auf den heutigen Tag und es ist bis heute weder bekannt, wer sich hinter dem Pseudonym Dionysius Areopagites verbarg, noch weiss man genau, wann er gelebt hat.
Mit Müh' und Not, möchte man fast sagen, kann man auf Grund der Tatsache, dass Dionysius Areopagites die Werke des neuplatonischen Philosophen Proklos zitierte, einen terminus post quam: Proklos' Todesjahr 485, definieren. Einen weiteren bildet das Jahr 476, in welchem das Credo, auf das Dionysius Areopagites in der EH anspielt, in die syrische Liturgie eingeführt wurde – und schliesslich die Erwähnung von Dionysius Areopagites Werken durch Severus von Antiochien (518 oder 528) und ihre vehemente Verteidigung durch Johannes von Skythopolis anlässlich eines Konfessionsgespräches zu Konstantinopel im Jahr 532/533.[46]
Was allgemein wohl im Laufe der Zeiten die verschiedenen Theologen und Literaturwissenschaftler noch mehr erregte, als dieses unknackbare Inkognito, war wohl die poetisch-literarische Verschleierung an sich, das Deckmäntelchen eines Pseudonyms, dass Dionysius Areopagites nicht einmal in seinen eigenen Schriften konsequent aufrecht hielt, auch wenn er sich nie wirklich enttarnte.[47] Da war dann glatt von «Fälschung» die Rede, welche den gesamten Wert des CD sogleich und in toto diffamierte[48], was wahre «Fans» von Dionysius Areopagites mit wütender Kritik wiederum kommentierten. [49]
Mitte der 90-er Jahre des 20. Jahrhunderts listeten Theologen 22 Hypothesen auf, wer nun wohl der wahre Dionysius Areopagites gewesen sein mochte,[50] die sich um einen biografischen Kern anlagerten, der seit Abt Hilduins (814–840 Abt der Abtei St. Denis bei Paris) dritter passio Dionysii, geschrieben 835, folgende fiktive Identitäten des Dionysius Areopagites vereint:
– Athener Areopage, der von Paulus getauft wurde
– ein in Rom geweihter Bischof, der
– auf Mission das Martyrium in Paris erlitt[51]
– Verfasser des 827 dem Frankenherrscher vom Hof zu Konstantinopel geschenkten CD[52]
In der Variante von Regina SUCHLA umfasst das Mosaik des Dionysius Areopagites:
– der Dionysius der Apostelgeschichte,
– der erste Bischof von Athen,
– der Verfasser von vier Traktaten und zehn Briefen,
– der Missionar des Frankenlandes,
- der erste Bischof von Paris,
– der Pariser Märtyrer.[53]
In Zeiten, da insbesondere theologische Wissenschaften, aber teilweise auch die Germanistik z.B. durchaus mit moralischen Ansprüchen daher kamen, rückte die Verwendung eines Pseudonyms gefährlich nahe an solch abscheuliche Untaten wie Plagiat oder Fälschung heran. Dass man aber grundsätzlich die Art der Zitation im ersten Jahrtausend n.d.Z. nicht mit unseren modernen Anforderungen an wissenschaftliche Redlichkeit vergleichen kann, hatte anscheinend keiner der entrüsteten Kritiker des Dionysius Areopagites im Blick. So war es beispielsweise zu Dionysius Areopagites Zeiten üblich, aus den Schriften noch lebender Zeitgenossen ohne Quellenangaben zu zitieren: Man schrieb sie einfach ab und ging anscheinend davon aus, dass jeder Leser wusste, wer da gemeint war. So auch Dionysius Areopagites Rezeption des Proklos.
Kurt RUH stellt dann endlich die Frage nach dem gesellschaftlichen Warum und der Funktion, welche das Pseudonym für den Autor jener so erfolgreichen literarischen Verschleierung selber hatte, die – obwohl Dionysius Areopagites einer der meist gelesenen Autoren des Früh- und Hochmittelalters wurde – konsequent bis heute aufrecht erhalten werden konnte.[54]
War denn die Propagierung neuplatonischen Gedankengutes tatsächlich schon so lebensgefährlich, dass sie nur unter dem Deckmäntelchen eines mehrfachen Pseudonyms ausgeführt werden konnte?
Beate R. SUCHLA ist durchaus dieser Ansicht[55] und weist Dionysius Areopagites unter anderem die Rolle eines Brückenbauers zwischen den unterschiedlichen christlichen Richtungen selber und auch zwischen dem Christentum und der griechischen Philosophie zu.[56]
Als solcher plädierte Dionysius Areopagites auch selbst für einen gesitteten, unpolemischen Stil des «interreligiösen» Dialogs.[57]
Kurt RUH spekuliert noch über ganz unpolitische und sehr persönliche Gründe für Dionysius Areopagites so erfolgreiche Verschleierungstaktik[58] und hält ihn eher für irgendeinen demütigen Klostermann, fern ab der Welt in einsamer Zelle.
Um Kurt RUHs Spekulationen noch mit einer eigenen zu ergänzen, will ich zuerst einmal darauf hinweisen, dass immer nur zahlreiche M ä n n e r als potentielle Dionysii genannt werden, was mir, als mit gender-Fragen vertrauter Prähistorikerin, auffällt.
Wäre es denn nicht tatsächlich denkbar, da bisher noch niemand die Frage stellte, ob sich hinter dem Pseudonym des Dionysius Areopagites nicht etwa eine kluge Philosophin, ähnlich beispielsweise der Hypathia von Alexandrien (355– 415/16 n.d.Z.) verbirgt? Was SUCHLAs These eines Schreibens unter Lebensgefahr sicher unterstützen würde, bedenkt man das Schicksal Hypathias[59] aber auch das in Glaubens- und Philosophiefragen so aufgeregte Jahrhundert, in welchem Dionysius Areopagites seine/ihre Schriften verfasste und die generelle Tendenz des immer christlicher werdenden Mittelmeerraumes zur Herausnahme der Frauen aus den öffentlich geführten gesellschaftlichen Diskursen.[60]
Trotz dieser Fragestellung, die ganz sicher doch eher mein eigenes Wunschdenken als Dionysius-Areopagites-Fanin widerspiegelt, verzichte ich also auf die vermutlich politisch korrektere grammatikalische Genderform eines grossen Binnen-I oder auf umständliche Doppelpronomina à la er/sie, ihre/seine etc., beuge mich dem Geheimnis als Ganzem (= Pseudonym als Abbild einer grossen, warum-auchimmer Unaussprechlichkeit) und im Besonderen (Dionysius Areopagites als « M a n n ohne Eigenschaften») und fahre nun mit der Referierung seiner Werke, dem Corpus Dionysiacum, fort.
3.2 Das corpus dionysiacum
McGINN[61] listet die Reihenfolge der Werke von Dionysius Areopagites folgendermassen auf:
– De divinis nominibus (als DN zitiert)
– Mystische Theologie (als MT zitiert)
– De caelesti hierarchia (als CH zitiert)
– De ecclesiastica hierarchia (als EH zitiert)
In der Reihenfolge meiner Gliederung halte ich mich allerdings eher an Beate R. SUCHLA, welche die MT auf DN und CH folgen lässt. Dieses scheint mir auch vom Literarischen her logischer. Wie auch die Formulierung «vermutlich»[62] zeigt, scheint die angenommene Abfolge bei McGINN nicht gesichert oder logisch zu sein,[63] a.a. O. schreibt McGINN: «DN handelt hauptsächlich vom Hervorgang, EH und CH befassen sich mit unteren Stufen der Rückkehr. MT schliesst die Darstellung der Rückkehr ab…»[64]
Die erste Herausgabe des CD wurde von Johannes von Skythopolis um 540 veranlasst und umfasste die genannten vier Abhandlungen (Traktate) sowie zehn Briefe. Es folgte eine kommentierte Herausgabe durch Maximus Confessor ca. 100 Jahre später, Übersetzungen z.B. ins Syrische, Kirchenslawische und Arabische, 827 dann ins Lateinische durch Hilduin den Abt des Klosters St. Denis bei Paris, um 855 durch den grossen Gelehrten Scotus Eriugena[65] sowie die professionell redigierte und verbesserte Version durch einen päpstlichen Bibliothekar Anastasius Bibliothecarius um 870.[66]
3.2.1 De divinis nominibus
In «De divinis nominibus» (DN) geht es, wie der Titel bereits sagt, um die Namen Gottes. Geht man die 13 Kapitel von DN einmal auf der Suche nach den Namen Gottes (eigentlich: göttliche Namen!) durch, so ergibt sich folgende Liste:[67]
im IV. Kapitel:
– das Gute
– das Licht
– die Macht
– der/das Anmutige
– die Schönheit
– die Liebenswürdigkeit
– die Liebe
im V. Kapitel:
– Sein