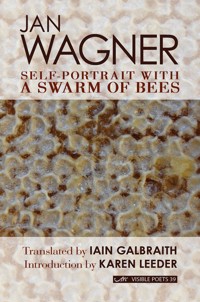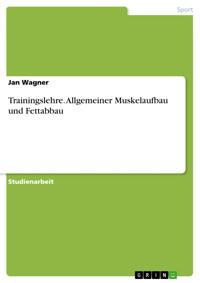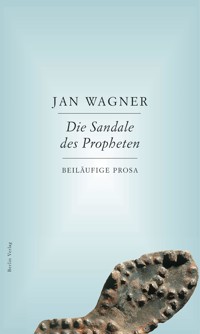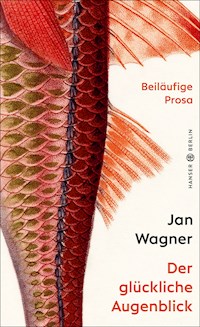
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser Berlin
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Jan Wagner ist nicht nur ein begnadeter, er ist auch ein begeisterter Lyriker, selbst wenn er Prosa schreibt. Seine Porträts von Dichterkollegen wie Dylan Thomas oder Inger Christensen sind von solch ansteckender Leidenschaft, dass man auf der Stelle deren Gesamtwerk erwerben und loslesen will. Worüber Wagner auch schreibt – über das Verhältnis von Lyrik und Fotografie, Motorroller und Geistergeld in Vietnam, über Pässe und Grenzen oder schlicht den Wiedehopf – sein offener, dem Staunen verpflichteter Blick auf die Welt macht diese mit beiläufiger Eleganz geschriebenen Essays zu herrlichen Wundertüten – aus jeder einzelnen sind meisterhaft zugespitzte Geschichten und immer wieder überraschende Erkenntnisse zu ziehen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 367
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch
Jan Wagner ist nicht nur ein begnadeter, er ist auch ein begeisterter Lyriker, selbst wenn er Prosa schreibt. Seine Porträts von Dichterkollegen wie Dylan Thomas oder Inger Christensen sind von solch ansteckender Leidenschaft, dass man auf der Stelle deren Gesamtwerk erwerben und loslesen will. Worüber Wagner auch schreibt — über das Verhältnis von Lyrik und Fotografie, Motorroller und Geistergeld in Vietnam, über Pässe und Grenzen oder schlicht den Wiedehopf — sein offener, dem Staunen verpflichteter Blick auf die Welt macht diese mit beiläufiger Eleganz geschriebenen Essays zu herrlichen Wundertüten — aus jeder einzelnen sind meisterhaft zugespitzte Geschichten und immer wieder überraschende Erkenntnisse zu ziehen.
Jan Wagner
Der glückliche Augenblick
Beiläufige Prosa
Hanser Berlin
Inhalt
Unterm Sprachskalpell
Versuch über Pässe
Mit gelben Quitten hänget
Belladonna, Digitalis
Der glückliche Augenblick
Rosenknospen und Kamelknochen
Wuddwudd, hupphupp, upupup
ephesusghasele
Vom Tau der reichen Sprache
Ein zarter Balg
ovid: erysichthon
Aus dem Munde des Altertums
Ruf der Eule
Ein Prosapferd für Max Jacob
Lob des Spreewals
Das offene Geheimnis
Hinterm Schilfpalast
Mucken
Drache, Phönix, Einhorn
Der Rausch und die Herrlichkeit
Weltenformeln
Im Königreich der Dinge
Götter und Landstreicher
Pietro Aretino: Dimmi, o Farnese mio, padre coscritto
Anmerkungen zu den Texten
Unterm Sprachskalpell
Dankesrede zum Georg-Büchner-Preis
»Verse kann ich keine machen«, schreibt Georg Büchner einem Freund ins Album — aber einen Reim macht er sich durchaus auf allerlei, auf Recht und Rebellion, auf Macht und Knechtschaft, auf die Geschichte und das Geschick, das Schicksal, dem keiner von uns entkommen kann — jedenfalls nicht dem, das die Nachwelt für uns verfügt, die noch die kleinsten Details, die Nichtigkeiten einer Biografie in ein stimmiges Gemälde zu überführen versteht. In der Rückschau gibt es ja keinen Zufall, und ich gestehe, dass es auch mir nicht unbedeutend erscheint, ich es im Gegenteil höchst reizvoll finde, dass das Manuskript des Hessischen Landboten, welches Büchner im Sommer 1834 zu Fuß von Gießen nach Butzbach trägt, dann von Butzbach weiter zur Umsturzdruckerei nach Offenbach, ausgerechnet in einer Botanisiertrommel versteckt wird, einem jener zylindrischen Blechgefäße, die der naturinteressierte Sammler für den Transport von Pflanzen nutzte, von Blüten und Stängeln, Früchten und Blättern, dass also die handschriftliche Urfassung dieses Dokuments, das die hessische Obrigkeit später als das gefährlichste und subversivste Flugblatt bezeichnen wird, vielleicht mit einem Borkenkäfer, der sich hineinverirrt hat, oder mit etwas Schleierkraut geschmuggelt wird, dass vielleicht ein Blättchen jenes hartnäckigen Doldenblütlers Aegopodium podagraria an den Worten haftete und während der zehn riskanten Stunden Fußweg von Butzbach nach Offenbach diese beiden Blätter einander im Dunkel einer Botanisiertrommel Gesellschaft leisteten.
Welch ein seltsames Wort: Flugblatt. Auch die cumäische Sibylle des Vergil schrieb ja ihre Prophezeiungen auf Palmblätter, doch sorgte bei ihr ein Wind dafür, dass die Blätter wirklich ins Wirbeln gerieten. Büchners Flugblatt aber verteilte sich keineswegs durch die Luft, nicht by airmail, nicht einmal via Brieftaube, sondern wurde mühsam ausgelegt und von Hand zu Hand gereicht. Es verbreitete sich nicht im Fluge, vielmehr mit unendlicher Langsamkeit, wurde geschrieben, umgeschrieben, von Ort zu Ort getragen über Tage und Wochen hinweg, mit einer Langsamkeit, die teils der Vorsicht und teils den technischen Möglichkeiten der Zeit geschuldet war. Nachrichten, auch Flugblätter, bewegten sich mit bewundernswerter Trägheit und Geduld fort, sechs Jahrzehnte vor der drahtlosen Übermittlung elektrischer Impulse durch Marconi, dreißig Jahre bevor Philipp Reis mit dem Satz »Das Pferd frisst keinen Gurkensalat« das Telefon testete, nur drei Jahre bevor der Morsetelegraf erfunden wurde. Der Hessische Landbote geht zu Fuß. Und auch Büchner läuft viel, wie er als Kind schon gelaufen sein muss, um Schmetterlinge zu fangen, die seine ersten Flugblätter, Flugblüten sind, eine Luftpost, die er sorgfältig mit Nadeln aufspießt in den Schmetterlingskästen — für die ihm die Mutter Gardinchen genäht hat —, zweifellos mit dem Wunsch des Forschers, sie dadurch zu verstehen, in ihnen lesen zu können, wie Woyzeck später in Pilzen und Schwämmen zu lesen begehrt und Lenz am Himmel Hieroglyphen zu entziffern glaubt.
Lässt sich denn Leben verstehen, indem man den leblosen Leib betrachtet? Dass sich Schädeldecken aufbrechen und Gedanken aus den Hirnfasern zerren ließen — vielleicht glaubt Büchner dies noch, als er den Vater als Heranwachsender ins anatomische Theater von Darmstadt begleitet und als er sich später die Wartezeit zwischen Abitur und Studienbeginn mit anatomischen Studien verkürzt. Er wird die kalten Gesichter betrachtet und sich gefragt haben, welches Leben einst darin steckte, welche Wünsche und Ängste, und vielleicht geht das Bild der Maske, das überall im Werk auftaucht, auf diese Begegnungen mit den Toten zurück, mit ihren erstarrten, maskenhaften Zügen, entstand im anatomischen Theater der Wunsch, hinter die Masken schauen zu können, die später Collot den Widersachern abreißen will, was, wie Danton antwortet, die Gesichter mitgehen lassen dürfte; die Masken, die, so sagt es Dantons Gefährte Camille, doch nur den Blick freigäben auf den »uralten, zahnlosen, unverwüstlichen Schafskopf«. Und man betrachte Valerio, der, aufgefordert, sich zu erkennen zu geben, langsam eine Maske nach der anderen abnimmt: »Wahrhaftig«, sagt er, »ich bekomme Angst, ich könnte mich so ganz auseinanderschälen und blättern«, was wie ein Echo der Sätze klingt, mit denen er etliche Seiten zuvor die Kleinstaaterei beschrieben hatte, das Land, das einer Zwiebel gleiche, »nichts als Schalen, oder wie ineinandergesteckte Schachteln, in der größten sind nichts als Schachteln und in der kleinsten ist gar nichts.« Ist da am Ende wirklich nichts? Und nähme man Büchner all die Masken ab, die des Dramatikers, des Aufwieglers, des Melancholikers, des Liebenden und Wissenschaftlers, was fände man, abgesehen von dem, was jeder einzelne in ihm zu finden wünscht? Vielleicht das, was in uns hurt und mordet und lügt und was uns, wie Woyzeck, »von Sinnen bringt«?
Büchner indes läuft und läuft. Lenz geht übers Gebirge, Büchner geht durch die Vogesen, den Schwarzwald, den Jura, er zieht von Gießen nach Butzbach nach Offenbach, wandert von Darmstadt nach Straßburg nach Zürich. Wann, fragt man sich, überkommt ihn zum ersten Mal das Gefühl, dass er sich, während er so läuft, über nichts als die allerdünnste Kruste bewegt, unter der ein Loch gähnt, wie ein Bürger in Dantons Tod sagt, dass, in Woyzecks Worten, »hohl, hörst du? Alles hohl da unten« ist? Vielleicht als er erneut der Route des Landboten folgt, eilig, um die Aufrührer von der Verhaftung des Freundes Minnigerode in Kenntnis zu setzen; und sicher auch, als er nach Monaten der Ungewissheit nach Straßburg flieht. Dass er zuvor in nur fünf Wochen Dantons Tod zu Papier gebracht hat, das Gegenteil eines Flugblatts, weil es nicht eindeutig, auffordernd, zielgerichtet ist, sondern voller Skepsis und Zweifel und Melancholie, nicht die Sprache als ein Mittel zum Zweck nutzt, muss auch mit der Erfahrung des Abgründigen unter jedem Schritt zu tun haben, mit der zehrenden Angst vor Verhaftung, dem Gefühl der Schuld am Schicksal der Gefährten. Keine Abwendung von der Politik und der Geschichte, das nicht, sehr wohl aber eine Hinwendung zur Literatur, nicht zu Versen, aber zur Dichtung, wie die Historiendramen Shakespeares es sind, dessen Einfluss ja überall sichtbar ist, in der hamlethaften Schwermut und Zögerlichkeit Dantons, in der Opheliengestalt der Lucile, in den Kutschergesprächen. Keine Antwort, sondern eine kunstvolle Suite von Fragen, nach dem richtigen Handeln, der Angst vor dem Scheitern und dem Tod, nicht zuletzt auch nach jener alten Schuld, die stets zurückkehrt und der man, wie Danton sagt, nie entkommt, weil man ja etwas ist, nicht nichts, weil alles durch das eigene bloße Dasein, durch Handeln oder Nichthandeln Schuld auf sich lädt. Man glaubt, Büchner nicht nur in Danton zu hören, sondern auch in Camille, dem Schreibenden, vielleicht sogar, mit Schaudern, in der kalten und effektiven Rhetorik Robespierres, diesem Tugendsassa und Schreckensmann, einem Tyrannen, der keusche Träume gehabt haben muss — auch wenn Büchner in einem Brief bekennt, »kein Guillotinenmesser« zu sein, sein Robespierre hingegen gerade durch die herumzuckenden Guillotinenmesser seiner Finger unvergesslich wird.
Büchner muss in Straßburg monatelang nach Fisch gestunken haben. Er seziert Hechte, Barsche, Maifische, Lachse und Frösche, vor allem aber die Flussbarbe, jenen Karpfenfisch mit den markanten Barteln, der bis zu acht Kilo schwer und einen halben Meter lang wird und den Büchner Tag für Tag frisch von den Fischern an Rhein, Ill und Breusch erwerben konnte. Wirklich, er muss durchdringend nach Barbe gerochen haben, während er die Lenz-Novelle schrieb, vielleicht von der Barbe zu Woyzecks Barbier geriet, muss Fisch verströmt haben, wenn er Minna zwischen Tür und Angel verstohlen einen Verlobtenkuss gab, wenn er am Abend mit den Freunden in der Weinstube zusammenkam, um über Politik zu reden, bei einem Glas Riesling, schlaksig und schmal, wie er uns beschrieben wird, bei ein paar Kirschen oder einem Stück Quiche, kein Gierschlund, aber mit knirschendem, knurrendem Magen nach den langen Stunden des Präparierens. Noch nachts muss ihn eine Fischnote umgeben haben, wenn er dann seine Beobachtungen über das Nervensystem der Barben notierte, das es tagsüber freizulegen galt, präzise, mit Lupe und Skalpell, den Fisch beim Sezieren unter Wasser haltend, kurzsichtig und mit seiner hohen Stirn, und stets mit frischen Exemplaren, weil nur bei diesen »die weiße Farbe der Nervenfasern noch kräftig von der Farbe des Fleischs absticht«.
Büchner hatte Erfahrung im Präparieren, war nicht nur Gast des Naturalienkabinetts in Darmstadt gewesen, sondern hatte schon früh, vor den väterlichen Anatomiestunden, Präparierkurse bei dessen Leiter Johann Jakob Keup besucht. In Straßburg dann waren die Donnerstage vorlesungsfrei, dafür die anatomischen Sammlungen geöffnet, konnte man vor den Amphibien und Fischen in Weingeist und Formaldehyd verharren, vor den hohen Glaszylindern mit ihren Präparaten, einer neben dem anderen, eine wahre stumme Präparateorgel. Noch bei den Vorträgen, die Büchner in Zürich hielt, demonstrierte er an eigenhändig erstellten Präparaten seine Thesen, und es ist denkbar, dass sich Büchner die Typhusinfektion, die zum allzu frühen Tod führte, durch eine Verletzung beim Sezieren zuzog. In seiner Dissertation jedenfalls ging es nicht zuletzt darum, die Beziehungen zwischen Hirn- und Rückenmarksnerven klären zu helfen, und es ist bemerkenswert, dass just diese Schnittstelle genau dies auch für Monsieur Joseph-Ignace Guillotin war, eben: eine Schnittstelle im Rückenmark und der Halswirbelsäule des Delinquenten, die schnell und effektiv zu durchtrennen war. Sodass Büchner an seinen Barben jenes rätselhafte Geflecht erforschte, das uns sehen, fühlen, hören lässt, uns überhaupt erst mit der Welt um uns herum verbindet, und dessen schnelle und, so zumindest das hehre Ziel Monsieur Guillotins, humane Kappung abertausende während der Französischen Revolution aus ebendieser Welt hinausbeförderte. Die Köpfe in den Körben auf der Place de la Concorde mögen ein letztes Mal so erstaunt geguckt haben wie die Barben in den Netzen der Fischer von Straßburg und in den Sezierwannen Georg Büchners.
»Verse kann ich keine machen«, schreibt Büchner, und wirklich sind ja außer ein paar Kindheitsversuchen keinerlei Gedichte erhalten, auch in den Dramen verzichtet er auf den Blankvers, und in Leonce und Lena grunzt der Hofpoet um die Gesellschaft herum »wie ein bekümmertes Meerschweinchen«, was doch eher despektierlich klingt. Andererseits: Wie viele Lieder streut Büchner in die dramatischen Szenen ein, wie oft Passagen aus Des Knaben Wunderhorn, mitunter leicht verfremdet, die Handlung kommentierend oder unterlaufend, wie oft lässt er seine Gestalten ihrem Geschick mit Strophen Ausdruck verleihen. Auch ist das Wort »Vers« Büchner gut genug für ein Wortspiel, wenn er Danton zum Lustspieldichter Fabre d’Eglantine sagen lässt, er werde als Toter doch weiterhin hervorbringen, was er ein Leben lang produziert habe, »des vers« nämlich, V-E-R-S, im Französischen der Plural des Wurms, eben jene Würmer, mit denen auch Danton selbst, wie man ihm zuruft, bald Unzucht treiben könne — Wortspiele sind das, die auch Shakespeare begeistert hätten, und wer weiß, ob nicht alldem sogar Hamlet zugrunde liegt, der die Theorie aufstellt, man könne mit dem Wurm fischen, der von einem König gegessen hat, und von dem Fisch essen, womöglich einer Barbe, der den Wurm verzehrte, und so zeigen, wie ein König seinen Weg durch den Darm eines Bettlers nimmt. Übrigens lässt Büchner Verse als Trost durchaus zu — denn Lenz sagt sich in der heftigsten Angst Gedichte auf, bis er wieder ruhig ist, und beide, Camille und Danton, greifen am Abend vor der Hinrichtung zu Versen, um nicht verrückt zu werden. Bei Camille sind es, er nennt sogar den Titel, die Nachtgedanken, die Night Thoughts des englischen Dichters Edward Young, in denen der Mensch als »der Herrlichkeit ein Erbe und des Staubes« erscheint, wovon Büchner vor allem den Staub lässt (»Du bist geschaffe Staub, Sand, Dreck«, brüllt der Marktschreier im Woyzeck), und, so fährt Young fort, der Mensch beides ist, »unendlich und Insekt! Ein Wurm! ein Gott!«. Einen Gott schließt Büchner nie aus, aber der Wurm ist gewiss.
Dass Büchner dabei noch lachen kann, auch wenn es ein schwermütiges Lachen ist, dass er auch so auffällig oft lachen lässt, den Lenz, den Valerio, den Danton, und allen Narren freundlich gesinnt ist — es nimmt für ihn ein. »Es ist wahr, ich lache oft«, schreibt Büchner, »aber ich lache nicht darüber, wie Jemand ein Mensch, sondern nur darüber, daß er ein Mensch ist, wofür er ohnehin nichts kann, und lache dabei über mich selbst, der ich sein Schicksal teile. Die Leute nennen das Spott, sie vertragen es nicht, daß man sich als Narr produziert und sie duzt; sie sind Verächter, Spötter und Hochmütige, weil sie die Narrheit nur außer sich suchen.« Wirklich, was hätte er für Verse gemacht, wenn er Verse gemacht hätte, mit seinem galligen Humor und dieser offenkundigen Lust am Sprachspiel und am kühnen Bild: Da werden ohne Schwielen an den Fingern die Wangen der hübschen Dame Verwesung gestreichelt, wird man am Ende der Bettlerin Erde in den Schoß geworfen wie ein durchgelaufener Schuh; da ist die Erde so nass und klein, dass man sie hinter den Ofen setzen will, muss der Kopf gerade auf den Schultern getragen werden wie ein Kindersarg; die Sonnenstrahlen wiegen sich an den Grashalmen wie müde Libellen, Käfer summen wie gesprungene Glocken, Augen sind so schwarz, als schaute man in einen Ziehbrunnen, und es wird empört gefragt, warum »Sie, Geehrtester, das Maul so weit« aufreißen, »daß Sie einem ein Loch in die Aussicht machen«. Herrlich ist das, und damit wäre man noch gar nicht bei den brillanten Beleidigungen und den Obszönitäten, die ja vorführen, dass Dichtung immer auch ein Spiel ist — wenn auch eines, das mit Präzision betrieben wird. Allein zu beobachten, auf wie raffinierte Weise im Woyzeck das Messer wandert als Motiv, in Redewendungen wie nebenbei immer wieder auftaucht, in Herzen und Augen sticht, bevor dann wirklich, unterm blutigen Mondeisen, der Mord geschieht!
Büchner derweil steht im Anatomiesaal in Straßburg, und auch er hält über seinen Präparaten ein Messer, kein Guillotinenmesser, nicht das Messer eines Mörders, sondern das Skalpell in der Hand, ganz so, male ich mir aus, wie sein Anatomielehrer Ernst Alexander Lauth es in seinem Werk Allgemeine Regeln, die bei’m Zergliedern zu beobachten sind geraten hatte: »Es genüge folglich, rücksichtlich der Scalpelle und der Pincette, zu bemerken, daß man sie so ziemlich wie eine Schreibfeder […] hält.« Und umgekehrt stelle ich mir vor, dass der Präzisionskünstler Büchner die Schreibfeder des Nachts in der nach Fisch duftenden Schreibhand führt wie, ja: ein Skalpell. Jedenfalls sind all die Absätze und Szenen und Dialoge so fein herausgearbeitet nicht nur aus Danton und Woyzeck, sondern aus unser aller Natur, kunstvoll freigelegt wie das Nervenkostüm einer Barbe, wie ein Hechtskelett. Das Wunder aber ist, dass dennoch alles ganz und gar lebendig ist, bei jedem Lesen erneut, als blitzten die Schuppen silbern vor uns auf, als wären da die Kälte und die Angst des präparierten Fisches plötzlich wieder spürbar in der Hand.
Und so beginnen auch die Toten der Geschichte unterm Sprachskalpell erneut zu leben. Büchner ist Woyzeck und ist Marie, wird zu Danton und Julie, indem er deren Masken leiht, sie zu denken wagt mit all ihren Widersprüchen, er ist Oberlin und Lenz, dessen Gabe wir auch bei Büchner vermuten dürfen — »dachte er an eine fremde Person, oder stellte er sie sich lebhaft vor, so war es ihm, als würde er sie selbst«.
Dieses Gestaltwandeln, dieses Schlüpfen in Rollen, ist eine Möglichkeit, die auch das Gedicht bietet. »Ich bin ein Stein«: Es stimmt, dass es nur im Gedicht möglich ist, dies nicht nur zu äußern, sondern auch vollkommen glaubhaft zu machen, im Vertrag mit dem Leser diesen sagen zu lassen: Ich akzeptiere, dass hier ein Stein spricht, und bin sogar bereit zu erkunden, inwiefern ich selbst Stein bin und wie es sein mag, aus der Perspektive eines Steins in die Welt zu blicken. In gleicher Weise würde ein lyrisches Masken-Ich zum Kumpan des Freibeuters Störtebeker, der auf die Hinrichtung wartet, spräche es als Feldkoch bei der Schlacht von Austerlitz, als in den Wahnsinn gleitender Missionar, als Kind im Brunnen, als Dachshund. Alles und jeder hat einen Platz verdient, nichts ist zu gering — so sieht es Büchner, der seinen Camille gegen alles allzu Exquisite, Entrückte wettern und eine Hinwendung zur »erbärmlichen Wirklichkeit« fordern lässt, zu den Menschen, gewiss, aber auch zur »Schöpfung, die glühend, brausend und leuchtend, um und in ihnen, sich jeden Augenblick neu gebiert«. Es ist nicht zuletzt diese offenkundige Liebe zu den Dingen, zur Welt, die zu Büchner hinzieht, dessen Lenz als literarisches Sujet sogar einen Hundsstall vorschlägt, Hauptsache, Leben sei darin, und der hinzufügt, dass man nur Aug und Ohren dafür haben müsse — Sprache, Dichtung als kunstvolle Verlängerung des Nervensystems in die Natur und in die Geschichte hinein. Büchner ist, als Ohren- und Augenmensch, tatsächlich mit allen Sinnen und Nerven in der Welt, packt präzise, aber leidenschaftlich und mit beiden Händen nach dem prallen Leben, und die Hände dürfen riechen danach, sie dürfen sogar stinken.
Ich mache Verse, ja, ich mache kaum etwas anderes als Verse, und dass Sie, meine Damen und Herren, mir dafür so viel Zuspruch schenken, diesen Preis im Namen Georg Büchners zuerkannt haben, hat mich erst stumm sein lassen wie eine Flussbarbe, dann beglückt und schließlich ermutigt. Ich mache Verse, die nicht im Reim aufgehen, obwohl sie mit dem Reim spielen, die aber das Spiel mit Klängen und Formen nicht als Kinderei begreifen, sondern als kreative Reibung, als einen Akt des Lockerns und Lösens erstarrter Zusammenhänge, es ist ein freies, meinetwegen: ein närrisches Spiel, das kein lyrischer Wohlfahrtsausschuss verbieten dürfte und könnte. Ich mache Verse aus der Überzeugung heraus, dass noch das Geringste zum Gedicht werden kann und, hat man Auge und Ohr, ein Gedicht die komplexesten Dinge in sich birgt, die Schönheiten wie die Dunkelheiten unmittelbar und sinnlich erfahrbar macht und dabei weder der Welt noch der Gegenwart den Rücken kehrt, selbst wenn es die Schlagzeile meidet, dass, wenn nur alle sprachlichen Möglichkeiten ausgeschöpft werden, es gleichgültig ist, ob ein Hundsstall oder eine historische Figur am Anfang stand, weil das gelungene Gedicht unwiderstehlich dazu einlädt, die Welt neu zu sehen und damit neu zu denken. Und ich gestehe, dass in meinen Augen ein Gedicht dieser Art durchaus zu einem fliegenden Blatt wird, das nicht sibyllinisch sein muss, zu einem Blatt, das allerdings Raum, Zeit und größte Gegensätze schnell wie der Wind und auf wenig mehr als zwei Zeilen zu überwinden vermag, sogar zu einem Flugblatt wird, das dazu ermuntert, es ihm gleichzutun, das Gedicht also als größtmögliche Freiheit auf engstem Raum zu begreifen, weil es sagt: Gestatte dir selbst, was auch ich mir Tag für Tag, Zeile für Zeile herausnehme. Nicht so unmittelbar und Hals über Kopf, Kopf vom Hals die herrschenden Verhältnisse umwerfend wie ein Danton aus Fleisch und Blut, auch nicht wie Büchners kunstvoller, prachtvoller Danton aus Worten, aber doch geradezu umstürzlerisch auf seine bescheidene Art, herausfordernd, die gedanklichen und sprachlichen Räume verändernd und erweiternd, könnte im Gedicht dann auch, sagen wir, ein Borkenkäfer sein, vorausgesetzt, er findet zur richtigen Zeit und in einem glücklichen Moment in die geeignete Botanisiertrommel, ein Borkenkäfer, nicht mehr, oder, meinetwegen, irgendein Unkraut.
Versuch über Pässe
Briefe an Nikola Madzirov
I
Lieber Nikola,
bei unserer letzten Begegnung, Du wirst Dich erinnern, saßen wir in einem lauschigen Biergarten im Westen Berlins, irgendwo zwischen Nollendorfplatz und Landwehrkanal, und genossen einen der letzten prachtvollen Tage des Sommers, ganz so wie die Wespen, die ihr nahendes Ende schon ahnten und wie angeschlagene Samurai um unsere Gläser torkelten. Wir waren zu dritt, denn ein gemeinsamer Freund aus China, der jedoch schon lange nicht mehr in seiner Heimat lebt, saß mit uns am Tisch, und irgendwie, wohl aus aktuellem Anlass, weil einer von uns dreien bei einem Konsulat vorstellig zu werden hatte, begann unser Gespräch sich ums Reisen zu drehen, um die Beschaffung von Visa und sonstigen Dokumenten, und ich gestand, welchen Zauber seit jeher die Einträge in Reisepässen auf mich ausgeübt hatten, schon jene im ersatzweise ausgestellten Kinderpass mit dem labberigen gelblichen Papier und dieser kleinen mintgrünen Gebührenmarke in der Ecke, auf der man den Kopf des Freiherrn von Stein erkannte. Ich war, Du hast es sicher bemerkt, kurz davor, meiner Begeisterung die Zügel schießen zu lassen: Für diese seltsame Bürokratenmagie der Stempel in all den Pässen, die man jemals besessen hat, für die Vermerke, die Formen und Farben und Sprachen, die nüchternen grauen Vierecke einer frühen Spanienreise im Jahre 1983, die allerdings durch ein Wort wie »fronteras« und die Zusätze »entrada« und »salida« an Feuer gewannen, dem Amtlichen einen Hauch Flamenco beizumischen schienen; für die peniblen Rechtecke und Ovale, diese seltsame Geometrielehre des Grenzverkehrs, mal meerblau, mal teerschwarz, mal blasser und gelegentlich kaum noch lesbar, hier für einen Rhombus von Beamtenhand, der wie ein Kinderdrachen an der krakeligen Unterschrift zerrt und den es über die Seite hinwegzufliegen drängt, dort für ein winziges gleichschenkeliges Dreieck, das 1978 irgendein »Immigration Officer«, ich vermute: aus England, in die untere linke Ecke gesetzt hat, ein überaus korrekt aufgeschlagenes kleines Pfadfinderzelt nach dem Musterbuch Baden-Powells; auf einer anderen Seite, in einem späteren Pass, ein Alpha, ein Epsilon, ein Rho, die, aber ja, auf einen griechischen Flughafen hinauslaufen, und das Feld dieser attischen Einreiseerlaubnis ist so wohlproportioniert wie der Grundriss eines Tempels, steht selbst seit Jahrzehnten beharrlich da wie ein solcher en miniature, ruht auf den Säulen seiner griechischen Buchstaben. Auch ein Visum für die Vereinigten Staaten gibt es, auf den Seiten vor ihm und nach ihm umschwirrt von zahlreichen kleineren Stempeln der Deutschen Demokratischen Republik, die faltergleich zwischen Dunkelblau und Violett changieren, was entweder auf extravagante zweifarbige Stempelkissen oder auf qualitativ minderwertige Tinte schließen lässt, Stempeln von den Grenzübergängen Zarrentin und Staaken, von Griebnitzsee und Stolpe, vom Bahnhof Friedrichstraße und vom Brandenburger Tor. Dabei sind es, je näher das Ausstellungsdatum der Pässe ans Heute rückt, immer weniger europäische Länder, die auftauchen. Ein Stempel des Grenzübergangs Zgorzelec anlässlich einer weihnachtlichen Reise nach Polen, dann hier und da Einreisegenehmigungen aus Übersee, aus Australien und Kolumbien, aus Indien und Nicaragua, gelegentlich ein Stempel für Bosnien-Herzegowina, für Israel oder für die Ukraine sowie ein frostfarbener Visumsaufkleber aus Belarus. Es ist wirklich erstaunlich zu sehen, wie der letzte stempelbare Pass trotz zunehmender Reisetätigkeit durch ein nunmehr grenzenloses Europa der Unionsstaaten geradezu unberührt wirkt, fast gänzlich frei ist von Farben, Formen, Kürzeln, Daten — und das, obwohl ich mich regelmäßig in Amsterdam und Kopenhagen, Dublin und London, Barcelona und Athen aufgehalten habe. Und ebendeshalb, weil all diese Grenzüberschreitungen unsichtbar geworden sind, viele Grenzen ja keine mehr sind, bremste ich mich in just dem Augenblick, als ich am Biergartentisch zu schwärmen beginnen wollte — denn mir schwante, dass Du und unser chinesischer Freund dieses amtliche Dokument, den Reisepass, mit weniger Begeisterung, weit nüchterner, skeptischer betrachten könntet, dass die Stempel, die Bewilligungen, die Visa nur für mich verhätschelten Westeuropäer nostalgischen Zauber und die Anmutung von Fremde und Abenteuer haben, für so viele andere hingegen und, wer weiß, vielleicht auch für Euch weniger Freiheit denn Restriktion, ja Willkür bedeuten. Wirklich, lieber Nikola: Wenn wir beide gebeten würden, eine »Ode auf den Reisepass« zu verfassen, einen »Versuch über Pässe« — wir würden wohl zwangsläufig zu grundverschiedenen Ergebnissen kommen, jedes Detail aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachten müssen, das misstrauische oder mürrische Mustern hinter der Glasscheibe, die haarige Hand, die das Dokument entgegennimmt, die Beamtin, die im Reisepass blättert, kurz aufschaut, blättert, sodann den unregelmäßigen Doppelschlag des Stempels zwischen Stempelkissen und Pass, während die Schlange langsam weiterrückt, und wieder, und wieder, und wieder, ta—tam, wie das Humpeln eines Holzbeinigen auf dem Oberdeck.
Wie leicht es ist, sich an unwahrscheinlichste Freiheiten zu gewöhnen, sie als selbstverständlich zu erachten. Mit welchem Recht könnte man auf Leute herabblicken, die, jünger noch als man selbst, nie ein Europa mit Grenzen erlebt haben und das Fehlen jeder Kontrolle als Normalität empfinden? Eine europäische Union (ich sage ausdrücklich nicht: Europa) ohne Schlagbäume — welch ein Wunder das angesichts der Geschichte unseres Kontinents ist, muss man sich wohl immer wieder bewusst machen, darf sich dabei auch ruhig in den Arm kneifen. Ein heute Zwanzigjähriger hat nie in der Autoschlange am Brenner darauf gewartet, nach Italien weiterfahren zu dürfen, hat nie sein Schulfranzösisch bemühen und kurz hinter Offenburg ein paar Worte mit dem elsässischen Grenzbeamten wechseln müssen, um den Rhein zu überqueren, ganz zu schweigen von der deutsch-deutschen Grenze, die unüberwindbar und nicht wegdenkbar war und doch irgendwann zu bröckeln begann. An eben jenem Zarrentiner Übergang, der noch als Stempel in meinem Pass überdauert, hatte ich kurz zuvor bei meinem um zehn Jahre älteren und furchtlosen Schwager im Auto gesessen. Unvergessen, wie er den säuerlichen Uniformierten, der uns mit der erhobenen linken Hand zu halten befahl und die Rechte großkaiserlich in die Jacke geschoben hatte, mit einem jovialen »Guten Morgen, Napoleon« begrüßte, was uns Stunden des Wartens sowie größtmögliche Aufmerksamkeit und Gewissenhaftigkeit bei der Demontage unseres Wagens bescherte.
Seltsam, dieses deutsche und fast nicht mehr gebrauchte, völlig aus der Mode gekommene Wort »Schlagbaum«, für das es auch im Mazedonischen eine Entsprechung geben muss, das im Französischen schlicht »barrière« und im Italienischen »barriera« heißt, im Englischen auch »turnpike«, wobei das »pike«, das ja auch »Hecht« bedeuten kann, nicht mit dem Fisch verwechselt werden darf; es handelt sich also nicht um einen zu wendenden oder sich windenden Hecht, sondern um einen Spieß oder zugespitzten Pfahl, »pike«, der sich beiseitedrehen oder anheben lässt. Das genau ist auch der Sinn des deutschen Worts, wobei die erste Silbe sich vom mittelhochdeutschen Verb »slahen« herleitet und hier so viel wie »zuschlagen, sich herabsenken, schließen« heißt. Natürlich findet man den Schlagbaum auch im Wörterbuch der Brüder Grimm, diesem unentbehrlichen Werk, in dem auf abertausenden von Seiten die Geschichte und der Reichtum der deutschen Sprache bewahrt wird, das aber zugleich die Wandlungsfähigkeit dieser Sprache zeigt, auch die Einflüsse anderer Sprachen kenntlich macht, die Bereicherung und den steten Wandel, dem jede Sprache unterworfen ist und der sie doch erst lebendig macht, ob es sich um Anleihen aus dem Lateinischen, Französischen oder Niederländischen handelt. Wie immer bringt der Grimm schöne Beispiele, zitiert aus Schillers Wilhelm Tell, führt Hebbel an und Musäus, der die Liebe wunderbarerweise über den Schlagbaum hinwegspringen lässt wie über einen bloßen Strohhalm. Aber die Gewalt des Wortes »slahen« ist schon noch spürbar, die physische Drohung des Erschlagenwerdens, und das Wörterbuch merkt an, dass der Schlagbaum noch eine zweite Sache bezeichnet, nämlich auch »eine falle für raubthiere« sein kann, »ein schwerer baumstamm, der auf einer stütze ruht und den darunter durchpassierenden thieren auf den rücken schlägt und sie zermalmt«, Füchse zum Beispiel oder Dachse. Die Versehrungen, die eine Begegnung mit dem Schlagbaum nach sich ziehen kann, klingen so auch in der sich senkenden Schranke noch an. Und wirklich: Welche Gefahren mit dem Überschreiten von Grenzen verbunden sind, ob sie nun unsichtbar in einem Meer verlaufen oder sich als Zaun manifestieren, können wir Abend für Abend in den Nachrichten sehen.
Wir schreiben einander ja Briefe zu einer Zeit, da Nationalismus und Engstirnigkeit plötzlich so en vogue scheinen wie lange nicht mehr, da auch in meinem Land eine Partei an Zulauf gewinnt, in deren Anfangsbuchstaben schon ein Schlagbaum querliegt und aus deren Reihen vor kurzem unter anderem gefordert wurde, das Wort »völkisch« wieder in den Alltagsgebrauch zu überführen. Nur wenige Tage vor Beginn dieser Diskussion hatte ich, weil seit Wochen und Monaten derart belastete Wörter von interessierter Seite wiederholt werden und Eingang finden in die politischen Debatten, ins Feuilleton und ganz ohne Zweifel auch in die privaten Gespräche an den Küchen- und den Stammtischen, abermals Victor Klemperers LTI gelesen, seine Betrachtungen der Lingua Tertii Imperii, der »Sprache des Dritten Reiches«. »›Volk‹ wird jetzt beim Reden und Schreiben so oft verwandt wie Salz beim Essen«, beobachtet Klemperer 1933, »an alles gibt man eine Prise Volk: Volksfest, Volksgenosse, Volksgemeinschaft, volksnah, volksfremd, volksentstammt …« Ich weiß nicht, wie sehr der Name Victor Klemperers außerhalb Deutschlands ein Begriff ist, lieber Nikola — er war Professor für Sprach- und Literaturwissenschaft in Dresden, wurde 1935 wegen seiner jüdischen Herkunft gezwungen, die Universität zu verlassen, und überlebte nur dank seiner nichtjüdischen Ehefrau, die sich weigerte, sich von ihrem Mann scheiden zu lassen, und die alle folgenden Schikanen und Demütigungen mit ihm durchzustehen bereit war. Vielleicht sind seine berühmten Tagebücher, in denen er diese zwölf lebensbedrohlichen Jahre beschreibt, sogar ins Mazedonische übersetzt worden? In seinen Texten zur LTI jedenfalls setzt sich Klemperer damit auseinander, welcher Art die Sprache war, die solche Taten vorzubereiten imstande war. »Und wenn nun«, fragt er, »die gebildete Sprache aus giftigen Elementen gebildet oder zur Trägerin von Giftstoffen gemacht worden ist? Worte können sein wie winzige Arsendosen: sie werden unbemerkt verschluckt, sie scheinen keine Wirkung zu tun, und nach einiger Zeit ist die Giftwirkung doch da.« Schwer vorstellbar, dass nicht auch heute der Hass und die Verachtung, die in die Wörter getröpfelt werden, ihren Ausdruck in hässlichen und verachtenswerten Taten finden. Die Brandanschläge jedenfalls sind so alltäglich geworden, dass sie fast nicht mehr zu zählen sind. Bei einem der letzten, ausgerechnet in Berlin, hatte der Täter vor dem Anreißen des Streichholzes die Aufforderung »Go to Home« auf die Wand der Flüchtlingsunterkunft geschmiert — im Grunde natürlich ein wunderbarer germanism und bizarr in seinem Willen, weltläufig, jedenfalls international verständlich zu wirken. Kann man von einem Brandstifter verlangen, korrektes Englisch zu verwenden? Und darf man über seinen Fehler lachen? Sollte man vielleicht darüber lachen, damit einem das Lachen nicht vergeht?
Dass Worte weit mehr als eine simple Bedeutung, den Hinweis auf einen Sachverhalt oder Ding enthalten — wer wüsste das besser als Lyriker, die ja für gewöhnlich wenige Wörter benutzen, dafür jedoch mit allen Bedeutungsebenen dieser Wörter spielen, mit den Klängen und Anklängen, den Brüchen und Brücken, die der Etymologie nachforschen, die geschichtlichen Ebenen des Wortes freizulegen versuchen, all die verborgenen Echokammern, deren Metier also das Abwägen, Feineinstellen, die Nuance ist. Freuden und Schwierigkeiten ohne Ende, die sich noch multiplizieren, wenn man Gedichte übersetzt, ein Gedicht von einer in die andere Sprache trägt, ihm sprachliche Grenzen zu überwinden hilft und dafür sorgt, dass ein fremdsprachiges Gedicht in der eigenen Muttersprache heimisch wird. Eine unserer ersten Begegnungen fand in Deiner Heimat statt, im mazedonischen Struga, und ich habe sehr deutlich vor Augen, wie wir eines warmen Abends zu sechst, mit nahezu allen jüngeren Teilnehmern des gerade dort stattfindenden Poesiefestivals, am gewaltigen Ohridsee saßen und die Sonne untergehen sahen, als irgendjemand, vielleicht warst sogar Du es, beiläufig erwähnte, er übersetze gerade die Gedichte des israelischen Dichters Jehuda Amichai — worauf eine Dichterin einwarf, sie ebenfalls, und ein Dritter sich einmischte, und plötzlich wurden Gedichte Amichais, den, wie sich herausstellte, alle gleichermaßen bewunderten, auf Mazedonisch, Deutsch, Englisch und Ukrainisch zitiert, dass es eine vielstimmige Freude war. Auf der anderen Seite des Sees, in der Ferne, begann Albanien, doch saßen wir natürlich auch wenig mehr als einen herkuleischen Steinwurf entfernt von Griechenland, wo Hölderlin seinen Hyperion als Eremit leben und auf sein Leben zurückblicken lässt, das er, übrigens in Briefen, wie mir jetzt einfällt, seinem Freund in Deutschland schildert: »O Bellarmin! wo ein Volk das Schöne liebt, wo es den Genius in seinen Künstlern ehrt, da weht, wie Lebensluft, ein allgemeiner Geist, da öffnet sich der scheue Sinn, der Eigendünkel schmilzt, und fromm und groß sind alle Herzen und Helden gebiert die Begeisterung. Die Heimat aller Menschen ist bei solchem Volk’ und gerne mag der Fremde sich verweilen.« Fast wie ein Kommentar zur Stunde liest sich das, auch wenn man von Helden heute kaum noch reden wollen wird, die besser im Epos oder einer vergangenen Epoche aufgehoben sind. Als ich vor kurzem bei polnischen Freunden zu Besuch war und sie mir nachmittags ihre Stadt zeigten, begannen wir, was natürlich reiner Zufall war, auf dem »Platz der Helden«, spazierten über den »Platz der Freiheit« bis hin zum »Platz der Freundschaft«, wo unser Stadtrundgang endete, und so hatten wir ganz nebenbei einen Gang durch die europäische Geschichte und die Entwicklung unseres Kontinents unternommen, bis hin zum glücklichen Ende. So schien es mir jedenfalls an diesem Tag.
Dabei habe ich wirklich allzu leicht leben, reisen, reden und schreiben, denn Krieg und Diktatur blieben mir erspart, und aufgewachsen bin ich in einer der seltenen glücklichen, windstillen Phasen der Historie. Ein Grund mehr vielleicht, das Reisen nicht nur als Vergnügen, sondern auch als Verpflichtung zu begreifen — zum Lernen, zum Wertschätzen. Und so lehrreich wie heilsam ist es ja, aus der Distanz auf Europa zurückzuschauen, von den nachts wie Leuchtalgen funkelnden Hängen Medellíns oder vom riesigen Shanghai, in dem allein ein Drittel der deutschen Gesamtbevölkerung Platz fände. Am liebsten aber reiste man natürlich mit Seamus Heaney, den Du sicherlich genauso verehrst wie ich, in die »Republik des Gewissens«. Ihr hat er ein langes, wunderbares Gedicht gewidmet, »From the Republic of Conscience«, in dem nach der Landung ein Brachhuhn zu hören ist, der alte Mann am Schalter verblüffenderweise Fotos von den Ahnen des Reisenden aus dem Mantel zieht, die Dame vom Zoll darum bittet, die traditionellen irischen Zaubersprüche gegen Stummheit und gegen den bösen Blick zu hören. Der dritte und letzte Teil des Gedichts klingt so:
I came back from that frugal republic
with my two arms the one length, the customs woman
having insisted my allowance was myself.
The old man rose and gazed into my face
and said that was official recognition
that I was now a dual citizen.
He therefore desired me when I got home
to consider myself a representative
and to speak on their behalf in my own tongue.
Their embassies, he said, were everywhere
but operated independently
and no ambassador would ever be relieved.
Da »relieve« ja beides bedeuten kann, »ablösen«, aber auch »erleichtern«, ahnt man: Dieses Amt ist durchaus eine Bürde. Noch schwieriger aber dürfte es sein, fürchte ich, sich überhaupt erst als Botschafter dieser erstaunlichen und notwendigen Republik zu qualifizieren. Man müsste vielleicht damit anfangen, selber Formeln gegen die Stummheit zu finden, auch die eigene, sich dem bösen Blick zu verweigern.
Nicht zuletzt zeigt ein Gedicht wie dieses natürlich, dass die herrlichsten, unvergesslichsten Reisen im Kopf stattfinden. Und für die benötigt man nicht einmal einen Pass.
Sei herzlichst gegrüßt
Dein Jan
II
Lieber Nikola,
sosehr ich das betrübliche Thema im ersten Brief vermieden habe, will ich nun doch noch einmal leise über Großbritanniens Abschied jammern — auch deshalb, weil vielerorts jenes niederschmetternde britische Referendum vom Juni bereits als Selbstverständlichkeit, als schicksalhafte Gegebenheit gesehen und schulterzuckend akzeptiert wird, ich hingegen immer noch einen Stich verspüre, wenn mir wieder einmal bewusst wird, dass die schöne Insel sich plötzlich um ein paar hundert gefühlte Seemeilen von uns anderen Europäern entfernt hat, dass sie weit in den Atlantik hinaustreibt und unser Kontinent ein bisschen einsamer erscheint; auch will ich mich nicht zu jenen gesellen, die mit kaum verhohlener Häme die ersten üblen Vorzeichen begrüßen und den wirtschaftlichen Niedergang des Königreiches herbeisehnen, um sagen zu können: Seht her, das habt ihr davon. Nein, mir ist einfach nur traurig zumute, auch wenn es ja wahr ist, dass ich nie in Großbritannien gelebt habe, lediglich auf der anderen Seite der Irischen See, in Dublin nämlich, dass es sich also, denke ich darüber nach, vor allem um eine literarische Liebe handelt, um die eines Lesers und Übersetzers. Für mich setzt sich die britische Landschaft aus dem London von Charles Dickens, dem Yorkshire von Ted Hughes und dem Wales von Dylan Thomas zusammen, sie erhebt sich aus dem Lake District der Romantiker Wordsworth und Coleridge, wohin ich es nie geschafft habe, doch vielleicht, wer weiß, macht die Tatsache, dass ich eher poetische denn wirkliche Landschaften durchstreift habe, diese tiefe Zuneigung nur umso beständiger. Vor wenigen Tagen erst war ich in Winchester, im wirklichen Winchester, meine ich, in der Grafschaft Hampshire südlich von London zu Gast, und schon bei der Ankunft am Flughafen Heathrow, beim ersten Gewahrwerden englischer Dialekte und während der ganzen folgenden Bahnfahrt stieg etwas Wehmut ins Herz. Wie erst musste es den Freunden in Winchester gehen, den alten und den neu gewonnenen, von denen nicht ein einziger für den Austritt votiert hatte, die allesamt noch immer unter Schock zu stehen schienen, es nicht wahrhaben wollten. Das Thema ließ uns den ganzen Abend nicht los und begleitete uns über die Tage hinweg.
Auch Winchester ist, das weißt Du so gut wie ich, lieber Nikola, in literarischer Hinsicht nicht unbedeutend. Keats hat hier eine Zeit lang gelebt (Keats, der angesichts seines kurzen Lebens und seines allzu frühen Todes fast als Verkörperung von »fragility«, von Zerbrechlichkeit und Flüchtigkeit gelten könnte — »Here lies one whose name was writ in water«, lautet die berühmte und berührende Inschrift auf seinem römischen Grabstein unter Pinien), und auch Jane Austen hat in Winchester ihre letzten Jahre verbracht. Sie wohnte in einem Haus unweit der imposanten Kathedrale, in der noch heute ihr Grab zu betrachten ist, eine Platte im Boden, die sich von einem zu eiligen Besucher übersehen ließe und in der Austens Romankunst mit keiner Silbe erwähnt wird. Ich pilgerte früh am Sonntagmorgen dorthin, noch vor dem ersten Gottesdienst, und der Küster war so freundlich, mir trotz der noch unbesetzten Kasse Einlass zu gewähren, sodass ich ganz allein mit den Gräbern, mit dem jungen Licht in den Buntglasfenstern und den steinernen Heiligen im gewaltigsten aller englischen Kirchenschiffe stand.
Dass Winchester ausgerechnet die Stadt von Keats und Austen ist, war auch deshalb nicht unpassend, weil ich beider Namen mit meiner vorangegangenen Reise nach England verband, einer Reise nach Cambridge nämlich, wo ich anderthalb Jahre zuvor das Fitzwilliam Museum besucht und unter dem bordeauxroten Samt einer Vitrine vollkommen unvermutet zwei Handschriften entdeckt hatte. Eine davon war erschütternderweise das Blatt Papier, auf dem Keats, offenbar wirklich in einem Durchgang und ohne größere Korrekturen, mit nur wenigen Streichungen, seine Ode to a Nightingale niedergeschrieben hatte, unter einem Baum sitzend und dem Gesang ebenjenes Vogels lauschend. Der andere Bogen war um einiges größer und, wie die zahlreichen Knickspuren zeigten, offenbar so oft gefaltet worden, bis er als winziges, viellagiges Papierpaket mit Wachs versiegelt werden konnte. Es handelte sich um einen Brief Jane Austens an ihre Schwester, verfasst während einer Rast auf einer Kutschfahrt durch England, ein langer, überbordender Brief mit einer insektenhaft zarten Handschrift, in dem, soweit ich sie zu entziffern vermochte, mit Eloquenz und Ausdauer lediglich zwei Themen verhandelt wurden — Austens Hut und die Tatsache, dass er die mühevolle Reise bislang ohne Fleck und Delle überstanden hatte, sowie das ausgezeichnete Roastbeef, das man während der besagten Pause verzehrte und dessen Qualität und Beschaffenheit mit vielen Worten beschrieben und gepriesen wurde. Kurzum: Es war ein herrliches Beispiel für die altehrwürdige Kunst des Briefeschreibens, die wir ja mit unserem kleinen Austausch wieder aufzugreifen versuchen — und der man sich vielleicht ganz allgemein wieder mit mehr Verve widmen sollte, tritt doch der Briefeschreiber, ganz wie der Dichter, einen Schritt zurück von der rasenden Hast und den weitereilenden Massen und hält für einen Augenblick die Zeit an, betrachtet, reflektiert, resümiert und wählt seine Worte mit so viel Bedacht, dass sogar das Flüchtigste Gewicht und Dauer erhält, selbst Hutmoden und Roastbeef zu Trägern einer Botschaft werden, weil sich dem Empfänger durch sie und ihre Beschreibung etwas mitteilt vom flüchtigen Moment und vom Gemüt des Absenders. Sollten wir nicht alle wieder mehr Briefe quer durch Europa schicken, mittels solcher Augenblickskapseln, über die Grenzen hin- und zurückgetragen, das Verständnis füreinander und das Wissen umeinander derart vertiefen, dass ein Missverstehen kaum noch möglich wäre? Und wer weiß, ob nicht die Entwicklung so oder so, nach all den technischen Fortschritten, in einer gewaltigen, ironischen Kreisbewegung schon bald zurückführt zu einem längst vergessenen Nachrichtenwesen, zu den Brieftauben, deren leere Türme in ganz Europa — ich denke etwa an die schönen gemauerten pigeonniers im Süden Frankreichs — sich dann erneut mit Leben füllen? Selbst urzeitlich wirkende Techniken sind ja in Wahrheit gerade mal ein paar Jahre alt, und so sollte man aus der Mode gekommene Verfahren vielleicht nicht voreilig verlachen und vergessen. Ich jedenfalls habe vor ein paar Wochen, denn sicher ist sicher, meine alte Remington-Schreibmaschine aus der Kammer geholt und zum letzten verbliebenen Reparateur Berlins gebracht, einem älteren Herrn im Stadtteil Kreuzberg, dessen kleine Werkstatt voller Olivettis und Underwoods, Triumph-Adlers und Optimas steht, lauter gewichtige, eiserne, schweigende Geräte, die den gesamten Raum mit der bleiernen Schwere eines Lokschuppens füllen. Noch könne er mir ein paar Farbbänder anbieten, noch ließen sie sich bestellen, murmelte er durch seinen gewaltigen Schnurrbart und versprach, die verhärtete und unbrauchbar gewordene Gummiwalze schleunigst durch eine frisch gegossene zu ersetzen.
Und während er meine Remington entstaubte, die Mechanik und die Tausendfüßlertastatur mit Liebe und einem profunden Wissen neu justierte, war ich bereits von Winchester zum riesigen Flughafen Heathrow zurückgekehrt und fest entschlossen, noch eine Dose von jenem hervorragenden Earl Grey zu erwerben, eine Dose Schwarztee als Souvenir aus dem noch nicht ganz abtrünnig gewordenen Königreich, erhältlich in einem speziellen und mir schon bekannten Geschäft, das sich allerdings, wie ich wusste, in Terminal 4 und nicht wie ich in Terminal 1 befand. Zum Glück hatte man mir mitgeteilt, dass der hochmoderne Flughafenzug mich trotz der äußerst knappen Zeit sicher zum Teegeschäft und wieder zurück zu meinem Abfluggate bringen werde — nur stellte sich heraus, als ich beschwingt mit meinem Tee aus dem Laden trat, dass nicht ein einziger Wegweiser den Weg zurück zu meinem Abflugterminal wies, dass der hochmoderne Zug vielmehr nur in eine einzige Richtung zu reisen erlaubte und man mit dem Betreten seiner Waggons alle Brücken hinter sich abbrach. Ein Flughafenangestellter, der ein Herz aus Gold hatte, doch ebenso ratlos war wie ich (»It’s my first day here, so sorry«), suchte mit mir nach möglichen Fuß- und Schleichwegen, erwog sogar, mir seine wertvolle Schlüsselkarte zu leihen, um mich auf unterirdischen Pfaden rechtzeitig zu meinem Flugzeug zu bringen, womit sein erster Arbeitstag jedoch auch sein letzter geworden wäre — und so blieb nur, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen, den Flughafen ganz zu verlassen und noch einmal mit der leidigen Kontroll- und Filzprozedur zu beginnen, in der Gewissheit, dass ich das Flugzeug angesichts der langen Schlangen nicht mehr erreichen und mein Koffer ohne mich nach Berlin zurückfliegen würde. Aber, oh, Albion! — wie durch ein Wunder öffnete mir mein Päckchen Tee, das ich als eine Reliquie vor mir hertrug, alle Schranken, teilte der Earl Grey die Massen, nickte man anerkennend, sobald ich die Packung hob und zu erklären versuchte, warum ich ein zweites Mal durch die Sicherheitsschleusen eilte, lächelte, sagte: »Oh, you’ve bought some tea, haven’t you?« und »Just go ahead, that’s a very fine one you’ve got there«, gingen alle Türen wie von Zauberhand auf, und das zu meinem Glück just in time.