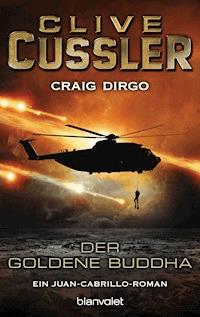
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Juan-Cabrillo-Abenteuer
- Sprache: Deutsch
Juan Cabrillo, Kapitän der »Oregon«, wird von der US-Regierung mit einer heiklen Mission betraut: Er soll eine alte Statue aufspüren, die dem Dalai Lama bei seiner Vertreibung aus Tibet im Jahre 1959 gestohlen wurde. Die verschollene Figur enthält geheime Karten und Aufzeichnungen über die tibetanischen Ölreserven und soll als diplomatisches Faustpfand eingesetzt werden, um den Dalai Lama wieder als Oberhaupt seines Heimatlandes einzusetzen …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 528
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Clive Cussler
& Craig Dirgo
Der goldene Buddha
Roman
Aus dem Englischen von Thomas Haufschild
Die englische Originalausgabe erschien unter dem Titel »Golden Buddha« bei Berkley, New York.
1. Auflage
E-Book-Ausgabe 2015 bei Blanvalet, einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH, München.
Copyright © 2003 by Sandecker, RLLLP.
„Foreword“ by Clive Cussler copyright © 2003 by Clive Cussler
All rights reserved by the Proprietor throughout the world
By arrangement with
Peter Lampack Agency, Inc.
551 Fifth Avenue, Suite 1613
New York, NY 10176-0187 USA
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2005 by Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung: © Johannes Wiebel | punchdesign, unter Verwendung von Motiven von Shutterstock.com
Redaktion: Alexander Groß
HK · Herstellung: sam
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN: 978-3-641-15211-6
www.blanvalet.de
Liebe Leser,
als ich vor ein paar Jahren an dem Roman Höllenflut arbeitete, wurde mir klar, dass Dirk Pitt bei einem speziellen Auftrag etwas Unterstützung benötigen würde, und daher ließ ich mir Juan Cabrillo einfallen.
Cabrillo befehligte ein Schiff namens Oregon, das äußerlich völlig unscheinbar wirkte, aber mit hochmoderner Nachrichtentechnik ausgestattet war und als privates Dienstleistungsunternehmen allen Regierungsbehörden zur Verfügung stand, die sich den Einsatz finanziell erlauben konnten. Die Oregon drang in Gewässer vor, die jedem regulären Kriegsschiff verwehrt blieben, und sammelte Daten oder transportierte geheime Fracht, ohne Verdacht zu erregen – sie stellte eine perfekte Ergänzung zur NUMA dar.
Es machte mir damals so viel Spaß, über die Oregon und ihren verwegenen, einbeinigen Skipper zu schreiben, dass es mir regelrecht Leid tat, sie nach erfülltem Auftrag wieder in die Weiten des Ozeans entschwinden zu sehen. Ich nahm mir fest vor, die beiden eines Tages zurückzuholen – und hier sind sie nun, wie ich Ihnen erfreut mitteilen darf. Der goldene Buddha ist der erste Titel einer neuen Romanreihe über Juan Cabrillos fröhliche Bande, und ich hoffe, Sie haben bei der Lektüre ebenso viel Vergnügen wie ich bei der Erschaffung dieser Figuren.
Und wer weiß, vielleicht werden Cabrillo und Dirk Pitt sich irgendwann wieder über den Weg laufen…
Clive Cussler
Für meine Brüder Larry, Steve, Cliff und John
sowie für meine Schwester Dawn,die sich auch an hektischen Tagennicht von ihrem Nickerchen abhalten lassen.
Vorwort
In diesem Buch geht es weder um eines von Dirk Pitts Abenteuern noch um eine NUMA-Geschichte mit Kurt Austin. Die Handlung dreht sich vielmehr um das alte Frachtschiff Oregon, das bereits in dem Pitt-Roman Höllenflut eine Rolle gespielt hat.
Hinter den heruntergekommenen Aufbauten und dem rostigen Rumpf der Oregon verbirgt sich ein wahres Wunderwerk der Technik und wissenschaftlichen Brillanz. Die Besatzung des Schiffes besteht aus intelligenten, erstklassig ausgebildeten Söldnern, die unter den vielfältigen Tarnmänteln eines ausgedehnten Firmenkonglomerats operieren und ihre Dienste Regierungen, Konzernen und Privatleuten in aller Welt anbieten. Der Kampf gegen das Böse führt sie an exotische Orte rund um den Globus, wo sie sich so mancher finsteren Bedrohung erwehren und üblen Schurken das Handwerk legen.
Craig Dirgo und ich haben gemeinsam das Konzept einer vollständig neuen Abenteuerreihe mit einzigartigen Hauptfiguren entworfen. Ich hoffe aufrichtig, dass unsere Idee bei Ihnen Anklang findet, und wünsche Ihnen eine vergnügliche Lektüre.
Clive Cussler
Die Figuren
Der Vorstand der Corporation
Juan Cabrillo: Vorsitzender
Max Hanley: Direktor
Richard Truitt: Technischer Direktor
Die Besatzung (in alphabetischer Reihenfolge)
George Adams: Hubschrauberpilot
Rick Barrett: Stellvertretender Küchenchef
Monica Crabtree: Koordinatorin für Nachschub und Logistik
Carl Gannon: Ohne spezifischen Aufgabenbereich
Chuck »Tiny« Gunderson: Pilot
Michael Halpert: Buchführung und Finanzen
Cliff Hornsby: Ohne spezifischen Aufgabenbereich
Julia Huxley: Ärztin
Pete Jones: Ohne spezifischen Aufgabenbereich
Hali Kasim: Fernmeldespezialist
Larry King: Scharfschütze
Franklin Lincoln: Ohne spezifischen Aufgabenbereich
Bob Meadows: Ohne spezifischen Aufgabenbereich
Mark Murphy: Waffenexperte
Kevin Nixon: Technischer Zauberkünstler
Sam Pryor: Antriebsingenieur
Gunther Reinholt: Antriebsingenieur
Tom Reyes: Ohne spezifischen Aufgabenbereich
Linda Ross: Sicherheit und Überwachungen
Eddie Seng: Leiter der Landoperationen
Eric Stone: Leiter des Kontrollraums
Die anderen
Dalai-Lama: Geistliches Oberhaupt Tibets
Hu Jintao: Staatspräsident der Volksrepublik China
Langston Overholt IV.: Leitender CIA-Beamter, der die Corporation beauftragt, Tibet zu befreien
Legchog Zhuren: Vorsitzender der Autonomen Region Tibet
Sung Rhee: Chefinspektor der Polizei von Macau
Ling Po: Kommissar der Polizei von Macau
Stanley Ho: Milliardär aus Macau und Käufer des goldenen Buddha
Marcus Friday: Amerikanischer Software-Milliardär, der einwilligt, den gestohlenen Buddha zu kaufen
Winston Spenser: Zwielichtiger Kunsthändler, der versucht, den goldenen Buddha zu stehlen
Michael Talbot: Kunsthändler aus San Francisco, der für Friday arbeitet
Einleitung
31. März 1959
Die Blumen rund um den Sommerpalast Norbulingka standen kurz vor der Blüte. Die parkähnliche Anlage war wunderschön. Sie war von hohen steinernen Wällen umgeben, und im Zentrum der Bäume und üppigen Gärten erhob sich eine kleinere gelbe Mauer, die nur der Dalai-Lama, seine Berater und einige auserwählte Mönche passieren durften. Hier lagen mehrere stille Weiher, das Heim des Dalai-Lama und ein Tempel für Gebete.
Es war eine Insel der Ruhe und Ordnung inmitten eines Landes in Aufruhr.
Nicht weit entfernt thronte auf einer Hügelflanke der imposante stufenförmige Winterpalast Potala, dessen wuchtige jahrhundertealte Bauten mehr als tausend Räume enthielten und viele hundert Mönche beherbergten. Die riesige Anlage war klar gegliedert: Von den mittleren Ebenen des siebengeschossigen Palastes führte eine steinerne Treppe in gleichmäßigem Zickzack hinab zu einer Mauer aus gewaltigen Steinblöcken, die am Fuß des Monumentalbaus nahezu fünfundzwanzig Meter in die Höhe ragte.
Unterhalb erstreckte sich eine flache Ebene, auf der mehrere zehntausend Tibeter ausharrten. Eine fast ebenso große Gruppe hatte sich am Norbulingka versammelt. Die Menschen waren gekommen, um ihren geistlichen Führer zu beschützen. Anders als die verhassten chinesischen Besatzer trugen die Bauern keine Gewehre, sondern Messer und Bögen. Anstelle von Artillerie verfügten sie lediglich über Tapferkeit und die Kraft ihrer Muskeln. Sie waren hoffnungslos unterlegen, aber zum Schutz ihres Oberhaupts mit Freuden bereit, das eigene Leben zu opfern.
Schon ein einziges Wort des Dalai-Lama würde genügen.
Im Tempel jenseits der gelben Mauer betete der Dalai-Lama zu Mahakala, seinem persönlichen Beschützer. Die Chinesen hatten ihm in ihrem Hauptquartier eine sichere Zuflucht angeboten, aber er wusste, dass ein anderer Beweggrund dahinter steckte. Falls er Schutz suchen musste, dann nicht bei, sondern vor den Chinesen. Soeben erst hatte der Dalai-Lama einen Brief von Ngabo Ngawang Jigme erhalten, dem Gouverneur von Chamdo. Nach einem Gespräch mit General Tan, dem chinesischen Oberbefehlshaber der Region, war Jigme davon überzeugt, dass man die Menschenansammlungen schon bald unter Einsatz von Geschützfeuer auflösen würde.
Falls es dazu kam, drohten schreckliche Verluste.
Der Dalai-Lama erhob sich, ging zu einem Tisch und läutete eine Glocke. Gleich darauf öffnete sich die Tür, und der Anführer der Kusun Depon, der persönlichen Leibwache des Dalai-Lama, trat ein. Im Vorraum warteten mehrere Sing-Gha-Krieger, Mönchspolizisten von einschüchternder Gestalt. Jeder der Männer war fast zwei Meter groß, trug einen Furcht erregenden Schnurrbart und war in ein schwarzes wattiertes Gewand gekleidet, das ihn noch massiger und unbezwingbarer wirken ließ.
Einige Dogkhyi, wilde tibetische Mastiffs, setzten sich wachsam auf.
»Verständige bitte das Orakel«, sagte der Dalai-Lama leise.
Langston Overholt III. überwachte die sich verschlimmernde Lage von seinem Haus in Lhasa aus.
Er stand neben dem Funker, während der Mann die Frequenz einstellte.
»Situation kritisch. Ende.«
Der Funker justierte die Einstellung, um die Störgeräusche zu verringern.
»Der Hahn will offenbar das Hühnerhaus betreten. Ende.«
Der Funker behielt die Skalen genau im Blick.
»Benötigen sofortige Unterstützung. Ende.«
Und wieder gab es eine leichte Verzögerung, während der Funker eine Änderung vornahm.
»Ich empfehle Adler und Kamele. Ende und aus.«
Der Mann wartete ab, das Funkgerät rauschte, und die grünen Anzeigen kehrten zu ihrem wellenförmigen Bewegungsmuster zurück. Die Botschaft war nun hinaus in den Äther gesandt; der Rest lag nicht mehr bei ihnen. Overholt wollte Flugzeuge – und zwar unverzüglich.
Dorje Drakden, das Orakel, war in tiefe Trance versunken. Durch ein kleines Fenster der hohen Tempelwand fielen die Strahlen der untergehenden Sonne herein und schufen einen hellen Pfad, der an einem Räucherfass endete. Die Weihrauchschwaden schienen auf dem Licht zu tanzen, und ein seltsam zimtartiger Geruch hing in der Luft. Der Dalai-Lama saß mit übergeschlagenen Beinen auf einem Kissen an der Wand. Ein Stück vor ihm kniete vornübergebeugt Drakden und hatte die Stirn auf den Holzboden gepresst. Plötzlich meldete das Orakel sich mit tiefer Stimme zu Wort.
»Ihr müsst aufbrechen! Noch heute Abend.«
Dann – noch immer in Trance und mit weiterhin geschlossenen Augen – stand Drakden auf, ging zu einem Tisch und blieb exakt dreißig Zentimeter davor stehen. Er streckte die Hand aus, nahm einen Federkiel, tauchte ihn in Tinte, zeichnete auf einem Blatt Papier eine detaillierte Landkarte und sackte in sich zusammen.
Der Dalai-Lama eilte an seine Seite, hob das Haupt des Mannes an und versetzte ihm einen leichten Schlag auf die Wange. Drakden kam allmählich wieder zu Bewusstsein. Nachdem der Dalai-Lama ihm ein Kissen unter den Kopf geschoben hatte, erhob er sich, schenkte aus einem Tonkrug einen Becher Wasser ein, kehrte zu dem Orakel zurück und hielt ihm das Gefäß an die Lippen.
»Trink, Dorje«, sagte er ruhig.
Der ältere Mann erholte sich langsam und setzte sich auf. Sobald der Dalai-Lama sicher war, dass Drakden keinen Schaden genommen hatte, ging er zu dem Tisch und nahm die Tintenzeichnung in Augenschein.
Es handelte sich um die genaue Fluchtroute von Lhasa zur indischen Grenze.
Overholts berufliche Laufbahn war ihm bereits in die Wiege gelegt worden, denn seine Familie hatte den Vereinigten Staaten seit dem Unabhängigkeitskrieg stets treu gedient. Sein Großvater war als Spion im amerikanischen Bürgerkrieg tätig gewesen, sein Vater im Ersten Weltkrieg und Langston III. im Zweiten Weltkrieg, zunächst beim OSS und dann bei der 1947 gegründeten CIA. Er war nun dreiunddreißig Jahre alt und hatte fast die Hälfte seines Lebens im Spionagegeschäft verbracht.
Eine dermaßen unheilvolle Situation war ihm in all den Jahren noch nie begegnet. Diesmal ging es weder um ein Adelshaus in Not noch um irgendeinen Würdenträger oder Diktator. Es ging um ein Religionsoberhaupt. Um einen Gottkönig, ein leibhaftiges höheres Wesen, das seinen Führungsanspruch bis auf das Jahr 1351 zurückführen konnte. Falls nicht bald etwas geschah, würde der Mann den Kommunisten in die Hände fallen, und das menschliche Schachspiel wäre vorbei.
Overholts Nachricht wurde im burmesischen Mandalay empfangen, nach Saigon und von dort aus nach Manila geleitet, mittels eines sicheren Tiefseekabels nach Long Beach, Kalifornien, und weiter nach Washington D.C. übertragen.
Da die Lage in Tibet sich während der letzten Jahre immer mehr zugespitzt hatte, war seitens der CIA eine geheime Eingreiftruppe in Burma stationiert worden. Die Einheit würde den Chinesen nicht lange standhalten können, war aber groß genug, einen eventuellen Vormarsch zu verlangsamen und die Heranführung schwer bewaffneter Infanteriedivisionen zu ermöglichen.
Das Geschwader operierte unter dem Tarnnamen Himalayan Air Services und bestand aus vierzehn C-47-Transportflugzeugen, von denen man vier Exemplare mit Schnellfeuerkanonen ausgestattet hatte. Hinzu kamen sechs F-86-Kampfjets und ein einzelner fabrikneuer B-52-Bomber der Firma Boeing.
Allen Dulles saß im Oval Office, rauchte seine Pfeife und schilderte Präsident Eisenhower den Stand der Dinge. Dann lehnte der CIA-Direktor sich zurück und ließ den Präsidenten eine Weile nachdenken. Es vergingen mehrere Minuten.
»Mr. President«, sagte er schließlich. »Die CIA hat sich erlaubt, in Burma eine schnelle Eingreiftruppe zu stationieren. Auf Ihren Befehl hin können die Jungs binnen einer Stunde in der Luft sein.«
Eisenhower hatte seit seiner Wahl im Jahre 1952 bereits eine Menge erlebt: die McCarthy-Anhörungen, die Entsendung erster Militärberater nach Vietnam sowie einen Herzanfall. Er war gezwungen gewesen, zehntausend Soldaten nach Little Rock, Arkansas, abzukommandieren, um dort die Aufhebung der Rassenschranken durchzusetzen; er hatte mit angesehen, wie die Sowjets die Vorreiterrolle im Weltraum übernahmen; sein Vizepräsident war in Lateinamerika von wütenden Steinewerfern empfangen worden. Und nun gab es auf Kuba, nur hundertfünfzig Kilometer vor der amerikanischen Küste, ein kommunistisches Regime. Er war müde.
»Nein, Allen«, sagte er nach kurzem Überlegen. »Ich habe als General gelernt, dass man sich seine Schlachten mit Bedacht auswählen sollte. Wir dürfen uns in Tibet vorerst nicht einmischen.«
Dulles stand auf und reichte Eisenhower die Hand. »Ich verständige meine Leute.«
Der Aschenbecher, der in Overholts Haus neben dem Funkgerät stand, quoll von filterlosen Zigarettenstummeln über. Es vergingen einige Stunden ohne Nachricht, abgesehen von der Bestätigung, dass die Funkmeldung empfangen worden sei. Alle dreißig Minuten überbrachten tibetische Gewährsmänner neue Informationen. Man konnte beobachten, dass die Menschenmengen vor den Palästen bei Lhasa immer mehr anwuchsen, wenngleich eine präzise Zählung unmöglich war. Aus den Bergen eilten unaufhörlich weitere Tibeter herbei, versehen mit Knüppeln, Steinen und Messern. Für die gut bewaffneten Chinesen stellte die wogende Masse lediglich Kanonenfutter dar.
Bislang hatten die Soldaten nichts unternommen, aber auf den Zufahrtstraßen der Stadt waren erste Truppenkontingente gesichtet worden. Vor fünf Jahren hatte Overholt in Guatemala eine ähnliche Situation erlebt. Damals war eine Demonstration von Anhängern der antikommunistischen Rebellen unter Carlos Armas unvermittelt außer Kontrolle geraten. Um das Chaos wieder in den Griff zu bekommen, hatten die Soldaten des Präsidenten Jacobo Arbenz das Feuer eröffnet, und noch vor Anbruch des nächsten Tages war in den Krankenhäusern und Leichenhallen kein einziger Platz mehr frei gewesen. Overholt hatte die besagte Demonstration organisiert, und die Erinnerung daran lag wie eine schwere Last auf seinen Schultern.
In diesem Moment erwachte das Funkgerät zum Leben.
»Anfrage negativ. Ende.«
Overholts Atem stockte. Die Flugzeuge, um die er gebeten hatte, würden nicht kommen.
»Papa Bär wird bei Abreise den Weg freiräumen, falls unbedingt nötig. Erwarten Zeitpunkt und Route. Ende.«
Eisenhower hat einen Angriff auf Lhasa untersagt, dachte Overholt, aber Dulles hat eigenmächtig entschieden, die Flucht aus Tibet gegebenenfalls militärisch abzusichern. Falls ich mich halbwegs geschickt anstelle, kann ich meinem Boss diese unangenehme Situation ersparen.
»Sir?«, fragte der Funker.
Overholt wurde unsanft aus seinen Gedanken gerissen.
»Man wartet auf Ihre Antwort«, fügte der Funker hinzu.
Overholt griff nach dem Mikrofon. »Verstanden und bestätigt«, sagte er. »Wir danken Papa Bär für die nette Geste, brechen hier unsere Zelte ab und melden uns von unterwegs. Ende und aus.«
Der Funker blickte zu Overholt empor. »Ich schätze, das war’s dann wohl.«
»Packt alles zusammen«, sagte Overholt ruhig. »Wir machen uns bald auf den Weg.«
Die Vorbereitungen zur Flucht des Dalai-Lama ins Exil gingen mit hektischer Geschwindigkeit voran. Overholt wurde von den Wachposten in den Schutz der gelben Mauer vorgelassen und wartete geduldig. Fünf Minuten später betrat der Dalai-Lama das Büro im Verwaltungstrakt. Der geistliche Führer Tibets trug seine schwarze Hornbrille und das gelbe Mönchsgewand. Er wirkte erschöpft, aber gefasst.
»Ich sehe es Ihrem Gesicht an, dass keine Hilfe kommt«, stellte er ruhig fest.
»Es tut mir Leid, Euer Heiligkeit«, erwiderte Overholt. »Ich habe getan, was ich konnte.«
»Ja, Langston, davon bin ich überzeugt. Wie dem auch sei, die Lage ist nun mal, wie sie ist, und daher habe ich beschlossen, ins Exil zu gehen. Ich kann nicht riskieren, dass mein Volk womöglich niedergemetzelt wird.«
Overholt hatte erwartet, den Dalai-Lama mit Engelszungen zur Flucht überreden zu müssen – stattdessen war diese Entscheidung längst gefallen. Bei genauerer Überlegung hätte er es sich eigentlich denken können – im Laufe der Jahre war der Dalai-Lama ihm immer vertrauter geworden und hatte dabei nie Zweifel an seiner Hingabe an das tibetische Volk aufkommen lassen.
»Meine Leute und ich würden Sie gern begleiten«, bot Overholt an. »Wir verfügen über genaue Landkarten, Funkgeräte und ausreichend Proviant.«
»Sehr gern«, sagte der Dalai-Lama. »Wir brechen in Kürze auf.«
»Ich wünschte, ich hätte mehr bewirken können«, sagte Overholt.
»Die Dinge sind wie sie sind«, erwiderte der Dalai-Lama. »Sie sollten nun lieber Ihre Männer holen. Wir treffen uns am Fluss.«
Am Himmel hoch über dem Norbulingka funkelte eine Billion Sterne. Der Mond, der sich fast vollständig gerundet hatte, warf einen trüben gelben Schimmer. Alles war still, nichts regte sich. Kein Nachtvogel sang sein betörendes Lied. Die zahmen Tiere im Innern der Anlage – Moschushirsche, Bergziegen, Kamele, ein einzelner bejahrter Tiger und die frei laufenden Pfauen – rührten sich kaum. Ein leichter Wind wehte vom Himalaja herab und brachte den Duft von Kiefernwäldern mit sich. Die bevorstehende Veränderung schien fast greifbar zu sein.
Auf einem hohen Bergrücken außerhalb von Lhasa ertönte der markerschütternde Schrei eines Schneeleoparden.
Der Dalai-Lama ließ den Blick über seine Umgebung schweifen, schloss die Augen und stellte sich vor, dass er eines Tages zurückkehren würde. Statt Mönchsgewand und Umhang trug er eine Hose und einen schwarzen Wollmantel. Über seinem linken Arm hing ein Gewehr, und auf der rechten Schulter lag ein zusammengerolltes uraltes Thangka, ein besticktes zeremonielles Seidengemälde.
»Ich bin so weit«, sagte er zu seinem Chikyah Kenpo, dem Stabschef. »Habt ihr die heilige Statue eingepackt?«
»Sie befindet sich wohlbehalten in einer Kiste und wird bewacht. Die Männer werden sie unter allen Umständen beschützen, genau wie Ihr.«
»So soll es sein«, sagte der Dalai-Lama sanft.
Sie gingen los und durchschritten das Tor der gelben Mauer.
Der Chikyah Kenpo hielt ein großes, mit Edelsteinen besetztes Krummschwert in der Hand. Er steckte es in die Lederscheide an seinem Gürtel und wandte sich an seinen Herrn. »Bleibt in meiner Nähe.«
Dann ließen sie auch das äußere Tor hinter sich und verschwanden in der Menge, gefolgt von einer Abteilung Kusun Depon. Schnellen Schrittes bogen sie auf einen ausgetretenen Pfad ein. Zwei Kusun Depon blieben zurück und hielten nach etwaigen Verfolgern Ausschau. Als sie niemanden entdecken konnten, eilten sie den anderen hinterher und passierten ein weiteres Postenpaar, das den nächsten Abschnitt des Wegs sicherte. So wurde abwechselnd der Rückzug gedeckt, und auch die Vorhut der Gruppe arbeitete auf gleiche Weise. Den Abschluss des Zuges bildete ein Handkarren, auf dem sich die Statue befand. Ein kräftiger Mönch hatte beide Hände fest um die Stangen des Wagens geschlossen und lief flink voran, als wäre er ein säumiger Rikschafahrer.
Alle verfielen in Laufschritt, und das Geräusch ihrer Füße glich gedämpftem Beifallklatschen.
Dann hörte man Wasser rauschen und roch nasses Moos. Es war ein Seitenarm des Flusses Kyichu. Über einige Trittsteine gelangten alle ans andere Ufer und eilten sogleich weiter.
Jenseits des Kyichu sah Overholt auf das Leuchtzifferblatt seiner Uhr und trat von einem Bein aufs andere. Einige Dutzend Kusun Depon, die man Stunden zuvor ausgesandt hatte, hielten Pferde und Maultiere bereit, die die weitere Flucht beschleunigen sollten. Wenn die Blicke der Männer auf den blonden Amerikaner fielen, lagen darin weder Zorn noch Angst, nur Schicksalsergebenheit.
Mehrere große Fährkähne hatten sie alle ans diesseitige Ufer gebracht, und nun lagen die Boote wieder auf der anderen Seite bereit und erwarteten die Ankunft des Dalai-Lama. Overholt sah ein Licht aufblitzen, das die sichere Überfahrt ankündigte. Die Boote wurden im Mondschein hastig beladen, und wenige Minuten später hörte er, wie die Ruder ins Wasser eintauchten.
Der erste Kahn glitt auf den Uferkies, und der Dalai-Lama stieg aus.
»Langston«, sagte er. »Sind Sie unbemerkt aus der Hauptstadt entwischt?«
»Ja, Euer Heiligkeit.«
»Befinden sich all Ihre Leute bei Ihnen?«
Overholt wies auf die sieben Angehörigen seines Teams. Sie standen abseits neben einigen Kisten mit Ausrüstungsgegenständen. Der Chikyah Kenpo erreichte ebenfalls das Ufer und ließ die Vorhut aufsitzen. Die Männer nahmen lange Lanzen mit seidenen Bannern. Ihre Pferde waren mit zeremoniellen Decken und prächtigem Zaumzeug geschmückt. Dann ertönte ein halblautes Trompetensignal, das wie der Ruf einer Gans auf dem Weg nach Süden klang. Es war Zeit für den Aufbruch.
Man half Overholt und seinen Männern beim Aufsteigen. Dann reihten sie sich hinter dem Dalai-Lama ein. Als die Sonne am Morgen aufging, lag Lhasa bereits viele Kilometer hinter ihnen.
Zwei Tage später. Der viertausendachthundert Meter hohe Pass namens Che-La sowie der Fluss Tsangpo lagen hinter den Reisenden, und die Gruppe schlug ihr Nachtlager im Kloster Ra-Me auf. Berittene Boten brachten die Nachricht, dass die Chinesen den Norbulingka mit Artillerie beschossen und die wehrlose Menge unter Maschinengewehrfeuer genommen hatten. Es gab Tausende von Opfern zu beklagen. Der Dalai-Lama wurde leichenblass.
Overholt hatte den Fortgang der Reise über Funk gemeldet und war erleichtert, dass sie bisher ohne Unterstützung zurechtkamen. Die Route war überaus geschickt gewählt worden und führte an den chinesischen Stellungen vorbei. Er und seine Männer waren erschöpft, aber die zähen Nepalesen drängten sie rastlos weiter, vorbei an dem Ort Lhuntse Dzong und dem Dorf Jhora.
Der Karpo-Pass und die indische Grenze waren weniger als einen Tagesritt entfernt.
Und dann fing es an zu schneien. Über Mangmang, der letzten tibetischen Stadt vor der Grenze, lauerte ein Schneesturm mit heulendem Wind und tiefen Wolken. Der Dalai-Lama, dem die anstrengende Reise und das Wissen um den Tod zahlloser Landsleute zugesetzt hatten, wurde krank. Seine letzte Nacht in der Heimat verlief qualvoll.
Um ihm den weiteren Verlauf etwas zu erleichtern, setzte man ihn auf den Rücken eines Dzomo, eines Mischlings aus Yak und Rind. Während des Aufstiegs zum Pass wandte der Dalai-Lama sich ein letztes Mal zu seinem geliebten Tibet um.
Overholt ritt näher heran und wartete, bis der Blick des Dalai-Lama auf ihn fiel. »Mein Land vergisst nie«, versprach er. »Eines Tages bringen wir Euch zurück nach Hause.«
Der Dalai-Lama nickte, tätschelte den Hals des Dzomo und ritt voran ins Exil. Am Ende der Kolonne überquerte der Mönch mit dem Handkarren die Passhöhe und musste beim Abstieg Acht geben. Das kostbare, fünf Zentner schwere Artefakt hatte sich auf dem Weg nach oben kaum von der Stelle rühren wollen, und nun machte es sich beinahe selbständig. Der Mann stemmte sich gegen die Last.
1
Gegenwart
Zwanzig Uhr. Gleich einem dunklen Insekt, das gemächlich über eine gekräuselte blaue Tischdecke krabbelte, stampfte aus Süden ein rostiges altes Frachtschiff durch die karibische Dünung auf die Hafeneinfahrt der kubanischen Stadt Santiago zu. Aus seinem einzelnen Schornstein stiegen bläuliche Rauchschwaden empor und wurden von einer leichten Brise nach Osten verweht, während die sinkende Sonne sich dicht über dem westlichen Horizont in einen großen orangefarbenen Glutball verwandelte.
Es war eines der letzten dampfbetriebenen Trampschiffe, kreuzte unauffällig auf allen Weltmeeren und steuerte exotische Ziele auf dem gesamten Globus an. Schiffe dieser Art waren selten geworden. Sie wurden nicht im Linienverkehr eingesetzt, sondern transportierten ihre wechselnden Frachten je nach Auftrag zu immer neuen Bestimmungsorten. Sie liefen einen Hafen an, löschten ihre Ladung und verschwanden wieder wie Gespenster in der Nacht.
Drei Kilometer vor der Küste näherte sich dem Schiff ein kleines Motorboot und ging auf parallelen Kurs. Als es neben dem verrosteten Rumpf längsseits kam, wurde aus einer offenen Luke ein Fallreep herabgelassen.
Der Lotse, ein Mittfünfziger mit brauner Haut und dichtem grauem Haar, blickte an dem uralten Schiff hinauf. Der schwarze Anstrich war verblichen und hätte dringend abgeschliffen und erneuert werden müssen. Von jeder Öffnung im Rumpf verliefen breite Rostspuren nach unten. Der riesige Anker, der oben in seiner Klüse hing, war vollständig korrodiert. Die Aufschrift am oberen Bug ließ sich kaum noch entziffern. Der müde alte Frachter hieß Oregon.
Jesus Morales schüttelte verblüfft den Kopf. Es kam ihm wie ein Wunder vor, dass man dieses Schiff nicht schon vor zwanzig Jahren verschrottet hatte. Die Oregon wirkte eher wie ein Wrack als wie ein Frachter im aktiven Dienst. Er fragte sich, ob die Parteibürokraten im Transportministerium überhaupt wussten, in welchem Zustand sich das Schiff befand, das ihnen laut Vertrag eine Ladung Kunstdünger für die Zuckerrohr- und Tabakfelder liefern sollte. Kaum zu glauben, dass es die Inspektion der Seeversicherung bestanden hatte.
Als das Schiff nun fast vollständig zum Stillstand kam, ging Morales zur Reling und sah, wie die Stoßfänger des Lotsenboots sich an den Rumpf des Frachters quetschten. Er wartete ab, bis eine Woge das Boot anhob, sprang vom nassen Deck flink auf das Fallreep und kletterte zur Luke empor. So etwas machte er bis zu zehnmal am Tag. Oben am Einstieg warteten zwei Besatzungsmitglieder und halfen ihm an Bord. Die beiden waren auffallend stämmig und hatten zur Begrüßung nicht mal ein Lächeln für ihn übrig. Stattdessen deutete einer der Männer lediglich auf die Leiter, die zur Brücke führte. Dann gingen die beiden weg und ließen Morales allein zurück. Er schaute ihnen hinterher und hoffte, er müsse ihnen nie in einer dunklen Gasse begegnen.
Morales blieb kurz stehen und ließ den Blick über die Aufbauten des Schiffes schweifen.
Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung und umfassenden Fachkenntnisse schätzte er die Länge der Oregon auf hundertsiebzig Meter – bei etwa dreiundzwanzig Metern Breite. Somit ergab sich ein ungefährer Bruttotonnengehalt von 11000. Fünf Auslegerkräne, zwei hinter dem Schornstein und den Aufbauten sowie drei auf dem Vorderdeck, standen zur Entladung der Fracht bereit. Morales zählte sechs Laderäume mit zwölf Luken. In ihrer Blütezeit hätte man die Oregon wohl als Expressfrachter klassifiziert. Bau und Stapellauf mussten Anfang der sechziger Jahre erfolgt sein. Am Heck wehte die iranische Flagge. Diese Registrierung hatte Morales noch nicht allzu oft gesehen.
Vom Wasser aus wirkte die Oregon nur ziemlich heruntergekommen, doch hier auf dem Hauptdeck bot sich ein Anblick absoluter Verwahrlosung. Jede Winde und Kette war von Rost überzogen, wenngleich die Geräte immerhin funktionstüchtig zu sein schienen. Die Kräne hingegen sahen aus, als habe man sie schon seit Jahren nicht mehr benutzt.
Wie um den Eindruck noch zu verschlechtern, lagen überall alte Werkzeuge, verbeulte Fässer und andere schrottreife Gegenstände herum. Während all der Jahre als Hafenlotse hatte Morales noch nie ein dermaßen verkommenes Gefährt gesehen.
Er stieg die Stufen zur Brücke empor, vorbei an Schotten, von denen die Farbe abblätterte, und Bullaugen, deren Scheiben geborsten und fast blind waren. Bevor er die Tür aufstieß, atmete er tief durch. Im Innern des Schiffes war es genauso übel, wenn nicht noch schlimmer. Das Ruderhaus starrte vor Dreck. Die Konsolen und der einst glänzende Teakholzboden waren mit den Brandspuren zahlloser Zigaretten übersät. Auf den Fensterbrettern lagen tote Fliegen, und ein beißender Gestank hing in der Luft. Und dann war da noch der Kapitän.
Morales sah sich einem wahren Koloss gegenüber, dessen gewaltiger Bauch weit über den Gürtel hing. Das Gesicht war voller Narben, die Nase nach einem Bruch nicht richtig verheilt und nun deutlich zur linken Wange geneigt. Der Mann hatte sich das dichte schwarze Haar mit irgendeiner schmierigen Pomade nach hinten gekämmt, und sein Vollbart war ungepflegt und verfilzt. Außerdem schillerte der Kerl in allen möglichen Farben: Seine Augen waren rot, die Zähne gelbbraun und die Arme mit blauen Tätowierungen verziert. Er trug einen schmutzigen Overall, und auf seinem Hinterkopf klebte eine fleckige Kapitänsmütze. Da es hier auf der Brücke keine Klimaanlage gab, herrschten tropische Hitze und hohe Luftfeuchtigkeit. Morales konnte riechen, dass der Fremde sich seit mindestens einem Monat nicht mehr gewaschen hatte. Jeder hergelaufene Straßenköter hätte versucht, den Kerl irgendwo zu verscharren.
Der Mann streckte Morales eine schweißnasse Hand entgegen. »Willkommen an Bord«, sagte er auf Englisch. »Ich bin Käpt’n Jed Smith.«
»Jesus Morales. Lotse der Hafenbehörde von Santiago.« Er fühlte sich unwohl. Smith sprach englisch mit amerikanischem Akzent – auf einem Schiff, das unter iranischer Flagge fuhr. Mit so etwas hatte Morales nicht gerechnet.
Smith reichte ihm einen Stapel Papiere. »Unsere Registrierung und das Ladungsverzeichnis.«
Morales warf nur einen kurzen Blick auf die Dokumente. Die Hafenbehörde würde sich genauer damit befassen. Ihn interessierte lediglich, ob das Schiff zur Einfahrt in den Hafen berechtigt war. Er gab die Papiere zurück. »Wollen wir anfangen?«
Smith wies auf ein hölzernes Steuerrad, das für ein Schiff aus den sechziger Jahren schrecklich antiquiert wirkte. »Sie gehört Ihnen, Señor Morales. An welchem Kai sollen wir festmachen?«
»Es wird erst am Donnerstag ein Anlegeplatz frei. Bis dahin werden Sie im Hafenbecken vor Anker gehen müssen.«
»Das sind noch vier Tage. Was ist mit unserem Terminplan? Wir können es uns nicht leisten, so lange untätig herumzusitzen und auf die Entladung unserer Fracht zu warten.«
Morales zuckte die Achseln. »Ich habe keinen Einfluss auf den Hafenmeister. Seit der Aufhebung des Embargos treffen zahlreiche Lieferungen mit landwirtschaftlichen Geräten und Automobilen ein. Die genießen gegenüber Ihrer Fracht Priorität.«
Smith hob beide Hände. »Na gut. Es ist nicht das erste Mal, dass wir uns in Geduld üben müssen.« Er grinste breit und ließ die fauligen Zähne aufblitzen. »Meine Männer und ich werden wohl einfach an Land gehen und uns mit den kubanischen Frauen anfreunden.«
Der Gedanke verursachte Morales eine Gänsehaut. Wortlos trat er ans Ruder, während Smith den Maschinenraum anwies, mit halber Kraft Fahrt aufzunehmen. Der Lotse spürte die Vibrationen des Motors, und das müde alte Schiff setzte sich in Bewegung. Morales richtete den Bug auf die schmale, von hohen Klippen gesäumte Hafeneinfahrt von Santiago aus.
Die Fahrrinne, die bis in das ausladende Hafenbecken verlief, war von See aus erst im letzten Moment zu erkennen. Auf den Klippen zur Rechten ragten in sechzig Metern Höhe die Mauern der alten Kolonialfestung Morro auf.
Morales bemerkte, dass Smith und einige Mitglieder seiner schäbigen Besatzung sich für die Verteidigungsanlagen zu interessieren schienen, die Fidel Castro vor vielen Jahren auf den Hängen installiert hatte, um einem möglichen Angriff der Vereinigten Staaten vorzubeugen. Die Männer betrachteten die Geschütze und Raketenstellungen durch teure Ferngläser.
Der Lotse lächelte. Sollten sie sich ruhig die Hälse verrenken – die meisten der Stellungen waren verlassen. Lediglich eine einzige Kompanie Soldaten blieb in zwei kleinen Bastionen stationiert, um die Raketenwerfer bemannen zu können, falls ein unerwünschtes Schiff sich Zutritt zum Hafen verschaffen wollte. Aber das war ziemlich unwahrscheinlich.
Morales schlängelte die Oregon zwischen den Bojen hindurch und ließ sie geschickt den Windungen des Kanals folgen, der wenig später in den breiten runden Hafen mündete, hinter dem sich die Stadt Santiago erstreckte. Das Steuerrad fühlte sich irgendwie merkwürdig an. Die Veränderung war kaum merklich, aber sie war eindeutig da. Immer wenn er das Rad drehte, schien das Ruder etwas verspätet zu reagieren. Morales steuerte ein kleines Stück nach rechts und gleich wieder zurück. Da war es erneut, fast wie ein Echo, eine Verzögerung von zwei Sekunden. Es kam ihm nicht wie ein schwergängiges Rudergestänge, sondern eher wie eine Pause vor. Die Ursache musste eine andere sein. Sobald die Reaktion einsetzte, war sie flink und präzise. Aber wieso dieser Zeitunterschied?
»Ihr Steuer verhält sich seltsam.«
»Ja«, bestätigte Smith. »Das geht schon ein paar Tage so. Im nächsten Hafen mit Werft lasse ich die Ruderwelle überprüfen.«
Das ergab für Morales noch immer keinen Sinn, aber das Schiff erreichte nun die Bucht, und so schob er den Gedanken beiseite. Er setzte sich über Funk mit der Hafenbehörde in Verbindung, gab einen kurzen Lagebericht durch und ließ sich einen Ankerplatz zuweisen.
Morales zeigte Smith die Bojen, mit denen der Liegebereich markiert war, und ordnete langsame Fahrt an. Dann schwang er das Heck herum, bis der Bug auf die einlaufende Flut wies, und ließ die Maschine abschalten. Die Oregon kam zwischen einem kanadischen Containerschiff und einem libyschen Öltanker zum Stehen.
»Sie können jetzt vor Anker gehen«, sagte der Lotse.
Smith nickte und hob ein Mikrofon an den Mund. »Anker los!«
Einige Sekunden später hörte man die Kettenglieder rasselnd durch die Klüse laufen, gefolgt von einem lauten Platschen, mit dem der Anker ins Wasser fiel. Der Bug des Schiffs wurde in eine Wolke aus Staub und Rostpartikeln gehüllt, die aus dem Windengehäuse der Ankerkette aufstob.
Morales ließ das abgewetzte Steuerrad los und wandte sich zu Smith um. »Bitte entrichten Sie die Lotsengebühr, wenn Sie die Papiere bei der Hafenbehörde einreichen.«
»Warum so lange warten?«, schnaubte Smith. Er griff in eine Tasche seines Overalls, holte ein Bündel zerknitterter Hundertdollarscheine daraus hervor, zählte fünfzehn Scheine ab, zögerte und sah Morales ins verblüffte Gesicht. »Ach, was soll’s. Ich würde sagen, wir einigen uns auf glatte zweitausend.«
Morales zögerte keine Sekunde, nahm das Geld und verstaute es in seiner Brieftasche.
»Sie sind überaus großzügig, Kapitän Smith. Ich werde der Behörde mitteilen, dass die Lotsengebühr in voller Höhe entrichtet wurde.«
Smith unterzeichnete die erforderlichen Papiere und vermerkte den Liegeplatz im Logbuch. Dann legte er dem Kubaner einen massigen Arm um die Schultern. »Jetzt zu den Mädchen. Wo in Santiago werden wir am ehesten fündig?«
»Ich empfehle Ihnen die Etablissements im Hafenviertel. Dort gibt es leichte Unterhaltung und billige Drinks.«
»Ich richte es meiner Besatzung aus.«
»Auf Wiedersehen, Kapitän.« Morales streckte nicht die Hand aus. Bereits die bloße Anwesenheit auf diesem Schiff ließ ihn sich besudelt fühlen, und er konnte sich einfach nicht überwinden, die schmierige Pranke dieses abscheulichen Kapitäns zu schütteln. Seine lockere und warmherzige kubanische Wesensart war in dieser Umgebung deutlich abgekühlt, und er wollte keine weitere Sekunde an Bord der Oregon verschwenden. Er verließ die Brücke, stieg die Leiter zum Deck hinunter und sogleich weiter in das wartende Lotsenboot. Noch immer kam er sich wie betäubt vor. Dies war das bei weitem ekelhafteste Schiff, das er je in den Hafen manövriert hatte. Was exakt dem Eindruck entsprach, den die Eigentümer der Oregon erwecken wollten.
Falls Morales genauer hingesehen hätte, wäre ihm die Täuschung vielleicht bewusst geworden. Das Schiff lag nur deswegen so tief im Wasser, weil spezielle Ballasttanks geflutet worden waren, um volle Frachträume vorzugaukeln. Sogar die vermeintlichen Vibrationen des Motors wurden künstlich erzeugt. Die echten Maschinen der Oregon waren flüsterleise und vollkommen schwingungsfrei.
Und die Rostschicht, die den gesamten Rumpf und die Aufbauten überzog? Die bestand aus kunstvoll angebrachter Farbe.
Kapitän Smith verfolgte zufrieden, wie das Lotsenboot von der Oregon ablegte. Dann ging er zu einer Reling, die keinem bestimmten Zweck zu dienen schien, und betätigte einen verborgenen Schalter an der Unterseite. Ein quadratisches Stück des Decks sank mit dem Kapitän unvermittelt in den Rumpf hinab und kam in einem großen, hell erleuchteten Raum zum Stillstand. Hier gab es zahlreiche Computer, automatische Steuerungsvorrichtungen sowie mehrere große Schaltpulte, mittels derer die Kommunikations- und Waffensysteme kontrolliert wurden. Der Boden der Kommandozentrale war mit dickem Teppich ausgelegt, die Wände waren mit exotischen Hölzern vertäfelt, und das Mobiliar schien direkt aus dem Ausstellungsraum eines Designers zu stammen. Dieser Ort war das wahre Herz der Oregon.
Sechs Personen – vier Männer und zwei Frauen –, adrett gekleidet in Shorts, geblümte Hemden und weiße Blusen, ließen die Systeme nicht aus den Augen. Eine Frau saß vor einer Reihe von Bildschirmen, auf denen die gesamte Bucht von Santiago zu sehen war, während ein Mann mit einer Kamera das Lotsenboot heranzoomte, das soeben wendete und die Fahrrinne ansteuerte. Niemand würdigte den fetten Kapitän auch nur eines Blickes. Nur ein Mann in khakifarbenen Shorts und grünem Golfhemd kam auf ihn zu.
»Ging mit dem Lotsen alles glatt?«, fragte Max Hanley, der Direktor des Schiffes, der für die Einsatzfähigkeit sämtlicher Systeme verantwortlich zeichnete.
»Ihm ist die Verzögerung beim Ruder aufgefallen.«
Hanley grinste. »Wenn ihm bewusst gewesen wäre, dass er an einem nutzlosen Stück Holz herumgekurbelt hat… Dennoch müssen wir die Anlage ein wenig nachjustieren. Hast du dich mit ihm auf Spanisch unterhalten?«
Smith lächelte. »Nein, in bestem Yankee-Englisch. Warum sollte ich ihn wissen lassen, dass ich seine Sprache beherrsche? Auf diese Weise konnte ich überprüfen, ob er beim Funkkontakt mit der Hafenbehörde irgendwelche Tricks versuchen würde.« Smith schob den Ärmel seines schmutzigen Overalls zurück und sah auf das Zifferblatt einer Armbanduhr Marke Timex mit stark zerkratztem Glas. »Noch eine halbe Stunde bis Sonnenuntergang.«
»Am Tauchbecken ist alles bereit.«
»Und das Landungsteam?«
»Ebenfalls.«
»Da bleibt mir gerade noch genug Zeit, um diese stinkende Kluft loszuwerden und mich hübsch zu machen«, sagte Cabrillo und bog in den Korridor zu seiner Kabine ein, an dessen Wänden Gemälde zeitgenössischer Künstler hingen.
Die Unterkünfte der Besatzung waren in zwei der Frachträume verborgen und so komfortabel wie in einem FünfSterne-Hotel eingerichtet. Auf der Oregon wurde nicht zwischen Offizieren und der Mannschaft unterschieden. Bei den Besatzungsmitgliedern handelte es sich durchweg um gebildete Männer und Frauen, die auf ihren jeweiligen Fachgebieten Höchstleistungen vollbrachten – Elitepersonal, das einst in den Streitkräften gedient hatte. Das Schiff gehörte seiner Mannschaft; alle waren Anteilseigner. Es gab keine Dienstränge. Cabrillo fungierte als Vorsitzender, Hanley als Direktor; die anderen hatten diverse weitere Positionen inne. Sie alle waren Söldner und wollten Geld verdienen, wenngleich das nicht unbedingt ausschloss, die eine oder andere gute Tat zu vollbringen. Ihre Auftraggeber waren Regierungen oder große Konzerne, und ihre geheimen und zumeist überaus riskanten Unternehmungen führten sie um die ganze Welt.
Der Mann, der zwanzig Minuten später die Kabine verließ, sah nicht so aus wie der Mann, der sie betreten hatte. Die schmierige Perücke, der struppige Bart und der dreckige Overall waren verschwunden, desgleichen der unangenehme Geruch. Statt der Timex trug er nun einen stählernen Chronograph der Marke Concord. Zudem schien er mindestens fünfzig Kilo Gewicht verloren zu haben.
Juan Rodriguez Cabrillo hatte sich von dem abstoßenden Kapitän Smith wieder in sein wahres Selbst verwandelt: einen hoch gewachsenen Mann Mitte vierzig, rau und stattlich, mit stechenden blauen Augen. Sein blondes Haar war kurz geschoren, und ein Schnurrbart zog sich von der Oberlippe seitlich an den Mundwinkeln herab.
Er eilte den Gang entlang zu einer Tür und betrat einen Kontrollraum in der Mitte des Schiffs, der hoch über einer gewaltigen Halle lag. Ihre Höhe betrug drei Decks, und sie diente als Lager für die gesamte Unterwasserausrüstung der Oregon: Tauchgeräte, bemannte und unbemannte Fahrzeuge sowie eine Reihe elektronischer Messvorrichtungen. Auf großen Stahlschlitten lagen zwei hochmoderne U-Boote des Herstellers U.S. Submarines: eine zwanzig Meter lange Nomad 1000 und eine zehn Meter lange Discovery 1000. Die Luke im Boden des Rumpfs glitt auf, und Wasser strömte ein, bis es sich auf einer Höhe mit der äußeren Wasserlinie befand.
Das bemerkenswerte Schiff war nicht, was es von außen zu sein schien. Man hatte Aufbauten und Rumpf getarnt, um es wie einen rostigen Seelenverkäufer aussehen zu lassen. Das Ruderhaus und die unbenutzten Mannschaftsquartiere am Oberdeck wurden absichtlich verdreckt und verunstaltet, um beim Besuch eines Hafenbeamten oder Lotsen keinen Verdacht zu erregen.
Cabrillo ging in der Zentrale für Unterwassereinsätze zu einem großen Tisch, auf dem dreidimensionale Hologramme einer jeden Straße der Stadt Santiago zu sehen waren. Linda Ross, die Spezialistin für Sicherheits- und Überwachungsfragen, unterwies dort soeben mehrere Leute, die Arbeitsanzüge des kubanischen Militärs trugen. Linda war im Rang eines Lieutenant Commander für die amerikanische Kriegsmarine tätig gewesen, bis Cabrillo sie überredet hatte, den Dienst zu quittieren und sich der Oregon anzuschließen. In ihrer militärischen Laufbahn hatte sie zunächst als Nachrichtenoffizierin an Bord eines Aegis-Lenkwaffenkreuzers gearbeitet und dann vier Jahre in der Washingtoner Geheimdienstzentrale der Navy zugebracht.
Cabrillo stellte sich wortlos zu den anderen. Linda warf ihm einen kurzen Blick zu. Sie war eine attraktive Frau, nach der ein Mann sich zwar nicht unbedingt den Kopf verdrehen würde, die den meisten aber dennoch als hübsch galt. Ihren einen Meter dreiundsiebzig großen und neunundfünfzig Kilogramm schweren Körper hielt sie mit stetem Training in Form, verwendete aber nur selten Zeit darauf, sich zu schminken oder zu frisieren. Sie war sehr klug und von einnehmendem Wesen; alle an Bord der Oregon hielten große Stücke auf sie.
Die fünf Männer und die Frau, die nun neben dem detaillierten 3D-Abbild der Stadt standen, hörten aufmerksam zu, als Linda ein letztes Mal den bevorstehenden Einsatz durchging und dabei mit einem kleinen Leuchtstab auf ein bestimmtes Gebäude wies. »Die Festung Santa Ursula. Sie wurde während des spanisch-amerikanischen Krieges erbaut und diente im zwanzigsten Jahrhundert als Warenlager, bis Castro und seine Revolutionäre die Macht übernahmen und dort ein Gefängnis einrichteten.«
»Wie lang genau ist die Strecke zwischen unserem Landungspunkt und dem Gefängnis?«, fragte Eddie Seng, der für seine Gerissenheit berüchtigte Leiter der Landoperationen.
»Eintausendvierhundertsechsundzwanzig Meter«, antwortete Linda.
Seng verschränkte nachdenklich die Arme. »Auf dem Hinweg dürfte es uns dank unserer Uniformen gelingen, die Einheimischen zu täuschen, aber falls wir uns dann mit achtzehn Gefangenen zurück zum Kai durchschlagen müssen, könnte es eng werden.«
»Vor allem angesichts des Zustands dieser armen Leute«, warf Julia Huxley ein, die Ärztin der Oregon. Sie würde an dem Einsatz teilnehmen, um sich um die Häftlinge zu kümmern. Die klein gewachsene Frau mit der beachtlichen Oberweite und der Statur einer Ringerin war an Bord die Mutter der Kompanie. Sie hatte als leitende Medizinerin vier Jahre im Marinestützpunkt von San Diego gearbeitet und wurde von allen gemocht.
»Unsere Kontaktmänner haben veranlasst, dass zwanzig Minuten vor unserem Aufbruch ein Lastwagen gestohlen wird. Normalerweise beliefert er die Hotels mit Lebensmitteln. Der Laster samt Fahrer wird einen Block jenseits des Geräteschuppens warten, der oberhalb des Landungspunkts steht. Der Mann bringt euch zum Gefängnis, wartet und fährt euch dann zurück zum Kai. Dort wird er den Wagen zurücklassen und mit seinem Fahrrad nach Hause fahren.«
»Hat er einen Namen? Gibt es ein Losungswort?«
Linda lächelte. »Die Parole lautet dos.«
Seng wirkte skeptisch. »Zwei? Das ist alles?«
»Ja. Er wird mit uno antworten. Ganz einfach.«
»Nun ja, zumindest ist es prägnant.«
Linda nahm eine kleine Fernbedienung und betätigte mehrere Knöpfe. Die Bilder der Stadt wichen einer Darstellung des Inneren von Santa Ursula ohne Dach, so dass man alle Räume, Zellen und Gänge erkennen konnte. »Laut unseren Quellen gibt es im gesamten Gefängnis nur zehn Wärter. Sechs in der Tagschicht, zwei abends und zwei von Mitternacht bis sechs Uhr morgens. Ihr müsstet die beiden Männer problemlos überwältigen können. Sie werden euch für ein Militärkommando halten, das die Gefangenen in eine andere Einrichtung überstellen soll. Der Plan sieht vor, dass ihr um zweiundzwanzig Uhr am Gefängnis eintrefft. Schaltet die beiden Wachen aus, befreit die Häftlinge, kehrt zum U-Boot zurück und seid bis elf Uhr wieder hier an Bord. Jede Verspätung würde unsere Flucht aus dem Hafen gefährden.«
»Wieso das?«, fragte jemand aus dem Team.
»Uns wurde mitgeteilt, dass die Verteidigungssysteme des Hafens jede Nacht um zwölf Uhr einem Funktionstest unterzogen werden. Bis dahin müssen wir ein ganzes Stück weit weg sein.«
»Warum warten wir nicht bis nach Mitternacht, wenn die meisten Leute schlafen?«, fragte ein Angehöriger des Landungstrupps. »Um zweiundzwanzig Uhr dürfte auf den Straßen noch ziemlich viel los sein.«
»Ihr werdet weniger Verdacht erregen, wenn ihr nicht erst bei Tagesanbruch um die Häuser schleicht«, erwiderte Linda. »Außerdem sind die anderen acht Wärter meistens bis zum frühen Morgen in den Kneipen der Stadt anzutreffen.«
»Sicher?«, fragte Seng.
Linda nickte. »Unsere Kontaktleute haben die Männer zwei Wochen lang beschattet.«
»Falls nichts Unvorhergesehenes dazwischenkommt, dürften die Befreiung und die Flucht reibungslos über die Bühne gehen«, sagte Cabrillo. »Schwierig wird es erst, wenn ihr alle an Bord seid und wir den Hafen verlassen wollen. Sobald Castros Sicherheitsleute bemerken, dass wir den Anker lichten und die Hafenausfahrt ansteuern, werden sie Verdacht schöpfen und Himmel und Hölle in Bewegung setzen.«
Linda sah ihn an. »Wir können sie mit unseren Waffen problemlos ausschalten.«
»Stimmt«, bestätigte Cabrillo. »Aber wir dürfen nicht den ersten Schuss abfeuern. Falls man uns jedoch angreift, bleibt uns keine andere Wahl, als uns zu schützen.«
»Bislang hat uns noch niemand verraten, wen wir da eigentlich aus dem Knast holen«, sagte Seng. »Die Leute müssen wichtig sein, sonst hätte man uns nicht angeheuert.«
Cabrillo sah ihn an. »Es sollte bis zu unserem Eintreffen geheim bleiben. Diese Männer und Frauen sind hoch angesehene kubanische Ärzte, Journalisten und Geschäftsleute, die sich irgendwann gegen Castros Regierung ausgesprochen haben. Castro weiß, dass sie in Freiheit eine Gefahr bedeuten. Falls sie die kubanische Gemeinde in Miami erreichen, können sie von dort aus eine Widerstandsbewegung ins Leben rufen.«
»Ist es ein guter Vertrag?«
»Zehn Millionen Dollar, sofern wir die Leute auf amerikanischem Boden absetzen.«
Seng und die anderen lächelten. »Das dürfte unseren bescheidenen Notgroschen ein hübsches kleines Sümmchen hinzufügen«, sagte er.
»Wir helfen gern, wenn sich’s auszahlt«, sagte Cabrillo mit breitem Grinsen. »Das ist unser Motto.«
Um genau zwanzig Uhr dreißig begaben sich Seng und sein kleiner Einsatztrupp an Bord der Nomad 1000. Zwei weitere Besatzungsmitglieder würden das Boot steuern und während der Operation bewachen. Die Nomad sah eher wie eine Luxusjacht als wie ein U-Boot aus. Ihre Dieselmotoren befähigten sie zu einer hohen Geschwindigkeit an der Oberfläche, die Elektroaggregate zu zwölf Knoten bei Tauchfahrt. Ihre maximale Tauchtiefe betrug dreihundert Meter, und sie bot zwölf Leuten bequem Platz. Für Missionen wie diese hatte Cabrillo Umbauten vornehmen lassen, so dass notfalls bis zu drei Dutzend Passagiere in den Rumpf gepfercht werden konnten.
Die Luke wurde geschlossen, und ein Kran hob das Boot an einer großen Halteschlaufe zur Mitte des Tauchbeckens. Der Kranführer blickte zum Kontrollraum empor, erhielt von Cabrillo die Freigabe und senkte die Nomad langsam ins schwarze Wasser hinab. Dort lösten Taucher die Schlaufe und ließen sich von dem Kran zur umlaufenden Galerie emporheben.
»Funktest«, sagte Seng. »Könnt ihr mich hören?«
»Als würdest du neben uns sitzen«, versicherte Linda Ross.
»Kann’s losgehen?«
»Keinerlei Schiffsverkehr. Bloß drei Fischerboote steuern soeben das offene Meer an. Zehn Meter Tiefe reichen aus, um ihren Kielen und Schrauben zu entgehen.«
»Setzt schon mal den Kaffee auf«, sagte Seng.
»Bon voyage«, spöttelte Cabrillo.
»Du hast gut reden«, gab Seng zurück.
Unmittelbar darauf erloschen die Lichter im Innern der Nomad, und sie versank im dunklen Wasser des Hafens.
Die Steuermänner des U-Boots vertrauten auf ihr GPS und setzten Kurs auf das Zielgebiet. Dank des Laserradars entging ihnen kein Hindernis. Es gelang ihnen, zwischen Bug und Heck zweier Containerschiffe hindurchzuschlüpfen, die derzeit im Hafen entladen wurden. Auch die gewaltigen Stützpfeiler der Kaianlagen stellten kein Problem dar. Sobald die Nomad sich unter den Bauten befand und sämtlichen Blicken entzogen war, tauchte sie auf und orientierte sich fortan mit Hilfe einer Nachtsichtkamera samt Restlichtverstärker. Zwischen den Pfeilern drang ausreichend Licht hindurch.
»Das schwimmende Wartungsdock liegt vor uns«, verkündete der leitende Steuermann.
Eine Überprüfung der Waffen und Ausrüstungsgegenstände war diesmal nicht nötig. Zwar trug jeder der Teilnehmer eine verborgene Pistole bei sich, doch sie wollten den Einheimischen auf dem Weg durch die Stadt als normaler kleiner Soldatentrupp erscheinen, nicht als bedrohliche Streitmacht. Aus diesem Grund mussten sie lediglich darauf achten, dass ihre Uniformen sauber und adrett aussahen. Alle männlichen Teammitglieder hatten bei den Special Forces gedient und besaßen strikte Anweisung, jegliches Blutvergießen zu vermeiden, sofern es nicht aus Notwehr unabdingbar wurde. Seng war ehemaliger Leiter eines Aufklärungstrupps der Marines und hatte noch nie einen Mann verloren.
Sobald die Nomad sanft gegen das Schwimmdock stieß, ging das Team auch schon von Bord und stieg die Treppe zu einem kleinen Gebäude hinauf, in dem Werkzeuge und diverse Geräte untergebracht waren. Die Tür ließ sich problemlos entriegeln. Seng warf einen kurzen Blick in die Runde und bedeutete den anderen, ihm zu folgen.
Die Scheinwerfer der Kräne und Schiffe tauchten den Kai in helles Licht, aber der Ausgang des Schuppens befand sich zum Glück auf der anderen Seite, und das Team sammelte sich im Schatten. Dann führte Seng die Leute in Zweierreihe und im Gleichschritt zum Ende des Kais und um das Lagerhaus herum.
Es war einundzwanzig Uhr sechsunddreißig. Ihnen blieben noch genau vierundzwanzig Minuten, um den Eingang des Gefängnisses zu erreichen. Neun Minuten später fanden sie den Lastwagen. Er stand unter einer trüben Laterne neben dem Lagerhaus geparkt. Seng erkannte das Modell: ein 1951er Ford, der aussah, als habe er mindestens drei Millionen Kilometer auf dem Tacho. Auf dem viereinhalb Meter langen Laderaum prangte eine leuchtend rote spanische Aufschrift: GONZALES – LEBENSMITTELTRANSPORTE. Im Führerhaus leuchtete die Glut einer Zigarette auf.
Seng ging zum offenen Fenster. Seine Hand lag auf dem Kolben der schallgedämpften Ruger P97 Automatik, Kaliber45. »Dos.«
Der Fahrer atmete den Qualm der filterlosen Zigarette aus. »Uno.«
»Steigt hinten ein«, befahl Seng seinem Team. »Ich fahre vorn mit.« Er öffnete die Beifahrertür und schob sich auf den Sitz. Wortlos legte der Fahrer den ersten Gang des ausgeleierten Getriebes ein und fuhr los. Die Hauptverkehrsstraße entlang der Bucht war nur spärlich beleuchtet, weil viele der Laternen entweder defekt und nie repariert worden waren oder weil man Strom sparen wollte. Nach einigen Blocks bog der Laster auf eine andere Straße ein und fuhr die leichte Steigung des San Juan Hill hinauf.
Santiago war Kubas zweitgrößte Stadt, lag in der Provinz Oriente, einer hügeligen Region voller Kaffee- und Zuckerrohrplantagen, und hatte im siebzehnten Jahrhundert als Inselhauptstadt fungiert. Das Labyrinth aus schmalen Straßen wurde immer wieder von kleinen Plazas durchbrochen, und die Gebäude im spanischen Kolonialstil waren allesamt mit Balkonen versehen.
Seng blieb stumm, schaute prüfend in die Seitengassen und behielt die Ziffern seines tragbaren GPS-Empfängers im Blick, um sicherzustellen, dass der Fahrer die richtige Richtung einschlug. Auf den Straßen herrschte kaum Verkehr, doch überall standen alte Autos geparkt, und die Bürgersteige waren voller Leute, die einen abendlichen Spaziergang unternahmen oder die Bars besuchten, aus denen laute kubanische Musik erklang. Von zahlreichen Fassaden blätterte der verblichene Anstrich ab, andere hingegen waren in leuchtenden Pastellfarben bemalt. Die Rinnsteine und Gehwege waren sauber, aber die Fenster sahen aus, als seien sie nur selten geputzt worden. Die Menschen wirkten überwiegend fröhlich; viele von ihnen lachten, und einige sangen sogar. Der Lastwagen durchquerte nun die Innenstadt. Niemand achtete auf ihn.
Seng sah einige Männer in Uniform, doch sie schienen eher daran interessiert zu sein, sich mit den Frauen zu unterhalten, als nach fremden Eindringlingen Ausschau zu halten. Der Fahrer zündete sich die nächste seiner stinkenden Zigaretten an. Seng hatte nie geraucht. Er lehnte sich gegen die Tür, hielt das Gesicht zum offenen Fenster hinaus und rümpfte angewidert die Nase.
Zehn Minuten später erreichte der Laster das Haupttor des Gefängnisses. Der Fahrer fuhr daran vorbei und hielt nach etwa fünfzig Metern. »Ich warte hier«, sagte er in nahezu perfektem Englisch. Es waren die ersten Worte, die er seit dem Kai gesprochen hatte.
Seng wusste sofort Bescheid. »Lehrer oder Arzt?«
»Ich lehre Geschichte an der Universität.«
»Vielen Dank.«
»Beeilen Sie sich. Wenn der Wagen nach Mitternacht immer noch hier steht, wird er Verdacht erregen.«
»Bis dahin dürften wir längst zurück sein«, versicherte Seng.
Er stieg aus und sah sich vorsichtig um. Die Straße war leer. Leise klopfte er an die Tür zum Laderaum. Sie schwang auf, das Team stieg aus und formierte sich. Dann marschierten sie als Einheit bis zum Tor und betätigten die Klingel. In der Wachbaracke hinter dem Tor läutete eine Glocke. Nach einigen Minuten kam ein Wärter zum Vorschein und rieb sich die Augen. Er hatte eindeutig im Dienst geschlafen und wollte die Störenfriede offenbar verscheuchen. Dann aber erkannte er Sengs Uniform mit den Rangabzeichen eines Obersts, öffnete hektisch das Tor, wich zurück und salutierte.
»Señor, was kann ich für Sie tun?«
»Oberst Antonio Yarayo. Ich und meine Begleiter wurden vom Ministerium für Staatssicherheit geschickt, um einen der Gefangenen zu verhören. Jüngste Erkenntnisse deuten auf einen Spionagering der Vereinigten Staaten hin. Wir glauben, die Häftlinge könnten über nützliche Informationen verfügen.«
»Verzeihung, Señor, aber ich muss Sie um die entsprechenden Papiere bitten.«
»Als guter Soldat sollten Sie das auch, Leutnant«, sagte Seng bereitwillig und reichte dem Mann einen Umschlag. »Warum sind hier nicht noch mehr Wachen postiert?«
»Ein zweiter Mann behält die Zellen im Auge.«
»Hmm. Nun ja, ich schätze, wir brauchen nicht die ganze Zeit hier draußen zu stehen. Bringen Sie mich in Ihr Büro.«
Der Mann führte sie sogleich in ein kahles Arbeitszimmer, das lediglich einen Schreibtisch und zwei Stühle enthielt. An einer der Wände hing ein Foto von Castro, aufgenommen in seiner Jugend.
»Wer ist hier der leitende Offizier?«, fragte Seng.
»Hauptmann Juan Lopez.«
»Wo ist er?«
»Seine Freundin hat ein Haus in der Stadt. Er kommt morgen früh um neun Uhr zurück.«
»Wie günstig«, sagte Seng, als sei er gelangweilt. »Wie heißen Sie?«
»Leutnant Gabriel Sanchez, Señor.«
»Und der andere Posten, der die Zellen bewacht?«
»Sergeant Ignez Macco.«
»Bitte überprüfen Sie die Dokumente, damit wir anfangen können.«
Sanchez setzte sich an den Schreibtisch und öffnete den Umschlag. Seng trat hinter ihn und zog eine kleine Pistole. Der Leutnant starrte verblüfft auf zwei Comichefte und hob den Kopf. »Oberst, ich verstehe nicht ganz, was…«
Weiter kam er nicht, denn Seng schoss ihm einen kleinen Betäubungspfeil ins Genick. Sanchez sah ihn mit großen Augen an und sank bewusstlos auf dem Tisch zusammen.
Seng warf einem der Männer eine Rolle Klebeband zu. Sie hatten ihre Einsätze so oft geübt, dass keine Befehle notwendig waren. Zwei der Soldaten nahmen das Klebeband, fesselten den Wachposten, durchsuchten ihn – wobei sie einen ungewöhnlichen runden Schlüssel fanden – und verstauten ihn in einem Schrank. Ein anderer Mann machte sich sorgfältig ans Werk, um die Alarmanlage und die Funkgeräte außer Funktion zu setzen.
Dann eilten sie durch mehrere Gänge, Tunnel und über eine Steintreppe, die zu den Zellen hinunterführte. Seng wusste stets, wo sie sich befanden, denn er hatte sich das holographische Abbild der Festung genau eingeprägt.
Es bestand zwar kein Anlass zu übertriebener Hast, doch sie konnten es sich nicht leisten, unnütz Zeit zu verlieren. Seng begriff, weshalb die Wachmannschaft aus so wenigen Personen bestand. Die Mauern waren überaus dick, und man konnte die unterirdischen Verliese nur durch einen einzigen Zugang erreichen. Eine Flucht war allein auf dem Weg möglich, den das Team der Oregon soeben zurücklegte. Der schmale und sehr hohe Gang wurde durch eine Reihe nackter Glühbirnen erhellt. Die Stufen endeten schließlich vor einer gewaltigen Stahltür, die an einen Banktresor erinnerte. Eine Überwachungskamera starrte ihnen bedrohlich entgegen. Jetzt kam der heikle Teil, dachte Seng, als er den seltsamen runden Schlüssel ins Schloss schob. Er hoffte inständig, dass kein zusätzlicher Kode erforderlich sein würde.
Seine Befürchtung bewahrheitete sich, denn auf der anderen Seite der Tür ertönte ein Summer, sobald er den Schlüssel drehte. Wenig später meldete sich aus einem nahen Lautsprecher eine Stimme: »Wer da?«
»Oberst Antonio Yarayo, Staatssicherheit, mit einem Team zum Verhör der Gefangenen.«
Es herrschte kurz Stille. Seng wartete die Antwort gar nicht erst ab.
»Öffnen Sie. Ich bin dazu befugt und verfüge über die notwendigen Dokumente. Leutnant Sanchez hätte uns begleitet, aber er sagte, es sei nicht gestattet, das Tor unbewacht zu lassen. Sie sind Sergeant Ignez Macco, nicht wahr?« Seng hielt den Umschlag hoch. »Falls Sie noch Fragen haben, dies hier ist Ihre Dienstakte.«
»Aber Señor«, erklang Maccos flehentliche Stimme. »Falls ich die Tür vor acht Uhr morgens öffne, wird bei der Staatssicherheit in Fort Canovar Alarm ausgelöst.«
»Ich habe Leutnant Sanchez angewiesen, den Türalarm abzuschalten«, bluffte Seng.
»Aber Señor, das kann er nicht. Die Tür hängt an einem separaten System, das direkt mit der Sicherheitskommandantur in der Stadt verbunden ist. Sie darf nicht vor acht Uhr morgens geöffnet werden.«
Es war ein Hindernis, aber kein völlig unerwartetes. Seng hielt jede Wette, dass die Sicherheitsoffiziere zunächst von einem Fehlalarm ausgehen und in der Festung anrufen würden, bevor jemand sich tatsächlich in Bewegung setzte.
Macco fiel auf Sengs Geschichte herein. Nach einigen Sekunden hörte man aus dem großen stählernen Schloss ein lautes Klacken, und dann glitten die Bolzen aus dem Rahmen und zurück in ihre Führungen. Die riesige Tür schwang leise auf. Sergeant Macco nahm Haltung an und salutierte.
Seng hielt sich nicht länger mit Spitzfindigkeiten auf, sondern richtete die Betäubungspistole auf Maccos Hals und drückte ab. Der Posten verdrehte die Augen und fiel wie ein Sandsack zu Boden.
Das Verlies war kein hochmodernes Gefängnis. Die verrosteten eisernen Zellentüren stammten aus dem späten neunzehnten Jahrhundert und ließen sich mit einem großen antiquierten Schlüssel öffnen, den Macco am Gürtel trug. Seng schloss die ersten der Türen auf, jeweils unmittelbar gefolgt von Julia Huxley, die die Verfassung der Insassen untersuchte. Dann führten die Teammitglieder nacheinander alle Gefangenen auf den Gang hinaus. Die verängstigten Häftlinge rechneten mit dem Schlimmsten.
»Fünf sind nicht in der Lage, sich auf den Beinen zu halten«, sagte Julia. »Wir müssen sie tragen.«
»Okay, wir laden sie uns auf den Rücken«, erwiderte Seng.
»Die armen Teufel glauben, wir wollen sie umbringen«, sagte ein hoch gewachsener stämmiger Teamangehöriger mit roter Bürstenfrisur.
»Uns bleibt keine Zeit für Erklärungen!«, herrschte Seng ihn an. Er wusste, dass die Sicherheitsleute in der Stadt derzeit rätselten, wieso in Santa Ursula am späten Abend unvermittelt Alarm ausgelöst worden war. Sie würden anrufen und feststellen, dass niemand ans Telefon ging. Danach konnte es nicht mehr lange dauern, bis sie einen Einsatztrupp schickten. »Julia, du kümmerst dich um diejenigen, die allein laufen können. Ihr andern tragt die restlichen Leute.«
Sie brachen auf und mussten die erschöpften Häftlinge beinahe aus dem Verlies und die Treppe hinaufzerren. Jedes der Teammitglieder trug einen Kubaner über der Schulter und half mit dem freien Arm anderen Gefangenen, die kaum die Stufen schafften. Julia bildete die Nachhut, stützte zwei Frauen und flüsterte ihnen aufmunternd zu. Die Bedeutung der Worte erschloss sich hoffentlich aus dem besänftigenden Tonfall – Huxleys Spanisch reichte höchstens aus, um eine Margarita zu bestellen.
Die gewundene Steintreppe erwies sich für die geschwächten Häftlinge als echte Tortur, aber es gab kein Zurück. Jede Gefangennahme würde den sicheren Tod bedeuten. Mühsam schleppten sie sich die Stufen hinauf, ihre Brustkörbe hoben und senkten sich, ihre Lungen schrien nach Luft, ihre Herzen hämmerten. Männer und Frauen, die schon vor langer Zeit alle Hoffnung aufgegeben hatten, sahen nun plötzlich wieder die Chance, ein normales Leben zu leben – dank dieser Verrückten, die den Tod riskierten, um sie zu retten.
Seng hatte keine Zeit, sein Mitgefühl zu äußern oder in die ausgemergelten Gesichter zu blicken. Dafür würde später noch Gelegenheit genug sein, wenn sie sich sicher an Bord der Oregon befanden.
Er konzentrierte sich darauf, sie alle zum Tor zu scheuchen und dabei kühl und logisch zu handeln.
Schließlich erreichten sie die Wachbaracke. Seng trat vorsichtig auf die Straße hinaus. Es war weder ein Laut zu hören noch irgendjemand zu sehen. Der Lastwagen stand dort, wo sie ihn verlassen hatten.
Die Teammitglieder keuchten inzwischen unter ihrer Last und waren wegen der tropischen Luftfeuchtigkeit schweißgebadet. Seng suchte die dunkle Straße sorgfältig mit dem Nachtsichtgerät ab. Die Luft war rein. Zufrieden winkte er die anderen heran und schickte sie in Richtung des Lasters.
Dann lief er zurück in das Büro und sah nach dem Wachposten. Der Mann war immer noch bewusstlos. Auf einem Schaltpult neben dem Tisch blinkte ein rotes Lämpchen. Demnach war tatsächlich Alarm ausgelöst worden. Das Telefon klingelte. Er nahm den Hörer ab. »Uno momento!«
Dann legte er den Hörer auf den Tisch und rannte hinaus.
Das Rettungsteam und die befreiten Gefangenen zwängten sich auf die Ladefläche des Lastwagens – fast wie japanische Arbeiter während der Rushhour. Der Fahrer legte den Gang ein, wobei das alte Getriebe metallisch knirschte, und der Laster machte einen Satz nach vorn. Auf den Straßen sah es immer noch so aus wie zuvor. Es gab kaum Verkehr, und die Kubaner genossen den lauen Abend auf ihren Balkonen, an Tischen auf den Gehwegen oder in den Cantinas, wo sie tranken, tanzten und sangen.
Seng streckte den Kopf aus dem Fenster und lauschte auf Alarmsignale oder Sirenen, doch die Nachtluft trug lediglich leise Musik an seine Ohren. Das lauteste Geräusch stammte vom Auspuff des Lastwagens, der sich vom Krümmer des Motors zu lösen schien und schon bald alles andere übertönte. Seng sah, dass manche Kubaner ihnen zwar kurze Blicke zuwarfen, sich aber gleich wieder abwandten. Auf den Straßen von Santiago waren lockere oder verrostete Auspuffanlagen keine Seltenheit. Die Bürger der Stadt ließen sich dadurch nicht bei ihrem Freizeitvergnügen stören.
Der Fahrer fuhr zum Verrücktwerden langsam, aber Seng hatte nicht vor, ihn zur Eile anzutreiben. Auf diese Weise erregten sie wenigstens keine Aufmerksamkeit. Nach fünfzehn Minuten, die sich wie eine Stunde anfühlten, hielten sie neben einem Lagerhaus am Hafen. Seng ließ den Blick über den menschenleeren Kai schweifen und schickte dann alle zu dem Geräteschuppen. Der fünfminütige Fußweg verlief ereignislos.
Das Glück blieb ihnen weiterhin treu. Nur bei den beiden Schiffen und ihrer Containerfracht herrschte noch Betrieb. Seng blieb aufmerksam, doch seine Anspannung ließ nach. Er führte die Leute durch das Gebäude und die Holztreppe hinunter. Im Dunkeln sah er die Silhouette des Steuermanns der Nomad, der auf dem Schwimmdock stand und den Kubanern an Bord half. Sein Kollege wartete unten und wies den Passagieren Plätze in der engen Hauptkabine der Nomad zu.
Als Seng und Julia Huxley als Letzte die Nomad bestiegen, machte der Steuermann sofort die Leinen los, blickte kurz auf und sagte: »Ihr liegt gut in der Zeit.«
»Bringt uns so schnell wie möglich zum Schiff«, erwiderte Seng. »Wir haben einen Alarm ausgelöst; es ließ sich leider nicht vermeiden. Ich bin überrascht, dass uns nicht schon längst ein kubanischer Einsatztrupp im Nacken sitzt.«
»Falls man euch bisher nicht entdeckt hat«, sagte der Steuermann zuversichtlich, während er die Luke schloss und verriegelte, »wird man auch jetzt nicht erraten, woher ihr gekommen seid.«
»Zumindest nicht, bis man die Oregon an ihrem zugewiesenen Ankerplatz vermisst.«
Wenige Sekunden später sank das U-Boot unter die dunkle Wasseroberfläche und tauchte nach einer Viertelstunde im Becken der Oregon wieder auf. Der Kran hob die Nomad sanft auf die Höhe des zweiten Decks an, wo sie an der Galerie vertäut wurde. Huxleys Sanitätsteam und einige andere Besatzungsmitglieder der Oregon warteten bereits, um den Kubanern auf die gut ausgestattete Krankenstation zu helfen.
Es war dreiundzwanzig Uhr drei.
Ein schmaler Mann mit vorzeitig ergrautem Haar erkannte in Cabrillo einen leitenden Offizier und ging mit wankendem Schritt auf ihn zu. »Señor, ich heiße Juan Tural. Würden Sie mir bitte verraten, wer Sie alle sind und weshalb Sie meine Freunde und mich aus Santa Ursula befreit haben?«
»Wir sind kommerzielle Dienstleister und wurden mit dieser Aktion beauftragt.«
»Von wem?«
»Von Ihren Freunden in den Vereinigten Staaten«, antwortete Cabrillo. »Das ist alles.«
»Demnach verfolgen Sie kein idealistisches Ziel, keine politische Absicht?«
Cabrillo deutete ein Lächeln an. »Wir verfolgen immer ein Ziel.«
Tural seufzte. »Ich hatte gehofft, dass eine etwaige Rettung aus anderen Motiven geschehen würde.«
»Ihre Freunde verfügen nicht über die notwendigen Hilfsmittel. So einfach ist das. Daher sind sie zu uns gekommen.«





























