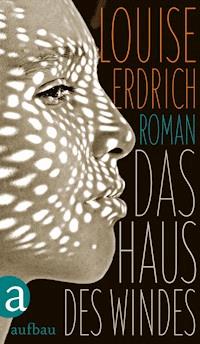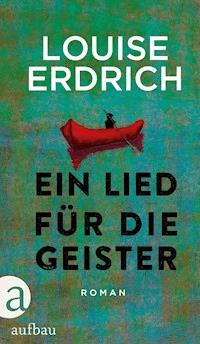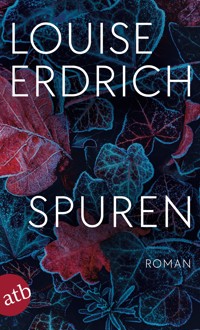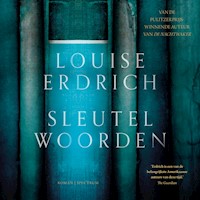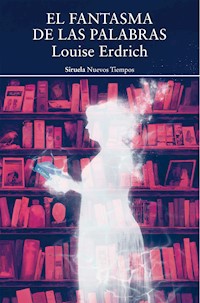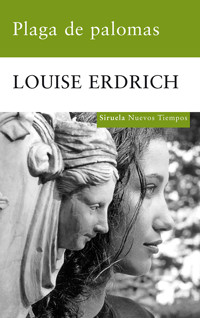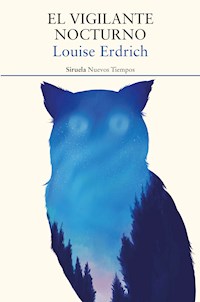9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Hat die Menschlichkeit noch eine Chance, wenn die Menschheit am Abgrund steht?
Eine junge Frau kämpft um ihr eigenes Leben und das ihres ungeborenen Kindes – in einer Welt, in der selbst auf die Naturgesetze kein Verlass mehr ist und die Angst vor der Katastrophe das Handeln der Menschen bestimmt.
Pulitzer Preisträgerin Louise Erdrich entwirft die furchteinflößende Vision einer düsteren Zukunft und zugleich eine bewegende, gegenwärtige Meditation über weibliche Autonomie und die Grundrechte des Menschen.
»Louise Erdrich konstruiert eine rasante und spannungsreiche Story. Es wird deutlich, dass die vielfach ausgezeichnete Autorin ihr Handwerk beherrscht.« Deutschlandfunk
»Louise Erdrich gehört zu den besten amerikanischen Autorinnen ihrer Zeit.« Philip Roth
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 455
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Über Louise Erdrich
Louise Erdrich, geboren 1954 als Tochter einer Ojibwe und eines Deutsch-Amerikaners, ist eine der erfolgreichsten amerikanischen Gegenwartsautorinnen. Sie erhielt den National Book Award, den PEN/Saul Bellow Award und den Library of Congress Prize. Louise Erdrich lebt in Minnesota und ist Inhaberin der Buchhandlung Birchbark Books.
Im Aufbau Taschenbuch sind ihre Romane »Liebeszauber«, »Die Rübenkönigin«, »Der Club der singenden Metzger«, »Der Klang der Trommel«, »Solange du lebst«, »Das Haus des Windes« und »Ein Lied für die Geister« lieferbar.
Gesine Schröder übersetzt seit 2007 aus dem Englischen und hat u.a. Jennifer duBois und Curtis Sittenfield ins Deutsche übertragen. Nach Aufenthalten in den USA, Australien, Indien, England und Kanada lebt sie in Berlin.
Informationen zum Buch
Die vielfach ausgezeichnete Bestsellerautorin Louise Erdrich zeichnet das aufrüttelnde Portrait einer jungen Frau, die um ihr eigenes Leben und das ihres ungeborenen Kindes kämpft.
Die Welt, wie wir sie kennen, gibt es nicht mehr. Auf rätselhafte Weise hat sich die Evolution verkehrt, und immer mehr Kinder, die zur Welt kommen, scheinen einer primitiven neuen Spezies anzugehören. Die junge Cedar betrifft diese apokalyptische Wende der Menschheitsgeschichte auch persönlich, sie ist schwanger. Gerüchte kommen auf: der Ausnahmezustand sei verhängt worden, die Regierung fahnde nach schwangeren Frauen und inhaftiere sie - doch niemand hat gesicherte Informationen.
Cedars Schicksal steht nun auf dem Spiel. Es ist das Schicksal aller.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Übersicht
Cover
Titelinformationen
Über Louise Erdrich
Informationen zum Buch
Newsletter
Teil eins
7. August
9. August
11. August
15. August
20. August
25. August
29. August
30. August
31. August
1. September
3. September
5. September
6. September
7. September
8. September
15. September
16. September
17. September
18. September
21. September
Teil zwei
27. September Fairview Riverside Hospital, Zimmer 624
28. September, morgens
5. Oktober
8. Oktober
9. Oktober
12. Oktober
13. Oktober
14. Oktober
15. Oktober
16. Oktober
17. Oktober
19. Oktober
20. Oktober
21. Oktober
23. Oktober
24. Oktober
Teil drei
26. Oktober
28. Oktober
1. November – Allerheiligen
6. November
10. November
18. November
19. November
20. November
Thanksgiving
30. November
1. Dezember
2. Dezember
3. Dezember
4. Dezember
6. Dezember
8. Dezember
11. Dezember
12. Dezember
14. Dezember
15. Dezember
18. Dezember
23. Dezember
24. Dezember
25. Dezember
Dezember
Januar
Februar
Danksagung
Editorische Notiz
Impressum
Louise Erdrich
Der Gott am Ende der Straße
Roman
Aus dem Amerikanischen von Gesine Schröder
Inhaltsübersicht
Über Louise Erdrich
Informationen zum Buch
Newsletter
Teil eins
7. August
9. August
11. August
15. August
20. August
25. August
29. August
30. August
31. August
1. September
3. September
5. September
6. September
7. September
8. September
15. September
16. September
17. September
18. September
21. September
Teil zwei
27. September, Fairview Riverside Hospital, Zimmer 624
28. September, morgens
5. Oktober
8. Oktober
9. Oktober
12. Oktober
13. Oktober
14. Oktober
15. Oktober
16. Oktober
17. Oktober
19. Oktober
20. Oktober
21. Oktober
23. Oktober
24. Oktober
Teil drei
26. Oktober
28. Oktober
1. November – Allerheiligen
6. November
10. November
18. November
19. November
20. November
Thanksgiving
30. November
1. Dezember
2. Dezember
3. Dezember
4. Dezember
6. Dezember
8. Dezember
11. Dezember
12. Dezember
14. Dezember
15. Dezember
18. Dezember
23. Dezember
24. Dezember
25. Dezember
Dezember
Januar
Februar
Danksagung
Editorische Notiz
Impressum
Für Gookoomisinaan Kiizh
Licht meiner Tage
Das Wort ist Leben, Sein und Geist, ist grünende Erneuerung, ist Schöpferkraft. Dieses Wort manifestiert sich in jedweder Kreatur.
Hildegard von Bingen (1098–1179)
Teil eins
7. August
Wenn ich erzähle, dass mein weißer Name Cedar Hawk Songmaker lautet und ich das Adoptivkind eines liberalen Pärchens aus Minneapolis bin und dass ich, als ich auf der Suche nach meinen biologischen Ojibwe-Eltern meinen Geburtsnamen Mary Potts erfuhr, dieses Wissen für mich behielt, vielleicht kannst du mich dann verstehen. Oder auch nicht. Berichten will ich davon in jedem Fall, weil sich seit letzter Woche alles verändert. Wie es aussieht – keiner weiß es genau –, läuft die Weltgeschichte gerade rückwärts. Oder vorwärts. Oder seitwärts, auf schwer begreifliche Weise. Bestimmt wird man für das, was gerade geschieht, einen Begriff finden, nur wie man es wieder in Ordnung bringen soll, alles um uns herum und alles in uns drin, ist mir ein Rätsel. Was geschieht, reicht bis ins Unsichtbare, bis in die kleinsten Einheiten, aus denen wir geschaffen sind. Aber egal, was es ist, jedenfalls jagt ein Vorschlag den nächsten, wie damit umgegangen werden sollte – Spekulationen eigentlich nur, darüber, welche Maßnahmen ergriffen werden –, und deshalb habe ich diesen Bericht begonnen.
Historische Zeiten! Schon immer hat es Briefe und Tagebücher gegeben, die mitten im Umbruch geschrieben und später wiedergefunden wurden, und so etwas könnte auch das hier werden. Mir ist schon klar, dass lexikalisches Wissen bald bedeutungslos werden könnte; trotzdem sollst du diese Aufzeichnungen haben.
Sagte ich schon, dass ich im fünften Monat schwanger bin?
Mit dir?
Bekenntnis:
Vor knapp zehn Jahren war ich zum ersten Mal schwanger und habe nach fast zwei Monaten abgetrieben. Das erzähle ich dir, weil es wichtig ist, dass du alles weißt. Meine Entscheidung stand fest, sobald ich das Testergebnis sah – nein. Diese Tür wollte ich schließen. Doch damit öffnete ich zugleich eine andere: Hätte ich damals nicht abgetrieben, dann gäbe es jetzt nicht dich. Diesmal erfüllte mich der Schnelltest mit einem Ja.
Ich bin also schwanger, bin sechsundzwanzig Jahre alt und habe keinen Krankenversicherungsschutz. Meine Eltern wären entsetzt, wenn sie das wüssten, denn die beiden haben mehr davon als nötig. Auch schöpfungsgeschichtlich ist es offenbar nicht der ideale Zeitpunkt. Wenn sich all die drängenden Fragen nicht bald klären, wirst du mitten in das große Unbekannte hineingeboren. Aber egal, was kommt – eine Familie aus mehreren Kulturen wird dich mit offenen Armen empfangen. Zum einen sind da meine Adoptiveltern, deren poetischer Nachname aus England stammt. Glen und Sera Songmaker. Sie sind wunderbare Menschen, ohne Frage, kein Zweifel, und obwohl sie es mit mir nicht gerade leicht hatten, haben sie ihre Sache meistens sehr gut gemacht. Sie sind eben tolerante Menschen, Buddhisten, und bis in die Tiefen ihrer Seele grün. Abgesehen von Seras nerviger Paranoia rund um Lebensmittelzusatzstoffe und Glens Affäre mit einer Plattenverkäuferin von Retro Vinyl, die vor etlichen Jahren beinahe die Familie zerrüttet hätte, sind sie glücklich verheiratete Veganer. Sie sind die nettesten Menschen, die man sich vorstellen kann, nur … Nur habe ich nie verstanden, wie sie mich adoptieren konnten – dass das legal war, wage ich zu bezweifeln. Es gibt da ein Gesetz, den Indian Child Welfare Act, das es praktisch unmöglich macht, als nichtindianische Familie ein indianisches Kind zu adoptieren. Dieses Gesetz sollte, nein, muss auch für mich gegolten haben. Wenn ich Glen und Sera darauf anspreche, murmeln sie etwas und wenden sich ab. Und drehen sich nicht wieder nach mir um, selbst wenn ich noch so schreie. Trotzdem sind sie gute Eltern, werden wundervolle Großeltern sein, und du wirst Onkel und Tanten haben und einen zweiten Satz biologischer Großeltern – die Potts.
Wie gesagt: Anfangs habe ich mein Wissen um meine biologische Familie verleugnet und verdrängt, und vielleicht verstehst du das besser, wenn ich dir erzähle, wie in der behüteten Enklave meiner Songmaker-Adoptivfamilie meine Herkunft gefeiert wurde. Eine echte Native American! Indianerprinzessin! Eine Ojibwe, Chippewa, Anishinabe oder wie auch immer. Ich war etwas Besonderes, eine edle Wilde, und der Star meiner Waldorfgrundschule. Sera flocht mir die Haare zu zwei Zöpfen, von denen ich zum allgemeinen Entsetzen einen abschnitt. Aber selbst als halb bezopfte, im Grunde rein theoretische Native fühlte ich mich außergewöhnlich, elitär, war ich eine, die man ehrfürchtig ansah, wenn es in der Schule um Geschichte und Kultur der amerikanischen Ureinwohner ging. Meine Beobachtungen zu Vögeln, Insekten, Würmern, Wolken, Katzen und Hunden wurden als Zitate herumgereicht. Ich war die mit dem heißen Draht zu Mutter Natur. So ging es auch in der Highschool weiter, aber am College, wo ich andere Indigene kennenlernte, ließ es nach, und zwar ziemlich deutlich. Dort war ich eine von vielen. Schlimmer noch – ich hatte keinen Clan, keine eigene Kultur oder Sprache, keine Verwandten. Ich hatte verwirrenderweise gar nicht zu kämpfen. In meinem neuen Umfeld kursierten Geschichten. Drogensucht. Selbstmord. Nur in meiner Biografie gab es keine Krisen, außer der Plattenladenverkäuferin vielleicht, also erfand ich eine. Ich schnitt mir beide Zöpfe ab und schwänzte zunehmend Seminare. Ich war eine Schneeflocke. Ohne meinen Sonderstatus schmolz ich dahin.
Vor einem Jahr ungefähr beschloss Sera, weil sie hinter meinem akademischen Desinteresse eine Identitätskrise witterte, vielleicht aber auch aus ganz anderen Gründen, mir einen Brief von meiner leiblichen Mutter auszuhändigen. Ehrenhaft, wie sie war, hatte sie ihn nicht einmal geöffnet. Das holte ich nach. Las den Brief zwei Mal und steckte ihn wieder in den Umschlag. Dann legte ich das Ganze in eine Aktenmappe. Ich bin ein sehr organisierter Mensch. Also beschloss ich, ihn abzuheften. Aber unter was? Unter welchem Stichwort? Das gab mir eine Weile zu denken. Unter Leibliche Familie? Potts? Oder doch eher Bodenlose Enttäuschung? Oder FUCK YOU? Ist ja schließlich aufwühlend, so ein Erstkontakt. Aber das war nicht alles: Im Reservat, stellte sich heraus, war ich noch langweiliger, als ich mir schon am College vorgekommen war. Meine Ursprungsfamilie hatte keine spirituellen Kräfte, keinen Kontakt zu heilenden Geistern oder Totemtieren. Wir waren nicht einmal arm, sondern bürgerlich. Eigentümer einer Superpumper-Tanke. Ich war Mary Potts, Tochter und Enkelin von Mary Potts und die große Schwester einer weiteren Mary Potts, kurz, nur die Nächste in einer langen Reihe von Mary Pottsen, die seit der Zeit der ersten Siedler so hießen und aktuell im Superpumper-Franchise ihr Geld verdienten, an der letzten Ausfahrt vor dem Kasino.
Was hätte ich damit anfangen sollen? Bis dieses biologische Durcheinander kam, bis zu meiner Schwangerschaft, bis mein ganzes Leben plötzlich unberechenbar wurde, habe ich getan, als hätte ich nicht einmal den Umschlag aufgerissen. Habe meinen Songmaker-Eltern gesagt, dass sie mich aufgezogen haben, dass ich sie liebe und damit gut. Ich wolle keine Komplikationen, habe ich gesagt, ich wolle mich nicht mit Verlassenwerden und Versöhnung auseinandersetzen, wolle kein rührseliges Wiedersehen, keine Schlangentränen. Aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass ich stinksauer bin. Wie kommen die Potts dazu, jetzt plötzlich meine Eltern sein zu wollen, ausgerechnet jetzt, wo ich sie nicht mehr brauche? Und wie kommen sie dazu, mir die romantische Vorstellung von meinen indianischen Eltern kaputt zu machen, die ich gehegt habe, seit ich denken kann, die Vorstellung von zwei schönen Menschen mit je zwei langen Zöpfen, die auf irgendwie spirituelle, typisch indigene Weise tragisch verstorben sind – die sich zu Tode gefastet haben oder beim Sonnentanz einem Hitzschlag erlegen sind, sich aus Liebe von einer Klippe gestürzt haben oder vom Donnervogel davongetragen wurden? Wie kommen sie dazu, ihr langweiliges Dasein einfach ohne mich weiter zu fristen und dann auch noch in einer Tankstelle zu arbeiten?
Ohne die Schwangerschaft hätte ich nichts mit ihnen zu tun haben wollen. Aber du machst den Unterschied, Kleines! Du bist anders. Mit dir kann alles neu beginnen, und das soll es auch. Du verdienst es. Du sollst zwei Großelternpaare haben. Ganz zu schweigen von genetischen Informationen, die selbst unabhängig von dem, was gerade los ist, entscheidende Bedeutung für dich haben könnten. Vielleicht gibt es Erbkrankheiten. Oder verborgene Talente – hoffen darf man ja, auch wenn der Brief meiner leiblichen Mutter mich eher skeptisch stimmt. Trotzdem finde ich, dass du in das soziale Netz eingebunden sein solltest, das ich nie hatte.
In meinem selbst gemachten Krisenjahr wurde ich Katholikin – zunächst aus Rebellion gegen meine Eltern, aber auch, weil ich mich nach mehr Bindungen sehnte. Ich wollte eine Großfamilie, eine ganze Pfarrgemeinde voller Bezugspersonen. Das war keine Phase, die sich wieder legt; ich habe sowohl meine Herkunft als auch meine akademischen Interessen mit dem Glauben verknüpft, indem ich erst eine Abhandlung über die Kanonisierung der Lilie der Mohawk, der heiligen Kateri Tekakwitha, schrieb und seitdem die Zeal herausgebe, ein Magazin für katholische religiöse Fragen, das ich fülle, redigiere, illustriere, herstelle und vertreibe. Finanziert wird meine Arbeit von privaten Spendern, gelegentlichen Pro-Kopf-Zahlungen aus dem Reservatskasino und einem kleinen Beitrag meiner Gemeinde. Ich habe genug beisammen, um bis zu deinem Geburtstermin, dem 25. Dezember, weiterzumachen, und so viel Zeit bleibt mir auch – viereinhalb Monate ungefähr –, um dir eine Familie zu bieten und eine brauchbare Mutter zu werden.
Das wird nicht reichen.
Dein Vater könnte dabei helfen, aber ich halte ihn auf Abstand.
Umso wichtiger, dass ich noch einen Großvater für dich finde, vielleicht ein, zwei Onkel, einen Cousin – das sollte reichen.
* * *
»Cedar?«
Während ich dir schrieb, habe ich mich durch das ständige Telefonklingeln nicht stören lassen. Jetzt hebe ich ab, weil ich glaube, dass der vorherige Anrufer dein Vater war, er inzwischen aber aufgegeben hat. Ich merke es immer, wenn er aufgibt.
»Mom.«
»Hör mal, es macht uns ziemlich nervös, was da draußen los ist. Komm bitte nach Hause.«
Ihre Stimme klingt wie immer besonnen und kompetent. Stress beruhigt sie.
»Ich muss erst noch was erledigen.«
Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, dich zu erwähnen – das sollte ich wirklich langsam mal tun –, aber die Worte Ich bin schwanger kriege ich einfach nicht über die Lippen, also erzähle ich ihr das andere, das Herkunftsding.
»Weißt du noch, der Brief, den du mir vor einem Jahr gegeben hast, von meiner leiblichen Familie oder wie man das nennt? Ich will da rausfahren und sie kennenlernen.«
Schweigen.
»Ins Reservat«, sage ich.
»Jetzt? Warum jetzt?«
Das fragt sie nicht aus Eifersucht oder Missfallen. Schließlich hat sie mir den Brief selbst gegeben und mir die Entscheidung überlassen. Sie hat mich sogar ermutigt, ihn zu öffnen. Es geht ihr wirklich nur um den Zeitpunkt – das ist typisch Sera.
»Weil ich muss.«
»Nicht jetzt. Bitte.«
Sie hat diesen entschlossenen Ich-kriege-das-geregelt-Ton, den ich bisher nur wenige Male von ihr gehört habe: Als ich anrief und sie bat, mich von einer Party abzuholen, wo ein Besoffener versucht hatte, mich zu vergewaltigen, und mich stattdessen nur vollgekotzt hatte. Als ich ihr sagte, dass ich mich katholisch taufen und firmen lassen würde.
Bestimmt hat sie recht, aber nichts von dem da draußen kommt mir annähernd so wichtig vor wie das hier drinnen. Vorhin, auf meinem Heimweg im Auto, waren überall in ganz normaler Anzahl die ganz normalen beschäftigten, gut gelaunten, geselligen Minnesotaer unterwegs und hielten Schwätzchen an den Bushaltestellen. Trugen Einkaufstaschen und Rucksäcke, liefen nicht zu schnell und nicht zu langsam und wirkten weder beunruhigt noch ängstlich.
»Ich muss einfach, ich kann’s nicht erklären. Ich bin bald wieder da, Mom, keine Sorge. Ich weiß, dass die Stimmung kippen könnte.«
»Ich fürchte, das tut sie gerade. Das kommt. Warte, ich gebe dir Dad.«
Es wird geraschelt und hektisch geflüstert, als Sera Glen von meinem Vorhaben erzählt.
»Pass auf, wir begleiten dich. Es ist einfach … hör zu, Baby …«
Als er mich Baby nennt, kommen mir die Tränen. Das hat er früher getan, wenn ich einen harten Schultag hinter mir hatte, an Liebeskummer litt oder Bs statt As unter meinen Klassenarbeiten standen. Ich hasste es, Bs zu bekommen. Glen vor den Kopf zu stoßen fiel mir schwer, aber ich tat mein Bestes. Glücklicherweise gelang es mir nie, ihn zu vergraulen oder auch nur einen Wutausbruch zu provozieren. Einmal sagte er mir, er sei sehr verärgert. Das musste mir reichen.
»Ach Dad, es tut mir leid. Keine Sorge, mir passiert schon nichts. Ich muss das einfach tun, und es dauert auch nur einen Tag.«
»Cedar, es wird wirklich gefährlich, auch wenn es noch nicht allen klar ist. In den Nachrichten heißt es … und was man so hört … Ich weiß, das klingt jetzt unwahrscheinlich, aber …«
»Nur einen Tag.«
»Hör mal Nachrichten. Die sagen …«
»Was denn nun?«
»Der Präsident will den Notstand ausrufen, und im Kongress debattieren sie, ob bestimmte Bürgerrechte …«
»Dad, du bist immer so …«
»Jetzt ist es wirklich so weit, bitte komm zu uns nach Hause.«
Er übergibt wieder an Sera. Sie hat sich gefasst. Einer ihrer wichtigsten Grundsätze ist in Gefahr – der feste Glaube an meine Autonomie. Sie hat mit sich gerungen, und sie hat gesiegt.
»Also, man weiß es nicht. Es könnte ein neuartiges Virus sein. Oder Bakterien. Aus Permafrostzonen womöglich. Desinfizier dir die Hände, ja? Und ruf an, wenn du dort ankommst und sobald du zurück bist.«
»Okay.«
»Und vergiss nicht, vorher zu tanken.«
»Ich komm schon klar.«
»Natürlich, Liebes.«
Erst nach dem Auflegen fällt mir wieder ein, wie oft Glen und Sera sich schon rühmen konnten, Dinge vorausgeahnt zu haben: Hightech- und Immobilienblasen, Entwicklungen im Irak, im Nahen Osten, in Afghanistan und Russland, unser zunehmend erratisches Wahlverhalten, den ersten schneefreien Winter und noch einiges mehr, politische Fehlentscheidungen, Kriege und Naturkatastrophen. Was jetzt passiert, haben sie nicht kommen sehen – das hat niemand –, aber sie sind gut darin, Folgen abzuschätzen. Ich sollte mir viel mehr Sorgen machen, aber statt auf meinen Verstand zu hören, rufe ich schnell unter 411 die Auskunft an und besorge mir die Nummer der Superpumper-Tankstelle, in der meine Herkunftsfamilie arbeitet. Ich lasse mich von der munteren Computerstimme sogar automatisch weiterverbinden, obwohl das zusätzliche Gebühren kostet.
»Boozhoo?«
O Gott, denke ich, die sprechen Französisch.
»Bonjour«, antworte ich.
»Hallo?«
»Hallo.«
»Wer ist da?«
»Ich … äh … wollte Mary Potts sprechen.«
»Tja, die bin ich nicht. Wer ist da?«
»Okay, also, vor einem Jahr ungefähr habe ich einen Brief von Mary Potts senior bekommen, in dem stand, dass sie meine leibliche Mutter ist. Bin ich … ich meine, Sie klingen nicht wie Mary Potts senior, aber sind Sie vielleicht …«
»Was zur Hölle?!«
»Hey, Moment …«
»MOOOM! Hier ist ’ne IRRE am Telefon und sagt, du wärst ihre Mutter und hättest ihr geschrieben!«
Gemurmel von einer anderen Stimme. Gib mal her. Es knackt und knallt, als hätte jemand den Hörer fallen lassen. Ein Mann fragt: Wer ist das, Sweetie? Eine Frau: Niemand! Dann die erste Stimme: LassmichinRuhe! Ein Aufschrei, der leiser wird und mit einem Krachen endet, einem Türenknallen vermutlich?
»Mary Potts senior?«, frage ich die Atemgeräusche in der Leitung.
»Am Apparat«, flüstert sie. Dann ein Räuspern. »Ja, das bin ich. Die dir geschrieben hat.«
Und plötzlich muss ich fast weinen. Mir zerspringt die Brust, ich kann kaum atmen, ich gehe kaputt. Die einzig mögliche Abwehr gegen das, was ich in dem Moment empfinde, ist die Wut, die gleichzeitig in mir hochkriecht und mir die Stimme einfriert.
»Sie sind nicht zufällig morgen da?«
»Wo?«
»Zu Hause.«
»Ich hab nichts vor.«
»Ich komme vorbei. Ich will Sie besuchen. Wir müssen reden.«
»Okay.«
Wer ist dran, Sweetie? Der Mann wieder. Niemand!, antwortet sie.
Ich ignoriere das fiese Kratzen im Hals, die Reaktion darauf, dass sie mich zum zweiten Mal als Niemand bezeichnet.
»Wer nennt Sie denn Sweetie?«, frage ich.
»So heiße ich«, sagt Mary Potts senior. »Alle nennen mich hier so.«
»Aha.«
Sie klingt so unterwürfig, so verhuscht, so überrascht und ängstlich. Tödlicher Hass flammt in mir auf, aber er äußert sich nur als unterkühlter, komplizierter Satzbau.
»Das wird sicher sehr passend sein, Sweetie, nichtsdestoweniger würde ich lieber bei Mary Potts senior bleiben, wenn es recht ist.«
»Das mit senior stimmt aber nicht richtig. Ich bin beinahe die Älteste, aber nicht ganz. Die Oma lebt noch.«
»Also dann Mary Potts beinahe-senior. Dürfte ich fragen, wie ich zu Ihnen komme?«
»Na klar«, sagt Mary Potts oder Sweetie, aber dann kommt nichts weiter.
»Und?«, frage ich mit Eisesstimme.
Plötzlich klingt sie schelmisch. Vielleicht kann sie nicht anders; vielleicht ist sie zeitgleich demütig und erschüttert und durchtrieben, was weiß denn ich.
»Du hast gefragt, ob du dürftest. Und, fragst du?«
Jetzt durchzuckt mich etwas – ein jäher Zorn wahrscheinlich, weil sie es schließlich war, die mir geschrieben hat und die wollte, dass ich mich bei ihr melde, und weil sie es war, die mich ausgetragen und dann entsorgt hat. Aber ich lasse mich von ihren Spielchen nicht irremachen.
»Sagen Sie es mir einfach«, antworte ich sachlich und neutral. »Ich brauche nur die Adresse. Dann benutze ich das Navi oder Siri.«
»Navis kennen uns nicht, und Siri ist tot. Wusstest du das nicht?«
»Was?«
»Wirst es schon merken. Von wo kommst du? Fährst du hoch oder runter?«
»Ich komme aus Minneapolis hoch.«
»Dann nimmst du den Highway Richtung Skinaway und fährst … äh, links. Links ab, über den Fluss.«
Sie wirkt erleichtert, dass es ihr gelungen ist, rückwärts zu denken, den Weg aus meiner Fahrtrichtung zu beschreiben. Vielleicht ist sie sogar ein bisschen stolz auf sich, als hätte sie gerade zum allerersten Mal einen Weg beschrieben.
»Welcher Fluss?«
»Der große.«
»Und zwar? Ich meinte, wie er heißt.«
»Das ist der einzige große mit Brücke. Dann kommt gleich links eine Straße. Unbefestigt. Da links rein.«
»Verstehe. Nach links auf eine unasphaltierte Straße. Hat die einen Namen?«
»Ach ja. Skinaway Road.«
»Das ist doch was. Und dann?«
»Da wohnen wir, ganz am Ende.«
»In welcher Hausnummer?«
Sie räuspert sich. Irgendwie klingt es, als wäre sie kurz davor, loszuschreien, als wäre Verzweiflung am Werk, als drohte ein hysterischer Anfall. Und da begreife ich, dass Reservate – ich kenne mich damit ja nicht aus –, dass die Leute in Reservaten vielleicht einfach keine Wegbeschreibungen brauchen. Vielleicht weiß einfach jeder, wo alles ist. Vielleicht geht niemand weg und waren alle immer schon da.
»Okay, egal, wie sieht Ihr Haus denn aus?«
Sie klingt sehr erleichtert.
»Es ist gelb, relativ neu, ein zweistöckiges Ranchhaus mit weißen Leisten und einer Rollstuhlrampe für die Oma. Morgen holen wir sie dann für dich her. Bis dahin borgt Avis sie noch aus. Aber du fährst jedenfalls in die Einfahrt. Da steht ein schwarzer Transporter mit lila Verzierungen, der ist aufgebockt, aber das ist das einzige Auto, das gerade … äh … nicht funktional ist. Ein neuer Pick-up wird da auch stehen, das ist meiner, und vielleicht ein kleiner brauner Maverick, Eddys Wagen, und ein Schwitzhüttenrahmen …«
»Schwitz-was?«
»Oma und Eddy wollten Mary junior behandeln. Die eben am Telefon war. Der steht jedenfalls dicht neben dem Haus, ein Stückchen hinten im Garten.«
»Ich weiß immer noch nicht, wovon Sie reden.«
»Tja, und Vogelhäuschen haben wir. Und einen Schrein, den siehst du gleich als Erstes. Mary.«
»Ich nenne mich ja gar nicht Mary. Mein Adoptivname, also, mein richtiger Name ist Cedar.«
Ein langes Schweigen. Dann: »Das ist ein schöner Name.« Sie klingt wieder zärtlich, schmerzerfüllt, melancholisch. »Ich habe dich im Kopf irgendwie immer Mary genannt. Aber jetzt gerade meinte ich den Schrein, weißt du, den Schrein mit der Heiligen Jungfrau.«
»Maria? Maria in einer vertikalen Badewanne?«
»Äh, ja, also, vertikal kann man wohl auch sagen, du musst ganz schön schlau sein, hm? Ich hätte gesagt, hochkant und zur Hälfte eingegraben. Woher wusstest du das? Das war noch die Wanne aus dem alten Haus. Hat Eddy aufgestellt. Und die Blumen sind von mir.«
»Wow.«
Da begreife ich etwas, und es macht mich beinahe fertig. Es dämpft ein bisschen meine Wut und sorgt dafür, dass ich mich leise verabschiede und höflich meiner Vorfreude auf unsere Begegnung Ausdruck verleihe. Als ich aufgelegt habe, sitze ich nur da und starre auf das Telefon. Da haben wir’s – eine genetische Übereinstimmung. Ich war schon Katholikin, bevor ich auf die Idee kam, meine leibliche Mutter zu kontaktieren. Diese Religion hat mich magisch angezogen, hat mich fasziniert mit all den Heiligen, der Liturgie, ja sogar mit diesen kleinen Schreinen. Und jetzt stellt sich heraus, dass wir die Heiligen und die Kirche gemeinsam haben. Ich und sie, Sweetie, Mary Potts beinahe-senior.
9. August
Am nächsten Morgen fahre ich auf dem Highway nach Norden, meinem Potts-Zuhause im Reservat entgegen. Es gibt Momente schmerzlicher Klarheit. Alles, was ich sehe – Ahorn- und Nadelbäume, Einkaufszentren am Straßenrand, Versicherungsbüros und Tattoostudios, das Gestrüpp in den Gräben und die Menschen in ihren Häusern –, balanciert physisch auf einem Grat zwischen dem Jetztzustand und der großen, unbegreiflichen Umwälzung, die uns bevorsteht. Trotzdem wirkt alles relativ normal. Ein bisschen still ist es vielleicht, und manche der Sprüche auf den Kirchenschildern klingen besonders alarmistisch. Endlich das Ende! Seid ihr bereit für die Entrückung? Auf einem riesigen leeren Feld steht ein Schild mit der Aufschrift: Die künftige Wohnstatt des lebendigen Gottes.
Es ist bloß ein leeres Feld, brach und unkrautbewachsen, das sich bis zum blassen Horizont erstreckt.
Ich halte an, fotografiere das Schild und fahre weiter. Ein Auto, das mich überholt, trägt den Aufkleber: Wenn du entrückt wirst, krieg ich dann dein Auto? Gut zu wissen, dass es nicht alle so eilig haben, abzuheben. Ich liebe die Highways. Das Nachdenken bei voller Fahrt. Wenn es wahr ist, dass jedes Materieteilchen, das ich sehe oder auch nicht, dass alles Lebendige und vielleicht auch alles Unlebendige die Segel streicht und beidreht und Kurs auf den Heimathafen nimmt, was bedeutet das dann? Wo treibt es uns hin? Ist das Ziel wirklich ein anderes als jenes, das wir schon immer hatten? Vielleicht ist die gesamte Schöpfung von der Wicklermotte bis zum Elefanten bloß ein extrem detaillierter Gedanke, dem nachzuhängen Gott eine Weile gefallen hat, nur dass Er dann plötzlich eingeschlummert ist. Dann wären wir also eine Vorstellung. Vielleicht hat Gott beschlossen, dass die Vorstellung von uns das Nachdenken nicht mehr lohnt.
So grüble ich weiter bis zur Rast. Ich biege in die typische Drive-in-Gasse einer typischen Fastfoodkette ein, esse ein Käse-Omelette-Sandwich und trinke zwei Packungen Milch. Fastfood gibt es also noch, und ich bin dankbar dafür. Essen erdet mich. Es macht mir den Kopf frei, und ein paar Stunden später bin ich schon im Reservat. Am Superpumper der Potts fahre ich vorbei, aber nicht ohne ein bisschen abzubremsen. Da sind sie also, denke ich, die Besitztümer meiner Ahnen – ein beleuchtetes Vordach aus rotem Plastik über einer Reihe von Zapfsäulen und ein Betonquader mit rot gerahmten Türen, die farblich zum Vordach passen. Große erleuchtete Fenster, ein hagerer Mann am Tresen, der sich, auf die Unterarme gestützt, über etwas beugt, anscheinend über ein Buch. Wahrscheinlich der Blue-Book-Katalog für Gebrauchtwagen oder bestenfalls ein technologielastiger Männer-Thriller. Hoffentlich kein Porno. Der dürre Mensch ist vermutlich der Ehemann meiner leiblichen Mutter. Eddy. Der wurde in dem Brief erwähnt. Kein Wort von meinem leiblichen Vater.
Ich überquere eine Brücke mit einem Rinnsal darunter – man kann es knapp als Fluss durchgehen lassen, finde ich. Aber es kommt lange kein Abzweig nach links. Die Straße, in die ich schließlich einbiege, führt an sechs Häusern vorüber. Fünf davon sind sauber und ordentlich, begärtnert und gepflegt, vogelbehaust und mit schwarzen Sperrholzbildnissen von Bären und Elchen dekoriert, oder von den Rückseiten vornübergebeugter Frauen in gepunkteten Pluderunterhosen. Der sechste Garten ist mit kolossal viel Zeug vermüllt – drei Kinderplanschbecken aus himmelblauem und grellpinkem Plastik, ein Trampolin, Autowracks, lecke Boote, die bestimmt zur Reparatur da liegen, bergeweise Rasenmäher, Gartentraktoren und Grills. Hier und da tauchen aus den Straßengräben Hunde auf, jagen mir nach und schnappen nach den Reifen. Das letzte Haus auf dieser Straße ist nicht gelb. Ich halte am Rand. Ein grimmiger hellbrauner Terriermischling springt unermüdlich vor dem Beifahrerfenster auf und ab. Ich wende. Vielleicht gibt es doch noch einen Fluss. Sie hat schließlich gesagt, er sei groß. Auf dem Rückweg zum Highway kommen alle Hunde in umgekehrter Reihenfolge noch einmal aus den Gräben geschossen.
Es folgen noch zwei falsche Flüsse und Linksabbiegerstraßen, die alle wieder zur ersten falschen Straße führen, der Straße mit dem Garten voller Planschbecken. In einem stehen ein paar Zentimeter Wasser, und eine dicke Frau in einem langen T-Shirt sitzt darin und lässt ein kleines nacktes Baby im Wasser spielen. Oooch, süß. Verdammt! Wo ist mein Elternhaus? Wo ist meine Familie? Wieder ein falscher Abzweig, eine kurvige Straße, die Hunde, die sich jedes Mal wieder für mich und für mein Auto begeistern, und die Frau im Planschbecken, die mich jetzt anschaut, als wäre ich vom FBI. Ich beschließe, sie nach dem Weg zu fragen, und biege in ihre Einfahrt ein. Das macht die Hunde rasend; sie geifern vor Selbstgerechtigkeit. Ich bin in ihr Revier eingedrungen und traue mich nicht aus dem Auto. Ich kurbele das Fenster runter. Die Frau schaut mich an – sie hat ein flaches, schönes, verschlossenes, misstrauisches Gesicht. Sie schweigt.
»Könnten Sie mir sagen, wo Familie Potts lebt?«
Die Hunde werfen sich gegen meinen Wagen, prallen dumpf gegen die Türen, so sehr regt meine Stimme sie auf. Die Frau hält sich eine Hand hinters Ohr. Ich habe eigentlich keine Angst vor Hunden, aber einer von denen hier kaut an meinem Reifen.
»Ich suche Mary Potts!«
»Keine Ahnung!«
»Oder … Sweetie?«
Die Frau hebt langsam den Arm, stützt mit dem anderen das Baby und zeigt in die Richtung, aus der ich gekommen bin. Mir steigen Tränen in die Augen. Es hilft alles nichts, denke ich, lege den Rückwärtsgang ein und fahre aus der Einfahrt. Verbitterung steigt in mir hoch. Ich werde jeden verdammten Abzweig von dieser Straße nehmen, jede Brücke über jeden Fluss überqueren – wie viele können es schon sein? Ist es vielleicht alles ein Fluss, der breiter und schmaler wird und sich windet wie eine Schlange? Gibt es am Kasino auch eine Siedlung? Gibt es irgendwo einen Wasserturm? Einen Lebensmittelladen? Einen Ort, wo man sich die Bildung und die medizinische Versorgung holt, die uns angeblich per Staatsvertrag zugesichert wurde? Ich fahre zum Highway zurück und folge ihm weiter. Trauer wallt in mir hoch, verirrtes Selbstmitleid, so ein schreckliches, einsames Gefühl. Außerdem kriege ich Hunger, einen ernsthaften Schwangerschaftsjieper, ungebändigten Hunger, und will nur noch anhalten und weinen. Ich trinke einen Schluck Wasser. Esse eine Tüte Erdnüsse aus dem Handschuhfach, reiße mich zusammen. Beim Weiterfahren fällt mir ein, dass ich umkehren und mir im Superpumper Junkfood holen könnte, und dann könnte ich gleich Eddy kennenlernen. Gerade will ich den Plan umsetzen, da komme ich an eine Brücke über einen großen Fluss. Einen echten Fluss. Einen mit strömendem Wasser, endlich. Und gleich danach kommt ein Abzweig nach links auf eine vielversprechende Straße, an deren Ende mich, das weiß ich, ein gelbes Haus erwartet.
Und da ist es. Ich biege in die gekieste Zufahrt meines gelben Herkunftsfamilienhauses – relativ neu, drei oder vier Schlafzimmer wahrscheinlich. Da sind die Rollstuhlrampe und die Vogelhäuschen, der aufgebockte Transporter mit den lila Ornamenten, der gepflegte Muttergottes-Badewannenschrein und ein Gerüst aus Zweigen – Weide wahrscheinlich –, das wohl der Schwitzhüttenrahmen sein muss. Und da, ungefähr im passenden Alter, Mary Potts beinahe-senior. Sie hält einen Gartenschlauch in der Hand, einen nicht angeschlossenen Gartenschlauch, und drischt damit brutal auf ein staubiges Sofakissen ein. Als sie mich kommen sieht, grinst sie schief und schelmisch und verpasst dem Kissen noch ein paar abschließende Hiebe.
Das ist die Frau, die mich auf die Welt gebracht hat.
»Oh-haa!« Sie streckt die Arme aus und kommt auf mein Auto zu. Sie schwitzt leicht in ihrem engen schwarzen Tanktop, unter dem rosa BH-Träger hervorschauen, und einer schwarzen Capri-Jeans. Ihr wohlproportionierter, bärenhafter Körper besteht ganz aus muskulös-kompaktem Fett, und sie hat ein hübsches, symmetrisches Gesicht. Sie ist jung. Hat strahlend weiße Zähne und schlaue, kleine, frohe dunkle Augen. Ihr dunkelbraunes Haar mit den roten Strähnchen hat sie mit so einer Plastik-Greifklammer hochgesteckt, einer blauen, und sie trägt Perlenohrringe, die sogar echt aussehen. Ich steige aus. Es ist heiß und drückend.
Wir stehen einander gegenüber, total hilflos. Mir ist nicht nach einer Umarmung, und ich weiß nicht, was ich mit den Tränen in den Augen meiner leiblichen Mutter anfangen soll.
»Hübsch«, sage ich und tippe mir an die Ohren. »Hübsche Ohrringe.«
»Ja, hat Eddy mir geschenkt.«
Sie schnieft, dreht den Kopf weg und blinzelt.
»Ich glaube, den habe ich im Superpumper gesehen. Er hat gelesen.«
»Dann war er’s. Hängt immer mit der Nase in einem Buch.«
»Was liest er denn gern?«
»Eddy? Alles! Alles bis auf die Sexratgeber.« Sie seufzt. »Ha, war nur’n Scherz. Aayyy …«
Meine leibliche Mutter steht neben dem Auto, die Hände in die Hüften gestemmt. Mir fällt auf, dass sie auf einem Schnürsenkel herumkaut. Sie bemerkt, dass ich es bemerkt habe, und erklärt, dass sie das macht, wenn sie mit dem Rauchen aufhören will. Dann lächelt sie mich an, ganz zaghaft, aber mit dem Schnürsenkel im Mund ist es irgendwie komisch.
»Also – wie ist es? Was sagen die Leute hier zur Nachrichtenlage?«
Ich weiß nicht, was ich tun soll. Sie bittet mich nicht herein und signalisiert auch sonst nicht, ob ich hier willkommen bin. Also versuche ich, Konversation zu treiben.
»Du weißt schon, die Nachrichten … Das große Thema …«
Sie reagiert überhaupt nicht. Umso verzweifelter versuche ich, irgendwie Eindruck zu machen.
»Du siehst aus wie …«, sagt sie.
»Wie wer?«
»Ach, schon gut.«
»Nein wirklich, wer?«
»Na, wie ich.«
»Tu ich gar nicht«, sage ich ohne nachzudenken, aus dem Bauch heraus. Sie senkt den Blick. Dann wendet sie sich mit einem leichten Schütteln ihres Haarknotens ab und geht, was mir vor Augen führt, dass sie den perfekten herzförmigen Hintern hat. So fest eingepackt, wie er in der schwarzen Capri-Jeans ist, bewegt er sich in einem gut geölten Rhythmus, den ich in dem Moment, muss ich gestehen, echt gern geerbt hätte. Ich selbst bin groß, knochig, schlank und habe einen flachen Po. Als ich mich nicht rege – sondern nur auf ihren Hintern starre, was vermutlich viele Leute genauso halten –, schaut sie über die Schulter und nickt zum Haus hin. Ich folge ihr die Rollstuhlrampe hoch, über die Veranda und durch die Tür. Im Haus ist es beinahe erträglich; irgendwo muss eine Klimaanlage sein. Im Wohnzimmer liegt ein dicker Teppich, und es riecht nach Draußensachen – nach Rinde vielleicht oder Vogelfutter oder gekochten Beeren – und Zigaretten.
»Wenn du rauchen willst«, sagt sie, »ist draußen eine Dose mit Sand für die Kippen. Hier drin rauche ich nie.«
Irgendjemand aber schon, denke ich.
Meinen Rucksack und den Laptop stelle ich hinter die Tür – im Auto wollte ich sie nicht lassen. Mary beinahe-senior rumpel-schlendert in die Küche. Ich beschließe, mich an den Tisch zu setzen – getüpfeltes Resopal. Von dort schaue ich zu, wie meine LM (weiß nicht, wie ich meine leibliche Mutter nennen soll, so jedenfalls nicht) schweigend eine Kanne starken Tee kocht. Sie schenkt mir welchen ein, mit Zucker, und setzt sich mir gegenüber.
»Schön bist du geworden«, sagt sie und schreit dann ins Nebenzimmer: »Schön ist sie geworden!«
»Wer ist da?«
»Deine Großmutter. Sie ist alt. Bei meiner Geburt war sie dreiundfünfzig, ungelogen, stell dir vor. Mach’s bis sechzig nie ohne Kondome, ha!«
»Einhundertachtundzwanzig!«, sagt eine schnarrende Stimme aus dem Nebenraum. Dann kommt eine winzige, gekrümmte, braunhäutige alte Dame Stückchen für Stückchen um die Ecke gerollt – im Rollstuhl, auf dem dicken Teppich.
»Da ist sie«, sagt meine leibliche Mutter. »Mary Potts eindeutig-senior.«
Die Alte gibt ein heiseres, flüsterndes Kichern von sich.
»Bitteeee …«, ächzt sie, haucht sie vielmehr und kämpft sich vorwärts. Ich springe auf und schiebe sie an den Tisch.
»Sie dürfte wirklich über hundert sein«, sagt meine leibliche Mutter. »Das ist kein Scherz.« Sie erzählt von ein paar anderen steinalten Verwandten.
»Mary Bodacia«, sagt die Großmutter und nickt weise. »Einhundertelf.«
»Bodacia. Sehr witzig. Ihr macht mich allesamt wahnsinnig«, sagt meine leibliche Mutter, ohne jemanden Bestimmten anzusprechen. »Und sie«, jetzt zeigt sie auf mich, »nennt mich Mary Potts beinahe-senior. Das findet sie witzig.«
»Beinahe witzig«, sage ich. »Ich weiß einfach nicht, wie ich dich nennen soll. Sweetie bist du nicht gerade.«
»Eh-heh-heh-heh …« Die Großmutter lacht und nickt der Teetasse zu, die Mary beinahe-senior behutsam zu ihr rüberschiebt. Ich halte das nicht mehr aus und beschließe, direkt zum Punkt zu kommen. Ich beuge mich vor und wende mich an meine leibliche Mutter.
»Zwei Fragen. Erstens: Warum hast du mich weggegeben? Zweitens. Ich will alles über Erbkrankheiten wissen.«
Beide Frauen schweigen, nippen in der warmen Küche an ihrem heißen Tee und schauen auf die Tischplatte. Meine leibliche Mutter betrachtet das Muster im Resopal, als könnte sie an der Konstellation der Pünktchen die Zukunft ablesen. Schließlich stößt sie einen Seufzer aus – ich gewöhne mich schon fast an diese Seufzer – und hüstelt erst einmal. Sie nimmt Anlauf, etwas zu sagen. Nach mehreren Fehlstarts, bei denen sie derselbe Mangel an verbalen Fähigkeiten befällt wie beim Versuch, mir den Weg zu beschreiben, fängt sie endlich an.
»Es lag nicht daran, dass ich so furchtbar jung war«, sagt sie, »ich meine, jung war ich schon.« Noch ein tiefer Seufzer. Nächster Versuch. »Ich hab’s getan, weil ich so dumm war. Seitdem ist kein Tag vergangen, an dem ich nicht daran denken musste, wie dumm ich war.«
Sie schaut mich stirnrunzelnd und verwundert an.
»Dumm«, sagt sie noch einmal und nickt. Sie schließt die Hand um den Henkel der Teetasse und öffnet sie wieder. »Drogen hab ich genommen. Nicht während der Schwangerschaft. Danach. Bin mit jedem Arschloch ins Bett gestiegen. Einfach beschissen dämlich«, flüstert sie. »Bis ich Eddy gefunden habe. Aber es ist kein Tag vergangen, ohne dass ich an dich gedacht hätte.«
Vergiss die praktischen Fragen. Die können warten. Jetzt muss ich erst mal klarkommen mit dem Gedanken: Kein Tag? Wie wär’s denn mit keine Stunde? Ich will losheulen. Ich hab dich vermisst. Dich gebraucht!
»Da hast du wohl mehr an mich gedacht als umgekehrt«, sage ich schulterzuckend.
Danach sagt niemand mehr was. Ihre Tränen trocknen, und wir schweigen uns an.
»Tja, ’ne gute Familie hast du, hm? Steinreich«, sagt sie schließlich, schüttelt sich und richtet sich auf. »Ein Jahr haben sie mir Fotos geschickt. Dann habe ich ihnen geschrieben, lasst es bleiben, ich halt das nicht aus.«
»Du hast es nicht ausgehalten?« Meine Augen verengen sich zu Schlitzen, und dieses Ding überkommt mich, dieses Etwas, das ich mit Gebeten in Schach zu halten versuche, diese Wut. Sie zischt in mir hoch wie geschüttelte Kohlensäure. »Du hast es nicht ausgehalten?«
Draußen heult ein Motor auf und geht aus, es nähern sich schnelle, polternde Schritte, und dann knallt hinter mir die Tür, und als ich mich umdrehe, erlebe ich den großen Auftritt der Königin der Verdammten – Mary junior. Auf High-Heel-Stiefeln stakst sie in die Küche, in zerrissenen Netzstrumpfhosen, mit mehr Piercings, als ich aufzählen könnte, und langem Haar mit einigen kürzeren rosa Spitzen, die bei der feuchten Luft aber am Kopf anliegen, bis auf eine steil abstehende Ponysträhne. Ihre Augen sind säuberlich rot und schwarz umrandet. Mit Markern? Mit wasserfesten Stiften? Ihre Pupillen sind groß und leuchtend. Wankend steht sie im Türrahmen, offensichtlich high.
»So, so«, sagt sie gedehnt.
»Das ist deine Schwester«, sagt meine leibliche Mutter. »Von der ich dir gestern erzählt habe.«
»Ach, niemand?« Mary junior lächelt uns verträumt boshaft an. Ihre Zähne sehen aus wie angespitzt – vielleicht sind sie es auch? Die Eckzähne sind ein bisschen länger als die Schneidezähne und wirken im Kontrast zu dem schwarzen Lippenstift sehr weiß, wie elegante Reißzähne. Sie ist hübsch, wie ihre Mom, hübscher als ich, denke ich, und bin mittendrin in diesem Mädchending: Wer ist schöner. Schwestern vergleichen sich bestimmt andauernd, und in dem Moment bin ich froh, dass ich nie eine Schwester hatte. Ich bin froh, dass ich nicht mit dieser Mutter, in dieser Familie aufgewachsen bin, abgesehen vielleicht von der Oma. Ich muss an Glen und Sera denken und an alles, was uns verbindet, und dabei kommen mir doch noch die Tränen. Ich wende mich meiner leiblichen Mutter zu und beuge mich vor. Nehme ihre Hand und drücke sie fest und warm.
»Ist schon gut, Sweetie. Wirklich, es ist alles gut«, sage ich und bleibe dabei so ernst wie möglich. »Wenn ich Mary so sehe, weiß ich gleich, was für eine gute Mutter du gewesen wärst.«
* * *
Meine Schwester, Mary junior, ist sechzehn, und als sie wieder weg ist und wir richtig reden, stellt sich heraus, dass Sweetie glaubt, Mary sei zwar nicht so toll in der Schule, aber sie nehme keine Drogen, sei keine Trinkerin und rauche auch nicht. Sweetie schüttelt sogar staunend den Kopf.
»Ich weiß, dass du das ironisch gemeint hast oder sarkastisch oder wie das heißt, das mit der guten Mutter. Ich weiß, dass ich nicht die tollste Mutter bin, das weiß ich. Aber Mary junior macht sich wirklich gut. Sie ist die Einzige in ihrer ganzen Klasse, die nicht rumhurt und keine Drogen nimmt. Sie sagt, irgendwann geht sie noch daran kaputt.«
»Natürlich. Verstehe.« Ich widerstehe dem Drang, mich lachend auf dem Boden zu wälzen und allen Heiligen für das Leben zu danken, das ich führen durfte. »Es ist hart, auf einer Party die einzig Nüchterne zu sein. Das einzige intelligente Wesen.«
Eine Weile trinken wir schweigend Tee und sinnieren über die Herausforderungen in Mary juniors Sozialleben. Und die Vorstellung vom einzigen intelligenten Wesen bringt mich natürlich auf den Gedanken, wer der letzte Vertreter unserer Spezies sein wird … der letzte Mensch, der mit allem Bekannten und Unbekannten allein wird fertigwerden müssen. Wie es aussieht, könntest das du sein. Oder ich. Vielleicht lebe ich ja ungewöhnlich lange, wie Großmutter. Oder vielleicht – ein übler Gedanke – wird Mary junior die Letzte unserer Art.
»Kann sie denn mit Eddy reden?«, frage ich. »Ist er ein verständnisvoller Mensch?«
Sweetie schüttelt den Kopf, ein paarmal gleich, eine Geste, die mir gefällt, weil ihr unordentlicher Knoten dabei in schöne Wallungen gerät. »Die beiden hatten neulich einen krassen Streit, es war echt traumatisierend. Eddy hatte Mary dabei erwischt, wie sie die Schnupfenmittel aus dem Pumper ins Auto verfrachten wollte – also, sie hat sich natürlich erwischen lassen. Ein Hilfeschrei. Aber, hey, sie hat das Zeug nicht genommen, nur hinter unserem Rücken an so ein Meth-Opfer verkauft.«
»Ah«, sage ich, »verstehe. Und Eddy? Wie ist der so?«
»Eddy«, sagt Sweetie, und ihre Züge werden weich und die der Oma hart. »Mein Eddy.« Es schüttelt sie vor Glück. Sie formt die Finger zu Krallen. »Miau!« Sie und die Oma lachen.
»Ich meine, was ist seine Geschichte?«, frage ich. Ich versuche, das Gespräch voranzutreiben, statt mir vorstellen zu müssen, was mit diesem Miau gemeint war.
»Tja, er ist schlau, ja, er hat’s echt drauf. War am Dartmouth College und hat dann in Harvard in Pädagogik promoviert. Danach hat er versucht, das Schulsystem hier im Reservat in den Griff zu kriegen, aber, also …« Jetzt sieht Sweetie traurig aus, ihr Gesicht, ihre ganze Haltung. »Daran ist er seelisch zerbrochen. Als er wieder halbwegs auf den Beinen war, hat er beschlossen, seine Familie, also uns, als Geschäftsmann durchzubringen. Für den Stammesrat hat er sich auch beworben, und er schreibt ein Buch. Dreitausend Seiten hat er schon beisammen.«
Sweetie schürzt die Lippen und nickt zu einer Tür hin, einem Wandschrank. »Da sind sie drin. Die Entwürfe für sein Manuskript, und es handelt alles von mir. Er folgt mir überallhin und beobachtet mich ständig.«
»Und wo ist er jetzt? Warum ist er nicht Zeuge dieser historischen Begegnung zwischen dir und mir?«
»Einer muss doch im Laden stehen«, sagt Sweetie. »Übrigens muss ich, also, ich habe doch noch was vor heute. Ich muss vor dem Stammesrat was erzählen. Und nach der Sitzung wird Rollrasen verlegt.« Dann fügt sie schüchtern hinzu: »Willst du mit?«
Mir geht es besser; ich gewöhne mich allmählich an das Ganze, und das heikelste Gesprächsthema habe ich schon hinter mir, aber es fehlt noch der Teil, wo ich meine Familie nach genetischen Besonderheiten ausfragen muss. Sobald das durch ist, will ich los. Dann mache ich mich vom Acker, beziehungsweise vom Reservat.
»Was ist das für eine Sitzung? Und warum Rollrasen?«
»Für den Schrein. Nicht unseren im Garten. Ein Schrein für Kateri, weißt du?«
»Ja, die kenne ich. Wirklich?«
Sweetie erzählt von der Wegkapelle, die sie und zwanzig andere Gemeindemitglieder errichten wollen, an einer Stelle, wo in den letzten vier Jahren dreimal Erscheinungen gemeldet wurden. Die Leute glauben, es könnte Kateri Tekakwitha gewesen sein, die Lilie der Mohawk, die Schutzheilige der Indianer. Da ist sie wieder, diese Übereinstimmung. Die Sache mit dem Glauben. Als wir mit dem Tee fertig sind, helfen wir Großmutter in ihr kleines, in die Ecke gezwängtes Bett mit hoch aufgestapelten Decken. Dann steigen wir in meinen Honda und fahren zur Stammesverwaltung.
Auf dem Weg sagen wir beide kein Wort. Wir stellen den Wagen ab und schreiten unter den Schwingen eines Adlers aus Fiberglas durch die automatischen Eingangstüren. Das ist mir alles neu. Und so interessant! Drinnen ist die Luft kühl und frisch. Ich atme sie in tiefen Zügen. Ich kann es kaum erwarten, Glen und Sera alles genau zu erzählen – ein Fiberglasadler! Wir melden uns an, und Mary redet mit dem Rezeptionisten, einem Cousin. Schließlich gehen wir ins Sitzungszimmer und nehmen gleich vorn am Ende des Tisches Platz. Wir sind hier die Einzigen ohne große Thermo-Kaffeebecher. Unser Thema ist als Erstes dran. Alle plaudern entspannt und stimmen sich auf die Sitzung ein. Mary öffnet eine Aktenmappe, die sie dabeihat.
Eine Frau spricht ein Gebet oder hält vielleicht eine kurze Rede auf Ojibwe, und dann verliest Henry »Bangs« Keewatin, ein dicker, blasser, teigiger Raucher und typischer Herzinfarkt-Kandidat, das Protokoll vom letzten Treffen und stellt uns der Runde vor.
»Mrs Potts wird uns die Sache mit dem Schrein erklären«, verkündet er. Sweetie verliest eine Kurzversion des Lebenslaufs der Heiligen.
»Im Jahre 1656 in Osserneon, New York, geboren, als Tochter einer christlichen Algonquin namens Kahenta. Kateris Mutter heiratete einen Heiden aus dem Turtle Clan und starb während einer Pockenepidemie, bei der auch Kateris Gesicht entstellt und ihr Augenlicht erheblich geschwächt wurde. Sie konvertierte, ließ sich 1670 taufen und lebte fortan ein bemerkenswert tugendhaftes Leben, selbst, so heißt es, inmitten grausamer Gemetzel, wilder Ausschweifungen und götzendienerischer Raserei.«
»Götzendienerische Raserei? Ist damit die traditionelle Religion gemeint?«, fragt Bangs.
»Schätze, ja«, sagte Sweetie. »Ich bin heidnische Katholikin. Kann ich weitermachen?«
Bangs nickt.
»Sie legte ein Keuschheitsgelübde ab und starb in jungen Jahren«, sagt Sweetie.
»Deshalb bin ich auch nicht keusch«, sagt Bangs.
Sweetie hebt die Augenbrauen, seufzt und liest weiter.
»Nach ihrem Tod ereigneten sich Wunder. 1980 wurde Kateri von Papst Johannes Paul II. seliggesprochen und später als Heilige kanonisiert. Sie ist die Schutzpatronin aller Ureinwohner sowie der Umweltschützer, der Exilierten, der Waisen und der … derer, die für ihre Frömmigkeit verspottet werden.
Ich teile jetzt die Finanzanalyse zu einer Stätte aus, in der es mehrere Erscheinungen der Jungfrau Maria gegeben hat. Das ist auf Long Island, New York. Damit könnt ihr euch ein Bild machen, welche Auswirkungen der Pilgerstrom auf die Geschäftswelt vor Ort hat.«
Sweetie zieht ihre Kopien aus der Mappe und teilt sie an die Ratsmitglieder aus, die ihre Lektüre skeptisch beginnen und lächelnd beenden.
»Und das sind nur die Folgen einer unbestätigten Sichtung, Leute. Von Kindern. Die heilige Jungfrau hat ihnen aus einem Rosenstrauch gewinkt. Jetzt werden von allen Rosen im Umkreis die Blütenblätter verkauft. Eins davon habe ich hier.«
Sie lässt eine kleine Klappkarte herumgehen, die ein laminiertes Blütenblatt enthält.
»Nicht schlecht«, sagt eines der Ratsmitglieder und lässt die Kopie mit den Zahlen sinken, die Sweetie aufgeschrieben hat. Bangs Keewatin lächelt. »Ich schätze, angesichts der Weltlage könnte das Interesse an Erscheinungen der spirituellen Sorte steigen, und darauf sollten wir uns zeitnah einstellen. Wir sollten es nutzen, dass diese Heilige hier aufkreuzt.«
»Ja, schließlich hat sie uns ausgewählt«, sagt Sweetie. »Hier sind die Zahlen, wie viel Geld ein Pilger im Schnitt in den Lokalen und Motels rund um die Pilgerstätte auf Long Island ausgibt. Ach ja, und eine Beschreibung der ersten beiden Erscheinungen.« Sie teilt Ausdrucke der Berichte aus.
»Ich weiß nicht. Man könnte viel mehr daraus machen«, wendet Bangs ein, »wenn dieser Geist, oder was es ist, nicht nur den kläglichsten Versagern erschienen wäre.«
»Solche Ressentiments bekommt man auch von den Kirchenoberen häufig zu hören«, sagt Sweetie.
Ressentiments?, denke ich. Vielleicht hat sie sich von Eddy coachen lassen. Oder habe ich Sweetie etwa unterschätzt?
»Die sieben Personen, denen Kateri erschienen ist, waren keine Versager«, sagt sie streng. »Sie hatten nur gerade größere Mengen Geld an den Automaten und den Blackjack-Tischen verloren und einen herben finanziellen Schlag einstecken müssen, als ihnen die holde indianische Maid erschien. Sie war in Wildleder gewandet und trug ein Kreuz vor sich her. Sie hatte einen Blumenkranz im Haar, als Zeichen der Reinheit von einer Lilie gekrönt. Und sie sprach zu den Leuten. Nicht tröstlich, übrigens. Sie machte ihnen unumwunden Vorwürfe, und zu Hap Eagle hat sie ganz konkret gesagt, er hätte das gute Essensgeld verspielt, und seine Kinder müssten jetzt von dem Zeug von der Essensausgabe leben.«
»Gibt es im Himmel Essensausgaben?«, fragt eins der Ratsmitglieder, ein Mann namens Skeeters. »Oder wie konnte sie davon wissen?«
»Heilige wissen alles«, sagt Sweetie sehr ernst. »Offenbar hat unsere Heilige eine Grundsatzentscheidung getroffen«, fährt sie fort, »und wie kämen wir dazu, sie infrage zu stellen? Sie hat beschlossen, nur den spirituell Unbeleckten zu erscheinen. Unergründlich, ja, aber mehr haben wir derzeit nicht in der Hand.«
»Unbeleckt! Nicht schlecht!«, flüstere ich Sweetie zu, als sie sich setzt.
»Ich wusste gar nicht, dass sie nur Jungfrauen erscheint«, sagt Bangs und schaut stirnrunzelnd in die Runde
»Unbeleckt war das, nicht unbefleckt«, sagt Sweetie.
Sie lächelt sanft und redet einfach weiter. »Im Sinne von planlos. Nur schade, dass sie nicht erschüttert genug waren, um dem Glücksspiel zu entsagen. Es gibt also leider keine Errettungsgeschichten. Sie spielen immer noch Bingo, nur jetzt mit der Bibel unter dem Arm. Na, jedenfalls wollen wir da auf dem Kasinoparkplatz, auf dem Stück, das wir frei lassen durften, jetzt Rollrasen verlegen. Wir haben Grassoden bestellt. Hier ist die Rechnung.«
Der Schatzmeister nimmt die Rechnung entgegen und lässt über die Mittelbewilligung abstimmen. Der Antrag kommt durch, und das war’s. Wir verlassen das Gebäude und gehen zu Fuß zum Schrein, der auf der anderen Seite des Highways gleich hinter dem frisch planierten und asphaltierten Kasinoparkplatz liegt, ein ovales Fleckchen heiliger Erde zwischen dem Nord- und dem Südteil des Parkplatzes. Das Komitee hat beschlossen, erst einmal Rollrasen zu verlegen, der vor einer Stunde geliefert werden sollte. Den genauen Schauplatz der Erscheinung markiert ein Felsblock, für den auch schon eine Plakette gegossen wird. Dahinter will das Komitee eine Statue errichten, wobei Sweetie befürchtet, eine Statue könnte Kateri daran hindern, noch einmal persönlich zu erscheinen.
Als wir ankommen, steht ein schwarzer Pritschenwagen am Straßenrand, und sechs, sieben Leute laden Grassoden ab. Irgendjemand hat einen langen Gartenschlauch von der Rückseite des Kasinos hergeschleift, um die Erde im Oval zu bewässern. Sweetie und ich packen gleich mit an. Zusammen tragen wir eine der Rasenrollen zu der Stätte und legen sie passgenau an die anderen Streifen. Die ganze Fläche dauert nur ungefähr eine halbe Stunde. Dann verabschieden sich die anderen, der Lastwagen fährt weg, und meine neue Mom und ich bleiben mit dem Gartenschlauch zurück, um die Soden anzugießen.
So ist es also, wenn die Welt untergeht, denke ich. Alles ist aus den Fugen, und man tut ganz normale Sachen.
Sweetie zündet sich eine Kippe an und setzt sich auf den heiligen Felsblock, während ich meinen Daumen in den Wasserstrahl halte und einen gleichmäßigen Sprühregen auf den fertigen grünen Rasen niedergehen lasse.
Sweetie seufzt – schon wieder dieses Seufzen –, schüttelt sexy ihren Haarknoten und lässt ihren Blick über den Parkplatz schweifen.
»Wie aufs Stichwort«, sagt sie und zeigt mit der Zigarette auf ein Auto. »Da kommt Eddy, siehst du? Er sucht Inspiration, wie immer, und die bin ich.« Sie steht auf und wirft die Zigarette mit einer abgezirkelten Handbewegung in den Gully am Bordstein des Parkplatzes. Dann holt sie den Schnürsenkel aus der Tasche und wickelt ihn sich um die Finger. Eddy hält und steigt aus, und Sweetie macht sich schnell ein bisschen zurecht. Offensichtlich bildet sie sich ein, dass ihr Ehemann ihr sklavisch ergeben ist, was ich schon jetzt leise bezweifle, was aber irgendwie trotzdem funktioniert, weil sie alles, was er tut, als Zeichen seiner Ehrerbietung deutet. Jetzt zum Beispiel steht da ein Slushie im Getränkehalter seines Wagens, und sie langt durchs offene Fenster und angelt ihn sich mit einem Seufzer nach dem Motto: Mein Mann sorgt so gut für mich.
»Du bist also Cedar«, sagt Eddy, kommt auf mich zu und schüttelt mir wohlerzogen die Hand. Er macht alles genau richtig, ohne falsche Nähe, aber auch er hat plötzlich Tränen in den Augen. Er beherrscht sich, mich nicht anzustarren. Es kostet ihn offensichtlich große Mühe, die richtige Distanz, die Balance zu finden. Und genau wie ich rettet er sich in die Abstraktion und redet zu schnell.
»Fast hätte ich gefragt, wie’s so geht, was so los ist, aber da kennen wir die Antwort schon, oder? Gawiin gegoo, nichts. Obwohl, das stimmt auch wieder nicht, oder, weil die Welt, wie wir sie kennen, gerade untergeht und kein Mensch weiß, was zur Hölle los ist oder ob man in vier Monaten unsere Spezies noch wiedererkennt.«
»Tja, und vielleicht hat sie auch einfach nur Lust auf einen Slushie«, sagt Sweetie und reicht mir die Kirsch-Eis-Plörre weiter. »Mehr braucht es nicht im Leben.«
»Wo du recht hast, hast du recht.« Eddy schenkt mir ein überraschendes Lächeln – überraschend deshalb, weil Sweetie behauptet hat, er lächle nie.
»Hey, er lächelt«, sage ich zu ihr. »Ich dachte, das tut er gar nicht.«
»Tu ich auch nicht. Normalerweise«, sagt Eddy und lächelt schon wieder. Er wirkt so nett, wirklich, ein bisschen schüchtern und irgendwie lieb. »Ich bin befallen«, sagt er halb ironisch. »Und zwar von chronischer Melancholie, einem Gebrechen, das Hippokrates damals als Überschuss an schwarzer Galle beschrieben hätte.«
Dann erklärt er, er habe beschlossen zu glauben, dass er sein Gebrechen nur mit Autoren wie Samuel Taylor Coleridge und großen Staatsmännern wie Winston Churchill teile. Er habe nicht diese moderne Sorte Depressionen, sagt er, die man mit Selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmern behandeln könne. Er habe den einzig wahren schwarzen Hund.
»Wir gehen alle den Bach runter, den Eileiter genauer gesagt, ganz zu schweigen vom Samenleiter«, sagt er, wirft vergnügt den Kopf in den Nacken und lässt sich von der Sonne bescheinen. »Ah, tut das gut.«
»Meinetwegen kann die Welt gern vor die Hunde gehen«, sagt Sweetie, »wenn nur mein Eddy gute Laune hat.«
»Ich habe exzellente Laune.« Eddy gibt Sweetie einen zärtlichen kleinen Kuss. Sie schaut ihn an wie geblendet.
»Das kam aber unerwartet«, sagt sie.
Eddy ist knapp eins neunzig und eher knochig. Er hat ein schmales Fuchsgesicht, wirkt verschwiegen und sorgenvoll, und sein rares Lächeln ist wehmütig und zaghaft. Jetzt plötzlich lächelt er aber viel zu sehr; er grinst wie ein glückliches Kind, und es ist klar, dass etwas mit ihm nicht stimmt. Für einen gesunden Menschen schwankt seine Laune zu stark.
»Ich hab es einfach schon immer gewusst.« Sein dichtes schwarzes Haar steht ihm vom Kopf ab wie der Schopf eines kleinen Jungen. »Mein Leben lang habe ich einen unterschwelligen Verfall wahrgenommen, Cedar, ich habe immer gewusst, was hier passiert. Es hat mein Denken durchdrungen und war schon immer mein Antrieb, zu schreiben. Ich habe nur darauf gewartet und gewusst, dass es – oder so etwas – eintreten würde. Wo es so weit ist, überkommt mich die totale Ruhe. Erleichterung vielleicht sogar.«