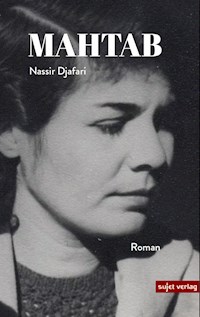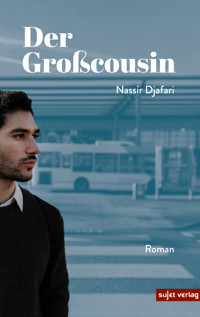
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Sujet Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Abbe, 62 Jahre alt, erfolgreicher Frankfurter Geschäftsmann und Kosmopolit, empfindet sich selbst als Deutscher. Seine iranischen Wurzeln sind verschüttet. Als ihn eines Tages ein entfernter Verwandter, soeben aus dem Iran eingetroffen, aufsucht, gerät sein Leben durcheinander. Der Besucher ist undurchschaubar, verwickelt sich in Widersprüche und stolpert von einer Notlage zur nächsten. Bald kreist Abbes Leben nur noch um die Probleme des Verwandten. Erst nach und nach erschließt sich ihm die wahre Geschichte des jungen Mannes, und er beginnt ihn und sich selbst mit anderen Augen zu sehen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 230
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Nassir Djafari
Der Großcousin
Roman
CIP - Titelaufnahme in die Deutsche Nationalbibliothek
© 2024 by Sujet Verlag
Nassir Djafari Der Großcousin
ISBN: 978-3-96202-632-5
Umschlaggestaltung: www.the-editorial.de
Umschlagfoto: https://de.freepik.com
Satz und Layout: Xenia Sophie Rhensius
Druckvorstufe: Sujet Verlag, Bremen
Printed in Europe
1. Auflage 2024
www.sujet-verlag.de
1
Der Brief lag auf meinem Schreibtisch. Es war noch früh am Morgen, mein Vorzimmer war verwaist, und in den Büros saßen nur wenige Mitarbeiter vor ihren Computerbildschirmen, die üblichen Frühaufsteher. Am Abend zuvor war ich von einer Geschäftsreise aus Mexiko zurückgekehrt, mit der Vertragsverlängerung für unser Team vor Ort in der Tasche. Drei weitere Jahre würden wir nun die Mexikaner dabei unterstützen, Konzepte gegen den tagtäglichen Verkehrskollaps in der Metropolregion ins Werk zu setzen. Natürlich lud ich nach der Vertragsunterzeichnung alle zum Mittagessen ein, auf dem Balkon meines Lieblings-Restaurants am Zocalo mit Blick auf den großen Platz und die altehrwürdige Kathedrale. Alles war prima, aber dann, als hätte sich das Schicksal einen Scherz mit mir erlaubt, saß ich auf dem Weg zum Flughafen stundenlang im Taxi fest, eingekeilt zwischen anderen Autos. Der Taxifahrer, ein gemütlicher Dicker mit buschigem Schnurrbart, redete mir gut zu, erklärte, als ob ich es nicht wüsste, der Dauerstau sei normal und bot mir von seinen Tortilla-Chips an, die er sich selbst unentwegt in den Mund schob. Meinen Flug verpasste ich folglich und musste durch den Flughafen hetzen, um wenigstens von einer anderen Airline mitgenommen zu werden.
Ich nahm den Brief in die Hand. Das Kuvert war aus dünnem Papier, hellblau mit rot-blau gestricheltem Rand, drei Briefmarken mit dem Konterfei Khomeinis, handschriftlich an mich adressiert. Drinnen befand sich ein dicht beschriebenes Blatt, auf dem sich die vertrauten persischen Schriftzeichen mit ihren vielen Punkten über und unter den Buchstaben aneinanderreihten. Ich verstand nichts. Bei genauerem Hinschauen konnte ich in der ersten Zeile immerhin „Abbas“ entziffern, das war das einzige persische Wort, das ich jemals zu lesen und zu schreiben gelernt hatte. Solche Luftpostbriefe kannte ich aus meiner Kindheit. Hatte Mutter ein, zwei Wochen lang keine Nachricht von ihrer Schwester aus Teheran erhalten, wurde sie unruhig. Jeden Tag sah sie im Briefkasten nach. Fand sie endlich ein Schreiben vor, riss sie den Umschlag noch im Treppenhaus auf und las ihn atemlos. Die Neuigkeiten über unsere Tante und die sonstige Verwandtschaft erfuhren wir Kinder dann beim Essen. Den Brief beantwortete Mutter noch am gleichen Abend, brachte ihn am nächsten Tag zur Post, und von da an begann für sie wieder die Zeit des Wartens. Mich interessierten an der Sache nur die Briefmarken. Die verkaufte ich in der Schule für zehn Pfennige das Stück an Gottfried, einen blassen Jungen, der Bücher von Karl May las und Briefmarken sammelte. Ich war sein einziger Freund.
Ich selbst hatte mein Leben lang noch nie Post aus Iran erhalten. Dieser Brief stammte wahrscheinlich von einem Verwandten und war gewiss an Vater gerichtet, sagte ich mir schließlich, steckte ihn in die Innentasche meines Jacketts und fuhr meinen Computer hoch.
Auf dem Bildschirm blinkte eine E-Mail von David Nzimande auf. David war Direktor der nationalen Energiekommission in Südafrika, die wir schon seit Jahren mit einem Team internationaler Experten berieten. In der E-Mail beschwerte sich David über unseren Projektleiter Ferdinand Warnke. Er warf ihm vor, sich in politische Angelegenheiten Südafrikas eingemischt und in einem Radiointerview die Energiepolitik der Regierung kritisiert zu haben.
Warum hatte mich Uwe nicht informiert? Seit zehn Jahren leitete Uwe Müller nun schon unsere Energieabteilung. Er war einmal mein bester Mann gewesen. Doch in letzter Zeit baute er ab. Er setzte falsche Prioritäten, traf keine und wenn doch die falschen Entscheidungen und verheizte auf diese Weise motivierte Mitarbeiter.
Ich griff zum Telefonhörer.
„Weber, guten Morgen Herr Hamidzadeh“, zwitscherte die Sekretärin von Uwe gut gelaunt. „Herr Dr. Müller ist heute Vormittag nicht im Haus.“
Die Aussicht, noch Stunden im Ungewissen zu bleiben, behagte mir nicht. Ich wählte Uwes Mobilfunknummer. Die Mailbox sprang an und meine Stimmung kippte. Ich schob die Kaffeetasse weg und warf einen Blick auf meinen Terminplan. Es war ein kurzer Arbeitstag, denn um 18 Uhr musste ich bereits im Seniorenheim sein, und um 19.15 Uhr erwartete mich Maria am Theater. Frau Schubert hatte die Karten besorgt und sie mir zusammen mit einer Kurzzusammenfassung des Theaterstücks hingelegt. Endstation Sehnsucht, in der Inszenierung von Kay Voges.
Am frühen Nachmittag hatte ich ein Zeitfenster von einer halben Stunde. Ich leitete die E-Mail aus Südafrika an Uwe weiter und schrieb dazu: „Rücksprache um 14.30 Uhr“. Er sollte ruhig meinen Ärger spüren.
Uwe erschien pünktlich. Er war blass und auf seiner Stirn hatte sich ein Schweißfilm gebildet. Sein Krawattenknoten war verrutscht.
„Alles in Ordnung, Uwe?“, fragte ich ihn.
Er straffte sich und nickte entschieden.
„Alles bestens.“
Wir setzten uns an den ovalen Besprechungstisch.
„Südafrika“, sagte ich.
Er wich meinem Blick aus.
„Ich weiß nicht, was in Warnke gefahren ist.“
Warnke war kein festangestellter Mitarbeiter, sondern hatte wie die meisten Auslandskräfte einen Projektvertrag. Er hatte sich vor seiner Ausreise nach Südafrika bei mir vorgestellt und einen guten Eindruck hinterlassen.
„Wie kommt er dazu, ein Radiointerview zu geben?“
„Der Stellvertretende Direktor hat ihn darum
gebeten.“
„Was hat Warnke denn gesagt?“
„Er hat über die häufigen Stromausfälle gesprochen und sie auf Managementversagen und Korruption im Energiesektor zurückgeführt.“
„Ist der Mann wahnsinnig?“
„Was Warnke in dem Interview gesagt hat, kann man seit Jahren in der Zeitung lesen. Das ist eigentlich nichts Neues.“
Das wusste ich selbst. Die Wahrheit zu kennen war eine Sache, sie öffentlich zu verkünden eine andere.
„Wir werden jetzt mit ihm sprechen“, entschied ich und ließ mich von Frau Schubert verbinden.
Kurz darauf hatte ich unseren Mann in Johannesburg in der Leitung.
„Guten Tag, Herr Warnke. Hamidzadeh aus Frankfurt“, begrüßte ich ihn. „Neben mir sitzt Herr Dr. Müller, das Telefon ist auf laut gestellt.“
Warnke benötigte einige Sekunden, um zu reagieren. Als ich dann seine fränkische Aussprache mit dem rollenden „r“ hörte, hatte ich wieder diesen Ein-Meter-Neunzig großen Mann mit grauen Haaren vor meinem inneren Auge.
Warnke bestätigte, der Stellvertretende Direktor habe ihn gebeten, das Radiointerview zu geben und notwendige Veränderungen im Energiesektor anzumahnen. Seine Stellungnahme als internationaler Experte würde die Reformkräfte im Lande stärken, habe der ihm erklärt.
„Es war doch zu erwarten, dass Sie damit ein Minenfeld betreten“, stellte ich fest.
Ich wechselte mit Uwe einen Blick.
„Wie kann es sein, dass Sie als erfahrener Berater so etwas nicht einschätzen können?“
Schweigen am anderen Ende der Leitung. Warum sagte er nichts? Wollte er mich herausfordern?
„Hören Sie,“ ich verschärfte meinen Ton, „wir beraten Regierungen und deren Behörden bei der Lösung wirtschaftlicher und sozialer Probleme. Wir lassen uns nicht in interne politische Auseinandersetzungen hineinziehen, niemals. Haben wir Kritik, so äußern wir sie gegenüber unseren Auftraggebern hinter verschlossener Tür, und auch dann nur, wenn wir einen Verbesserungsvorschlag haben.“ Ich merkte, dass ich laut geworden war und ging zu einem geschäftsmäßigen Ton über. „All das wissen Sie natürlich. Also was um Gottes Willen ist in Sie gefahren?“
„Nadeli Patel hat mich zur Eile gedrängt.“
„Wer ist das?“
„Sorry, das ist der Stellvertretende Direktor.“
„Herr Warnke, mit diesem Interview haben Sie sich in die politischen Angelegenheiten des Einsatzlandes eingemischt und damit gegen Ihren Arbeitsvertrag verstoßen.“
„Aus meiner Sicht ist das ist keine politische, sondern eine fachliche Angelegenheit.“
„Das sieht David Nzimande anders. Mir liegt sein Schreiben vor. Sie sind bis auf Weiteres beurlaubt. Halten Sie sich bitte vorerst von der Kommission fern. Und keine weiteren Äußerungen gegenüber den Medien.“
„Herr Hamidzadeh, ich habe lediglich …“
„Auf Wiederhören.“
Ich legte den Hörer auf und fragte mich, was ihm der Stellvertretende Direktor für dieses Interview versprochen hatte.
Nachdem Uwe mein Büro verlassen hatte, bat ich Frau Schubert, mich mit David Nzimande zu verbinden. Doch der war nicht zu erreichen.
2
In der Seniorenresidenz nahm ich grundsätzlich die Treppe, das ging schneller. Die Aufzüge waren ständig besetzt. Bis die alten Leute ihre Rollatoren in den Lift hinein und wieder hinausbugsiert hatten, dauerte es. So viel Geduld hatte ich nicht. Maria meinte ohnehin, ich solle nur noch die Treppe benutzen, egal wo, auch im Büro. Letzteres war völlig absurd. Wer lief schon 14 Stockwerke die Treppe hinauf? Marias Kritik, dass ich keinen Sport trieb, riss nicht ab. Anfang des Jahres hatte ich mich schließlich bei einem Fitnesscenter angemeldet. Als ich ihr das erzählte, gab sie mir einen Kuss. Jetzt lief ich also die Treppe hoch, es waren nur drei Stockwerke. Vater lebte nun schon seit fünf Jahren in der Seniorenresidenz, wo er eine Zwei-Zimmerwohnung mit Balkon bezogen hatte. Sein neues Domizil erinnerte ein wenig an seine alte Wohnung, darauf hatte ich bei der Einrichtung geachtet. Perserteppiche bedeckten den Parkettboden und von der Wand lächelte ihn Mutter an: jung, schön und gespannt auf dieses Deutschland, in das sie gerade eingewandert waren. Das Porträt war in dem Fotostudio in der Großen Eschenheimer Straße aufgenommen worden, den Laden gab es schon lange nicht mehr. Das musste 1959 oder 1960 gewesen sein. Vaters Bronzefiguren, hellenische Athleten und Jugendstil-Schönheiten, die er früher so leidenschaftlich gesammelt hatte, verteilten sich über die beiden kleinen Zimmer. Ich konnte mich noch an Mutters nachsichtiges Lächeln erinnern, wenn er wieder einmal mit einer neu erworbenen „Antiquität“ nach Hause kam, begeistert wie ein kleiner Junge. Auf dem Sideboard stand sein Kurzwellenradio, mit dem er früher Nachrichten des Londoner Exilsenders gehört, beim Abendessen wiedergegeben und sich dabei über die neuesten Verbrechen des Schahs aufgeregt hatte.
Die Fotos seiner Kinder und Enkelkinder hatte ich auf einem Beistelltisch nebeneinander aufgereiht, unser letztes Familienfoto in der Mitte. Wir hatten es ein Jahr vor Mutters Tod bei Azadeh auf der Terrasse aufgenommen. In der Mitte stand meine Schwester, ihre Arme um die Schultern der Eltern gelegt, an Vaters Seite war ich, und neben mir mein Bruder Hamid, der gerade braungebrannt aus Peru zurückgekehrt war.
Vater war in seinem neuen Ohrensessel eingeschlafen, und im Fernsehen lief bei maximaler Lautstärke ein Tierfilm. Ich schaltete das Gerät auf stumm und schaute mich nach den Hörgeräten um. Sie lagen achtlos auf dem Teppich neben dem Sessel, ich war froh, nicht versehentlich darauf getreten zu sein. Ich steckte ihm nacheinander die beiden Geräte wieder in die Ohren und begrüßte ihn mit lauter Stimme:
„Salam Pedar.“
Jetzt erst schlug er die Augen auf.
„Mein lieber Abbas. Wenn du kommst, geht die Sonne auf. Ich bin so einsam. Nie im Leben hätte ich gedacht, dass ich so enden würde, abgeschnitten von der Welt. Ach, ach.“
Ich streichelte seine Glatze. Vater war keineswegs allein. Wenn ich mit ihm im Gebäude unterwegs war, blieb er bei jedem und jeder stehen und erkundigte sich, auf den Lenker seines Rollators gestützt, wie es denn so gehe, hörte sich die Klagen der Heimbewohner an und versprach Abhilfe, ganz so, als sei er der Chef des Hauses. An das meiste, was ihm bei diesen Gelegenheiten erzählt wurde, konnte er sich eine halbe Stunde später schon nicht mehr erinnern. Und da auch seine Mitbewohner meistens wieder vergaßen, worüber sie sich soeben noch aufgeregt hatten, blieb alles im Gleichgewicht. Besonders den Damen hatte er es angetan. Im Seniorenheim hatte er den Ruf, ein Gentleman zu sein, was vielleicht daran lag, dass er stets Anzug und Krawatte trug und so galant war. Einige Pflegekräfte verdrehten die Augen, wenn sie ihm morgens zusätzlich zu ihrem üblichen Pensum auch noch die Krawatte binden mussten. Um sie bei Laune zu halten, steckte ich ihnen gelegentlich einen kleinen Geldschein zu. Es gab drei Damen, die um Vaters Gunst warben. Eine davon schien seine Favoritin zu sein, er sprach immer von einer Ursula. Ich hatte eine der Altenpflegerinnen gebeten, mir Ursula mal zu zeigen. Eine Mitbewohnerin, die so hieße, gebe es nicht, wurde mir beschieden. Vater stellte sie mir schließlich selbst vor, die bezaubernde achtzigjährige Frieda.
Ich bereitete als erstes Tee zu. Dann machte ich es mir auf dem kleinen Sofa bequem und stellte mich darauf ein, Vater zuzuhören. Er sprach am liebsten von weit zurückliegenden Geschehnissen, die ihn nun von Neuem aufwühlten. Aus ihnen leitete er Lehren ab, die er mir mit auf den Weg gab. Dann griff er nach meinem Arm und sah mir eindringlich in die Augen, bis ich nickte und sagte „Ja, Pedar“. All diese Geschichten hatte ich schon unzählige Male gehört, war mit ihnen groß geworden. Ich richtete mich darauf ein, Menschen und Begebenheiten aus Vaters Vergangenheit an mir vorbeiziehen zu lassen, während ich meinen eigenen Gedanken nachhing. Hier wurde nichts weiter von mir erwartet als da zu sein. Vater sah mich besorgt an.
„Wo ist Hamid? Warum kommt er nicht mehr vorbei? Ist er krank?“
Die Sorge um Hamid ließ ihn nicht los.
„Der ist doch in Südamerika. Er leitet dort ein wichtiges Projekt und muss längere Zeit bleiben.“
„Ich will ihm gleich schreiben. Hol dir Papier und einen Stift …“, befahl Vater.
„Später, Pedar, jetzt brauche ich erst einmal Ihre Hilfe.“
Ich holte den Luftpostbrief, den ich aus dem Iran erhalten hatte, hervor und bat Vater, ihn mir vorzulesen. Mit der großen Lupe vor den Augen gab er den Inhalt wieder. Trotz der überaus höflichen und verschnörkelten Ausdrucksweise, der vagen Andeutungen und der sehr indirekt vorgetragenen Wünsche verstand ich schnell, worum es ging.
„Die wollen, dass ich einen jungen Verwandten bei mir aufnehme“, fasste ich zusammen.
Der Brief schien Vater zu beleben so wie stets, wenn sich ihm eine Gelegenheit bot, verschüttete Erinnerungen freizulegen.
„Mahmud ist der Sohn von Ali Agha, meinem Onkel väterlicherseits. Er dürfte zehn, zwölf Jahre jünger sein als ich. Alles, was er ist, ist er durch mich geworden. Der arme Kerl verlor früh seinen Vater, und ab da kümmerte ich mich um ihn. Nachdem er die Schule abgeschlossen hatte, brachte ich ihn bei der Nationalen Ölgesellschaft unter, wo er dann sein ganzes Berufsleben blieb. Er schreibt über seinen jüngsten Sohn Reza, der jetzt 30 ist. Der Junge sei hochbegabt, aber im Iran hätte er keine Chance.“
Vaters Hand legte sich wie ein Schraubstock um meinen Arm. Ich war erstaunt, welche Kraft noch darin steckte.
„Wer stark ist, hat die Pflicht Schwächeren zu helfen. Manchmal muss man dem Schicksal seiner Mitmenschen etwas nachhelfen. Jeder hat eine Chance verdient, Abbas. Kümmere dich um den Jungen, so wie ich mich um seinen Vater gekümmert habe. Gott wird`s dir vergelten.“
„Ja, Pedar“, sagte ich und dachte, mal sehen.
Es wurde Zeit zu gehen. Ich war froh, als eine Pflegerin erschien, das ersparte mir traurige Abschiedsszenen. Sie hatte nur kurz geklingelt, sogleich die Wohnungstür aufgeschlossen und marschierte geradewegs auf Vater zu, eine kleine energische Person, blond, mit einem offenen freundlichen Gesicht. Sie musste neu sein, ich hatte sie noch nie gesehen.
„Guten Abend, Herr Hamidzadeh. Zeit ins Bett zu gehen“, schmetterte sie dem alten Herrn fröhlich entgegen. Sie hatte einen Akzent, ich tippte auf Osteuropa.
„Schwester Hanna. Wie geht es Ihnen?“, fragte Vater und wirkte plötzlich um 70 Jahre jünger. „Sie werden jeden Tag schöner, Schwester Hanna. Wie machen Sie das?“
Die Pflegerin warf ihren Kopf nach hinten und lachte.
„Wie ich sehe, haben Sie netten Besuch, Herr Hamidzadeh.“
Sie drehte sie sich zu mir um und streckte mir die Hand entgegen.
„Guten Abend, mein Name ist Hanna Waslewska. Und Sie sind bestimmt der Sohn.“
Waslewska klang russisch. Ihr Händedruck war so fest, wie ich ihn bei Frauen selten erlebt hatte, so als wollte sie mir damit zu verstehen geben, dass sie keinesfalls zu unterschätzen sei. Aber dann hielt sie sich nicht länger mit mir auf, kniete sich vor Vater hin und begann, ihm die Stützstrümpfe auszuziehen.
„Trinken Sie Tee mit uns“, lud Vater sie ein und befahl mir auf Persisch, eine saubere Tasse hinzustellen.
„Nein, Herr Hamidzadeh“, sagte die Russin mit gespielter Strenge. „Jetzt ist Schlafenszeit.“
Mir gefiel es nicht, dass Vater schon so früh ins Bett gesteckt wurde. Aber so waren die Arbeitsabläufe im Heim. Für mich gab es hier nichts mehr zu tun.
„Ich muss gehen, Maria wartet schon. Wir haben Karten fürs Theater“, sagte ich laut genug, damit auch Vater es verstand und strich ihm zum Abschied über den Kopf. Aber er hatte nur Augen für die Pflegerin.
Beim Hinausgehen hörte ich, wie sie zu Vater sagte: „So Herr Hamidzadeh, jetzt helfe ich Ihnen, den Schlafanzug anzuziehen.“
Der langgezogene Flur auf Vaters Stockwerk war verwaist, unten im Restaurant wischte eine Mitarbeiterin in blauem Kittel die Tische ab und im Eingangsbereich drehte eine alte Dame über ihren Rollator gebeugt in aller Ruhe ihre letzten Runden, bevor auch sie sich zur Nachtruhe begeben würde.
Der Theatersaal lag im Dämmerlicht, Stille, hier und da ein leises, verlegenes Räuspern. Der Vorhang öffnete sich und gab die Bühne frei: die Frontansicht eines Hauses, oben die dunkle Holzfassade, unten ein hell erleuchtetes Wohnzimmer, runder Tisch, Stühle, Bett, im Hintergrund ein Fenster, das den Blick ins Freie andeutete. Maria saß etwas steif neben mir. Sie sah hübsch aus in ihrem schwarzen Kostüm. Ich schob sanft meine Hand auf ihre. Sie verschränkte die Arme und würdigte mich keines Blickes. Ich war in letzter Minute eingetroffen, das Foyer war bereits leergefegt, nur Maria stand noch verloren da und funkelte mich zornig an. Ich hätte früher bei Vater weggehen sollen, sagte ich mir. Aber für Erklärungen war jetzt keine Zeit. Wir stürmten zwei Stufen auf einmal nehmend die Treppen hinauf und erreichten immerhin noch rechtzeitig den Theatersaal, bevor die Türen geschlossen wurden. Als wir die in unserer Reihe bereits Sitzenden nötigten, für uns aufzustehen und uns zu unseren Plätzen durchzulassen, senkte ich, unablässig „Danke“ murmelnd, meinen Blick, um bloß keinem bekannten Gesicht zu begegnen, man wusste nie, Frankfurt war eine kleine Stadt, ständig lief man jemandem über den Weg.
Ich versuchte es noch einmal, indem ich meine Hand auf ihren Oberschenkel legte. Ohne die Augen von der Bühne zu wenden, schob sie die Hand weg. Mit diesem Theaterbesuch hatte ich ihr eigentlich eine Freude machen wollen.
„Wenn du in dieser Wettbewerbswelt die Nase vorn haben willst, musst du an dein Glück glauben“, sagte Stanley auf der Bühne und verkörperte in seiner machohaften Jämmerlichkeit doch einen Menschen, der nie die Nase vorne haben wird, egal an was er glaubt, dachte ich. Die anderen Figuren ebenso wenig, die abgehalfterte Blanche Du Bois oder ihre Schwester Stella, sie alle waren in einer ausweglosen Lage, bildeten sich aber wer-weiß-was ein.
„Mir kommt vor, man hat dich verarscht, und wenn man dich verarscht, dann hat man auch mich verarscht. Und ich lass mich nicht gern verarschen“, rief Stanley nun.
Meine Güte, was für ein Satz, dachte ich.
Nach der Vorstellung schlug ich Maria vor, im Bockenheimer Weinkontor eine Kleinigkeit zu uns zu nehmen. Sie wolle nach Hause, entgegnete sie kühl, ohne mich anzusehen. Ich war müde von der Reise, die Vorstellung früh schlafen zu gehen, erschien mir zwar verlockend, aber nicht unter diesen Umständen.
„Es tut mir leid, dass ich zu spät gekommen bin.“
„Lass mich in Ruhe mit deinen ewigen Entschuldigungen. Die halten immer nur bis zum nächsten Mal.“
Ihr schneidender Ton ärgerte mich. Ich war zu spät gekommen, aber ich hatte kein Verbrechen begangen.
„Dann fahren wir eben nach Hause“, sagte ich.
Das Weinkontor war gut besucht, an der Bar drängten sich überwiegend junge Leute und ein paar Anzugträger, die wohl aus den naheliegenden Banktürmen kamen. Ich entdeckte eine freie Nische, die in die weiß getünchte Wand eingelassen war. Rote Sitzkissen sorgten für den nötigen Komfort. Nachdem die Bedienung für Maria ein Glas Chardonnay und für mich einen Tee hingestellt hatte, sagte ich ihr, wie gut ihr das Kostüm stünde und wartete auf ein Lächeln, ein Dankeschön von ihr. Aber anstatt dessen fragte sie, ob ich gut geschlafen habe. Ich ließ die Bemerkung an mir abtropfen.
„Wie fand’st du denn das Stück?“, fragte ich.
„Immerhin hast du nicht geschnarcht.“
Ich lehnte mich zurück und trank in Ruhe meinen Tee. Der Tag war zu lang, um mit einem Streit zu enden.
„Also, dieser Stanley ist doch ein entsetzlicher Mensch, ein dumpfer, brutaler Macho“, sagte Maria nach einer Weile.
„Darum geht es doch gar nicht.“
„Ach ja? Sondern?“
„Also, da ist auf der einen Seite Stanley, ein polnischer Einwanderer, der aufsteigen will, ohne wirklich etwas dafür zu tun. Auf der anderen Seite Blanche, die Großgrundbesitzertochter, die ihren eigenen sozialen Absturz nicht wahrhaben will. Eine Frau, die einem Wrack gleicht und am Ende ihrer Möglichkeiten angekommen ist. Sie zehrt vom verlorenen Glanz, und er träumt davon, zu den Bessergestellten zu gehören. Beide sind in ihren Träumen gefangen. Sie verachten einander.“
Maria musterte mich. Ich kannte diesen Blick, sie dachte nach.
„Dafür, dass du geschlafen hast, hast du eine Menge mitbekommen“, sagte sie schließlich. Es klang fast freundlich.
Ich griff nach ihrer Hand, froh, dass sie mir nicht mehr böse war.
„Du alter Ignorant“, sagte sie leise und erwiderte den Druck meiner Hand.
Ich beugte mich vor, um ihr einen Kuss zu geben, da fuhr sie fort: „Das erklärt auch den Titel des Stücks.“
„Endstation Sehnsucht?“, fragte ich.
„Ja, weil beiden nichts als die Sehnsucht bleibt.“
„Die sich aber nie erfüllen wird. Blanches glanzvolle Vergangenheit ist unwiederbringlich verloren. Und Stanley ist und bleibt nichts weiter als ein Großmaul.“
„Ihre Sehnsucht hält sie am Leben.“
„Und hindert sie daran, sich zu verändern.“
„Das mag auf die Beiden zutreffen, aber das ist doch nicht immer so.“
„Sehnsüchte erfüllen sich nie, das macht sie aus.“
„Aber wir können uns ihnen annähern.“
„Im besten Falle.“
„Weißt du, was ich manchmal denke?“ Maria griff nach meiner Hand. „Wenn wir in einer nicht mehr allzu fernen Zukunft richtig alt sein werden, werden wir uns an Tage wie diese erinnern und uns zurücksehnen. Unser kleines Glück heute wird dann zu einer Sehnsucht geronnen sein.“
Mein Smartphone vibrierte.
„Entschuldige.“
Ich griff in meine Hosentasche, um das Gerät hervorzuholen.
„Lass es“, sagte Maria.
„Was?“
„Dein Handy.“
„Es ist wichtig“, beharrte ich.
Ich zögerte, der nächste Streit stand bevor. Da schenkte sie mir ein Lächeln, und die verpasste Nachricht verlor mit einem Mal an Bedeutung.
3
Ich saß auf meinem üblichen Platz an der Fensterfront des Café Siesmayer. Regen prasselte auf die Terrasse. Die Wassertropfen auf der Glasscheibe glichen einem Perlenvorhang, hinter dem sich der Rasen, die Blumenbeete und die Bäume des Palmengartens abzeichneten. Typisches Aprilwetter, mich störte es nicht. Das Café war wie jeden Sonntagvormittag gut gefüllt mit frühstückenden Paaren, die sich etwas Besonderes gönnen wollten. Der Duft von Rühreiern mit Speck wehte vom Nachbartisch zu mir herüber. Ich nahm einen Schluck Tee und vertiefte mich in die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. In einem langen Artikel wurde über ein Schiffsunglück vor der Küste von Sizilien berichtet. Hunderte Flüchtlinge waren ums Leben gekommen. „Etwa 700 Menschen würden vermisst, sagte die Sprecherin des UN-Flüchtlingshilfswerks der UNHCR am Sonntag dem italienischen Fernsehsender „RAInews24“. Der überfüllte Fischkutter kenterte demnach in der Nacht zum Sonntag rund 110 Kilometer vor der lybischen Küste im Kanal von Sizilien.“ Ich ließ die Zeitung sinken. Monat für Monat ertranken hunderte Flüchtlinge. Ihre Leichen waren kaum geborgen, da bereitete sich schon die nächste Kohorte auf die Überfahrt vor, bereit dieses Wagnis auf sich zu nehmen.
Die hässlichen Bilder kann man nur vermeiden, wenn man die Leute legal einreisen lässt, dachte ich. Aber wenn jeder kommen kann, dann wollen alle kommen, und was dann?
Ich blätterte weiter und stieß auf einen Artikel über Krawalle, die nun Johannesburg erreicht hätten. Südafrika! Das war wichtig. Ging es etwa um Stromausfälle und um Korruptionsvorwürfe im Energiesektor? Nein, stellte ich fest. Die landesweiten Unruhen richteten sich gegen Einwanderer aus anderen afrikanischen Ländern. Eine Welle des Fremdenhasses hatte das Land erfasst, der aufgebrachte Mob jagte Migranten, plünderte ihre Läden und zündete sie an. Allein in Durban waren sechs Menschen ums Leben gekommen, ein äthiopischer Händler bei lebendigem Leib verbrannt. Meine Güte, dachte ich, selbst in Südafrika. Immerhin war unser Geschäftsfeld nicht betroffen. Und wer weiß, in diesem Tohuwabohu würde vielleicht Warnkes dämliches Interview nicht so sehr auffallen. Mit dem Radiointerview hatte der Kerl unser gesamtes Südafrika-Geschäft gefährdet. Die südafrikanische Presse hatte sich sofort darauf gestürzt und bekannte Korruptionsfälle im Stromsektor erneut aufgerollt. Der Energieminister wies in den Fernsehnachrichten die Vorwürfe zurück, und der Leiter der Kommission erklärte, der ausländische Berater habe nur seine private Meinung geäußert. Wie dem auch sei, mir war nichts anderes übriggeblieben als Warnke unverzüglich aus dem Projekt abzuziehen. So kurzfristig Ersatz für ihn finden, würde nicht leicht werden.
Maria hatte nur den Kopf geschüttelt, nachdem sie sich die Geschichte angehört hatte.
„Und was ist, wenn der Mann recht hat?“
„Natürlich hat er recht, aber darum geht es nicht“, erwiderte ich und ahnte schon, worauf sie hinauswollte. Maria mit ihren hohen moralischen Ansprüchen teilte nach wie vor die Welt in Gut und Böse ein, und wer glaubte sich durchlavieren zu können, wurde zwischen beiden Seiten zermahlen. Grautöne gab es bei ihr nicht.
„Dann lass die Finger von dem Projekt.“
Andererseits liebte ich sie für ihre Entschiedenheit. Ich lachte. Wenn ich wegen eines solchen Vorfalls einen Auftrag platzen ließ, könnte ich gleich meine ganze Firma schließen, das müsste sie eigentlich wissen.
„Ich meine es ernst. Da ist was faul.“
Nein, am wichtigsten ist jetzt, das weitere Geschäft in Südafrika zu retten, sagte ich mir. Ich bat um die Rechnung. Es war schon zwanzig vor eins, Zeit, mein Fitness-Training zu beenden. Maria wartete bestimmt schon mit dem Mittagessen auf mich. Ich würde meine Sporttasche unübersehbar im Wohnzimmer fallen lassen, sie mich in ihre Arme schließen, an mir schnuppern, sagen „Bäh, du riechst nach Schweiß“ und mich unter die Dusche schicken. Seit meiner Anmeldung hatte ich das Fitnesscenter nicht wieder betreten. Das Café Siesmayer war in der Nähe, mir gefiel das Ambiente, außerdem gab es hier eine gute Auswahl an Tageszeitungen. So stahl ich mir drei Stunden, die ich ganz für mich hatte, ohne Besprechungen, Termine und gesellschaftliche Verpflichtungen, ohne Maria und ohne meinen Vater.
4
Den ganzen Vormittag hatte ich eine Besprechung nach der anderen. Gegen Mittag brachte mir Frau Schubert ein Käsebrötchen und ein Schälchen Salat an den Schreibtisch. Ich war froh, nun wenige Stunden Ruhe zu haben, bevor es ab 15 Uhr weiterging.
Eine Lösung für das Südafrika-Geschäft hatte ich immer noch nicht. Dazu brauchte ich Ruhe. Mit dem Rausschmiss von Warnke war es nicht getan. Mein Blackberry brummte. Ich schaute auf das Display. Drei verpasste Anrufe von Maria, zwei Textnachrichten von ihr. Ich schob das Gerät zur Seite, ich musste mich konzentrieren. Das Vertrauensverhältnis zu unserem Auftraggeber war gestört. Da musste ich ansetzen. Mein Telefon klingelte.
„Ja?“
„Ich weiß, ich soll nicht stören“, meldete sich Frau Schubert, „aber es ist Ihre Frau. Sie hat schon mehrmals angerufen.“
„Nicht jetzt. Sagen Sie ihr bitte, ich rufe sie zurück.“
Ich legte auf. Also Vertrauen schaffen, Kompetenz zeigen, nahm ich den Faden wieder auf. Eine große Initiative, ja ich musste das Blatt wenden, indem ich mit etwas Neuem kam. Etwas, das den Reputationsschaden, den Warnke angerichtet hatte, wieder gutmachte. Ein Workshop, überlegte ich, offiziell ausgerichtet von der Kommission, konzipiert und durchgeführt von uns. Ich griff zum Telefon. Kaum war Uwe in der Leitung, kam ich zur Sache und erläuterte ihm die Idee. Große Veranstaltung, Teilnahme des Energieministers und Vertretern verschiedener internationaler Geber, wie der Europäischen Union, Großbritannien, Deutschland. Großer Zirkus, neue Ideen, Anstoß einer Reformdiskussion. Natürlich tragende Rolle des Kommissionsleiters, im Grunde genommen seine Party, etwas mit dem er angeben kann.
„Klingt gut“, sagte Müller.
„Schreib bitte ein Konzept. Rechne alles durch, Honorare, Logistik, Reisekosten. Wir werden es David Nzimande vorschlagen.“
„In Ordnung.“
„Prima. Schaffst du es bis morgen früh?“
Ich legte auf und streckte mich. So kämen wir wieder in die Offensive.
Das Telefon klingelte.
„Frau Schubert?“
„Ihre Frau ist in der Leitung. Sie besteht darauf, mit Ihnen zu sprechen.“
„Stellen Sie durch.“
„Sag mal, warum rufst du nicht zurück? Ich rufe jetzt schon zum x-ten Mal an.“