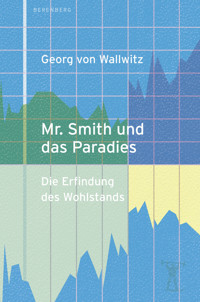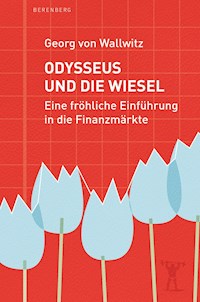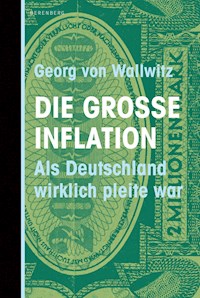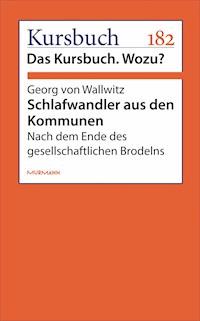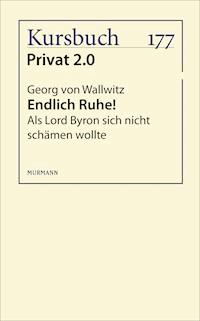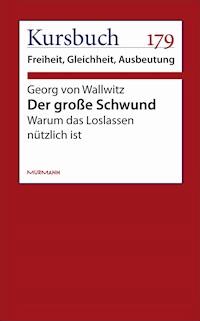
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Murmann Publishers
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In seinem Beitrag für das Kursbuch 179 erkennt Georg von Wallwitz die Diskrepanz zwischen Freiheit & Gleichheit und Brüderlichkeit und ihrer Bedeutung in der Wirtschaft. Von der Französischen Revolution bis zur Gegenwart erklärt er das Prinzip des monetären Schwunds, der für ihn unvermeidlich und unerlässlich, herausragend bedeutend und ungreifbar für die heutigen Marktwirtschaftssysteme und die Gesellschaft ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 26
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Benutzerhinweise
Dieser Artikel enthält Anmerkungen, auf die die Anmerkungszahlen im Text verweisen. Durch einfaches Klicken auf die Anmerkungszahl wechselt das E-Book in den Anmerkungsteil des Artikels, durch Klicken auf die Anmerkungszahl im Anmerkungsteil wieder zurück zum Text.
Georg von Wallwitz
Der große Schwund
Warum das Loslassen nützlich ist
In den Wochen nach dem Sturm auf die Bastille am 14. Juli 1789 kam es in großen Teilen Frankreichs zu Gewaltexzessen. In der Normandie, im Elsass, im Tal der Saône und in der Freigrafschaft Burgund wurden Schlösser und Abteien angegriffen, geplündert und niedergebrannt. Mit dem Aufstand gegen die alte Ordnung verbreitete sich aber auch eine große Furcht vor Bürgerkrieg und Chaos, vor einem militärischen Eingreifen des Ancien Régime und des mit ihm verbündeten Auslands. Es gab Gerüchte, wonach der Graf von Artrois mit 16 000 Mann ins Limousin marschiere. Im Osten hatte man Angst vor den Deutschen, in der Dauphiné vor den Savoyern und in der Bretagne vor den Engländern. Die Propaganda aus den Städten fiel bei den Bauern auf einen fruchtbaren Boden und regte die Fantasie der einfachen Gemüter an. Von Dorf zu Dorf wurden die Gerüchte greller und größer, bis sie Panik auslösten und als Rechtfertigung für Bewaffnung und Gewalt dienten. Die Französische Revolution drohte in blutige Trivialität abzugleiten und denselben Weg zu nehmen wie frühere jacqueries (Bauernaufstände). Es musste etwas geschehen, sollte der Geist der Revolution gerettet werden.
Geburt einer neuen Gesellschaftsordnung
In der Nacht vom 3. auf den 4. August 1789 trafen sich in den Räumlichkeiten des Bretonischen Klubs – Vorläufer der Jakobinerklubs – im Café Amauray in Versailles etwa 100 Abgeordnete der Nationalversammlung, um ein Bündel von Notmaßnahmen zu besprechen. Die Notwendigkeit von Reformen und ihre Richtung waren unstrittig. Schon am nächsten Abend gab es einen Konsens, dem der Vicomte de Noailles, Sohn einer verarmten Familie, und der Duc d’Aiguillon, einer der reichsten Landbesitzer des Landes, der noch viel zu verlieren hatte, Ausdruck gaben. Mit großer Begeisterung erklärten sie die Abschaffung der Lehns- und Frondienste und aller anderen feudalen und kirchlichen Vorrechte. Die Versammlung war sich des historischen Moments bewusst: Sie war Motor, Zeuge und Vollstrecker der Abschaffung des Feudalismus und der Geburt einer neuen Gesellschaftsordnung. Der Geist der Französischen Revolution wehte vielleicht nie stärker als an jenem 4. August 1789. Bald drängten sich immer neue Abgeordnete ans Rednerpult, um entweder unter allgemeinem Applaus ihren Verzicht auf alte Privilegien zu erklären oder um die alte Ordnung mit weiteren Reformen noch tiefer zu begraben. Abgeschafft wurde der Ämterkauf, eingeführt wurden die Gleichheit vor dem Gesetz und die Gleichheit des Zugangs zu Ämtern. Um drei Uhr früh am 5. August war es vollbracht, ein neues Zeitalter war geboren, und die Versammlung verabschiedete sich ins Bett mit der etwas unpassenden Proklamation von König Ludwig XVI. zum restaurateur de la liberté française.