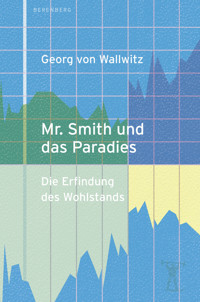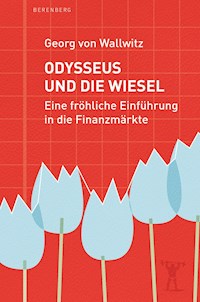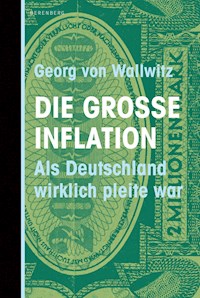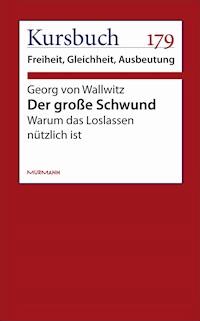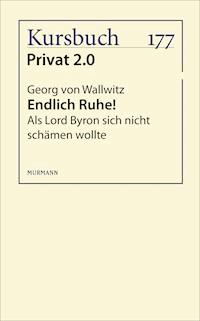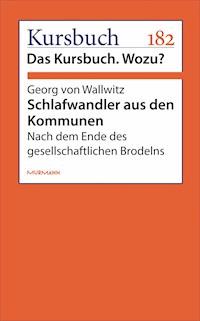
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Murmann Publishers
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Georg von Wallwitz rekonstruiert in seinem Beitrag die revolutionäre Bedeutung von Kommunarden - gemeint sind einerseits diejenigen aus dem Paris des Jahres 1871, andererseits die Kommunarden der 1968er Jahre. Die zweite, so von Wallwitz, war eine bürgerliche Bewegung, die erste, so seine Bemerkung, meinte es wirklich ernst. So unterschiedlich beide waren, so sehr hat sich beider Kritik in die gesellschaftliche Entwicklung eingeschrieben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 29
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Benutzerhinweise
Dieser Artikel enthält Anmerkungen, auf die die Anmerkungszahlen im Text verweisen. Durch einfaches Klicken auf die Anmerkungszahl wechselt das E-Book in den Anmerkungsteil des Artikels, durch Klicken auf die Anmerkungszahl im Anmerkungsteil wieder zurück zum Text.
Georg von Wallwitz
Schlafwandler aus den Kommunen
Nach dem Ende des gesellschaftlichen Brodelns
In Frankreich ist das Jahrhundert der Revolutionen bis heute ein offenes Thema, welches bis in die Tagespolitik hineinragt. Die große Revolution von 1789 endet keineswegs mit der Kaiserkrönung Napoleon Bonapartes. Sechzehnmal haben die Bürger von Paris zwischen 1789 und 1871 Barrikaden auf ihren Straßen gebaut, bereit zum Häuserkampf: Royalisten gegen Republikaner, Klerikale gegen Säkulare, Bürger gegen Arbeiter, Kommunisten und Anarchisten gegen alle anderen oder auch gegeneinander. Am Ende sogar Männer gegen Frauen. Das unverdaute Ende dieser Epoche macht Frankreich bis heute zu schaffen. Das Zeitalter der Französischen Revolution endete erst 82 Jahre nach dem Sturm auf die Bastille mit der Zerstörung erheblicher Teile von Paris in Krieg und Bürgerkrieg, in einem bemerkenswerten Gleichklang von Naivität und Brutalität, welche die nachfolgenden Revolutionsjahre 1918 und 1968 in Westeuropa wie Sandkastenspiele aussehen ließen. Die Gräben in der Gesellschaft sind bis heute tief und lähmen das Land bei jedem Reformversuch. Das gesellschaftliche Brodeln ist in Frankreich durch glanzvolle Zwischenzeiten immer nur überdeckt, nie aber befriedet worden.
Auslöser der Kommune war die desaströse Niederlage Frankreichs gegen Preußen im Krieg von 1870/71. Napoleon III. fühlte sich stark nach Siegen gegen die Russen (1854 im Krimkrieg) und die Österreicher (im Sardischen Krieg 1859) und traute sich noch mehr zu. Aus recht nichtigem Anlass (es stand zur Diskussion, ob ein Hohenzollern-Prinz die spanische Erbfolge antreten könnte) verlangte er eine Unterwerfungsgeste von Preußen. Seine Generäle versicherten ihm, die Emporkömmlinge aus dem Osten seien leichte Beute, ein Unterschied zwischen Preußen und Österreich sei nicht auszumachen. Diese Geisteshaltung nahm Bismarck als Gelegenheit wahr, denn auch ihm versicherten seine Generäle, mit den Franzosen werde man spielend fertig. So nahm er die Provokation gerne an, und Frankreich erklärte postwendend den Krieg. Die süddeutschen Mittelmächte stellten sich, wie von Bismarck kalkuliert, an die Seite Preußens.
Auf beiden Seiten des Rheins freute man sich auf den Krieg, aber die Stimmung in Paris war besser, als die harten Tatsachen es rechtfertigten. Das Offizierskorps war ein Hort der Vetternwirtschaft und bei den einfachen Soldaten unbeliebt. Es fehlte ein echter Oberkommandeur: Als Neffe des gefühlt größten Feldherrn aller Zeiten sah Napoleon III. keine Notwendigkeit, den Siegeskranz einem Dritten zu überlassen, und übernahm selbst die Regie in diesem Feldzug. Der Aufmarsch war chaotisch und langsam, es fehlten Uniformen, topografische Karten und Versorgung. Lediglich zwei Drittel der erwarteten Soldaten meldeten sich bei ihren Sammelstellen, der Rest verpasste urlaubs- oder krankheitsbedingt diesen wichtigen Termin. Die deutsche Armee wurde von einem echten General kommandiert. Sie rollte über fünf ausgebaute Bahnlinien Richtung Elsass. Den Franzosen stand lediglich eine einzige Linie zur Verfügung. Fünfzig deutsche Züge fuhren jeden Tag an die Front gegenüber zwölf französischen. Nach 18 Tagen hatten die Deutschen 1,2 Millionen Soldaten an der Grenze stehen – während ein in Panik geratener französischer General ins Hauptquartier telegrafierte: »Bin in Belfort angekommen. Kann meine Brigade nicht finden. Kann den Divisionskommandeur nicht finden. Was soll ich tun? Weiß nicht, wo meine Regimenter sind.«