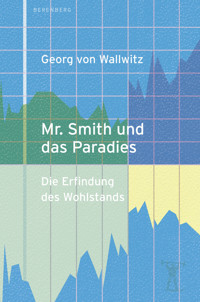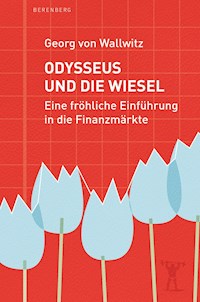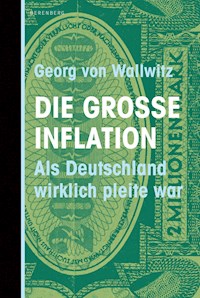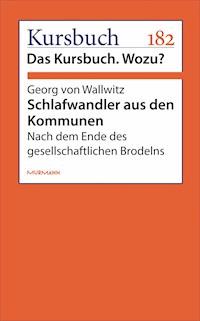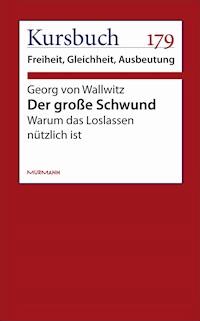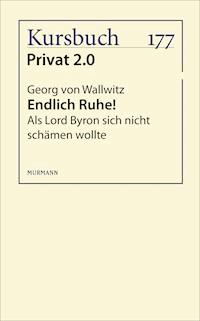
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Murmann Publishers
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
"Wer uns und unsere tiefen und untiefen Gründe kennt, kann über uns bestimmen." Ein Essay über die Bedeutung von Privatsphäre und wie der gefeierte Dichter Lord Byron eines der ersten Opfer des Verschwindens von Privatheit in einer Mediengesellschaft wurde. Georg von Wallwitz zieht die Verbindung zwischen Privatheit und Freiheit und stellt die Prämisse auf, dass Privatsphäre ganz wesentlich eine finanzielle Frage ist. Er untersucht das Konzept der Privatheit im Laufe der Geschichte unter Berücksichtigung neuer Entwicklungen wie Internet, Google und Facebook.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 29
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Benutzerhinweise
Dieser Artikel enthält Anmerkungen, auf die die Anmerkungszahlen im Text verweisen. Durch einfaches Klicken auf die Anmerkungszahl wechselt das E-Book in den Anmerkungsteil des Artikels, durch Klicken auf die Anmerkungszahl im Anmerkungsteil wieder zurück zum Text.
Georg von Wallwitz
Endlich Ruhe!
Als Lord Byron sich nicht schämen wollte
Das Schreiben von Essays ist eine sehr private Angelegenheit, betont Montaigne immer wieder. Der Essayist stellt den Menschen in all seinen Facetten dar, in seinen Vorlieben und Abneigungen, in seinen Eitelkeiten und Niedrigkeiten, in seinem Heroismus und seiner Banalität. Auch wenn er nicht über Tugenden schreibt, sondern über Dinge oder Geschichten, geht es dabei stets um die Beziehung des Menschen zu diesen im Speziellen und um die condition humaine im Allgemeinen. Wiederholt beklagt Montaigne, dass er in seinen Schriften gerne noch offenherziger gewesen wäre, was die Regeln des Anstands aber, zu seinem Bedauern, unmöglich machten. Das Thema des Essays ist, so lässt es sich verkürzend dem Schöpfer des Genres in den Mund legen, der Mensch – ein schwer zu fassendes, wenig standhaftes Wesen in einer schwankenden Welt, das, in seiner Veränderlichkeit eingefangen, kategorisiert, charakterisiert, vermessen, gewogen und skizziert werden soll.
Nichts und niemanden kennen wir so genau wie uns selbst, und wenn wir uns selbst nicht gut kennen, dann ist es mit dem Verstehen unserer Mitmenschen meist auch nicht weit her. Das ist die Prämisse, unter der Montaigne seine Essays schreibt. Also bleibt dem Essayisten wenig anderes, als die condition humaine an sich selbst erscheinen zu lassen, und so dröselt Montaigne mit jedem neuen Versuch seine Privatsphäre vor einer staunenden literarischen Welt weiter auf. Er ist kein Freund der abstrakten Formeln der Moralphilosophie und beschreibt, so konkret es nur geht, wie es sich mit dem Menschsein verhält – was nichts anderes bedeutet, als dass er möglichst realistisch und anschaulich (und soweit moralisch möglich) über sich und seine eigenen Zustände erzählt.
Essays sind damit immer eine private Angelegenheit. Und ein Essay über die Privatheit ist es in doppelter Weise. Es lässt sich kaum über eine andere Privatheit schreiben als die eigene, wenn es nicht akademisch abstrakt, sondern konkret historisch werden soll. Die einzige Maske, die sich bietet, ist die der biografischen Notiz. So begebe ich mich auf die slippery slope dieses Textes.
—
Die Privatsphäre wird meist in Zeiten ein Thema, in denen die Konventionen gering geachtet werden. Konventionen bezeichnen Grenzen, entstanden aus Pflichten und Selbstverständlichkeiten, die irgendwann bedrückend geworden sind und abgeschüttelt werden müssen, die aber auch Privates abschirmen und in dieser Funktion erst vermisst werden, sobald sie untergegangen sind.
Selten ist mit größerer Wonne gegen Konventionen verstoßen worden als in der Zeit um 1800. Das ging in Frankreich los mit anstößigen Pamphleten, in denen das angeblich ausschweifende Geschlechtsleben der Königin reich bebildert wurde. Es ging weiter mit der bald offen gestellten Frage, warum der Dritte Stand so wenig Ansehen und Mitsprache hat. Und es machte in Frankreich, bei den französischen Verhältnissen, nicht halt. In der Revolutionszeit hatten nicht nur viele Regierungen große Not, das Volk von ihrer legitimen Herrschaft zu überzeugen, es stand auch das Bürgertum in Angst, neben den Werten des Adels (vielleicht Name, Verantwortung, Treue, Ehre, Frömmigkeit) könnten auch die eigenen (wahrscheinlich Fleiß, Effizienz, Besitz, Bildung) in das Mahlwerk der Revolution geraten.