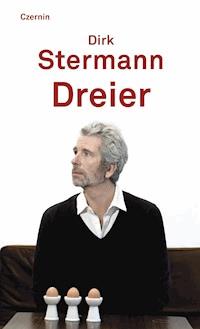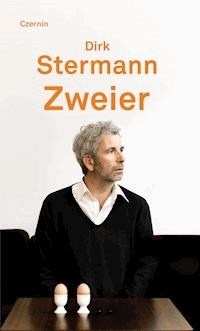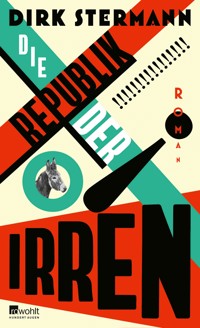9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mit 15 Jahren kommt der begabte Joseph Hammer an den Wiener Hof, wo er "Sprachknabe", Dolmetscher, werden soll. Joseph lernt Türkisch, Arabisch, Persisch, wird nach Konstantinopel entsandt, erlebt den Feldzug gegen Napoleon in Ägypten, sieht, was er nur aus Büchern kannte. Sein Leben lang vermittelt er zwischen Orient und Okzident und ist doch nirgends zuhause. Dass die Welt sein Genie nicht erkennt, schmerzt ihn. Er muss wohl erst etwas ganz Großes leisten: ein vollständiges Exemplar der Geschichten aus 1001. Nacht finden und übersetzen. Ein Leben zwischen dem Morgenland und dem genauso fremden Wien um 1800, Stermann erzählt es mit sanfter Ironie: ein mitreißender Roman um ein großes Thema: Die Sucht nach der Ferne, der Wunsch nach Unsterblichkeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 575
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Dirk Stermann
Der Hammer
Roman
Über dieses Buch
Die Sucht nach der Ferne. Der Wunsch nach Unsterblichkeit.
Mit 15 Jahren kommt der begabte Joseph Hammer an den Wiener Hof, wo er «Sprachknabe», Dolmetscher, werden soll. Er lernt Türkisch, Arabisch, Persisch, wird nach Konstantinopel entsandt, erlebt den Feldzug gegen Napoleon in Ägypten, sieht, was er nur aus Büchern kannte. Sein Leben lang vermittelt er zwischen Orient und Okzident und ist doch nirgends zu Hause. Dass die Welt sein Genie nicht erkennt, schmerzt ihn. Er muss wohl erst etwas ganz Großes leisten: ein vollständiges Exemplar der Geschichten aus Tausendundeiner Nacht finden und übersetzen ...
«Ein Hochgenuss zu lesen». ZDF Das Blaue Sofa
«Eine faszinierende Geschichte.» Kronen Zeitung
«Dirk Stermann hat einen bildstarken historischen Roman geschrieben.» Die Presse
«Der brillante Satiriker Dirk Stermann setzt in seinem neuen Roman «Der Hammer» dem Orientalisten Hammer-Purgstall virtuos ein Denkmal.» Die Kleine Zeitung
«Bitte sofort besorgen.» WDR2
Vita
Dirk Stermann, geboren 1965 in Duisburg, lebt seit 1987 in Wien. Er zählt zu den populärsten Kabarettisten und Fernsehmoderatoren Österreichs. 2016 erschien sein Roman «Der Junge bekommt das Gute zuletzt», und «Die Welt» urteilte: «Ein lustiger deutscher Medienstar, der als österreichischer Romancier sehr ernst genommen werden sollte.»
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Dezember 2020
Copyright © 2019 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Covergestaltung Anzinger und Rasp, München
Coverabbildung Markos Botsaris, 1874 (oil on canvas), Gerome, Jean Leon (1824–1904) / Private Collection / Bridgeman Images
ISBN 978-3-644-00152-7
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Prolog
In einer Zeit, als es noch Abenteuer gab und fremde Welten, als die eigene Welt noch klein war und deshalb groß, lag in Graz eine Frau im Bett und wartete unter Schmerzen auf die Wehmutter, die nicht kam. Es war der neunte Juni siebzehnhundertvierundsiebzig. Ihr Mann Josef war Gubernialrat und seit Tagen in der Krain und in Oberkärnten auf Jesuitengütern unterwegs, um Steuern einzutreiben. Ninette, wie man Anna Hammer rief, war keine zwanzig Jahre alt und wischte sich selbst den Schweiß von der Stirn. Im Bett war es feucht, als hätte sich etwas aus ihr heraus entleert. Sie erschrak. Ihr Unterleib krampfte. Noch war es dunkel. Sie hatte sich zur Tür der Nachbarn geschleppt, als die Schmerzen zu groß geworden waren. Margarete, die Frau des Gelbgießers Egger, hatte ihr versprochen, nach der Wehmutter zu suchen. Sie selbst war kinderlos und traute es sich nicht zu, ihrer Nachbarin eine Hilfe zu sein.
Wieder schrie Ninette auf. Das Kind in ihr gebärdete sich wie toll. Wie lang war Margarete schon fort? Ninette versuchte sich abzulenken, indem sie in Gedanken dem Weg folgte, den Margarete auf der Suche nach der Wehmutter nehmen musste. Beim Perückenmacher Gränäthä vorbei, beim Haus des Schlossbergtürmers Weeß die Gasse nach links, dort wohnte der Schiffklampfelmacher Pallwein. Dann der Wachskerzler Honig, der Kartenmaler Fetscher, der Landschaftssprachmeister Nikolaus Napee. Um die Ecke der Kotzenmacher Gissl, von dem sie die grobe, zottelige Wolldecke gekauft hatten, die ihr zu schwer geworden war. Sie hatte sie in ihrem Bett weggestoßen. Der Stockfischwässerer Eybl, der Schön- und Schwarzfärber Wallgram, der Geisterbrenner Schäffer, der Zischmenmacher, der nur Ungarisch sprach, der Kapaunhändler Paull und der Wachsbossierer Pauliel. Dann links die Brüder Germain, die Pfeifenkopferzeuger, die ihre eigenen Pfeifen nur zum Essen aus dem Mund nahmen und nur aßen, um danach wieder rauchen zu können. Dort wohnte der Wochenmelbler Fuchs mit seiner Frau, der Wehmutter. Vielleicht hatte sie ihn auf einen der Wochenmärkte begleiten müssen? Fuchs war als Weinhändler viel unterwegs. Oder war Margarete gar nicht losgegangen, die Wehmutter zu rufen? Margarete war schon bald vierzig und hatte dem Gelbgießer Egger noch immer keinen Sohn geschenkt. Oft hatte Ninette das Gefühl, dass die Eggerin ihr neidische Blicke zuwarf. Sie traute ihrer Nachbarin zu, dass sie sich wieder hingelegt hatte, missgünstig grinsend, eine böse Frau.
Im Haus der Hammers lebten noch der Kleinuhrmacher Khopp und der Salpetersieder Geyer, beide Großkunden des Geisterbrenners Schäffer. Ihnen traute sie daher nicht über den Weg. Ständig stritten sie sich betrunken, ob es Graz oder Grätz heißen müsse. Khopp trank so viel, dass er stark zitterte. Er bekam seine Kleinuhren kaum mehr in den Griff, was dazu führte, dass er aus Verzweifelung noch mehr trank. Der Salpetersieder Geyer wiederum war wie eine Plage. Er roch nach dem verrieselten Urin und den Exkrementen, die er aus der Erde grub, und dumpf nach der Pottasche, die er beidem zufügte. Geyer sah aus, wie Ninette sich den Satan vorstellte. Keinen ihrer beiden Nachbarn hätte sie in diesen Stunden gerne an ihrer Seite gehabt.
Das Kind zerriss ihr die Eingeweide. Sie biss in die wollene Kotze, die nach Pferd schmeckte.
In Boston hatten die Kolonisten guten Tee ins Meer gekippt. Was für dumme Menschen, fand Ninette, und sie verstand, dass der englische König Georg streng reagiert hatte. Die Engländer liebten Tee, und jeder Dummkopf wusste, dass man Tee in kochendes Wasser schütten musste. In Italien war ein Vulkan ausgebrochen. Das war ihr egal. In ihr war auch ein Vulkan ausgebrochen. So fühlte es sich an. Wieder biss sie in die grobe Decke. Der französische König war gestorben, der neue hieß auch Ludwig. Der Sechzehnte. Wie viele da wohl noch folgen würden? Das alles wusste sie von Josef, der auf seinen Reisen viele Neuigkeiten erfuhr. Wenn er in Postkutschen saß, in Gasthäusern schlief oder von den Jesuiten, die nicht nur beteten, sondern am Weltgeschehen beteiligt sein wollten. Die Türken hatten einen neuen Sultan. Sie hatte sich den Namen nicht merken können. Ein Ü kam im Namen vor, aber der neue Sultan bedeutete sicher nichts Gutes. Sie war aufgewachsen in der Furcht vor den Osmanen. Schon als Kind hatten ihr diese dunklen Gestalten, diese unchristlichen Barbaren schlaflose Nächte bereitet.
Jetzt war es ihr ungeborenes Kind. In dieser Nacht beneidete sie ihre Nachbarin um deren Kinderlosigkeit. Die Schmerzen waren ein zu hoher Preis für alles, was da kommen mochte. Sie richtete sich auf und sah aus dem kleinen Fenster in die Dämmerung. Hilfesuchend. Aber da nahte keine.
Als die Sonne im Osten aufging, drängte das Kind mit aller Kraft hinaus in die Welt. Als würde es magisch von der morgenländischen Seite angezogen. Ninette schrie so laut, dass den Perücken beim Perückenmacher Gränäthä die Haare hochstanden und sogar die kastrierten Kapaune beim Kapaunhändler Paull kurz mit ihrem heiseren, tremolierenden, fast gläsernen Krähen innehielten. Vielleicht, weil sie ahnten, dass da ein besonderer Mensch auf die Welt kam. Hier, mitten in Graz oder Grätz. Die Uhr vom Schlossturm zeigte Viertel vor sieben. In Konstantinopel war die Sonne bereits seit mehr als einer Stunde aufgegangen und die Muezzine längst wieder von den Minaretten heruntergestiegen.
1. KapitelDer Sprachknabe
Zwei, drei. Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt, jeder Schultag um sieben Uhr mit dem Gebet bei den Peiserstöcks. Josephs Kostherr war ein geborener Bauer, klein und verwachsen, und hatte es sich gemeinsam mit seiner Frau auf der niedersten Stufe krassester Bigotterie eingerichtet. Ihre Hauptsorge für den ihnen anvertrauten Kostknaben bestand darin, das regelmäßige Messehören zu überwachen und ihm die unzähligen Gotteshäuser der Hauptstadt zu zeigen. Die über zweihundert Kirchen und ihre Glocken. Peiserstöck, der Kürbisgesichtige, liebte die heiligen Stimmen der Glocken. Und es läutete immer in Wien. Fünfzig verschiedene Klänge zur Raum- und Zeitorientierung. Wien markierte das Zentrum des Glockeneuropas, die Glocken waren die offizielle Stimme der Reichshaupt- und Residenzstadt. Die bekannteste Glocke, die Pummerin, hing im Südturm des Stephansdoms. 1711 von Johann Achamer aus türkischen Kanonen gegossen, die man bei der glorreichen Verteidigung der Stadt kein Menschenalter zuvor erbeutet hatte, wog sie mehr als 40000 Pfund inklusive Klöppel und Joch, aber ihren tiefen Klang hörte man nur zu besonderen Anlässen. Am Heiligen Abend, am Stephanitag, zum Jahreswechsel, zur Osternachtfeier, zu Fronleichnam, Mariä Himmelfahrt und an Allerseelen. Der Hausinspektor Peiserstöck stand dann jedes Mal mit geschlossenen Augen vor dem Dom und ließ sich vom tiefen Klang der Königin der Glocken ergreifen.
Die Wohnung der Peiserstöcks gehörte zum Klangterritorium von St. Anna. Die Glocke von St. Anna war Joseph inzwischen die vertrauteste. Sie läutete ihn durch den Tag. Morgens, mittags das Angelusläuten, dazu das Freitagsläuten, mit dem man einmal wöchentlich der Todesstunde Jesu gedachte, mehrmalige Aufrufe zum Gottesdienst, jeweils unterschiedlich intoniert an Werk-, Sonn- und hohen Festtagen. Das geübte katholische Ohr kannte sich aus. Dazu läutete es bei besonderen Anlässen wie Geburt, Taufe, Hochzeit und Begräbnissen. Die Glocken warnten vor Sturm und gefährlichen Angriffen, sie riefen zu Versammlungen und zum Schließen der Wirtshäuser. Bei Bränden bimmelte die «Feuerin», das «Zügenglöcklein» begleitete Sterbende, die eben in den letzten Zügen lagen. Beim Tod eines Mannes läutete es dreimal, bei dem einer Frau zweimal, bei einem Kind einmal. Für die Peiserstöcks hatte es im letzten Jahr zweimal geläutet. Zweimal einmal.
«Ich muss los», sagte Joseph.
Die Peiserstöcks bekreuzigten sich. Für den Sohn, der am Faulfieber, und die Tochter, die an der Bangigkeit der Kinder zugrunde gegangen war. Schon stand er bei der Tür.
«Eins?»
Der Peiserstöck nickte, soweit Joseph das durch die dichten Schwaden des Herdfeuers erkennen konnte.
«Zwei, drei.» Das Hühnchen und das Judenohr. So zählten die Soldaten in Paris seit ihrer Revolution. Die Franzosen hatten ihr Hirn unter der Guillotine verloren. Und welcher Dummkopf war auf die Idee gekommen, den Monaten neue Namen zu geben und der Uhrzeit einen neuen Verlauf? Nicht Oktober, November und Dezember, sondern Weinlese, Nebel und Gefrierender Nebel? Vendémiaire, Brumaire und Frimaire? Joseph war im Juni geboren, einem warmen Tag in der Steiermark. Für die Franzosen hieß der Juni nun «Wiese». War er also am 9. Wiesentag geboren? 1774 zu Graz im schönen Monat Wiese? Wie würde er das einem Franzosen sagen müssen? Und wie trifft man eine Verabredung, wenn der Herr aus Paris glaubt, der Tag habe zehn Stunden zu hundert Minuten und hundert Sekunden? Wie sagt man das, wenn man einen Revolutionssoldaten am 2. Januar um drei Uhr zu treffen gedenkt? Hühnchen Schnee Judenohr? Die Franzosen hatten bereits eigene Uhren. Revolutionsuhren, auf denen die verwirrten Zeiger viel länger für jede Umrundung brauchten. Abbé Bruck hatte eine solche Uhr aus der Werkstatt des Uhrmachers Lenoir. Er hatte sie Joseph gezeigt, und der Bub hatte lachen müssen.
«Geht die nicht immer nach, wenn die Minute hundert Sekunden hat?», hatte Joseph ihn gefragt.
«Nein, sie geht vor», hatte der kluge Abbé geantwortet. «Vielleicht viel zu weit vor.» Mit den Uhren hatte sich auch die Sprache verändert. Seit der Abschaffung des Adels war Französisch vulgär geworden. In der Akademie hatten die Sprachknaben unter der Hand Zugang zu französischen Pamphleten wie dem Père Duchesne, in denen Marie-Antoinette als schlimmste Dirne Frankreichs beschimpft wurde. Sie habe sich mit ihren Dienern im Schmutz gesuhlt und es sei unmöglich zu sagen, welcher Kerl für die kümmerlichen, eitrigen Buckelzwerge verantwortlich war, die aus ihrem faltigen, dreiwülstigen Bauch kämen.
Wie konnte man auf diese Weise über Königinnen sprechen? Franz Maria von Thugut, mit dem sich Joseph angefreundet hatte, war im Besitz eines französischen Nachttopfes, der mit Allegorien aus den Tagen der Revolution bemalt war.
«Da macht’s Scheißen Freude», hatte Franz Maria, der Sohn des Vizestaatskanzlers, gesagt und mit Joseph gemeinsam seine Blase auf die Revolution geleert. Ihr Strahl traf die Bastille.
Seine Mutter, die Frau von Thugut, war dick wie Maria Theresia, nur dass sie anders als die tote Kaiserin auch in ihrer Jugend schon mit einer Körperfülle extremen Ausmaßes geschlagen gewesen war, während die Kaiserin erst mit jedem ihrer sechzehn Kinder eine Wulst dazubekommen hatte. Frau von Thugut saß den ganzen Tag auf ihrer Ottomane und fächerte sich Luft zu. Wahrscheinlich war ihre Nase zu fett und träge, um ohne Fächer zu atmen. Wenn sie sich in ihrem Palais bewegen musste, nahm sie dazu einen englischen Gichtstuhl auf Rädern. Denn natürlich hatte sie Gicht. Es war das goldene Zeitalter der Gicht. Gicht war das äußere Zeichen des Wohlstandes und, bei Männern, der intellektuellen Tätigkeit. Diener hoben sie in den mit Rindsleder bezogenen Rollstuhl und schoben das adelige Walross durch die herrschaftlichen Räume. Ähnlich wie die Habsburgerin, die mit umständlichen Aufzugsmaschinen durch Stockwerke und Räume transportiert worden war, weil sie es nicht mehr alleine geschafft hätte. So dick war die Kaiserin und fraß so viel, dass ihr Leibarzt an ihrer Tafel einen großen Kübel aufstellen ließ, in den er die gleichen Portionen warf, die sie zu sich nahm. Gang für Gang ließ er in den Kübel füllen. Am Ende präsentierte er den übervollen Eimer der Kaiserin. «Das alles, Majestät, liegt jetzt so bleischwer in Ihrem kaiserlichen Magen.» Aber sie ließ sich davon nicht abschrecken, und auch Franz Marias Mutter musste mehrere Kuhherden und Schweineställe verschlungen haben. Und die Vereinigten Belgischen Staaten von Österreich gab es sicher auch nur noch wegen des Confects, das Frau von Thugut kistenweise unzerkaut schluckte. Aber Brüssel hatten sich die Franzosen inzwischen auch geschnappt. Frau von Thugut aß Confect der Jakobiner.
«Liberté, Fraternité? Egal», sagte Franz Maria verächtlich. «Wie lächerlich ist die Idee, ich sei so viel wert wie unser Diener. Unser Diener ist so viel wert wie sein Bruder, also weniger bis nichts. Diener ist Diener, und Herr ist Herr, n’est-ce pas?»
Joseph nickte, aber er wusste, dass er selbst gemeint war. Sein Vater war Sohn eines einfachen Gärtners gewesen, geboren in Katzelsdorf, weit weg von der Hauptstadt. Immerhin Verwalter der ehemaligen Jesuitengüter in den Kronländern Steiermark, Kärnten und der Krain.
Als Joseph elf Jahre alt war, hatte ihn der Vater zu einer Reise zu einem Gut in Kärnten mitgenommen. «Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt», hatte sein Vater gesagt, als sie aus dem Haus traten.
In einer Kutsche verließen sie Graz. In den Dörfern außerhalb der Stadt schauten aus den kleinen Fenstern der Holzhäuser neugierige Köpfe mit breitkrempigen, grünen Hüten dem vorbeieilenden Wagen hinterher. Das sah Joseph noch vor sich. Es war Sommer, an den Bäumen hingen herrliche Kirschen. Mit dem Vater pflückte er sie, als sie Rast machten. Sie schmeckten nach süßem Licht.
Mädchen in kurzen Leibestrachten trugen Bündel von Futtergras auf dem Kopf.
Bei der Burgruine Hohenwang hielten sie. Ein Bauer, der neben der Ruine einen Baum fällte, zeigte ihnen eine Vertiefung im Schlossgraben.
«Das ist das Türkenloch», sagte er in bellendem Steirisch.
Hier hinein waren 1683 die heidnischen Leichname geworfen worden, die bei der neuntägigen, vergeblichen Bestürmung der Festung den Tod gefunden hatten.
«Es war ein tiefer Abgrund», bellte der Bauer. «Aber der war so vollgefüllt mit Türken, dass die Leichen sich aus dem Loch türmten. Erst später, als sie verwest sind, höhlte sich das Loch wieder.»
Auf der tosenden Drau setzten sie auf einem Floß zusammen mit zwanzig Menschen und mehreren Gipsfässern die Fahrt fort. Die Schiffsleute ermahnten die Passagiere, achtsam zu sein und nicht in Angst zu geraten, die Fahrt werde sehr beschwerlich werden, weil die Drau wütend sei. Alle Männer entblößten das Haupt und bekreuzigten sich. Einige Mädchen zitterten und klagten erbärmlich. Vergebens, der Lauf war unerbittlich. Schon bald stürzten sie donnernd fünf Schuh über ein Wehr hinab. Die Wogen drängten sich fußhoch über und durch das Floß.
«An dieser Stelle hat es schon viele erledigt», schrie der Bootsführer. Zwei Hunde waren schon über Bord gegangen. Das Boot schoss pfeilschnell weiter. Gebete wurden gebrüllt, man hielt sich an den Händen, Joseph klammerte sich an ein Gipsfass. Er sah einen der Hunde in den tosenden Fluten untergehen. Und plötzlich beruhigte sich die Drau, und sie fuhren dahin, als seien sie eine fröhliche Landpartie.
Das erste Häuschen Kärntens an der Grenze, neben dem Torbogen, machte auf Joseph einen widerlichen Eindruck. Eine arme, von Schmutz und Kröpfen ganz entstellte Familie bettelte ihn und seinen Vater an.
«Sollen wir ihnen etwas geben», fragte Joseph.
«Nein», sagte sein Vater. «Der Kaiser hat die Leibeigenschaft abgeschafft. Jetzt liegt es an ihnen, etwas zu machen aus der Freiheit.»
In Unterdrauburg hatte ein Brand wenige Monate zuvor mehrere Häuser vernichtet. Manches lag noch wild und wüst durcheinander und entstellte den ohnedies unansehnlichen Ort noch mehr. Sie wanderten eine abgeschmackte Promenade entlang, im Kot bergauf und bergab, Richtung Lavamünd. Außer saurem Wein gab es im Gasthaus nichts.
«Wo man nichts zu essen bekommt, lässt sich nichts kritisieren», sagte sein Vater, und sie zogen schweigend und hungrig sechs Stunden weiter in das Dorf Eis, das aus fünf Häusern bestand. Die Posthalterin war zugleich Gastwirtin, aber sämtliche Hausbewohner schienen eine Fastenkur zu halten, oder die Millionen Fliegen hatten alles Essen weggeschnappt.
In der Nacht träumte Joseph von Wurst und seiner früh verstorbenen Mutter.
Am nächsten Tag nahmen sie einen wohlbespannten Wagen nach Klagenfurt und ließen sich in dem schnell fahrenden Vehikel auf der jämmerlichen Straße hin- und herschleudern.
Auf den Feldern stand ausgemergeltes Rindvieh. Als es dunkel wurde, erleuchteten vereinzelte Flammen die Umgebung.
«Das sind Feuerbrände, die nutzen die Kärntner für das elendeste Getränk, das je auf der Welt gebraut wurde», erklärte ihm sein Vater. «Steinbier. Sie tun Steine in die Glut und bereiten daneben in einem Fass einen Wasseraufguss über Gerste, packen Wacholderbeeren hinein und ein paar Kräuter, aber keinen Hopfen. Danach werfen sie die glühenden Steine hinein. Sie trinken das dann ungeklärt und ungereinigt.»
«Und wie schmeckt das Bier?», fragte Joseph.
«Nach Rauch und Lehm. Es ist widerlich. Darum wird es auch nicht in Gläsern ausgeschenkt, es würde zu ekelhaft aussehen. Sie haben eigene, schwarze Krüge für ihr Teufelszeug.»
Der Bezirk bis Lieseregg ist der unglückseligste an Hervorbringung von Fexen, Trotteln und Kretins. Sein Vater hatte ihn vorgewarnt, aber die Wirklichkeit schlug jede Vorstellung. Es gab kaum ein Haus, vor dem man nicht diesen Stiefkindern der Natur begegnete. Joseph sah Kinder, die sich neckend mit Kot beschmierten, und Erwachsene, die lachend große Steine auf Vorübergehende warfen. Eine offensichtlich blöde Frau stürzte sich auf Josephs Vater, riss ihm ein Knäuel Haare aus und bestreute damit ihren Kopf. Zwergartig waren diese Unglücklichen. Mit dicken Köpfen, kleinen Augen und großen, hängenden Kröpfen. Als Haustiere hielten sie schwarze Schweine, die mit schlechter Nahrung leichter zu erhalten sind als rosafarbene. Wölfe und Bären müssen sich vor diesen Schweinen fürchten. Auch die Schweine attackierten Joseph und seinen Vater und ließen nur von ihnen ab, als ein Hund sich neugierig näherte. Die mordsüchtigen Borstenviecher zerrissen ihn vor ihren Augen.
Die folgende Nacht verbrachte Joseph in einem Bett, auf dessen Leintüchern große Blutflecken waren. Er konnte kaum einschlafen, auch weil er sich vor dem Wirt fürchtete, einem schief gehenden Mann mit Kropf und Speckdrüsen, der sich ständig unter den Hut griff, offensichtlich bemüht, in seinen Haaren nicht vorhandene Gedanken zu finden.
Als er endlich erwachte, brannten sein Gesicht, sein Leib und seine Hände. Zecken, Schafkäfer und Achtfüßler hatten seinen Körper zerfressen. Er konnte die verdammten Tiere im erstickenden Tabakdampf aus der Pfeife des Wirtes kaum erkennen.
Da ein starkes Gewitter aufgezogen war, mussten sie noch eine Nacht länger bleiben. Am Abend füllte sich die Gaststube. Man reichte schwarze Krüge und Fleisch vom schwarzen Schwein. Die Kärntner waren ausgelassen. Sie sangen und schrien und lutschten an alten Steinen. Die Irre, die Josephs Vater Haare ausgerissen hatte, starrte sie an mit Augen, die sich im Kreis bewegten.
Das Essen schmeckte ihm nicht. Jeder Bissen wurde zum Würgapfel.
«Eine furchtbare Gesellschaft», flüsterte sein Vater. «Da wären mir Schneckenhändler und Juden lieber als diese armseligen Tröpfe.»
Ein schwarzer Krug zerschellte an der Wand. Zwei Männer sprangen auf und begannen eine Schlägerei. Der eine von beiden schlug mit seinem Krug dem anderen ins Gesicht, das schon vorher nichts Anmutiges hatte, nun aber immer mehr zu Brei zerfloss.
Josephs Vater, der als Verwalter auch für diesen Bezirk zuständig war, wollte eingreifen, aber ein älterer Mann, der aussah, als wäre er mehrmals vom Blitz getroffen worden, hielt ihn zurück.
«Lassen Sie. Das ist mein Sohn», sagte der Halbmensch.
«Der Untere?»
Der erfolglose Blitzableiter nickte.
«Wollen Sie, dass Ihr Sohn erschlagen wird?», fragte Josephs Vater aufgebracht.
«Ich habe keinen Sohn gezeugt, der mit Fausthieben umgebracht werden kann», sagte der alte Kärntner ruhig.
In der Früh regnete es nur noch leicht. Sie gingen durch dichten Wald. Kein Licht weit und breit. Tot ruhte die Gegend. Als hätte die Pest sie verzehrt.
Im ehemaligen Jesuitengut, dem Ziel ihrer Reise, herrschte große Aufregung. Ein über hundert Jahre alter Wels hatte einen Holzknecht gefressen. Wie viele Kärntner hatte der Verstorbene mehrere uneheliche Kinder. Josephs Vater entschied, dass ihnen eine kleine Leibrente auf Kosten des Guts zugesprochen werden solle.
Joseph sah in den trüben Teich. Und meinte, den Wels noch schlucken zu hören.
86 Gütern hatte sein Vater tadellos als Hofkommissär und Administrator vorgestanden, bis die schreiende Ungerechtigkeit, die ihm durch Freiherr von Schwitzen und Hofrat von Dornfeld einige Jahre davor angetan worden war, ihn von seiner Tätigkeit entbunden hatte. Nur weil er kein Mitglied der Freimaurer war, des so mächtigen Bundes, der alle seine Brüder begünstigte und seine Gegner klein hielt, war er auf die kränkendste und ungerechteste Weise in einem bösen Ränkespiel in den Vorruhestand geschickt worden. Mit einem Drittel seiner Bezüge und dem empfindlichsten Schaden an Ehre und Gut. Der aus dem Maul nach Stumpfsinn riechende Gundaker von Schwitzen, der dümmste Hornochse, der je in einer Loge saß, wurde sein Nachfolger als Staatsgüteradministrator.
Josephs Vater kümmerte sich nun als Verwalter um das dahingeschmolzene Vermögen des noch unmündigen Grafen Zeno von Saurau, des letzten Sprosses dieses alten steiermärkischen Geschlechts. Es war die einzige Anstellung, die er hatte finden können. Verwalter eines verarmten Kleinkindes, dessen Name größer war als sein Wert.
Joseph hatte das Gefühl, sein Vater gehe gebeugter als zuvor und auf der Straße werde er seltener gegrüßt. Manchmal begleitete er ihn zum Palais Saurau in der Grazer Sporgasse. Es war entwürdigend, wie servil sich sein Vater dem verzogenen Kleinkinde gegenüber verhielt. Joseph war Zeuge, wie der johlende Zeno von einem zerschlissenen, goldverzierten Sessel aus eine Flasche Kernöl über dem Vater ausleerte. Der hatte es wortlos erduldet. Seit diesem Erlebnis wartete Joseph lieber auf der Gasse vor dem Palais auf seinen Vater. Von unten betrachtete er den bunten Fenster-Türken, der die Grazer an die Ereignisse von 1532 erinnern sollte. Damals hatten die tapferen Bewohner der Stadt den osmanischen Besatzer Ibrahim Bassa zum Abzug gezwungen, indem sie vom Schlossberg aus eine Kanonenkugel abfeuerten, die ausgerechnet dessen Braten traf. Entnervt ließ der Osmane von Graz ab. Jemandem in die Suppe spucken, dachte Joseph. Oder jemandem in den Braten schießen.
«Die Männer hier sind bei all ihrer Knochenstärke artig im Benehmen», sagte der fremde, junge Herr. Er war sehr elegant gekleidet und wirkte im weihnachtlich geschmückten Grazer Dom wie zusätzlicher Schmuck. «Anders als die Salzburger, diese gewöhnlichen, ausdruckslosen Physiognomien. Die Salzburger, und es schmerzt mich das zu sagen, sind kein veredelter Menschenschlag. Aber hier? Chapeau!»
«Grätz ist ein Bollwerk der Christenheit und der Grätzer ein Soldat Christi», antwortete der Jesuitenpfarrer, der stolz darauf war, dass seine Kirche in diesem Jahr zur Domkirche erhoben worden war. Die beiden standen nahe beim Südportal, wo das Landplagenbild hing, auf welchem Pest, Türken und Heuschreckenplage dargestellt waren.
Wann immer Joseph mit dem Vater und den Geschwistern den Dom besuchte, standen die Kinder lange Zeit vor dem Bild und schauderten. Was war schlimmer? Pest, Türken oder Heuschrecken?
«Die Pest, weil sie dich ins Grab bringt», sagte Johann.
«Ach, und der Türke nicht? Sieh dir das Bild an. Der krumme Dolch zerteilt dir die Eingeweide schlimmer als das gerade Christenschwert», entgegnete Alois, und Cajetan nickte.
Die Schwestern Anna und Fanny hatten vor den Heuschrecken mehr Angst als vor Pest und Türken. Vor allem, was flatterte und klein war, grauste ihnen.
«Am schlimmsten ist ein pestkranker Türke», sagte Wilhelm.
«Genau, ein pestkranker Türke, der Heuschrecken in Säcken dabeihat», sagte Franz.
Joseph war der Älteste der acht Geschwister. Er hatte keine Angst. Nicht vor der Pest, nicht vor den Türken und schon gar nicht vor Heuschrecken. Er hatte Angst davor, so klein zu werden, wie sein Vater es jetzt war. Angst, nicht der Joseph Hammer zu werden, der in ihm schlummerte. Dass ihn niemand erwecken, nicht das Feuer in ihm entfacht würde.
Der Gottesdienst begann. Die Lichter, das Gold, die Glocken. Wie groß und prachtvoll der Raum, die acht mächtigen Pfeiler, die den Dom in drei Schiffe unterteilte, der langgestreckte Chor hinter dem Triumphbogen, die farbigen Fresken aus dem Mittelalter, die Christophorusdarstellungen über den Seitengängen, die wunderschönen Blütendekorationen in den Seitenschiffgewölben. Jesus sah ihn an, ihm direkt in die Augen. An diesem Abend wurde er erneut geboren, auch hier in Gracz, Greze, Grätz oder Gradschas, wie die Türken seine Stadt so gemein nannten. Ein gerader Schaß. Nichts davon traf hier und heute zu, fand Joseph, der ergriffen wurde von der Feierlichkeit des Augenblicks.
«Die Tür des Stalls in Bethlehem war klein, aber groß genug, um die Ewigkeit hineinzulassen», predigte der Jesuit, und Joseph sah sich selbst vor einer kleinen Tür stehen. Er wusste noch nicht, wo diese Tür stand, aber würde er hindurchgehen, da war er sich sicher, würde ein Hauch dieser Ewigkeit auf ihn fallen.
Man erhob sich, sang, betete, fiel auf die Knie, stand auf, und Jesus sah vom Kreuze zu.
Es war wie jedes Jahr zu Weihnachten, bis der alte Jesuit das Wort an den jungen Herren richtete. «Herr Jakob von Wallenburg ist heute unser Gast in Grätz, um die heilige Christmesse mit uns zu feiern. Einer seiner Ahnen war Veit von Wallenburg, der in Wien während der ersten Türkenbelagerung vor 250 Jahren oberster Kriegszahlmeister seiner Majestät war. Jakob von Wallenburg ist ein studierter Mann, ein Orientalist, und auf dem Weg nach Konstantinopel. Er ist außerdem ein gottbegnadeter Organist und hat sich von mir überreden lassen, für uns alle in dieser besonderen Nacht zu spielen.»
«Orientale? Ist der Mann ein Türke», fragte Fanny ängstlich.
«Nein, mein Kind, der Mann ist Orientalist. Einer von uns», beruhigte sie ihr Vater.
«Schau, Fanny, in seinem feinen Rock hat er Heuschrecken versteckt», flüsterte Alois und kicherte.
Der junge Herr von Wallenburg saß in der ersten Reihe und erhob sich. Er verbeugte sich leicht vor dem Jesuiten und ging stolz durch die versammelte Gemeinde zur Orgelempore.
Es war totenstill in der Kirche. Man hörte nur die Schritte des feinen Herrn.
So selbstsicher gehen können, dachte Joseph. Von allen Augen begleitet und doch durch nichts zu erschüttern.
Die Kerzen leuchteten fast noch heller als zuvor, als er zu spielen begann. Die Pastorella von Gottlieb Muffat, dem kaiserlichen Hof-Kammerorganisten und Musiklehrer von Maria Theresia. Die Töne erfüllten den riesigen Raum und jedes noch so kleine Herz. Joseph schloss die Augen. Niemals hatte er so etwas gehört. Niemals gewusst, dass es solche Klänge gibt. Als türmten sich die Töne in immer neuen Höhen aufeinander und hallten von sich selbst zurück. Jeder Stein im Dom war Musik, jedes Beinkleid, jeder Schuh, jedes Kreuz. Die Märtyrer an den Wänden wussten endlich, wozu sie gestorben waren. Und den Menschen ein Wohlgefallen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit auf Ewigkeit, Amen, dachte Joseph, und plötzlich war es klar. Dieses Orgelspiel machte alles deutlich. Er wusste, was er werden wollte. Durch welche Tür er gehen würde. Er öffnete die Augen und sagte zu seinem Vater:
«Ich möchte Orientalist werden!»
Sein Vater hatte noch alte Gönner, wie den Grafen Bethgen. Der hatte ihn ermuntert, beim Vizekanzler Philipp Graf Cobenzl eine Bittschrift einzureichen um Josephs Aufnahme als Zögling der orientalischen Akademie. Und tatsächlich war Antwort gekommen.
So fuhren sie nach Wien. 1787 war das Jahr. Joseph dachte, er würde nur wenige Wochen in der Hauptstadt bleiben und dann nach Graz zurückkehren. Als sein Vater ihm aber auf der Höhe des Semmerings eröffnete, er wolle ihn ganz in Wien lassen, ergriff tiefster Schmerz den Buben.
«Weine nicht», sagte sein Vater. «Ergreif die Möglichkeit. Lerne, bevor die Sonne aufgeht, und lerne, bis der Mond sich im Tag verliert. Lerne beim Gehen, lerne im Sitzen. Gib die Bücher nicht aus der Hand. Ich hab dir wenig mehr zu geben als diesen Ratschlag.»
Der Vater sah alt aus und müde, seine Perücke war schlecht gearbeitet und aus der Form geraten. An der Seite, über dem rechten Ohr, hatte sie ein Loch. Es sah aus, als hätte ihn ein Vogel attackiert.
«Es war ein Raubvogel mit seinem Schnabel», sagte sein Vater. «Ein Falke im Stift Admont. Der Falkner war unvorsichtig. Ich war im Gespräch mit Columban von Wieland, dem Abt, und hab den Falken zu spät bemerkt. Wahrscheinlich hielt er die Perücke für ein Schneehuhn.»
«Jetzt siehst du aus, als hättest du ein gerupftes Schneehuhn auf dem Kopf», sagte Joseph.
Sein Vater lächelte traurig.
«Es sind Benediktinermönche in Admont. Ein herrliches Stift. Und die neue Bibliothek ist unglaublich, Joseph. Riesig. Und hell. Als würdest du im Himmel lesen. Licht durchströmt die hohe Halle von überall. Licht ist Erkenntnis. Man nennt die Bibliothek schon jetzt das achte Weltwunder. Ich hab die anderen sieben noch nicht gesehen, aber prachtvoller können sie nicht sein.»
«Ut in omnibus glorificetur Deus», sagte Joseph.
«Wie meinst du?»
«Damit in allem Gott verherrlicht werde.»
Sein Vater nickte und streichelte ihm den Kopf.
Die staubige Kutsche rollte an der Spinnerin am Kreuz vorbei. Joseph kannte die Sage von der Frau, die hier Wolle spinnend saß und jahrelang auf ihren Mann wartete, der sich dem Kreuzzug angeschlossen hatte, um Jerusalem aus der Hand der Türken zu befreien. Der Mann kam wieder und brachte die erste Safranpflanze nach Wien. Alle standen damals im Herbst staunend vor der violetten Blüte.
Joseph hielt ein Papier in der Hand. Sein Vater hatte es ihm geschenkt. In der Bibliothek des Stifts Admont hatte sein Vater ein arabisches Buch gefunden und die erste Seite für seinen Sohn abgeschrieben, vielmehr abgemalt. Die Zeichen verschwammen ihm in der wackelnden Kutsche vor den Augen zu einem Rätselbrei. Gesichter, Wolken, Vögel, Silhouetten einer Stadt. Schöne Schlangenlinien.
Es war eng und stickig in der vollbesetzten Kutsche. Neben ihnen saßen ein Grazer Chymist, ein Hendlkramer aus der Südsteiermark, der seine krähende Last auf das Dach des Wagens geschnallt hatte, ein Laibacher Zahnbrecher und ein pockennarbiger Tintenmann in einem kobaltblauen Justaucorps, der seine Tinte von minderer Qualität am Hof anbieten wollte.
«Waschblau und Tinte», sagte er. «Ich sehe, Sie sind gebildete Herren. Wie wär’s mit ein paar Fässern? Sechs Kreuzer das Fass? Wenn der Kaiser meine Tinte nimmt, können Sie sagen, Sie schreiben wie Franz II.»
«Der Kaiser wird Ihre dünne Suppe nicht kaufen», antwortete der Chymist. «Wussten Sie nicht, dass er seine Tinte selber macht? Weil er weiß, welcher Dreck sich Tinte nennt? Überm Herdfeuer macht er’s, aus Ligusterbeeren mit einer Beimischung von Bleizucker, Weinessig und etwas Pflanzenzucker. Er beliefert auch seine Kabinettskanzlei und die Hofwirtschaftsämter mit seiner Tinte.»
Der Tintenmann rieb sich seine Pocken und starrte wortlos aus dem Fenster. Es regnete. Die Räder des Wagens spritzten den Kot massenweise auf, die Schaufenster der Gewölbe waren braun bespritzt. Fußgänger, die den Fuhrwerken noch näher waren, bekamen eine regelrechte Kotverkleidung.
«Wenn es regnet», sagte sein Vater, «wird Wien für den Fußgänger eine wahre Sündenflut, wie du siehst. Die Straßen sind mit Unrat bedeckt, und die schmutzigen Rinnen überschwemmen das Trottoir.»
«Welches Trottoir», fragte Joseph.
Sein Vater sah hinaus. «Du hast recht. Wenn es eines gibt, meinte ich natürlich.»
Plötzlich hämmerte es bei voller Fahrt an die Kutsche. Am Fenster erschien ein dampfender, triefnasser Kopf mit einem sehr hohen Hut, an dem traurige Straußenfedern hingen. Noch einmal klopfte es von außen an die Tür. Joseph sah den langen, mit allerlei Firlefanz versehenen Stab, mit dem der Straußenmann an die Karosse schlug. Dann blickte der Mann, dessen Halsadern stark pochten, noch einmal ins Innere und lief an der schnell fahrenden Kutsche vorbei.
Der Kutscher lenkte das Fahrzeug an die Seite und machte Platz für eine sechsspännige Prachtkarosse, die an ihnen vorbeiflog. Joseph streckte den Kopf in den Regen und sah dem Wagen nach. Der Straußenmann lief vorneweg, schneller, als Joseph je einen Menschen hatte laufen sehen. Der Läufer hatte eine auffällige, farbenprächtige Uniform mit Goldtressen, Samtschnüren und Achselborten. Um den Bauch trug er einen bunten Leibgürtel.
«Das war der Johann Häusler, der berühmteste Läufer Wiens», sagte der Chymist. «Er ist beim Fürsten Colloredo-Mannsfeld bedienstet. Ein Teufelskerl. Er ist beim Läuferrennen im Prater die Strecke in 40 Minuten gelaufen, schneller noch als der Wandrasch vom Fürsten Schwarzenberg. Möchte nicht wissen, was der Schwarzenberg dem Wandrasch dann gesungen hat. Sicher kein Lied für Mädchenohren.» Der Chymist lachte, und Joseph schaute ihn verständnislos an.
«Alle feinen Herren haben Läufer. Das ist sogar ein Ausbildungsberuf. In Maria Brunn kann man das richtige Laufen lernen, im Anschluss an die Forstakademie. Es ist ein hübsches Bild, wenn sie nachts mit Windlichtern und Fackeln in den Händen vor den Kutschen herlaufen.»
«Gemeingefährlich sind sie», sagte der Hendlkramer. «Diese tollblöden Hornochsen mit ihren Fackeln. Mit denen schlagen sie an die Ecksteine der Häuser, dass die Flammen hell aufleuchten, um zu imponieren. Leichtfertige Hund sind sie. Sie schlagen auch an Läden und Holzbuden. Wie viele Brände so schon entstanden sind, man kann’s nicht mehr zählen. Ich würd’s am liebsten mit ihren Läuferstäben erschlagen!»
«Ach, was. Das sind arme Burschen. Waren’s schon einmal bei so einem Läuferrennen? Es geschieht immer wieder, dass Läufer bei dem Rennen zusammenbrechen vor Erschöpfung. Da gab’s schon Tote. Wenn man Menschen wie Tiere wettrennen lässt, bis ihnen das Blut aus dem Mund und der Nase herausströmt, das hat niemand verdient. Und außerdem, wie viele brave Wiener schon an deinen verwurmten Hendln zugrunde gegangen sind», gab der Tintenmann zurück. «Wer schreibt da an der Liste mit?»
Langsam erreichten sie die Innere Stadt. Ungeachtet des schlechten Wetters wimmelte es vor Menschen und Tieren. Die Kutsche rumpelte durch das schmale Katzensteigtor ins Herz der Hauptstadt. Dann hielt sie. Endlich. Der Zahnbrecher, der neben Joseph saß, roch aus dem Mund wie faules Obst.
Unter einem morschen Holzdach luden sie ihr Gepäck ab. Viel hatte Joseph nicht dabei. Einen Regenmantel, einen breiten Hut, ein Paar Schuhe, eine Hose, Nachtgewand und Bettzeug. In einem ledernen Gurt trug er seine Dokumente und das Geld. Für die Reise hatte er abgetragene Kleidung angezogen. Das hatte sein Vater ihm geraten. Spätestens jetzt, im Regen auf dem Weg zur Taborstraße über die Brücke in den Unteren Werd, wurde ihm bewusst, wie gut der Ratschlag war. Er war völlig durchnässt, und sein Beinkleid sah aus, als hätte eine Armee von Dünnscheißern an ihm ihr schreckliches Geschäft verrichtet.
Leider hatte der Zahnbrecher den gleichen Weg wie sie. Auch er suchte ein Zimmer in der «Weißen Rose», einem der berühmten Einkehrhäuser Wiens, wo man mit oder ohne Wagen beherbergt wurde. Hier stiegen Beamte, fahrende Händler und merkwürdig finstere Gesellen ab. Man konnte Pferde wechseln und beim Wagner die Räder der Kutschen reparieren lassen. Und man konnte Pferde, die nicht mehr gebraucht wurden, essen.
Hier durchschlief Joseph die erste Nacht in seinem neuen Leben.
Gleich am nächsten Tag stellte sein Vater ihn dem Vizekanzler, Graf Cobenzl, vor. Sie waren in dessen Landhaus auf dem Reisenberg gefahren, das er durch Zusammenlegung mehrerer Jesuitenhäuser hatte errichten lassen. Das Landhaus war umgeben von einem Garten im neuen englischen Stil mit zahlreichen hölzernen Staffagebauten. Der Graf selbst wirkte auf Joseph wie eine zufriedene alte Frau. Sie gingen im Garten spazieren. Es hatte aufgehört zu regnen. Hier, am Reisenberg, roch es deutlich angenehmer als in der Stadt.
Josephs Vater hatte sich tief verbeugt vor dem dicklichen Cobenzl, der gerade im Gespräch war mit Gottfried van Swieten, dem Sohn von Kaiserin Maria Theresias Leibarzt. Van Swieten hatte ein zu kurzes Näschen und war steif wie die Symphonien, die er komponierte. Van Swieten hatte starkes Interesse an Musik, aber überhaupt kein Talent. Er förderte Musiker wie Mozart und Beethoven und war Präfekt der kaiserlichen Hofbibliothek. Außerdem lag in seinen Händen die oberste Leitung des Studienressorts für die Orientalische Akademie. Cobenzl und van Swieten hatten herausragend schön gearbeitete Zopfperücken, ordnungsmäßig gepudert, das war Joseph sofort aufgefallen. Sein Vater dagegen wirkte gegen die beiden hohen Herren so, wie umgekehrt die Kärntner Waldschrate auf ihn gewirkt hatten. Die Hierarchie war äußerlich klar und manifestierte sich auch bei ihrem gemeinsamen Spaziergang. Der Vizestaatskanzler und der Präfekt bestimmten das Tempo, Joseph und sein Vater trotteten wie treue Schoßhunde hinterher durch den gut orchestrierten Duftgarten des Vizestaatssekretärs.
«Jeder Garten sollte errichtet werden als weite Wohnung unter freiem Himmel», erklärte Cobenzl. «Der Garten ist die Leinwand, die der Gartenkünstler bemalt.»
«Die Körper Ihrer Gartenkunst, Cobenzl, schlagen geradezu an die Organe unserer Empfindung. Ist das Wiesenknopf?» Van Swieten hielt sein stumpfes Näschen an einen dunkelrot leuchtenden Blütenkolben auf einem dünnen langen Stängel.
«Ja, Sanguisorba. Man sagt ihm nach, er bewirke eine Verhütung der Empfängnis.»
«Und? Tut er das?»
«Nein», sagte Cobenzl und trat auf wilden Thymian, der am Boden wuchs. «Riechen Sie das? Most delightful, isn’t it? Tritt man drauf, setzt er seine herrlichsten Gerüche frei. Und dort vorn hab ich Wasserminze pflanzen lassen. Die Nase soll hier Feste feiern.»
Schließlich kamen sie zu einem hölzernen Triumphbogen, der wohl an das antike Rom erinnern sollte. Davor war eine Steinbank, auf der ein älterer, schöner Mann saß und mit geschlossenen Augen betete.
«Das ist der Haydn», erklärte van Swieten. «Der betet wieder darum, dass seine Frau endlich stirbt. Jeden Tag fleht er Gott an, sie zu sich zu nehmen. Eine furchtbare Person, diese Maria Anna Aloysia Haydn. Kennen Sie die schlechtere Hälfte vom Haydn, Cobenzl?»
Cobenzl nickte. «Lieber van Swieten, sie ist die Tochter eines Hamburger Perückenmachers, was kann man da erwarten.»
«Und sie hat gar keinen Bezug zu Musik. Sie interessiert sich nicht für die Arbeit ihres Mannes, für sein Genie. Die Leute sagen, seine Musik sei gut, aber ich verstehe nichts davon», äffte van Swieten die Frau des Komponisten nach.
«Hoffen wir für ihn, dass es einen Gott gibt, der seine Gebete erhört, und der arme Mann endlich mit seiner kleinen Sängerin Luigia Polzelli zusammenkommen kann», sagte Cobenzl.
«Es gibt keinen Gott», antwortete van Swieten laut, und Joseph sah, wie Haydn sich krümmte.
«Haydn ist Freimaurer. Er ist wie Mozart auch in der Wiener Loge ‹Zur wahren Eintracht›. Wie steht’s mit Ihnen, Hammer?»
Zum ersten Mal wurde seinem Vater eine Frage gestellt.
«Ich entschuldige mich vielmals, Herr Vizestaatskanzler, aber nein, ich gehöre keiner Loge an.»
«Ach», erwiderte Cobenzl.
Sie waren am Ausgang des Gartens angekommen. Wildrosen wuchsen hier, Geißblatt, Veilchen, Nelken und Maiglöckchen. Süß duftende Sträucher. Joseph spürte die angenehme Wirkung der verschiedenen Aromen.
«Und der junge Hammer will also einer unserer Sprachknaben werden», richtete Cobenzl endlich das Wort an ihn. Die Sonne spiegelte sich in den blank polierten Schnallenschuhen des Grafen und blendete Joseph so sehr, dass er die Augen zusammenkneifen musste.
Joseph nickte. «Ja, das möchte ich, Euer Exzellenz», sagte er.
«Dann soll er fleißig lernen und dabei mithelfen, die Welt zu entbabeln. Virtute et exemplo. Lebe er nach dem Wahlspruch von Kaiser Joseph.»
«Mit Tugend und Beispiel», übersetzte Joseph, und Cobenzl nickte.
Es war ein langer Fußmarsch vom Reisenberg zurück zur Taborstraße. Über den Höhenweg kamen sie nach Nussdorf und gingen an der Donau entlang zur Stadt. Die Wohlgerüche des Cobenzl’schen Gartens verschwanden, die muffigen Ausdünstungen der Stadt rückten bedrohlich näher. An der Donau sahen sie am Treppelweg Schiffszieher. Nach der Abschaffung der Todesstrafe wurden Verbrecher neuerdings dazu verurteilt, ihr Leben lang Kähne per Seil donauaufwärts, also gegen den Strom zu ziehen. Mehr als die Hälfte der Schiffszieher verstarb bereits nach wenigen Monaten. Die Arbeit war furchtbar zehrend, immer wieder wurden Männer von der Strömung mitgerissen und am Friedhof der Namenlosen angeschwemmt. Das Schiffsziehen war eine Strafe, abschreckender als der Tod.
«Ich werde dich noch heute Abend meinem alten Freund Abbé Bruck übergeben, Joseph. Ich vertraue ihm, er war mein Schulkamerad. Er wird sich um dich kümmern», sagte sein Vater und versuchte zu lächeln.
Zillen mit Waren aller Art zogen an ihnen flussabwärts vorbei. Nach Wien, Pressburg, Pest oder Buda.
«Wann darf ich nach Hause kommen?», fragte Joseph. «Erst in den Ferien?»
«Nein, du wirst auch die Ferien hierbleiben, Joseph. Alle Sprachknaben bleiben in der Akademie.»
«Wie lang wird meine Ausbildung dauern, Vater?»
Sein Vater blieb stehen. «Neun Jahre.»
Joseph sah ihn starr an. Er war dreizehn Jahre alt.
«Du wirst den Orient sehen, Joseph. Orte, die ich nur aus Büchern kenne. Und Orte, die ich nicht einmal aus Büchern kenne.»
Joseph begann zu weinen. Während die Adern den Schiffsziehern aus dem Schädel zu platzen schienen, rannen ihm die Tränen die Wangen hinunter. Sein Vater nahm ihn in den Arm.
«Bis hierher», sagte sein Vater, «reicht das Wachstum meiner glücklichen Tage. Aber du», und er zeigte mit der Hand nach Osten, «wirst dort an glücklichen Tagen reich sein. Das wünsche ich dir, mein Sohn.»
Zum Barbarastift musste er durch die ganze Stadt laufen. Wien war innerhalb der Bastei auch schon so früh am Tag in Staub eingehüllt wie ehemals Ägypten in seine Finsternis. Seine Füße versanken im Boden, der infolge einer riesigen Ansammlung von Scheiße und der verfaulten Rückstände von Aas und Leichen halber wie Brei, fast flüssig wirkte. Teile der Straßen waren Sumpf. Vor der «Blauen Kugel» sah Joseph geschorene Gefangene in Gruppen im dunkelflimmernden Laternenlicht stehen. Der Anblick war ihm vertraut. Wann immer man davon ausging, dass der Kaiser die Gasse durchqueren werde, wurden Gefangene aus ihren Zellen geholt, um den Straßenmoder auszukehren und zu kleinen Häufchen nahe den Rinnsteinen zu schichten. Ein grauenhafter Geruch machte sich breit. Pferdeäpfel, Hundehaufen, menschliche Exkremente. Jetzt befehligte man die Gefangenen in Reih und Glied an die stinkenden Haufen, um den Geruch aufzuriechen. Auf Order hatten sie die Nasenflügel weit und rhythmisch zu öffnen und zu schließen. So erhoffte sich der Stadtphysiker eine Wegriechung der übelsten Belästigung zugunsten der kaiserlichen Nase. Mit ihren Ketten machten die Gefangenen dazu eine Musik, als wären sie ein menschliches Glockenspiel, fand Joseph. Ein Glockenspiel aus Verbrechern und Betrügern, aus Bettlern und Vagabunden. Gesichter, denen man die Lunglsucht ansah. Augen, die sagten: Schau mich an, wie ich hier rieche für die feinen Herrn, bald holt mich der Schleimschlag, und alles wird stinken wie zuvor.
Einigen der Gefangenen fehlten Hände, Ohren und Zungen. Für sie war die Abschaffung der Verstümmelungsstrafen zu spät gekommen. Joseph hatte es noch gesehen, wie einem Wilderer auf offener Bühne die Augen ausgestochen worden waren, kurz nachdem er in der Präparandenschule begonnen hatte. Der Wilderer hatte in Lainz gejagt und war gefasst worden. Der Teufel, der Angstmann, der Knüpfauf, Hämmerlein, Meister Hans – es gab so viele Namen für den Henker. Er hatte dem dünnen, kleinen Mann die Augen ausgestochen und die Finger abgehauen. Bei jedem der beiden Augen und jedem einzelnen Finger jubelte die Menge. Die Fingerglieder hatte der Henker direkt nach der Vollstreckung des Urteils an Zuschauer verkauft. Trug man so ein Fingerglied eines Verurteilten bei sich, war man vor Ungeziefer geschützt. Bewahrte man es im Geldbeutel auf, ging das Geld nie aus.
Bei Hinrichtungen war das Hirn des Delinquenten begehrt, galt es doch als Medizin gegen Tollwut, die Haut des Verbrechers half gegen Gicht, die Schamhaare, in einem Tuch um den Unterleib getragen, erfüllten Kinderwünsche, das frische Blut von Geköpften half Epileptikern. Die Henker verdienten gut an ihren Opfern und waren nicht erfreut von der Abschaffung der Todesstrafe. Josef II. hatte in ihnen erbitterte Feinde gefunden, und auch das Verbot der Verstümmelungen machte die Teufelsmänner nicht glücklich. Nach der Vollstreckung solch einer Strafe war es ihre Aufgabe gewesen, die Wunden der Verstümmelten zu verbinden. Da konnte man gut Blut sammeln und Knochensplitter für den späteren Verkauf. Damit war es jetzt vorbei dank dem Kaiser, der Voltaire gelesen und sich an dem Preußenkönig ein Vorbild genommen hatte. Er war kein Hokuspokuskaiser.
Einmal nur hatte Joseph den Herrscher gesehen. Alleine in einer prachtvollen Kutsche, begleitet von Reitern und Läufern, melancholisch aus dem Fenster blickend. Vielleicht dachte er voller Abscheu an seine zweite Frau, Kaiserin Maria Josepha, die so legendär hässlich war. Mit fauligen Zähnen in einem aufgedunsenen Gesicht. Kein Wunder, dass der Kaiser auf getrennten Zimmern in Schönbrunn bestand und sogar den gemeinsamen Balkon im Schloss abteilen ließ, um nicht einmal dort seine Frau sehen zu müssen. Als sie vor zwanzig Jahren an Pocken gestorben war, war er sogar ihrem Begräbnis ferngeblieben.
Inzwischen wohnte Joseph II. in einem einfachen Haus im Augarten. Die Hofburg und Schloss Schönbrunn mied er. «Was soll mein Hof? Parasiten mästen?» Diesen Satz kannte jeder Wiener, aber beliebt war der Kaiser trotzdem nicht. Weil er sich in alles einmischte. Er legte die Zahl der Kerzen fest, die bei Messen anzuzünden seien, er verbot Pfeffernüsse, weil er sie für gesundheitsschädlich hielt, er ließ das mutwillige Schreien und Händeklatschen auf der Gasse verbieten und den Sparsarg hatte er verpflichtend eingeführt, das war einer mit Falltüre, ein Josephinischer Gemeindesarg. Das fanden viele pietätlos. Ja, er hatte das Allgemeine Krankenhaus bauen lassen, das modernste Krankenhaus der Welt, und ja, er setzte sich für die Verbesserung der Lebensverhältnisse arbeitender Kinder ein, er hatte Schulen einrichten lassen, Waisen- und Armenhäuser gegründet, eine Grundsteuer für den verblüfften Adel erhoben, die Religionsfreiheit eingeführt, aber die Pfeffernüsse wogen schwerer. Die Wiener liebten Pfeffernüsse und deshalb ihren Kaiser nicht. Außerdem vermissten viele das Spektakel der öffentlichen Hinrichtungen. Es gab zwar noch die Züchtigungen vor Publikum, mit Schlägen auf das Gesäß, bei Männern 50 Hiebe mit dem Haselnussstock, bei Frauen 30 mit dem Ochsenziemer, und es gab die Ausstellung auf der Schandbühne, mit entblößtem Haupt und einer Tafel um den Hals, auf der das politische Verbrechen des Delinquenten zu lesen war für den, der lesen konnte. Aber das war nicht dasselbe wie eine Enthauptung oder der Strick für arme Sünder. Damals waren das Volksfeste gewesen, richtige Ereignisse. Die Schandbühne dauerte gerade mal eine Stunde zur Mittagszeit, und viel geschehen tat auch nicht. Ein bewachter Mensch, in Eisen geschlossen mit einer Tafel. Das war kein gleichwertiger Ersatz für die vergnügungssüchtigen Wiener. Nicht einmal Bordelle erlaubte der tugendliebende Monarch seinen Untergebenen, obwohl er doch selbst Hurenhausbesucher war, wie jedermann wusste. Hatte es nicht den Vorfall am Spittelberg gegeben, von dem die ganze Stadt sprach? Als die Spittelbergnymphe Sonnenfels-Waberl ihn in hohem Bogen aus dem Haus Nr. 13 in der Gutenberggasse geworfen hatte, weil der Kaiser zu wenig zahlen wollte? Das hatte auch Joseph gehört, aber der Kaiser hatte sich der Errichtung von Freudenhäusern dennoch widersetzt.
«Was, Bordelle? Da brauch ich über ganz Wien nur ein großes Dach machen z’lassen», soll Joseph II. ausgerufen haben. Und jetzt hatte er Tuberkulose, die er sich auf einer seiner vielen Reisen zugezogen hatte, und alle warteten nur auf die Nachricht seines Todes. Aber dass der Kaiser auf seinen Reisen incognito als Graf von Falkenstein gereist war, gefiel Joseph. Das klang nach Abenteuer. Und dass er schon wieder einen Krieg gegen die Türken führte, zusammen mit der Moskowiterin, das war aufregend für die Sprachknaben an der Orientalischen Akademie. Sie lernten die Sprache des Feindes und fühlten sich deshalb einer Mission verpflichtet.
«Wer will, wer mag, um ein Kreuzer in mei Butten scheißen?»
Das Buttenweib von St. Anna hatte eine hohe, schrille Stimme. Zwei Kübel hingen an einem Joch über ihrer Schulter. Links pisste man, rechts schiss man in die Kübel hinein. Sie trug einen weiten, schwarzen Umhang, unter dem man, vor neugierigen Blicken geschützt, seine Notdurft verrichten konnte. Joseph kannte viele von diesen Madames Toilette, die meisten waren maskiert, aber Margarete, die Abtrittanbieterin von St. Anna, nicht.
«Wieso sollt ich mich verstecken? Versteckt der Salamutschi sein Gesicht? Ist der Salamutschi was Bessres als ich? Ich frag dich, junger Herr. Er verkauft den Leuten die Würste, ich sammle sie wieder ein», hatte sie Joseph erklärt, als er in völliger Schwärze pinkelte und seiner Nase den Befehl gab, sich tot zu stellen. Nicht nur aus den Kübeln roch es fürchterlich, auch die alte Frau stank, wie die offene Gruft von St. Stephan, nach Verwesung und Tod. Als strömten Miasmen aus all ihren Poren. Sie hatte nur ein Auge, und die Narbe, aus der wildes Fleisch wuchs, sah aus, als hätte sie sich das andere selbst ausgekratzt. Er spornte seine Blase zur Eile, während sie den bekannten Kaufruf des Salamutschi nachäffte. «Durri, Durri, Do bin i, Salamutschi!» Die Salamutschi waren Lombarden, Friauler oder Venezianer und gingen mit ihren Körben voller Wurst und Käse durch Wien.
Ein einziges Mal nur hatte er sich unter ihren schwarzen Umhang gestellt, in den Notwinkel, zu einem Mann, der den anderen Kübel benutzte und offenbar unter Qualen seine Därme leerte.
«Halt das Maul», hatte der Mann in einem fremden Akzent gesagt. «Kann man wenigstens beim Scheißen seine Ruhe haben?» Es war düster, durch einen Schlitz fiel nur wenig Tageslicht unter den schwarzen, modrigen Umhang. Die Luft war zentnerschwer.
«Der Kübel geht fast über», brummte der Mann und stieß Joseph einen Ellbogen in die Rippen.
«In der Dunkelheit der Fäulnis. Im Arsche Satans», dachte Joseph, und wie so oft wünschte er sich, die Nase verschließen zu können. Mit Lavendelzweigen oder Weihrauch, den man zusammen mit Wacholderholz den großen Scheiterhaufen beimengte, die überall in der Stadt gegen die üblen Gerüche entzündet wurden. Man müsste die ganze Stadt abfackeln, dachte er. Die Basteien schleifen und alles verbrennen, was die Luft verpestet. Und endlich die wirksame Mixtur aus antimefitischen Stoffen finden, nach der die Chemiker seit langem suchten. Um die Stadt von ihrem schädlichen Geruch zu befreien. Man hatte es mit Karbolsäure und Eisenvitriol versucht, mit schwefelsaurem Kalk. Mischungen aus Torf, Steinkohlengrus, schwerem Gasteer und allerlei Abfällen seien direkt in die Aborte, Senkgruben und Kanäle zu leeren, worauf die Fäkalmassen sich augenblicklich verfestigten und geruchlos blieben. So hieß es, aber ein Unterschied war nicht zu riechen. Nichts wurde besser.
«Scheiß dich zu einem Ende, Darmsaitenmacher», rief die einäugige Madame Toilette, und Joseph musste unter dem modrigen Umhang würgen. Darmsaitenmacher? Neben ihm entleerte sich ein Darmsaitenmacher? Von denen, das hatte man ihm eingebläut, musste man sich fernhalten, wollte man nicht seinem Körper Schlimmes antun. Von den Färbern, den Gerbern, zu denen das Buttenweib um ein paar Kreuzer die Pisse trug. Den Miststirlern und Lumpensammlern, den Abdeckern und Totengräbern. All den Kumpanen des Gestanks. Was schiss der Mann hier neben ihm mitten in der Stadt? Wozu hatte man diese Leute an den Rand der Stadt verbannt, wenn sie dann doch herkamen, um sich neben ehrbaren Sprachknaben zu entleeren? Joseph wusste, dass die schlechte Luft direkt in den Körper eindringt. Die Luft ist eine bedrohliche Brühe, in der sich alles Böse mischt. Rauch, Schwefel, wasserhaltige, flüchtige, ölige und salzige Dämpfe, die von der Erde aufsteigen, ja auch die feurigen Materien, die unser Boden ausspuckt, die aus den Sümpfen kommenden Dünste sowie winzige Insekten, deren Eier, allerhand Aufgusstierchen und schlimmer noch, am allerschlimmsten und verderblichsten die ansteckenden Miasmen der verwesenden Körper. Und was, wenn der dauernde Kampf in den Eingeweiden des Menschen zugunsten der Fäulnis ausgeht? Dann sind Krankheit und Tod die Folge. Der Gestank ist die Bewegung vom Tod zum Tod, während die aromatischen Wohlgerüche, das wusste jedes Kind, eine Stärkung der Lebenskräfte bewirken. Doch statt Weihrauch vor der Nase hatte er einen sich entleerenden Darmsaitenmacher an der Seite, aus dem der Tod in den Kübel fiel, der überging. Krötengroße Keime, denen Josephs Nase schutzlos ausgeliefert war. Wie der Boden sondert auch die Haut, vor allem aber die Kleidung des Arbeiters faulige Säfte ab. Wie oft hatte man ihn gewarnt. Die Quellen des Gestanks vermeiden. Ja, schon. Aber wie? Die Nase war ein Warnorgan. Nur mit ihrer Hilfe konnten die in der Atmosphäre lauernden unheilvollen Gase gerochen und damit vermieden werden. Aber wie hätte er unter dem nach Salpeter und faulem Obst stinkenden Umhang einen Darmsaitenmacher erriechen sollen? Die Augen waren ihm da, an diesem finsteren Ort, keine Hilfe. Die miasmatische Infektion lauerte überall. Cholera, Scharlach, Typhus. Diarrhö, Keuchhusten. Einmal war er in Eile nahe St. Stephan in einen Totengräber gelaufen. Am helllichten Tag. Jeder wusste, dass man Totengräber nicht berühren darf. Nächtelang hatte Joseph schlecht geträumt, er sah sich schon tot.
Der Sonnenkönig hatte es gesagt, und er hatte recht: «In der ganzen Natur ist nichts Schreckbareres zu sehen, nichts Schaudernderes zu riechen, das mit einem in Faulung zerfließenden Menschenkörper in Vergleich gezogen werden könnte!»
Rund um die Kirchen war es am schlimmsten. Die Grüfte waren mangelhaft verschlossen, die Erdgräber zu seicht ausgehoben, und die toten Leiber wurden zu spät begraben und zu früh exhumiert. Ständig wurden die Fäulnisse erneuert durch die frisch eintreffenden Leichen, und immerwährend beförderte man die Ausdünstungen durch das Umgraben der verpesteten Erde. Dadurch wurden ganze Nachbarschaften um die Kirchhöfe fiebersüchtig. Die Sterblichkeit war in Wien weit höher als in Paris oder London. Jeder Physiker musste die im Herzen der Stadt liegenden Friedhöfe und Grüfte von St. Stephan, St. Michael, bei den Schotten, den Augustinern und an der Freyung als heimliches Gift und Zunder jeglicher ansteckenden Krankheit betrachten. Als ständige Bedrohung. Der Totengräber, in den Joseph gelaufen war, war sicher schon tot. Totengräber wurden nie alt, weil sie ja in dieser Wolke des Todes lebten.
«Niemand», hatte der Sonnenkönig seinen Schülern krächzend geklagt, «der zur Sommerzeit in St. Stephan gegangen ist, der nicht den offenen Totengeruch und ekelhaften, müchelnden, räßen Gestank mit Widerwillen und Erschütterung empfunden und gewittert hätte.»
Wie gut, dass man langsam daran ging, Friedhöfe außerhalb des Linienwalls anzulegen. In St. Marx, Matzleinsdorf, Währing und am Hundsturm.
Joseph glaubte, es reiße ihm unter dem Umhang den Magen heraus. Wasser trat ihm in die Augen, die Beine zitterten. Er feuerte seine Blase an, sich endlich ganz zu entleeren. Finalement! Rasch zog er sich das Beinkleid hoch und trat ins Freie.
Das elendste türkische Landstädtchen besaß bei jeder Moschee Anstandsorte, hatte er in der Orientalischen Akademie gelernt. Und in der Hauptstadt der Monarchie? Des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation? Gab’s Pissstände in den Gasthäusern und Butten. Den Darmsaitenmacher hörte er unter dem Umhang stöhnen, und das Buttenweib rief schon wieder ihr Wer will, wer mag, um ein Kreuzer in mei Butten scheißen?
So wie Liselotte von der Pfalz beeindruckt war von den Kackstühlen in Versailles, so andächtig sprach der Professor Chabert, der einem kränklichen Fleckenziesel wie aus dem putzigen Gesicht geschnitten war, von der Reinlichkeit des Orients. Welches Leuchten da in seine Augen trat.
«Fünfmal am Tag gibt es die religiöse Waschung der Hände, Füße, Arme, Beine, des Kopfes und Halses, meine Herren», sagte der Sonnenkönig. Weil er keine Zähne hatte, sprach er schwer verständlich, trotzdem hingen die Sprachknaben an seinen Lippen. Leider hatte Professor Chabert in seiner Zeit in Frankreich einen Schüler des Arztes von Ludwig XIV. als Zahnarzt gehabt, der, wie sein großer Lehrmeister Dr. Daquin, der Meinung war, es gebe für den Körper keinen gefährlicheren Infektionsherd als die Zähne. Deshalb, so auch die gängige Meinung an der Sorbonne, solle man alle Zähne ziehen, solange sie noch gesund sind. So hatte man es damals beim echten Sonnenkönig gehalten, und der Sonnenkönig der Wiener Orientalisten war eines der letzten Opfer dieser zahnmedizinischen Schule. Leider verlief die Operation wie beim französischen Monarchen. Beim Ziehen der unteren Zähne brach der Kiefer, beim Ziehen der oberen Zähne wurde ein Teil des Gaumens mit herausgerissen. Der Unterkiefer wuchs nach einiger Zeit wieder zusammen, aber der herausgerissene Gaumen war natürlich nicht zu ersetzen. Zur Desinfektion brannte der Schüler von Dr. Daquin das Loch im Gaumen vierzehn Mal mit einem glühenden Eisenstab aus. Wenn Professor Chabert etwas trank, sprudelte ihm ein Teil des Getränkes gleich wieder aus der Nase. Aber, schlimmer noch, in der offenen Tropfsteinhöhle, mit der sich sein Mund zur Nase öffnete, setzten sich ständig größere Brocken fester Nahrung auf so komplizierte Weise fest, dass sie sich erst nach Wochen durch die Nase auflösten, was mit einem fürchterlichen Gestank verbunden war. Weil Chabert die Nahrung unzerkaut schlucken musste, litt er unter Blähungen und übergab sich mehrmals am Tag. Aber er war Josephs Lieblingslehrer, denn trotz seiner Behinderung am Artikulationsapparat war er von allen Lehrern der Akademie der einzige, der Türkisch, Arabisch und Persisch so sprach, wie die Sprachen auch wirklich klangen. Direktor Hoeck, der Lehrer der ersten Jahre, vermochte kein einziges Wort der zu erlernenden Sprachen richtig zu artikulieren. Hoeck war Innsbrucker, sein Arabisch klang wie krachendes Tirolerisch. Als der Sonnenkönig die ersten Worte Arabisch sprach, war es nach den holprigen Versuchen Hoecks wie ein akustisches Feuerwerk.
Studieren heißt auf Arabisch darasa, was auf Deutsch dreschen bedeutet. Professor Chabert, der Sonnenkönig, brauchte keine Schläge, um seine Sprachknaben zu erziehen. Die jungen Schüler hatten Angst vor ihm und starrten auf all das, was während der Stunden aus seiner Nase drängte, die Älteren waren fasziniert von seinem Wissen und seiner Liebe für den Orient, den er seinen Schülern vermittelte.
«Vor jeder Mahlzeit tauchen die Menschen dort die Finger in Wasser, und nach dem Essen geschieht eine reichliche Reinigung, aber nicht, indem man seine Hände in schmutzigem Wasser in einem Becken plätschert, sondern indem reines Wasser aus einem Gefäß über die Hände in ein weites Becken gegossen wird.»
Einige Schüler verzogen den Mund vor Ekel. Immer noch hielt sich hartnäckig der Glaube, im Wasser läge die Ursache für die Pest. Viele Wiener vermieden deshalb jeden Kontakt damit.
«Wenn ich meine Hände im Donaukanal oder im Wienfluss wasche, liege ich schon kurz darauf unter St. Stefan», sagte Franz Maria von Thugut.
«Im Orient ist Reinlichkeit ein Glaubensartikel. Die leiseste Unreinheit drückt das Gewissen, weil sie die Nerven aufregt. Das Wasser selbst muss völlig rein sein und darf, wenn es den Menschen einmal berührt hat, ihn nicht wieder berühren. Neben ihren Häusern sind zahlreiche Brunnen, aus denen ein Wasserstrom über ein Marmorbecken zum Waschen genutzt werden kann. Sie waschen sich nicht in stinkenden Kanälen voller Unrat, Thugut!» Aus Chaberts Nasenlöchern lugten drohend Essensrückstände.
«An den Moscheen und in den Gassen und Gängen sind zahlreiche Wasserhähne niedrig angebracht, mit einer Marmorstufe davor, um den Menschen die Möglichkeit zu verschaffen, sich am ganzen Körper zu waschen. Hat man sich einmal an ihre Weise gewöhnt, so hat die unsrige etwas ganz Widerliches an sich, und man kann leicht den Ekel begreifen, den ein Reisender aus dem Abendland zuweilen unbewusst beim Orientalen erregt.» Chabert begann zu würgen und übergab sich in den Holzkübel, der neben seinem Pult stand. Er wischte sich mit einem Tuch, das er immer in seinem Ärmel bei sich trug, über den Mund und fuhr fort.
«Der beständige Gebrauch von Seife und Wasser wird für die Sauberkeit der Menschen zeugen, und doch bekommt man im Morgenland über das Waschen hinaus einen Begriff von Reinlichkeit, wenn man nämlich drei oder vier Stunden im Dampfbad zugebracht hat. Das verlässt man mit dem Gefühl so vollkommener Sauberkeit, dass es unmöglich erscheint, irgendetwas könne einen je wieder beschmutzen.»
Für Joseph, der unter den unwürdigen Wohnverhältnissen der unreinlichen Peiserböcks sehr litt, klangen Chaberts Ausführungen wie ein Traum. Er schlief im Bett des toten Sohnes; nachts sah er dessen Schatten an der schmutzigen Wand. Wenn er die Kerze anzündete, waren es doch nur feuchte Flecken. Frau Peiserböck kehrte den Schmutz von einer Ecke in die andere, und wenn Joseph am Staub und am Rauch des Herdfeuers zu ersticken drohte und ein Fenster öffnete, drang eine furchtbare Geruchswolke von der engen Gasse in seine Kammer. Bald würde er endlich in die Akademie ziehen, weg von den Bauerntölpeln, unter deren Dach er zu verwelken drohte. Wie anders wohl der Orient roch? Luftig, leicht und klar und rein.
«Eine sehr wesentliche, zur Sauberkeit beitragende Gewohnheit ist auch die, dass man Stiefel, Schuhe und Pantoffeln an der Tür lässt und herinnen lederne Halbstiefel ohne dicke