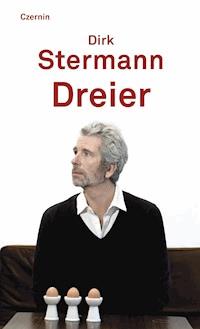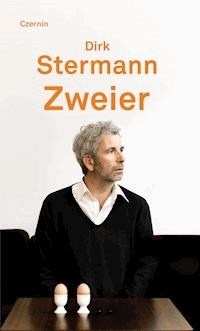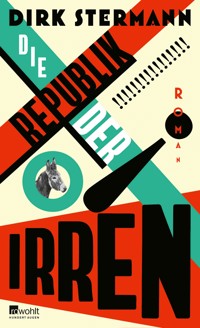Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BONNEVOICE Hörbuchverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Fast ihr ganzes Leben hat Erika Freeman in New York verbracht, dann sitzt sie eines Abends in der Talkshow von Dirk Stermann, «Guten Abend, Österreich», und verzaubert ihren Gastgeber und die Nation. Im hohen Alter lebt sie wieder in ihrer Heimatstadt Wien, jeden Mittwoch kommt Dirk sie nun besuchen, um sich mit ihr bei Kipferln und Melange über Gott und die Welt und über ihr faszinierendes Leben zu unterhalten. Geboren 1927, ist Erika mit 12 Jahren vor den Nazis nach New York geflohen. Sie wächst in einem Waisenhaus auf, hat Anteil an der Gründung Israels und wird nach dem Studium Psychoanalytikerin; ganz auf sich gestellt, ihre Mutter hat den Krieg nicht überlebt. Ihr Vater, vermeintlich im KZ gestorben, glaubt seinerseits, als Einziger der Familie überlebt zu haben, bis er mitten auf dem Broadway seinen Bruder trifft. Als Therapeutin ist Erika bald eine Berühmtheit, die Riege ihrer Patienten reicht von Brando bis Monroe. Nun, mit 95, ist sie wieder Österreicherin geworden, residiert im berühmten Hotel Imperial, wo einst Hitler nächtigte, und wenn man sie fragt, wie es ihr geht, sagt sie: «Gut. Wenn nicht heute, dann morgen.»
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dirk Stermann
«Mir geht's gut, wenn nicht heute, dann morgen.»
Über dieses Buch
Fast ihr ganzes Leben hat Erika Freeman in New York verbracht, dann sitzt sie eines Abends in der Talkshow von Dirk Stermann, «Willkommen Österreich», und verzaubert ihren Gastgeber und die Nation. Im hohen Alter lebt sie wieder in ihrer Heimatstadt Wien, jeden Mittwoch kommt Dirk sie nun besuchen, um sich mit ihr bei Kipferln und Melange über Gott und die Welt und über ihr faszinierendes Leben zu unterhalten.
Geboren 1927, ist Erika mit 12 Jahren vor den Nazis nach New York geflohen. Sie wächst in einem Waisenhaus auf, hat Anteil an der Gründung Israels und wird nach dem Studium Psychoanalytikerin; ganz auf sich gestellt, ihre Mutter hat den Krieg nicht überlebt. Ihr Vater, vermeintlich im KZ gestorben, glaubt seinerseits, als Einziger der Familie überlebt zu haben, bis er mitten auf dem Broadway seinen Bruder trifft. Als Therapeutin ist Erika bald eine Berühmtheit, die Riege ihrer Patienten reicht von Brando bis Monroe. Nun, mit 95, ist sie wieder Österreicherin geworden, residiert im berühmten Hotel Imperial, wo einst Hitler nächtigte, und wenn man sie fragt, wie es ihr geht, sagt sie: «Gut. Wenn nicht heute, dann morgen.»
Vita
Dirk Stermann, geboren 1965 in Duisburg, lebt seit 1987 in Wien. Er zählt zu den populärsten Kabarettisten und Fernsehmoderatoren Österreichs und ist auch in Deutschland durch Fernseh- und Radioshows sowie durch Bühnenauftritte und Kinofilme weit bekannt. 2016 erschien sein Roman Der Junge bekommt das Gute zuletzt, und NDR Kultur urteilte: «Ein lustiger deutscher Medienstar, der als österreichischer Romancier sehr ernst genommen werden sollte.» 2019 folgte Der Hammer und 2022 Maksym.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, November 2023
Copyright © 2023 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Covergestaltung Anzinger und Rasp, München
Coverabbildung Petra Wöhrmann/Kombinatrotweiss
Fotos auf Vor- und Nachsatz sowie Seite 6 und 53 © Ingo Pertrame
ISBN 978-3-644-01768-9
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Erika
It matters not how strait the gate,
How charged with punishments the scroll,
I am the master of my fate,
I am the captain of my soul.
Invictus, William Ernest Henley
EinsMittwochs Erika
Hillary Clinton lacht. Sie sitzen bei einer Gala in New York nebeneinander. Erika trägt wie Hillary ein Abendkleid. Beide haben großartige Laune. Erika beugt sich hinüber und sagt etwas. Hillary beginnt zu wiehern.
«Was hast du denn da zu ihr gesagt», frage ich.
«Siehst du meinen Orden?»
Ich nicke. Bei uns im Studio trägt Erika an ihrem roten Kleid einen goldenen Orden.
«Das österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst. Hillary fragte mich, was das ist, und ich sagte ihr: They tried to kill me, now they decorate me!»
Jetzt lacht auch das Studiopublikum.
Franz Schubert hatte recht gehabt. Er hatte mir als Erster von Erika erzählt. Sie sei Wienerin, als Kind allein vor den Nazis nach New York geflohen und viele Jahre später die Psychoanalytikerin der Hollywoodstars geworden. Eine fantastische Frau, sagte Franz. Sie lebt jetzt wieder in Wien. Wollt ihr sie nicht in die Fernsehshow einladen?
Davor hatten wir über Stefan Troller gesprochen, den 1921 in Wien geborenen Schriftsteller, Journalisten und Dokumentarfilmer, zu dessen hundertstem Geburtstag ein toller Dokumentarfilm gemacht worden war. Der Film lief gerade in Wien.
Interviews hatte Troller gern als «Menschenfresserei, die vom warmen Blut ihrer Opfer lebt», bezeichnet. Er war aus Wien vor den Nazis geflohen, nach Paris und Amerika und später wieder zurück nach Paris. Nach der Filmpremiere waren alle ins Café Korb gekommen, wo Franz als Impresario arbeitet. Franz bat den Hundertjährigen darum, ein Filmplakat für das Café zu signieren. Gern, sagte Troller und tat es auch. Später las Franz, was der ehrwürdige Greis auf das Plakat geschrieben hatte: «Wo bleibt eigentlich meine Frittatensuppe, die ich vor einer halben Stunde bestellt habe?»
Troller war für den Film mit dem Kamerateam in die alte Wohnung seiner Familie gegangen. In der Wohnung lebt heute ein älteres Ehepaar. Troller ging durch die Wohnung, und dann fiel ihm der große Bücherschrank im Wohnzimmer auf.
«So einen Schrank hatten wir auch», sagte er. Das Ehepaar wurde unruhig und erklärte, den Schrank habe man nach dem Krieg gekauft, es könne also nicht der Schrank der Trollers sein.
Troller nickte und flüsterte dann der Regisseurin zu: «Da steht sogar noch das Buch im Regal, das ich zu meiner Bar Mizwa geschenkt bekommen habe.»
«Wien, das fidele Grab an der Donau, dessen Bewohner allein sein wollen, aber dafür Gesellschaft brauchen», zitierte Franz Alfred Polgar, und ich sah mich im Kaffeehaus um.
«Mag Troller Wien noch?», fragte ich.
«Paris mag er mehr», antwortete Franz. «Die Frittatensuppe kam dann aber gleich, nachdem er’s aufs Plakat geschrieben hat.»
«Gut», sagte ich. «Ich mag es, wenn Wiener Emigranten gut behandelt werden, wenn sie in die Stadt zurückkehren.»
Billy Wilder, Lotte Lenya, Arnold Schönberg, Hedy Lamarr, Carl Djerassi, der Vater der Antibabypille, Sigmund Freud, Kurt Gödel, Otto Preminger, Max Reinhardt, Theodor Reik, Franz Werfel, Paul Wittgenstein, Fritz Lang, Friedrich Torberg, der Filmproduzent Eric Pleskow und Tausende andere. Sie kamen aus Wien und wurden vertrieben.
«Pleskow war auch einmal als Gast in meiner Sendung», sagte ich.
«Wie viele Oscars hat er gewonnen?», fragte Franz.
«Vierzehn. West Side Story, Amadeus, Einer flog übers Kuckucksnest, Das Schweigen der Lämmer, Rocky, Der Stadtneurotiker, Der letzte Tango von Paris.»
«Eine Legende.»
«Ja, eine Legende. Er sprach sehr leise. Als ich ihn vor der Sendung begrüßte, sagte er, er wisse nicht, warum ich ihn eingeladen habe. Nach der Sendung sagte er, jetzt wisse er es.»
«Ich hab die Sendung gesehen. Er war großartig.»
«Er liebte Alkohol, Zigaretten und Innereien und wurde trotzdem so alt.»
«Alle Wiener lieben Alkohol, Zigaretten und Innereien.»
«Er hat sogar während der Sendung geraucht.»
«Pleskow und Helmut Schmidt waren die Einzigen, die das durften. Als Helmut Schmidt starb, fand man in seinem Keller 5000 Stangen Mentholzigaretten, wusstest du das?»
In der Sendung hatten wir ein Video mit Grußbotschaften an ihn gezeigt. Jody Foster, Kevin Costner, Woody Allen, Anthony Hopkins. Ein Hauch von Hollywood in unserer kleinen Nacht-und-Nebel-Show.
«Jody Foster hat zu meiner Frau gesagt, ich nehme ihn mit zur Oscarverleihung. Und meine Frau sagte, du kannst ihn behalten.» Großes Gelächter. Die Zuschauer hatten ihn geliebt. Weil er leise sprach, hatten wir das Publikum gebeten, während des Gesprächs mit ihm sehr ruhig zu sein. Er saß da in der Stille, rauchte, lächelte und bezauberte.
«Mit alten Emigranten haben wir immer gute Erfahrungen gemacht. Wie alt ist diese Erika Freeman?»
«92», sagte Franz. «Aber du wirst sehen, sie ist im Kopf jünger als wir!»
Erika ist klein, aber ihre blonden Haare leuchten im Scheinwerferlicht. Sie trägt einen roten Pullover, eine rote Jacke. Das goldene Ehrenkreuz um den Hals.
«Ihr habt eine sehr empfindliche Seele», sagt sie.
«Wer, wir Schauspieler?», fragt mein Kollege.
«Nein», sage ich. «Sie meint Marlon Brando und mich.»
«Marlon Brando war ja sexuell sehr aktiv», wirft mein Kollege ein.
«Nicht mit mir», sagt Erika, und das Publikum lacht. «Interessant war, dass er niemals mit einer weißen Frau schlafen konnte. Das war der Schutz vor dem Wunsch, mit der eigenen Mutter zu schlafen.»
«Darfst du uns das erzählen, weil er tot ist?», frage ich.
«Nein. Weil das bekannt ist. Geheimnisse würde ich nicht erzählen. Auch nicht über Tote.»
Man merkt, dass sie es gewohnt ist, im Scheinwerferlicht zu stehen. In Amerika war sie in vielen Shows zu Gast. Sie spielt mit der Kamera, mit den Zuschauern.
«Wie würdest du als Psychoanalytikerin Donald Trump einordnen», frage ich.
«Ein armer Mensch. Sein Vater mochte ihn nicht, und seine Mutter sagte mir einmal, sie hoffe, ihr nichtsnutziger Sohn würde niemals in die Politik gehen.»
«Seine eigene Mutter?»
«Ja, sie kannte ihn wohl am besten. Ich saß einmal bei einem Abendessen am Nebentisch von Donald Trump. Und ich habe gesehen, dass er einen Fettsteiß hat.»
Ich blicke sie fragend an.
«Ein Po, auf dem man Gläser abstellen kann. Sein Sakko hat hinten zwei Schlitze, damit alles hineinpasst.»
«Und deswegen ist er so, wie er ist? Weil er einen sehr dicken Po hat?»
«Nein, nicht nur. Ein Vater, der ihn nicht mag, eine Mutter, die ihn für einen Nichtsnutz hält, und ein Gesäß, auf das man Dinge stellen kann. Ich war an dem Abend mit Barbra bei dem Essen, und sie wollte gleich einen Teller auf Trumps Po stellen.»
«Welche Barbra?»
«Streisand.»
«Du kennst Barbra Streisand?»
«Natürlich. Sie hat ja meine Mutter gespielt.»
«Barbra Streisand hat deine Mutter gespielt?»
«Ja, in ‹Yentl›. Kennst du den?»
Am Mittwoch nach der Sendung rief Franz an und fragte, ob ich Zeit hätte, ins Café Korb zu kommen. Erika sei da und würde mich gerne wiedersehen. Tagesfreizeit ist mein Hobby; ich sagte zu.
Ich zog mich an und ging zu Fuß von der Berggasse zur Brandstätte, vorbei an der Strickemanufaktur, die Seile für Segler herstellt und im Schaufenster mit dem Spruch wirbt: «Stricke – Körper und Seele baumeln lassen». Ein sehr wienerisches Plakat.
Vorbei an dem historischen Werbeschild des Apothekers Jul. Trnkóczy für seine Linderung der Atemnot versprechenden Asthmazigaretten.
Im gut gefüllten Café Korb sah ich mich um. An der Wand hing das Plakat mit der Frittatensuppen-Nachfrage von Stefan Troller, und hinter einem der Tische entdeckte ich Erika.
Sie trank einen kleinen Braunen. Ich musste unweigerlich an den Witz denken, in dem ein Nazi im Kaffeehaus zum Kellner «Ein kleiner Brauner!» sagt, und der Kellner antwortet: «Das seh ich, aber was wollen Sie trinken?»
Ihre Tasse war bis an den Rand gefüllt. Ich setzte mich ihr gegenüber, vorsichtig , dass der Kaffee nicht überschwappte.
Sie strahlte mich an. «Wie schön, dass du Zeit hast!»
«Du hast schon gearbeitet?», fragte ich.
«Ja, eine Klientin aus New York. Sie ist seit Jahren bei mir.»
«Aber in New York ist es doch mitten in der Nacht!»
«Ihr Termin bei mir ist immer um 9. Und bei mir war es 9.»
«Bei ihr war es 3 Uhr in der Nacht!»
«Ja, aber es war eine gute Stunde.»
Sehr langsam führte sie die volle Tasse zum Mund. Ich erwartete, dass sie den Kaffee verschütten würde, aber die 93-Jährige trank und stellte die Tasse wieder ab, ohne dass ein Tropfen verschüttet wurde.
«Bei meinem Therapeuten hängt ein Comic aus dem New Yorker an der Wand», sagte ich. «‹Wir kommen auf die Welt, dekonstruieren unsere Kindheit und dann sterben wir.›»
Sie lachte.
«Ich find den Satz eher deprimierend», sagte ich und schlug unter dem Tisch meine Beine übereinander. Der Tisch wackelte, und neben ihrer Tasse bildete sich eine kleine Pfütze. «Oh, Pardon!» Ich wischte sie mit einer Serviette weg.
«Warum ist das deprimierend? Wir kommen auf die Welt, das ist doch schon mal sehr gut. Wir schauen, was in unserem Leben passiert, auch gut. Und wenn der Herrgott findet, dass wir genug angestellt haben, gehen wir.»
«Woody Allen hat irgendwo gesagt, dass er nach Jahrzehnten der Psychoanalyse jetzt damit aufgehört hat, weil es nichts gebracht hat.»
«Na ja, in der Zeit wurde er ein Star. Wird ihm die Psychoanalyse schon nicht geschadet haben.»
«Ich glaube, er ist der berühmteste Analysepatient der Welt. War er dein Patient?»
«Jeder Name, den ich erwähne, war kein Klient von mir.»
«Aber du hast ihn nicht erwähnt, ich war es.»
Erika lächelte verschmitzt. «Die Analyse hat ihn nicht verletzt, und das ist oft schon das Beste, das du für jemanden erhoffen kannst: wenn es nicht schlecht ist für dich.»
Sie jonglierte ihre Tasse zum Mund. Und wieder gelang das Kunststück. «Er wohnte auf der 5th Avenue und sie gegenüber von mir, Central Park West, in einem Gebäude, wo alle Stars wohnen. Sehr hübsch.»
«Wer wohnte dort? Seine Analytikerin?»
«Nein, die Mutter seines Sohnes.»
«Mia Farrow?»
«In Mias Haus lebte eine Kollegin von mir und ich war zu einer Party eingeladen, bei der Mia auch war. Als sie die Party verließ, bedankte sie sich bei mir, dass ich so freundlich zu ihr gewesen sei. Die anderen waren eifersüchtig oder bewunderten sie, jedenfalls verhielten sie sich nicht normal. Ich schon. Sie kommt aus einer berühmten Familie, schon ihre Mutter war ein Hollywoodstar, ihr Vater ein berühmter Regisseur. Mia war mit Frank Sinatra verheiratet, für ungefähr fünf Minuten. Sie war so lieb und höflich. Das sind sie alle. Schauspieler sind unsichere Menschen.»
«War sie auch Neurotikerin? Ich habe mein Manhattan-Bild von Woody Allen, also glaube ich, dass dort alle Neurotiker sind.»
«Verglichen mit dem Rest der Welt stimmt dein Bild. Aber Woody ist gar kein Neurotiker. Er war früher einer und er tritt wie einer auf. Aber er ist keiner, weil er unablässig arbeitet. Neurotiker können nicht arbeiten. Er ist jetzt ein offizieller Neurotiker, ohne einer zu sein. Very interesting! Wir sind uns das erste Mal auf einer Party bei Liv Ullmann begegnet.»
Partys bei Mia Farrow und Liv Ullmann. Ich überlegte, wer meine letzten Gastgeber waren. Eher weniger Hollywoodstars.
«Und ich erzählte den Leuten, dass Dominic Habsburg gerade auf der Durchreise nach Antigua sei und in meiner Wohnung auf der Couch schlafe», fuhr sie fort. «Dominic hat Glück. Seine Mutter war eine Schönheit und die Schwester des Königs von Rumänien. Also sieht er nicht aus wie die anderen Habsburger.»
«Der Glückliche», warf ich ein.
«Ja», sagte sie. «Die Habsburger waren not a schönes Volk. Also, er war bei mir in der Wohnung. Mein Mann fragte, warum ich so nervös sei, und ich erklärte ihm, ich sei ein kleines Flüchtlingskind aus Wien und nun schlafe ein Habsburger auf meiner Couch! Und als Woody die Party verließ, sagte er: Ich muss gehen, weil bei mir auch ein Habsburger auf der Couch liegt! Alle lachten. So ein lustiger, kleiner Kerl.»
«Ich möchte nicht durch meine Arbeit unsterblich werden. Ich möchte unsterblich werden, indem ich nicht sterbe», zitierte ich Woody Allen. «Ich möchte nicht in den Herzen meiner Landsleute weiterleben. Ich will in meinem Apartment weiterleben.»
Erika lachte. «Woodys Vater wurde 100. Juden sagen zum Geburtstag: Bis 120! Weil Moses bis 120 gelebt hat. Aber Sarah, die Frau von Abraham, hat bis 127 gelebt. Darum sage ich: 127!»
«Das heißt, du könntest dann mit 125, 126 Jahren noch immer arbeiten.»
«Ja, wenn das Gehirn bleibt.»
«Du kannst es trainieren. Es ist wie ein Muskel.»
«Vor allem brauchst du Massel. Aber ich glaube, der liebe Herrgott ist ein netter Kerl. Ich bin gesund. Und ich wohne im Imperial.»
«Eben. Nicht mal Gott wohnt im Imperial.»
«Kommst du mich nächste Woche besuchen? Bei mir daheim?»
«Im Imperial?» Ich nickte und stieß erneut gegen den Tisch. Die Tasse war zum Glück schon leer.
«Ich hätte auch gerne eine Frittatensuppe. Muss man die Bestellung hier aufs Plakat schreiben?», sagte sie, und wir lachten beide.
Zwei Tage später erhielt ich eine SMS. Denke nicht, es ist nichts da. Denke, es steht nichts im Weg. Bleib gesund und bis Mittwoch, Erika.
Um halb elf waren wir verabredet. Ich brachte meinen Sohn in die Schule und schlenderte dann durch die Stadt. Auf dem Universitätsring transportierte ein offener Lastwagen mehrere goldene Glocken, offensichtlich war er auf dem Weg zur Votivkirche, die seit Jahren restauriert wurde. Vor mir auf der Straße bremste scharf ein Polizeiauto. Ein Polizist sprang aus dem Wagen und rannte auf mich zu. Ich wurde panisch, da blieb er abrupt vor mir stehen und fragte: «Kann ich ein Selfie mit Ihnen machen?»
«Sie haben mich erschreckt», sagte ich.
«Sie mich auch. Ich kenn Sie ja nur aus dem Fernsehen.»
«Machen Sie das bei jedem, den Sie aus dem Fernsehen kennen?»
«Ja», sagte der Polizist. «Smile!» Ich lächelte aus Höflichkeit.
Auf der Straße am Heldenplatz fuhren Fiaker und kleine, bunte Kinderrennautos, in denen Touristen saßen und erbarmungswürdig albern wirkten. Ein Hund, dessen Hinterbeine an ein Dreirad angebunden waren, blickte den infantilen Touristen traurig nach und ich ihn traurig an.
«Ihr geht es gut», sagte die Frau, die die Hündin an der Leine führte. «Stellen Sie sich einfach vor, es wäre ein Rollstuhl.»
Ich stellte es mir vor, wurde aber nicht glücklicher. Erst jetzt sah ich, dass die Hündin ein Plastikteil im Po stecken hatte, aus dem es tröpfelte. Wohl ein Hundekatheter.
Die Rennautos knatterten durchs Heldentor, ich hörte ein Quietschen und Hupen. Ein Taxifahrer kurbelte sein Fenster hinunter und fauchte die Touristen an.
«Geht’s in Oarsch mit eure gschissenen Gschrappn-Kraxn!»
Einer der Touristen nahm seinen Helm ab und brüllte irgendetwas auf Holländisch zurück.
Wenn man will, ist die Stadt eine Theaterbühne. Das Bühnenbild ist prachtvoll, die Schauspieler sind authentisch. Das Stück heißt «Wien» und wird jeden Tag bei freiem Eintritt gespielt.
Maria Theresia thronte zwischen den Museen, neben dem Denkmal stand ein Biologe des Naturhistorischen und suchte im Stamm eines Baumes nach der Schwarzhalsigen Kamelhalsfliege. Das erfuhr ich von einer Lehrerin, die mit ihren Schülern der Suche zuschaute und ihren mittelinteressierten Schülern von der Schwarzhalsigen Kamelhalsfliege erzählte.
«Die Schwarzhalsige Kamelhalsfliege zählt zu den Kamelhalsfliegen, der artenärmsten Ordnung der zu den Insekten gehörenden Netzflüglerartigen», sagte sie, ihr Handy in der Hand.
«Aus Wikipedia vorlesen kann ich auch», sagte eine Schülerin.
«Das könnt sogar die depperte Kamelfliege», sagte eine andere.
Ich stellte mich kurz dazu, bis der Biologe seine Suche ergebnislos aufgab.
«Na ja», sagte er.
«Scheiß Fliege», sagte einer der Jugendlichen zu mir. Ich zuckte mit den Schultern.
«Ich kenn sie nicht. Aber ich glaube, ihr ist es ziemlich egal, wie wir sie finden.»
«Wir finden sie ja gar nicht. Der Typ vom Museum hat gesagt, die gibt’s hier massenweise, genau in dem Baum, und dann das. Nichts. Komplette Verarsche!»
Ich fragte mich, was für die 12-Jährigen deprimierender war. Dabei zuzuschauen, wie Schwarzhalsige Kamelhalsfliegen gesucht werden, oder ohne Kamelhalsfliegen-Erlebnisse wieder zurück in den Schulalltag zu müssen. Würden die anderen in der Schule sie fragen, ob sie fündig geworden waren?
Erika war im Alter dieser Schüler gewesen, als sie aus Wien flüchtete. Zwölf. Eine der Schülerinnen war blond und hatte ihre Haare zu zwei Zöpfen geflochten. Ich hatte in Vorbereitung auf unsere Fernsehsendung alte Fotos von Erika gesichtet. Es gab da auch ein Kinderfoto. Sie war blond und hatte Zöpfe. Ich wünschte, sie hätte damals auch nur Frustrationen wegen Insekten gehabt. Hier, in Wien.
In der Sendung hatte sie erzählt, wie ihre schönen blonden Zöpfe sie auf der Straße oft gerettet hatten, denn wer mochte sich schon vorstellen, dass ein jüdisches Kind so weizenblond sein konnte?
Ich ging ins Café Schwarzenberg und bestellte mir eine Melange. Ich war immer noch zu früh. Ich schaute aus dem Fenster hinüber aufs Hotel Imperial. Bevor ich vor vielen Jahren nach Wien zog, hatte ich eine Freundin aus Düsseldorf besucht, die hier eine Musicalausbildung machte. Mit ihr war ich damals auch im Schwarzenberg gesessen. Sie hatte aufs Imperial gezeigt und gesagt: «Wenn man da wohnt, hat man es geschafft!»
Das Imperial ist im Stil der italienischen Renaissance erbaut und wurde 1865 fertiggestellt. Herzog Philipp von Württemberg hatte das Gebäude in Auftrag gegeben und seiner Frau, der Erzherzogin Marie-Therese von Österreich, zur Hochzeit geschenkt. Leider gefiel es ihr nicht. Vielleicht weil der neu gebaute Musikverein die Sicht auf den Wienfluss versperrte? Oder eine Straße plötzlich den Zugang zum Park verbaute? Die genervten Royals verkauften das Haus schon 1871, und zur Wiener Weltausstellung wurde es als Hotel eröffnet.
Manchmal kann man ein Jahrhundert mit Menschen illustrieren. Bismarck, der König von Serbien, der Zar von Bulgarien, Charlie Chaplin, Thomas Mann, John F. Kennedy, Nikita Chruschtschow, Richard Nixon, Marschall Tito, Gandhi, Elisabeth II., Walt Disney, Hitchcock, Sinatra, Woody Allen. Michael Jackson schrieb im Imperial den «Earth Song».
1994 wurde das Imperial zum besten Hotel der Welt gekürt. Hier also wohnte Erika jetzt, seit Beginn der Pandemie bereits. Sie hatte in Wien eine Herzoperation, und Covid verhinderte ihre Heimreise nach New York. Also quartierte sie sich im Imperial ein und blieb.
«Meine Rache an Adolf Hitler», hatte sie gesagt. «Er war nur einmal im Imperial. Ich wohne hier!»
1938 ließ Hitler das Hotel arisieren und erklärte es zu seiner Wiener Residenz. Samuel Schallinger, der Hauptaktionär des Imperial, wurde ins KZ Theresienstadt deportiert und 1942 ermordet.
Ich zahlte und überquerte den Ring, der auf Hitler, wenn er aus dem Männerheim in der Meldemannstraße hierherkam, wie «ein Zauber aus Tausend und einer Nacht» gewirkt hatte.
Seiner Sekretärin Christa Schroeder zufolge logierte er im Imperial in einem kleinen Apartment «mit märchenhaft schönen Blumenarrangements». Verglichen mit dem Obdachlosenasyl in der Meldemannstraße war das sicher eine merkliche Verbesserung.
Zu seinem Schutz war zuvor am Seiteneingang des Hotels ein fünf Meter tiefer Schacht gegraben und als Luftschutzkeller ausgebaut worden. Ein Gang führt noch heute vom Hotel zum Bunker. Hitler selbst hat ihn nie betreten, er war ja, wie gesagt, nur ein einziges Mal im Imperial. Dafür fanden hier während der alliierten Bombenangriffe Philharmoniker, die vom nahen Musikverein hereilten, Unterschlupf.
An der Wand des Hotels hängt eine Gedenktafel mit dem Bildnis Richard Wagners. «Richard Wagner war am Ausgange des Jahres 1875 mit seiner Familie fast zwei Monate lang zur Vorbereitung der Aufführung seiner Opern Tannhäuser und Lohengrin Gast dieses Hotels. Der Wiener Schubertbund zum 50. Todestag des Meisters 1933».
Hitler, Wagner, und jetzt Erika. Und Erika am längsten.
Der livrierte Doorman grüßte mich und ich trat in die Drehtüre des Hotels. Über mir die vier Portalfiguren, Allegorien der Weisheit, der Ehre, der Gerechtigkeit und der Stärke.
Marmor, Statuen, Kristallleuchter. Eine majestätische Treppe aus Kaiserstein führt zu Suiten und Zimmern, Kerzenhalter, Stuckdecken.
138 Zimmer hat das Hotel, aber nur eines war belegt.
«Frau Dr. Freeman ist unser einziger Gast. Sie ist der Grund, warum wir alle noch hier arbeiten», sagte mir der Oberkellner im Café des Hotels. «Wegen Covid kommt sonst keiner, aber sie ist da. Wir lieben sie. Und wenn wir Probleme haben, sprechen wir mit ihr, sie ist ja eine berühmte Analytikerin!»
«Ich weiß», sagte ich und sah mich um. Sie war noch nicht da. «Freie Platzwahl?»
Der Kellner lachte. «Wo Sie wollen. Wir haben genug Tische, und, wie gesagt, Sie sind die einzigen Gäste.»
Ich nahm an einem Ecktisch Platz. Der Kellner kam mit einer Karte.
«Gute Wahl, der Tisch», beglückwünschte er mich. «Hier saß jeden Morgen Niki Lauda. Immer. Um sieben Uhr kam er und hat jeden Morgen das Gleiche gefrühstückt.»
«Und was war das?»
«Melange, Schnittlauchbrot, ein Ei im Glas und ein Joghurt Natur mit gerissenem Apfel und Himbeeren.»
Mir war es fast unangenehm, etwas derart Privates über Lauda zu hören. Ich bestellte nur ein Mineralwasser. Keine gerissenen Äpfel. Obwohl, ich hatte den Kellner ja gefragt, was Lauda immer bestellt habe. Jetzt so zu tun, als sei mir meine eigene Neugierde peinlich, war lächerlich. Also bestellte ich zum Mineralwasser auch eine Lauda-Melange.
Ich sah mich um. Etwa 30 leere, aber eingedeckte Tische. Erika, die hier frühstückte, konnte jeden Tag anders beginnen. Und doch, das riesige Hotel und nur sie allein? Diese kleine, über neunzigjährige Frau? Ich dachte an «Shining» und Jack Nicholson. Redrum im Spiegel. Dazu der Gang, der in den unterirdischen Bunker führte. In einer Stadt, die ihr als Kind nach dem Leben trachtete. Wo in den Vasen märchenhafte Blumenarrangements für Hitler steckten? War das nicht selbst für die versierteste Psychoanalytikerin zu viel?
«Good Morning, Frau Doktor», hörte ich den Oberkellner, bevor ich sie sah.
«Good Morning», sagte sie, und da bog sie um die Ecke. In einem himmelblauen Blazer, schwarzem Rollkragenpullover, einer Halskette mit hebräischen Buchstaben.
«Dirk! How sweet, you came!» In der Hand hatte sie ein kleines Sackerl, das sie mir überreichte. «Ein kleines Geschenk aus dem Imperial für dich!»
Ich schaute in das Sackerl und fand Shampoo, Bodylotion, Conditioner, Seife und ein kleines Imperialtörtchen.
«Aus meinem Zimmer. Sie wechseln es jeden Tag. So eine Verschwendung!»
Ich bedankte mich bei ihr. Sie setzte sich mir gegenüber auf die Bank. «Kannst du den Tisch etwas näher schieben?»
Ich schob den Tisch vorsichtig, weil ich sie nicht verletzen wollte. «Ich habe mir gerade überlegt, ob es für dich nicht spooky ist, in diesem riesigen Hotel als einziger Gast. Und der Hitler-Bunker gleich neben dir.»
«You need to mach dir nix draus», sagte sie und lachte.
«Schwarzhaarige Kamelhalsfliege? Was ist das?», fragte Erika, als ich ihr von der Begegnung mit der Wiener Schulklasse erzählte.
«Ein Insekt, nicht sehr hübsch», antwortete ich.
«Sie muss etwas Besonderes sein, wenn der Mann vom Museum dafür extra auf den Baum geklettert ist.»
«Sie frisst Schädlinge. Larven von Borkenkäfern.» Das wusste ich, weil ich der Lehrerin ja bei ihrem Wikipedia-Vortrag zugehört hatte.
«Das wird die Larven nicht freuen. Sie wissen ja nicht, dass sie Schädlinge werden, und kein Schädling sieht sich selbst als Schädling.»
«Und dann habe ich einen Hund in einem Rollstuhl gesehen», fuhr ich fort. «Also, kein richtiger Stuhl, aber ein Gestell mit Rädern für die hinnigen Hinterbeine.»
«Poor dog», sagte sie, und ich erzählte ihr den Witz von dem Mann, der mit seinem Hund eine Bar betritt und den Hund auf die Bar setzt. Warum setzen Sie Ihren Hund auf den Tresen?, fragt der Barmann. Weil er keine Beine hat. Hat der Hund einen Namen? Nein. Armer Hund. Keine Beine, keinen Namen. Warum hat er keinen Namen? Weil, wenn ich ihn rufen würde, könnte er eh nicht kommen!
«Ich hatte einen Hund, nach dem Tod von Paul.»
«Dein Mann?»
Sie nickte. «Husbands are difficult, they die too soon. Er ist 1980 gestorben, mit 51. Eine Unverschämtheit!»
«Wie hieß dein Hund?»
«Napoleon Bonaparte. Ich brauchte einen mächtigen Namen für den armen kleinen, zittrigen Kerl. Die ganze Zeit hat er Angst gehabt. Ich hatte ihn aus einem Tierheim. Und dann stellte sich heraus, dass er ein Zirkushund war. Er konnte wunderbare Tricks, ist bei mir daheim rückwärts auf zwei Beinen gelaufen und hat Pirouetten gemacht.»
«Aber wenn du deinen Hund Napoleon Bonaparte nennst, dann weißt du, dass irgendwann Waterloo kommen wird.»
«Ja, aber er ist vor Waterloo gestorben. Und Waterloo muss nicht zwangsläufig kommen.»
«Nicht für Hunde.»
Sie lächelte und führte die bis an den Rand gefüllte Tasse Kaffee an den Mund.
«Du lernst es einfach nicht. Pass auf!», rief ich und beobachtete die Tasse.
«Ich zittere nicht, schau!» Tatsächlich führte sie die Tasse ganz ruhig zum Mund. Wie um mich zu ärgern, besonders langsam.
«Aber so ist es viel schwieriger», sagte ich.
«Schau», wiederholte sie und lächelte mich an. Sie nahm einen Schluck, stellte die Tasse auf den Tisch und goss sie aus der Kanne wieder ganz voll. «Ich zittere nicht, weil ich es nicht brauche. Wozu soll ich zittern?»
«Why don’t you zitter? In deinem Alter darf man zittern.»
«I don’t agree with my age.»
«Es ist nicht praktisch zu zittern, aber es wäre total in Ordnung.»
«Ja», sagte sie und nahm noch einen Schluck. Das war ein untermauernder Showschluck. Eine Jonglage, die mir zeigen sollte, dass sie die Tasse beherrschte und nicht umgekehrt.
«Man würde das Zittern erwarten», sagte sie. «Und ich tu nie das Erwartbare. Ich weiß nicht einmal, was das Erwartbare ist. Wenn sie sagen, etwas geht nicht, mache ich es erst recht. Was ist Nein für eine Antwort? Nein ist der Anfang von Ja. Du musst nur einen Schlüssel finden.»
«Oder eine andere Tür.»
«Wir brauchen das Nein nicht.»
«Trotzdem», sagte ich. «Ich werde jetzt einen kleinen Braunen trinken und dir zeigen, wie man die Tasse befüllt, um keine Probleme zu bekommen!»
Ich nahm die Kanne und schüttete Kaffee in meine Tasse. Der Deckel der Kanne fiel hinunter. Der Kaffee ergoss sich über den Tisch und meine Hose. Erika reichte mir ihre Serviette und wortlos wischte ich den Kaffee auf.
«Wie beim letzten Mal», lachte Erika plötzlich los. «Wie im Korb. Da hast du auch Kaffee verschüttet. Interesting!»
Wahrscheinlich suchte sie nach einer tieferen Bedeutung meiner Kaffeeunfälle.
«Es heißt nichts», kam ich einer Deutung zuvor. «Es war nur der Deckel.»
«Aber was ist mit dem Deckel? Oder dem Kaffee? Deinem Fleck auf der Hose?»
«Machen wir hier jetzt eine Therapie? Das kann ich mir nicht leisten. Bin ich jetzt dein Klient?»
«Ich nenne sie Patienten, nicht Klienten. Ich bin keine Rechtsanwältin. Ich sage ihnen nicht, was sie tun sollen, sie bringen es sich selber bei.»
«Ich wollte dir beibringen, richtig zu trinken. Nicht mir.»
Sie lächelte.
«Bist du nicht manchmal ungeduldig mit deinen Patienten?»
«Impatient with the patient? Das geht nicht. Sie sind nicht langsam, sie sind so schnell, wie es braucht. Langsam wäre mein Urteil. Ich urteile nicht. Wie lange es für dich dauert, Erkenntnisse über dich selbst zu gewinnen? So lange es dauert. Einige meiner Kollegen sind ungeduldig und üben Druck aus. Weil sie sich selbst zu wichtigmachen. Ich sage: Mach dich nicht wichtig, mach dich nützlich. Machst du dich nützlich, bist du wichtig.»
«Gibt es Analytiker, die du magst?»
«Natürlich.»
«Das ist gut, denn ich habe das Gefühl, dass in den Häusern von Manhattan entweder Analytiker wohnen oder Patienten. Es gibt nichts dazwischen.»
«Doch», antwortete sie. «Die, die dringend Patienten werden sollten. Die, die schon Patienten sind, brauchen es oft nicht so dringend wie die, die es werden sollten.»
«Aber noch mal, machen wir jetzt eigentlich eine Therapie, wenn wir reden? Nicht jeder, mit dem du sprichst, ist ein Patient, oder?»
«Natürlich nicht, aber es ist therapeutisch, wenn du mit bestimmten Menschen sprichst. Du fühlst dich hinterher besser. Niemand weiß, warum. Es ist alles Chemie.»
Ich öffnete die kleine Schachtel und holte das Miniatur-Törtchen heraus.
«Möchtest du die Hälfte?»
«Nein, es ist deine Torte. Sie ist so winzig, wenn du die teilst, bekommt jeder von uns fast nichts. Besser, du isst sie. Ich hab mein Ei im Glas.»
«Dein Ei ist schon kalt», sagte ich schmatzend.
«Gut, dann red du und ich esse. Kennst du die Geschichte von den beiden Juden im Winter? Du weißt, Juden benutzen immer ihre Hände beim Reden. Es ist sehr kalt. Und der eine sagt zum anderen: Red du, du hast Handschuhe!»