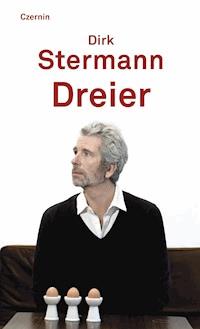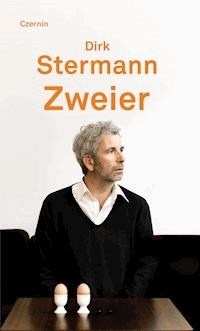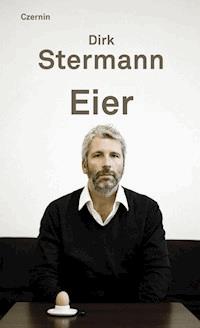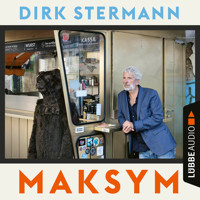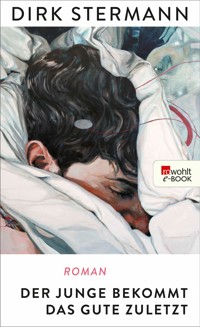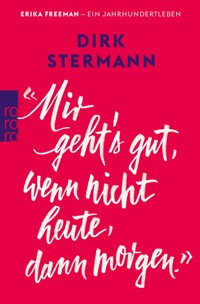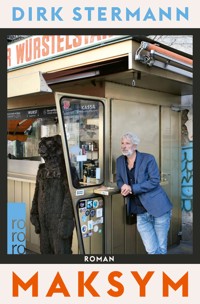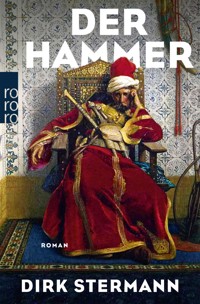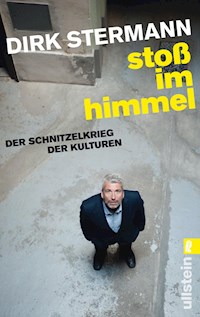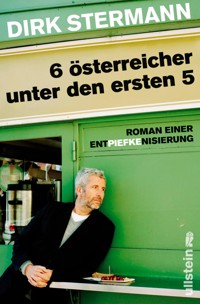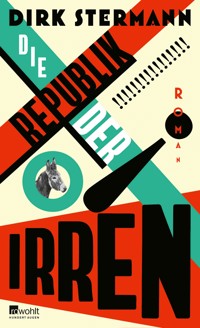
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Fiume an der Adria. Bis 1918 hat die Hafenstadt zum Habsburgerreich gehört, jetzt rücken italienische Freischärler ein, unter Führung eines berühmten Mannes. Gabriele D'Annunzio, Dichter, Kriegsheld und glühender Nationalist, ruft die Republik aus. In Fiume soll nun der verrückteste Staat der Weltgeschichte entstehen, Politik als Spektakel. Unter D'Annunzios Anhängern: ein gewisser Mussolini. Und Guido Baron Keller von Kellerer und Wolkenkeller. Der tollkühne Flieger, Nudist und Utopist ist besessen von einer Idee aus futuristischen Künstlerkreisen: Will man die morsche Welt von gestern zerstören und eine strahlende neue erbauen, braucht es die Sprengkraft des Wahnsinns. Gesagt, getan. Aus den Irrenhäusern ganz Italiens werden (möglichst ungefährliche) Patienten angefordert. Sie sollen Minister werden im neuen Staat. Und so macht sich auch der Krankenwärter Cherubino auf, um einen freundlichen Axtmörder an die Adria zu begleiten – der Morgenröte einer neuen Zeit entgegen, in die Republik der Irren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 352
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Dirk Stermann
Die Republik der Irren
Roman
Über dieses Buch
Fiume an der Adria. Bis 1918 hat die Hafenstadt zum Habsburgerreich gehört, jetzt rücken italienische Freischärler ein, unter Führung eines berühmten Mannes. Gabriele D’Annunzio, Dichter, Kriegsheld und glühender Nationalist, ruft die Republik aus. In Fiume soll nun der verrückteste Staat der Weltgeschichte entstehen, Politik als Spektakel. Unter D’Annunzios Anhängern: ein gewisser Mussolini. Und Guido Baron Keller von Kellerer und Wolkenkeller. Der tollkühne Flieger, Nudist und Utopist ist besessen von einer Idee aus futuristischen Künstlerkreisen: Will man die morsche Welt von gestern zerstören und eine strahlende neue erbauen, braucht es die Sprengkraft des Wahnsinns. Gesagt, getan. Aus den Irrenhäusern ganz Italiens werden (möglichst ungefährliche) Patienten angefordert. Sie sollen Minister werden im neuen Staat.
Und so macht sich auch der Krankenwärter Cherubino auf, um einen freundlichen Axtmörder an die Adria zu begleiten – der Morgenröte einer neuen Zeit entgegen, in die Republik der Irren.
Eine unglaubliche Geschichte aus einem entlegenen Winkel der Weltgeschichte. Schrecklich komisch. Unheimlich aktuell.
Vita
Dirk Stermann, geboren 1965 in Duisburg, lebt seit 1987 in Wien. Er zählt zu den populärsten Kabarettisten und Fernsehmoderatoren Österreichs und ist auch in Deutschland durch Fernseh- und Radioshows sowie durch Bühnenauftritte und Kinofilme weit bekannt. 2016 erschien sein Roman «Der Junge bekommt das Gute zuletzt», 2019 «Der Hammer» und 2022 «Maksym». «Mir geht’s gut, wenn nicht heute, dann morgen.» erreichte in den österreichischen Bestseller-Charts den Spitzenplatz.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, September 2025
Copyright © 2025 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Covergestaltung Anzinger und Rasp, München
Coverabbildung Antiqua Print Gallery/Alamy Stock Photo
ISBN 978-3-644-02298-0
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Mira
«Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt.»
Mark Twain
I
«Cherubino, schau!»
Direktor Garbinis Augen leuchteten. Mit seinem nach oben gezwirbelten Schnauzer sah er ein wenig aus wie der deutsche Kaiser, den wir gerade mitsamt dem Österreicher vom Hof gejagt hatten. Der Direktor hatte auf dem Kopf dichtes dunkles Haar, seine Wangen waren blau vom Bartschatten. Er war sehr behaart. Ich stellte mir vor, er müsse jeden Morgen sein ganzes Gesicht rasieren, damit Augen, Nase und Stirn frei lägen, sonst sähe er von vorne aus wie von hinten.
Er breitete seine Arme vor dem Wiesenplateau aus, als präsentierte er im Hörsaal von Rom seinen Studenten einen epileptischen Patienten. Der Piano Grande leuchtete in allen Farben. Die weißen Blüten der Linsen, das satte Grün des Grases, die roten Mohnblumen.
«Die Trikolore! Ein Feld der italianità», sagte Garbini ergriffen. «Ein lebendes Gemälde.»
«Aber der gelbe Raps», warf ich ein. «Und das viele Blau.»
Dr. Garbini überlegte. Ich schien ihn aus dem Konzept gebracht zu haben. «Das Gelb steht für das Gold der Königskrone, Cherubino. Und das Blau für die Umrahmung des Kreuzes.» Er wirkte zufrieden mit seiner Erklärung, und ich verbesserte ihn bei den Bezeichnungen der verschiedenen Wildblumen, zeigte ihm das römische Knabenkraut, die Schachblume, den Zungenstendel und die Dichternarzisse. Wir rochen den wilden Senf und wurden hungrig.
Auf dem Weg in mein Heimatdorf Castelluccio lag der Lago di Pilato, in dem sich Pontius Pilatus aus Reue für seine Schuld am Tode Jesu ertränkt hat. Ich bekreuzigte mich.
Garbini sah mich streng an. «Warum tust du das? Du bist keine Ordensschwester und keine Hure des Papstes», sagte er. «Du bist die Zukunft Italiens. Wir wandern am Campo Imperatore, Cherubino, und dieser Name ist uns Verpflichtung für die Zukunft!»
Nicht mehr bekreuzigen, merkte ich mir. Es waren neue Zeiten und Dr. Garbini einer der Wegweiser in diese neue Zeit. Er hatte im Irrenhaus von Teramo die Strohverarbeitung für die Patienten eingeführt. Die Irren machten nun Besen und füllten Matratzen. Die Klinik verdiente gut, mehr als früher, als die Irren an die Bauern vermietet wurden. Die Bauern zahlten schlecht, auch wenn die Irren von der Früh bis in die Nacht auf den Feldern waren.
Teramo war eine der größten Nervenheilanstalten Italiens, eine Festung der Verrückten. Untergebracht war sie in einem riesenhaften Hospizbau aus dem Mittelalter. Seit zwei Jahren war Guido Garbini der neue Direktor, eine seiner ersten Anweisungen hatte der Entfernung der meisten Schließtore und Gitter gegolten.
Unzählige Male hatte ich die Schlüssel ein- und ausstecken müssen, wenn ich durch alle Säle wollte. Jetzt beaufsichtigte ich die Irren der Schmiedewerkstatt, die für Jahre mit Arbeit versorgt waren, denn es gab viele Gitter und Tore, die nun zu Friedhofskreuzen und Bücherregalen, zu Sicheln und Pflügen umgearbeitet wurden. Dr. Garbini glaubte sehr an seelische Gesundung durch sinnvolle Tätigkeit.
Als einmal Pino Nardi mit einem Hammer vor mir stand, bekam ich Angst. Pino war einer dieser tobsüchtigen Verrückten aus Teramo. Die Oberin hatte ihn zu den Schmieden eingeteilt, und jetzt schien er mich mit einem der Gitter zu verwechseln. Ich brüllte ihn an, aber erst zusammen mit den Kollegen Lorenzo und Salvatore konnte er mit einiger Mühe überwältigt werden. Pino kämpfte mit der Kraft eines Ochsen, und wir mussten schließlich den basto del bue einsetzen, den comacio. Wir legten dem Rasenden ein Laken über den Kopf, ergriffen von hinten die Ecken des Lakens, rollten es auf und zogen es so lange fest, bis es schien, als würde er ersticken. Schließlich wurde er ohnmächtig, und wir konnten ihm den Schmiedehammer aus der verkrampften Faust ziehen. Dr. Garbini schimpfte mit uns. Der comacio sei untersagt, dunkle, mittelalterliche Folter, so etwas habe in einer von ihm geführten Klinik keinen Platz. Außerdem sei comacio ein vulgärer Begriff.
«Er hätte mich sonst erschlagen», sagte ich.
«Er hätte keinen Hammer bekommen dürfen», sagte Dr. Garbini, ging ins Zimmer der Oberin und schloss die Tür hinter sich. Was er dort laut schrie, stand in keinem Gebetbuch.
Immer einen Putzlappen dabeihaben und dem Patienten nie den Rücken zukehren, das hatten wir verinnerlicht. Das Einwickeln der Tobsüchtigen in nasse, kalte Tücher, um sie zu erschöpfen, hatte der alte Direktor Roscioli uns gelehrt. Du musst selbst stark sein, um Tobende zu erschöpfen, und ich war stark. Darum wurde ich oft in die Säle der Unruhigen gerufen. Schlüssel rein, Schlüssel raus. All diese Schlösser.
Ein Irrer hatte eine Trennungsmauer erklommen und war auf der anderen Seite heruntergefallen, wobei er sich ein Bein brach. Professor Roscioli ordnete daraufhin an, die Mauer zu erhöhen. Der Irre, ein Bauernsohn aus Valle San Giovanni, kletterte wieder hinauf, fiel erneut herunter und brach sich den Hals.
Direktor Roscioli zog daraufhin nach Genua, und Dr. Garbini wurde sein Nachfolger.
«Öffnen wir die Fenster», sagte er an seinem ersten Tag. «Nun weht ein neuer Wind.»
Wir öffneten wie befohlen die Fenster.
«Es zieht», sagte Dr. Garbini.
Später ging ich mit ihm durch die schönen Gärten der Klinik. Professor Roscioli hatte viel Wert auf seinen Park gelegt. Stets sah man Irre im Grün, die jäteten und gossen.
«Die Arbeit ist ein Mittel der Heilung», sagte Dr. Garbini. «Aber was hilft der schönste Garten bei dem Elend der Schlafsäle und Innenräume?»
Wahrscheinlich hatte er sich zuvor mit Fabrizio ausgetauscht. Fabrizio lebte seit mehr als zwanzig Jahren als unser ältester Patient in einem der kleineren Säle. 45 Personen, eingeschlossen in einen Raum von 25 Quadratmetern. Sechs Bänke mit jeweils drei Sitzplätzen und acht am Boden befestigte Eisenschemel, also 26 Sitzplätze für 45 Insassen. Die übrigen streiften wie blinde Fliegen im Raum umher. An einer Seite befand sich die Toilette, ohne Tür oder Vorhang, die einen Übelkeit erregenden Gestank verbreitete. Fabrizio schrieb im Stehen auf einem an die Wand gehefteten Blatt in einer Geheimschrift. Kein italienisches Wort war zu entziffern, dafür kleine Wesen, die aus den Zeichen aufstiegen.
Er sei das Werkzeug eines sehr kleinen Gottes, hatte er mir einmal zugeflüstert. Er sei in einem Werkzeugkasten auf die Welt gekommen, in einer klitzekleinen Schmiede, auf deren Dach ein Kreuz gewesen sei, und jetzt schreibe er im Namen des sehr kleinen Gottes ein ganz neues Testament. Ich hatte nur genickt. Fabrizio war harmlos.
Fabrizio sei melancholischen Zufällen ausgesetzt, erklärte mir Dr. Garbini später das sonderbare Wesen des Patienten. Und es seien zu wenige Sitzgelegenheiten im Raum.
«Mehr Stühle oder weniger Patienten», forderte er.
Die Oberin schaute missbilligend zu, wie wir eine Eckbank aus der Schlosserei in den Saal trugen.
«Firlefanz!», zischte sie. «Unser Herr trug auch sein Kreuz!»
«Die Patienten können ihres aber doch trotzdem im Sitzen tragen», antwortete Dr. Garbini.
Die Oberin, die schon Professor Roscioli in den Wahnsinn getrieben hatte, schaute unseren neuen Direktor an, als male sie sich eine Löwengrube aus, in die sie ihn stoßen würde.
«Ein Irrenhaus», sagte er leise zu mir, und ich nickte.
«Ja, ich weiß.»
Mit seinem Taschentuch wischte Dr. Garbini sich schwer atmend den Schweiß von der Stirn. Castelluccio ist das höchste Bergdorf im ganzen Apennin, und der Direktor war körperliche Anstrengung nicht gewohnt. Er stand in den Hörsälen von Rom und Perugia, las Bücher oder untersuchte Irre; auf 1500 Meter über dem Meeresspiegel zu steigen, war eine neue Erfahrung für ihn.
Wir hatten bei der Grotta della Sibilla eine Pause eingelegt und kristallklares Wasser getrunken. Jetzt gingen wir den steilen Weg zu meinem Dorf, vorbei an der Höhle, in der meine Großeltern jahrelang gelebt hatten nach dem Felssturz, der ihr Haus zerstört hatte. Mein Vater war in der Höhle auf die Welt gekommen.
«Ein Höhlenmensch», hatte Dr. Garbini gelacht, als ich ihm die Stelle zeigte, aber jetzt lachte er nicht mehr, sondern kämpfte sich die letzten steilen Meter des Weges hoch.
«Sind wir noch auf der Erde oder schon auf dem Mond?», fragte er keuchend. Wir waren oberhalb der Wolken angelangt. Das Farbenmeer des Wiesenplateaus war unter der dichten weißen Decke verschwunden. Ich würde ja springen wie eine Gämse, rief der Dottore, aber dies war mein Dorf, hier hatte ich meine Jugend verbracht, bis ich mit fünfzehn nach Teramo kam, um dort Pfleger zu werden. Vorher hatte ich meinen Eltern bei der Linsenernte geholfen und, seit ich ein kleines Kind war, die Schafe gehütet. Seit ich laufen konnte, sagte meine Mutter, half ich im März bei der Saat und im August bei der Ernte der Seelentröster, wie wir die Linsen nannten. Die Linsen aus Castelluccio di Norcia sind berühmt, sie wachsen an den Hängen des Gran Sasso, und so beschwerlich ihr Anbau ist, so glücklich machen sie auf dem Teller, mit Knoblauch und Safran, ein Geschmack, den ich niemals vergessen werde. Beim letzten Abendessen eines Jahres werden bei uns immer Linsen gegessen, denn sie bringen Glück, und Glück können wir da oben in Castelluccio gebrauchen. Es ist ein hartes Leben, darum gibt es nur ein paar Familien in unserem Dorf, das viele Monate im Jahr eingeschneit und von der Außenwelt abgeschnitten ist. Wir wenigen Menschen teilen uns diese einsame Welt mit Wölfen und Marsischen Bären.
Wenn ich nicht bei der Ernte half, war ich mit den vier Dutzend Schafen unterwegs. Für sie war unser kleines Italien ein Paradies. Kleines Italien nennen wir den Apennin, wahrscheinlich, weil die meisten von uns nie etwas anderes von Italien sehen als unsere Gegend.
«Ich wär auch gern ein Schaf», sagte Romualdo, der zwei Jahre älter war als ich und mich oft begleitete. «Hier wächst alles, was sie lieben.»
«Du bist ein Schaf», sagte ich, denn Romualdo war wirklich nicht der Hellste. Mama meinte, das läge daran, dass seine Eltern zu verwandt waren, das sei nicht gesund.
«Aber Papa und du, ihr seid doch auch verwandt», antwortete ich. «Alle im Dorf sind verwandt.»
«Aber nicht so verwandt. Ist dir nie aufgefallen, dass er nur einen Großvater und eine Großmutter hat? Deshalb ist sein großer Bruder auch nach Teramo gekommen», sagte meine Mutter, und ich wusste, Teramo war der Ort, an den die Merkwürdigen aus der ganzen Region geschickt wurden. Romualdos Bruder war so ein Merkwürdiger, der den ganzen Tag eingerollt auf dem Boden vor dem Haus gelegen hatte, eine ganze Hand im Mund. Er sprach nie und machte Geräusche wie ein kleiner Vogel. So einer kam nach Teramo.
Dass ich auch einmal dort landen würde, ahnte ich als Kind noch nicht. Teramo schien kein Ort zu sein, sondern ein Schicksal, und wenn ein Hund im Ort tollwütig war, sagten die Alten, sie brächten ihn nach Teramo, aber dann hörte ich nicht weit entfernt vom Dorf einen Schuss, und die Alten kamen bald darauf ohne Hund zurück, das Gewehr über der Schulter. Vielleicht, dachte ich damals, hatten sie das mit Romualdos Bruder genauso gemacht.
Wenn ich mit den Schafen über die Hochebene ging oder im Gras lag und Gigio streichelte, meinen Hirtenhund, dann dachte ich über die Zukunft nach. Es gab drei Möglichkeiten für uns Leute aus dem Dorf. Amerika, Teramo oder Linsen und Schafe. Amerika war weit weg, man hörte nie mehr etwas von denen, die dorthin ausgewandert waren. Sie sind wahrscheinlich während der Überfahrt ertrunken, sagten die Alten, das Meer ist tief, die Wellen sind hoch und die Stürme heftig. Teramo war wie Amerika, nur ohne Wellen und Stürme. Wer aus dem Dorf dorthin ging, war auch verschwunden. Achtzig Kilometer entfernt von Castelluccio war Romualdos Bruder, als Kind schien mir das weiter weg als der Mond, denn den konnte ich nachts von den Weiden aus sehen, aber Teramo nicht. Gigio bewachte die Schafe und mich vor den Wölfen und Romualdo, der sich immer wieder anschlich, um mich mit einem Stein zu bewerfen oder einem Ast zu schlagen. Jedes Mal begann Gigio rechtzeitig zu bellen, und ich gab Romualdo eine Ohrfeige, dass er ins Gras fiel, wo er sich vor Lachen kugelte. Ich verstand, warum die Leute aus dem Dorf lieber mich zum Hirten bestimmt hatten als den zwei Jahre Älteren.
Gigio war schon mit meinem Vater unterwegs gewesen und ein alter, treuer Freund. Wenn die Wölfe kamen, verbellte er sie, und ich wunderte mich, warum die Wölfe Angst vor ihm hatten, denn er war nicht mehr der Schnellste, aber sein Bellen klang wohl so selbstbewusst, dass sie sich nicht so sicher waren, ob er nicht doch siegen würde, wenn es zu einem Kampf käme.
Aber als ich vierzehn war und schon einige Wochen mit Gigio und den Schafen am Piano Grande verbracht hatte und nachts in der kleinen Steinhütte lag, hörte ich sie kommen. Gigio, der vor dem Eingang neben dem Feuer lag, erhob sich schwerfällig und hinkte in die Nacht hinaus. Ich wartete auf sein Bellen, hörte aber nur ein erbarmungswürdiges Krächzen und kurz darauf schreckliche Kampfgeräusche. Ich sprang auf, meinen dicken Ast in der Hand, und lief auf das kämpfende Knäuel zu, schlug auf die Wölfe ein, die sich in Gigio verbissen hatten, schrie und trat. Schließlich ließen sie von ihm ab und verschwanden in der Dunkelheit. Auf der Wiese lag ein gerissenes Schaf, mein alter, geliebter Gigio war tot.
Am nächsten Morgen, als die Sonne aufging, stellte ich fest, dass drei weitere Schafe fehlten. Die Leute im Dorf warfen mir vor, nicht gut genug aufgepasst zu haben, und übertrugen die Schafe dem Dummkopf Romualdo. Bisher hatten Mama und ich jedes Jahr drei Schafe als Lohn für meine Arbeit bekommen, das würde jetzt wegfallen.
«Der Pfarrer sagt, du kannst nach Teramo gehen», sagte Mama, und ich bekam Panik. Ich sah die Männer schon ihre Gewehre umschnallen und mit mir wie mit den tollwütigen Hunden das Dorf verlassen, aber Mama erklärte mir, dass es dort Arbeit für mich geben würde, und ein paar Tage später begleitete mich der Pfarrer nach Norcia, von wo mich ein Bauer auf seinem Wagen mit nach Teramo nahm.
Zehn Jahre war es jetzt her, dass ich in Teramo als Unterpfleger begonnen hatte, und jetzt würde ich in den Norden gehen und dort Capo della Casa werden, Oberpfleger. In einem Irrenhaus der Österreicher im Trentino, das wir als Sieger des Krieges dem Vaterland anschließen würden.
«Wir haben es fast geschafft», sagte ich zu Dr. Garbini, als der steilste Teil des Weges nach Castelluccio hinter uns lag und wir einen weiten Blick auf das Tal des Gran Sasso hatten.
«So stelle ich mir den Olymp vor, aber der da ist nicht Zeus», sagte mein Direktor und nickte zu Romualdo, der uns mit dem einen Arm zuwinkte, der nicht im Krieg geblieben war. Ich hatte gehört, er sei am Isonzo schwer verletzt worden.
«Cherubino!», schrie Romualdo und hoppelte uns entgegen, denn er hatte auch beide Füße und Unterschenkel für Italien verloren. Trotzdem bewegte er sich auf dem schwierigen Terrain sicherer und schneller als der Psychiater aus Rom. Ein Tierarzt hatte ihm die Beine und den Arm amputiert und alles sauber vernäht, wie er es bei Eseln und Pferden gelernt hatte.
«Schade, dass er mir keine Hufe gemacht hat», lachte Romualdo. «Hufe sind in den Bergen besser als Stümpfe.»
Später saßen wir in der dunklen Küche. Auf dem Tisch stand eine Schüssel salsicce in umido, ein Linseneintopf mit Wurst, wie ihn nur meine Mutter kochte. Keine andere Frau im Dorf konnte es wie sie, von allen anderen Dörfern im Tal des Tirino und bis nach L’Aquila ganz zu schweigen, auch wenn Romualdo behauptete, der Eintopf seiner Mutter wäre besser. Aber Romualdo war ein verkrüppelter Dummkopf, der nicht lesen und schreiben konnte und das Dorf nur für einen Krieg verlassen hatte, der dafür gesorgt hatte, dass er es auch niemals wieder verlassen würde.
Meine Mutter war glücklich. Sie küsste mich vor dem Essen, während sie kochte und während ich aß. «Erzähle, erzähle, mein Cherubino», rief sie immer wieder. Und «Mein Cherubino zieht in den Norden» und «So ein feiner Herr», wenn sie Dr. Garbini ansah. Sie war noch nie bei einem Arzt gewesen, noch nie in einer Stadt, und mein Direktor war für sie wie ein König. Sie verbeugte sich vor ihm und strahlte, weil ihr Sohn diesen König kannte.
«Nein, nein, Signora. Ich bin kein feiner Herr, ich bin ein Diener all der seelisch Kranken, ich versuche, ihre Psyche zu befreien von all dem Unrat, der sie beeinträchtigt», sagte der Direktor, und ich sah meiner Mutter an, dass sie nichts verstand, aber sehr beeindruckt war. Und ich war für sie wie Christoph Columbus, der eine neue Welt entdeckte, weil ich Castelluccio verlassen hatte.
«Wo sind denn all die Menschen?», fragte der Direktor, als wir durchs grabesstille Dorf gingen.
«Tot oder in Amerika», sagte ich. «Oder beides.» Die Familie Fabriano zum Beispiel, unsere Nachbarn, war auf der Überfahrt gestorben. Alle vier.
Am nächsten Morgen verabschiedeten wir uns. Ich bekam einen Sack mit Linsen von meiner Mutter, die sich nicht vorstellen konnte, dass es außerhalb von Castelluccio auch welche geben könnte, und falls doch, sicher nicht so gute wie unsere sehr kleinen Linsen, die man nicht einmal in Wasser einweichen musste. Sie küsste mich und befühlte mit ihren Händen noch einmal jeden Teil meines Gesichtes. Sie lächelte, zahnlos und wehmütig, und wir gingen los. Romualdo hoppelte mit, bis es für ihn zu steil wurde. Hufe wären wirklich gut gewesen für ihn. Ich drehte mich noch einmal um und winkte ihm.
«Zahl es den Habsburgern heim!», rief er, und es hallte von den Bergen wider. Seinen Armstumpf streckte er drohend in den Himmel.
Laut Dr. Garbini gingen wir auf der falschen Seite des Gran Sasso hinunter. «Von Pescara aus betrachtet ähneln seine Umrisse in der Abenddämmerung einer schlafenden Frau. Deshalb hat D’Annunzio den Gran Sasso als die schlafende Schöne bezeichnet. Aber, wie gesagt, von Pescara aus.»
«Schade», sagte ich und hatte zum ersten Mal den Namen D’Annunzio gehört.
In der Anstalt trugen ein paar Irre und Pfleger gemeinsam Steine, mit denen gerade der größte der Innenhöfe gepflastert wurde. Einige Isolationszellen waren auf Befehl des Direktors abgerissen worden, und das kostbare Baumaterial sollte nicht verschwendet werden. Die Irren legten sich sehr ins Zeug; sie wussten, es gab Bonbons, Tabak und manchmal sogar ein wenig Geld, was die Oberin stark kritisierte, aber Dr. Garbini war der Terror der alten Krähe zunehmend gleichgültig geworden, seitdem feststand, dass er die Klinik in Pergine übernehmen würde, weit oben im Norden des Landes. Auch ich ließ mir von der bösen Alten nichts mehr gefallen. Wenn das die Braut Christi war, dann tat der Heiland mir leid.
«Jesus würde wohl eher dem einen oder anderen seiner Jünger an die Wäsche gehen als diesem Besen», sagte Salvatore einmal, und wir lachten alle.
Die Oberin stand neben den ehemaligen Isolationszellen und fauchte den Direktor an. «Wenn eine einzige meiner Schwestern von einem Tobsüchtigen attackiert wird, den Sie aus der Isolation holen, werde ich dem Kardinal schreiben! Sie sind verantwortlich für alles, was da kommen mag! Ich habe das furchtbare Gefühl, Sie sind hier in der Klinik auf Seiten der Irren!»
«Ihr Gefühl trügt Sie nicht, Schwester Mafalda. Ich bin Irrenarzt, nicht Schwesternarzt!»
Mit diesen Worten ließen wir sie stehen und gingen in den Keller, wo der Direktor eine Art Grotte eingerichtet hatte, die zum Schlachten diente. Hier durften nur ausgesucht harmlose Patienten unter Anleitung unserer Köchin Esmeralda arbeiten. Sie war vor kurzem Witwe geworden, ihr Mann war in den letzten Kriegstagen noch ums Leben gekommen. Isonzo. Isonzo, Isonzo. Ich hatte vor dem Krieg nie von dem Fluss im Norden gehört, wie die meisten aus dem Süden nichts von ihm wussten, bis sie dann zu Hunderttausenden an seinem Ufer starben. Für den König, fürs Vaterland, für Italien.
Die meisten von ihnen waren einfache Männer wie ich gewesen, Tagelöhner, ohne eigenen Boden, mit Ochs und Esel in Hütten auf gestampftem Lehm hausend, der sich im Winter in einen schlammigen Sumpf verwandelte. Wanderarbeiter, die im Norden von den Großgrundbesitzern in riesigen Gemeinschaftssälen untergebracht wurden. Bei uns im Süden lebten sie in Höhlen, Grotten oder alten Gräbern.
Im Norden litten sie an der Pellagra, weil sie tagein, tagaus nur Maisbrei zum Fressen hatten, ganze Landstriche waren verseucht von Malaria. Die allermeisten im Lande konnten nicht lesen, schreiben und rechnen, die Großgrundbesitzer im Süden forderten das Ende des verpflichtenden Schulunterrichts, weil die Kinder kostbare Arbeitszeit vergeudeten. Wozu sollten sie auch etwas lernen, das sie bei ihrer Arbeit niemals brauchen würden? In Castelluccio hatte nie jemand eine Schule besucht.
Das war das Italien, für das sie gefallen waren. Wir, die Bastarde der Menschheit, waren gut genug gewesen, unsere Körper in die Kugeln und Granaten zu werfen. Für den König mit seiner Krone aus Senf.
Ich schraubte das Schild ab, das der Direktor am Tor angebracht hatte. Wir wollten es mitnehmen in den Norden.
«Macht es gut, ihr verrückten Irren von Teramo», murmelte ich, während ich es abmontierte. Qui solamente pochi, forse neppure i veri stand auf diesem Schild, das ich eine Woche später am Tor von Pergine anbrachte.
«Polentone», sagte ein deutschsprachiger Insasse in Pergine zu mir, er war kleinwüchsig und hatte einen Buckel. Polentone war sein einziges italienisches Wort. Polentafresser, so nannten sie da oben alle Italiener. Was witzig war, denn Polenta aßen sie ja nur in Norditalien, in der Po-Ebene. Wir nannten die Norditaliener deshalb auch Polentoni, und sie schimpften uns Terroni, Erdfresser. Der Kleinwüchsige blickte auf das Schild und legte den Kopf schief, als könne er die Aufschrift so besser lesen.
«Schiefer», sagte ich, aber er verstand mich nicht. Ich schraubte weiter, und eine Schwester der Göttlichen Vorsehung kam aus der Totenkapelle und stellte sich zu uns.
«Hier nur ein paar, vielleicht nicht einmal die Richtigen», übersetzte sie dem Kleinwüchsigen das Schild.
Er nickte und trottete durchs Tor zurück in die Anstalt, das letzte Ufer für jene, die infolge ihres Leidens, ihres Andersseins nirgends sonst einen Platz fanden, wie Dr. Garbini mir erklärt hatte. Der Direktor war noch in der Hauptstadt geblieben, wo er an der Universität eine Vortragsreihe über Epilepsie halten musste. Wir hatten uns wenige Tage zuvor am Bahnhof Roma Termini verabschiedet.
Einen Tag lang war ich mit ihm zusammen in Rom gewesen, nachdem wir Teramo verlassen hatten. Ich hatte ein Zimmer im Stadtteil Esquilino in einer kleinen Pension bekommen. Dr. Garbini übernahm die Kosten. Noch nie zuvor hatte ich in einer Pension übernachtet, noch nie eine so lange Reise gemacht. Das Zimmer hatte ein Bett und einen wackeligen Stuhl. Ich nahm den Stuhl für die Nacht, denn das Bett war von Wanzen und Läusen besetzt.
Am nächsten Morgen besuchte ich ihn wie verabredet in seinem Hotel in der Nähe der Sapienza. Er stand schon neben dem uniformierten Türsteher vor der Universität und trieb mich sofort zur Eile. «Wir gehen ins Caffè Greco, Cherubino. Gabriele erwartet mich, komm, mein Freund. Wir wollen nicht zu spät kommen, sonst verpassen wir vielleicht etwas!»
Hastig liefen wir durch die Stadt, die seit der Ewigkeit besteht. In den Gassen Roms war der Direktor besser zu Fuß als in den Bergen, ich wunderte mich, in welchem Tempo er sich bewegen konnte. Dieser Gabriele musste ihm sehr am Herzen liegen, wenn er so schnell lief, und die Geschichte der Stadt zog im Laufschritt an mir vorbei. So viele Menschen. In jedem Haus lebten mehr Leute als in ganz Castelluccio, auf jeder Piazza waren mehr Menschen zu sehen, als Teramo Einwohner hatte. Teramo war bis jetzt die größte Stadt gewesen, die ich je besucht hatte, aber was war Teramo gegen Rom?
Schließlich erreichten wir die Via Condotti, und als wir eintraten, war ich sprachlos, wie prunkvoll das Caffè war und wie fein die Herren, die aus feinstem Porzellan Espresso tranken. Ein Kaffeepalast, und Dr. Garbinis Freund Gabriele schien der Herrscher dieses Palastes zu sein. Er war zierlich und hatte eine Glatze, ein Auge war von einer schwarzen Augenklappe bedeckt.
«Schau ihm nicht auf den kahlen Schädel, er ist da empfindlich», hatte Dr. Garbini mich vorgewarnt, als wir die Spanische Treppe hinunterliefen. «Er hatte früher wundervolles Haar, nach einem Duell ist er dann kahl geworden.»
Ich blickte ihn fragend an, aber er konzentrierte sich auf die Stufen. Ein Duell, bei dem man seine Haare verlor? Was für ein Hieb mochte das gewesen sein? Weil ich nichts entgegnete, klärte der Direktor mich auf. «Ein Spötter hatte ihn Bachstelze auf Frauenjagd genannt und Gabriele damit tödlich beleidigt. Also forderte er ihn heraus. Mit dem zweiten Hieb hat der andere D’Annunzio schwer am Kopf verletzt und mehrere Millimeter tief in den Schädel geschnitten. Leider war nur ein ausgesprochen schlechter Arzt anwesend; um die blutende Wunde zu stillen, behandelte er sie mit Eisenchlorid. Eisenchlorid! Ein Esel von einem Arzt! Die Wunde hörte zwar auf zu bluten, aber auf beiden Seiten der Narbe begann das Haar auszufallen. Es fiel und fiel und wuchs nicht mehr nach. Das Eisenchlorid hatte die Haarwurzeln zerstört. Schau ihm also nicht aufs entblößte Haupt, sondern in seine wachen, schnellen Augen. Er ist faszinierend!»
Neben Gabriele D’Annunzio saß eine schöne Dame, und als wir an den Tisch kamen, hörte ich ihn sagen: «Madame, la beauté future sera chauve!» Sie war wohl Französin und lachte amüsiert. «Die künftige Schönheit wird eine kahle sein», rief er in den Raum, und als er Dr. Garbini sah, sprang er auf, um ihn unter Ausrufen der Freude zu umarmen.
«Guido! Mein Bezwinger kranker Seelen, Samariter der Schwermütigen. Hast du uns einen melancholischen Irren vom Gran Sasso mitgebracht?» Er schaute mich an. «Den die schlafende Schöne abgewiesen hat und der nun in einem Kerker des Trübsinns lebt?»
Alle am Tisch blickten mich an, wie Besucher der Anstalt in Teramo die Kranken in den Isolationszellen durch den Spion angegafft hatten. Mir wurde mit einem Mal schmerzhaft meine bäuerliche Kleidung bewusst. Ich nahm die Mütze ab und wurde rot.
«Das ist Cherubino, mein eifrigster Schüler. Ein Pfleger aus Teramo, der mit mir zusammen in den Norden gehen wird.»
«In unseren Norden, immerhin. Dieser verkrüppelte Frieden! Hast du meine Römische Rede gehört? Wie ich den amerikanischen Präsidenten beleidigt habe? Über Wilsons berühmtes Lächeln mit 32 falschen Zähnen und sein langes Pferdegesicht sprach?» Er lachte so herzhaft, dass seine Augenklappe verrutschte. «Und wie Orlando sich als Hure auf Wilsons Gemächt setzt? Der lahme amerikanische Gaul, der gar nicht Freier sein will? Zwei Impotente im Liebesrausch!»
Ich verstand kein Wort. Aber Dr. Garbini schlug ihm anerkennend auf die Schulter. Wir setzten uns. Ich hatte noch nicht gefrühstückt und nahm mir ein Cornetto aus dem Korb.
Die Französin hieß Claudette, ein Herr, der ebenfalls am Tisch saß, wurde mir als Signor Marinetti vorgestellt. Er hatte lustige, bewegliche Augen, einen dunkelbraunen Schnurrbart, war muskulös und hatte eine kräftige Stimme. Wenn er sprach, schien ein Sturzbach aus Worten aus seinem Mund zu kommen, der von einem dunkelbraunen Schnurrbart umrahmt war. Er war gutaussehend und machte merkwürdig katzenartige Bewegungen, als er nun zu sprechen begann.
«Dein Schnauzbart wird immer imposanter, Guido. Du könntest Gabrieles Schädel nach jeder Rasur zweimal bedecken», sagte er, während D’Annunzio neben ihm schaute, als habe jemand seine Mutter ermordet.
Ein anderer, schlanker Herr erklärte der Französin, wie er sich das zukünftige Italien vorstelle.
«Claudette, ich träume von einer Industriestadt mit Wohnhäusern und Fabriken, ohne Bäume und Parks, nur noch Zement und Stahl!»
«Oh», sagte die Französin.
«Im Andenken an Antonio, der für diese Vision 1916 in Monfalcone sein Leben gab.»
«Sant’Elia?», fragte die Französin.
«Ja, er ist tot noch lebendiger als dieser verknöcherte Paragraphenreiter Orlando und all die anderen Professoren. Wir werden die Toten, die Alten und die Opportunisten zugunsten der kühnen Jugend entmachten!» Er erhob sich und hielt sein Glas in die Höhe, in dem kein Espresso war.
«Auf Antonio!»
«Auf Antonio!», riefen auch die anderen. «Und auf Boccioni!» D’Annunzio ergänzte lachend: «Der sich freiwillig zu einem Radfahrbataillon meldete und bei Verona bei einer Übung vom Pferd fiel und als erster Futurist den Heldentod starb!»
Marinetti sprang auf: «Baut eure Städte an den Vesuv! Seid Räuber und Eroberer!»
«Nietzsche?», fragte die Französin, und ich wusste nicht, ob das ein französisches Wort war.
Marinetti nickte, nahm sich das letzte Cornetto aus dem Korb auf dem Tisch und setzte sich wieder. Schade.
«Nietzsche! Wir stellen diesem griechischen Übermenschen, den er will, einen Feind der Bücher entgegen, einen Schüler der Maschine, denn auf das Reich des Menschen folgt das Reich der Motoren», sagte er kauend. «Der Mensch der Zukunft ist ein Erzieher des eigenen Willens. Seine Inspiration ist von leuchtender Klarheit, und seine Berechnungen sind blitzartig. Er ist mit der Witterung der Katzen ausgestattet, mit einem wilden Instinkt, mit Intuition, List und Verwegenheit.» Er schluckte den Rest des Cornettos hinunter. «Die Welt stinkt vor Wahrheit, aber es ist alte, verfaulte Weisheit», sagte er und hustete, weil ihm ein Brösel im Hals stecken geblieben war.
Ich schlug ihm auf den Rücken, und er blickte mich irritiert an. «Ist er gutmütig?», fragte er den Direktor.
«Er ist kein Irrer. Cherubino ist Pfleger. Er wird in Pergine als Capo arbeiten.»
«Cherubino», murmelte D’Annunzio. «Zeigt nicht schon dieser Name Italiens Überlegenheit im Ästhetischen?» Er wiederholte meinen Namen. «Che-Rubino.»
«Jaja», sagte Marinetti. «Wichtig ist nur, diesem greisen Italien der Altwarenhändler und Bibliotheken in die runzelige Fresse zu schlagen!»
«Genau», brüllte der schlanke Mann begeistert. «Und die stinkigen Kanäle Venedigs schütten wir zu und bauen dort aus Eisen ein … egal, irgendwas!»
Nun standen alle auf, bis auf die Französin, und sprachen gemeinsam ein Gebet, das ich in Castelluccio nicht in der Kirche gehört hatte und auch nicht in Teramo von der Oberin und ihren Pinguinen.
«Wir wollen preisen die angriffslustige Bewegung, die fiebrige Schlaflosigkeit, den Laufschritt, den Salto mortale, die Ohrfeige und den Faustschlag!»
Die Französin sagte dazu etwas in ihrer Sprache. Die Herren nahmen ihre Mäntel, warfen Geld auf den Tisch, dann verließen wir das Lokal. Wir zogen durch die Straßen, die Herren diskutierten angeregt, und mein Magen knurrte, es war Mittag. Bei der Piazza del Popolo prügelten sich junge Männer mit roten Fahnen und solche mit der Trikolore. Marinetti lenkte uns in eine Seitenstraße.
«Wohin gehen wir?», fragte ich den Direktor.
«Mittagessen», antwortete er. «Und stell dir vor, Cherubino! Marinetti erzählte mir gerade etwas Wunderbares. Die Insassen des Turiner Irrenhauses haben den futuristischen Kollegen ihre Sympathien ausgedrückt!»
«Wir müssen Mut und Stolz aus dem billigen Vorwurf der Verrücktheit schöpfen, mit dem man die Neuerer geißelt und knebelt! Irrenhaus, Irrenhaus! Bravo!», rief der schlanke Mann, den die anderen Ugo nannten. Er sei Maler, erklärte er mir, als ich ihn verständnislos anstarrte, wolle aber nur malen, was noch nie gemalt worden sei, in Farben, die noch niemand kenne.
«Also malen Sie nichts?», fragte ich.
«Die Frage ist falsch», sagte er, nannte mir aber keine Frage, die richtig gewesen wäre, stattdessen brüllte er drei verschreckt schauende ältere Damen mit großen federbesetzten Hüten an, die uns auf dem Trottoir entgegenkamen. «Platz der Jugend, den Gewalttätigen, den Verwegenen!»
«Es lebe das Erdbeben!», rief Marinetti begeistert, und ich verstand seine Begeisterung nicht. Ich erinnerte mich noch gut an das Erdbeben von 1915. Es war früh am Morgen gewesen, als die Erde zu zittern begann und wir aus unserem kleinen Haus in den Schnee liefen, der zu explodieren schien. «Die Welt stürzt ein», rief meine Mutter und warf sich auf mich, als könne sie mich so vor der bebenden Erde schützen, aber ich spürte die Gefahr unter mir, das Brodeln des Bodens und hörte, wie das Haus der Giordanis einstürzte, das Schreien des alten Giuseppe Giordani, der mir das Angeln beigebracht hatte und jetzt unter den Trümmern seines Hauses begraben lag. Mehr als 30000 Menschen waren an diesem Morgen gestorben, die Stadt Avezzano hatte das Erdbeben völlig zerstört.
«Erdbeben sind nicht gut», sagte ich. Marinetti blickte mich an, als hätte ich ihm einen Fisch von seinem Haken gestohlen. «In Castelluccio bebt die Erde oft und macht uns Angst.»
«Die Erde bebt aus Zorn über die Dummheit der Alten», rief Marinetti. «Sie will uns aufwecken, und sie hat es geschafft. Wir Futuristen sind endlich wach und wecken jetzt den Rest Italiens!»
Bei einer Trattoria kehrten wir ein. Die Gäste aßen Pasta, und ich hörte meinen hungrigen Magen vor Vorfreude jubeln. Aber wir gingen durch das Lokal hindurch zu einer schmalen Treppe, die in einen dunklen Keller führte. An einem langen Tisch saßen zwei Männer ohne Teller, dafür mit Gläsern und Flaschen. Der Direktor machte uns bekannt miteinander, einer hieß nur Corrado, der andere Libero Altomare. «Das ist sein Futuristenname», sagte Dr. Garbini, «früher, als er noch bei der Eisenbahn gearbeitet hat, hieß er Remo Mannoni.»
«Und der ist ein Exemplar aus deinem Irrenkäfig? Bravo!», rief der Mann, der seinen Namen geändert hatte. Ob der Direktor vielleicht früher einmal Insassen der Klinik in Rom zur Schau gestellt hatte, dass alle glaubten, ich gehöre zu seinen Verrückten?
«Ich bin aus Castelluccio», sagte ich dem Bahnbeamten.
«Als sei das ein Garant dafür, nicht verrückt zu sein», lachte Corrado. «Mr. Pink, setz dich zu uns!»
Warum auch immer Marinetti sich angesprochen fühlte, er hockte sich zu dem Mann mit der wilden Lockenmähne.
«Hier werde ich die Taverna del Santopalato gründen, die Taverne zum heiligen Gaumen», sagte Corrado. «Wenn sie fertig ist, wird sie wie das Innere eines U-Bootes aussehen.»
«Das klingt vielversprechend», sagte Marinetti. «Und was wird in deinem U-Boot gegessen?»
Corrado machte eine ausladende Armbewegung. «Luftspeisen.»
«Luftspeisen?», fragte D’Annunzio, und seine Augen leuchteten. Ich wusste von dem Direktor, dass der Mann mit der Augenklappe ein begeisterter Flieger war und im Krieg über Wien nicht Bomben, sondern Flugblätter abgeworfen hatte. 50000 Exemplare, bedruckt mit der italienischen Flagge und einem Text, den D’Annunzio selbst verfasst hatte. Direktor Garbini konnte mehrere Sätze aus dem Gedächtnis zitieren.
Wiener! Lernt die Italiener kennen. Wenn wir wollten, wir könnten ganze Tonnen von Bomben auf eure Stadt hinabwerfen, aber wir senden euch nur einen Gruß der Trikolore, der Trikolore der Freiheit. Wiener! Man sagt von euch, dass ihr intelligent seid, jedoch seitdem ihr die preußische Uniform angezogen habt, seid ihr auf das Niveau eines Berliner Grobians herabgesunken, und die ganze Welt hat sich gegen euch gewandt! Hoch lebe die Freiheit! Hoch lebe Italien!
«Aber auf Italienisch? Können die Wiener denn Italienisch?», hatte ich ihn gefragt.
«Nein, kein Wort, darum ging es doch nicht. Der Flug war ein Exempel der unserer italienischen Rasse eigenen Energie. Wir waren überlegen und konnten in ihrem Luftraum machen, was wir wollten. Unangefochten!»
«Und sein Auge?», fragte ich.
«Ein Flugunfall. Gabriele ist ein Hasardeur. Es ist einfacher, den Wind einzufangen als ihn. Ein Dichter und Führer. Er hat den Kampfruf der Militärpiloten umgedichtet. Früher haben sie ip, ip, ip, urrah gerufen», sagte er naserümpfend.
«Und jetzt?»
«Eia, Eia, Eia! Alalà! Ein antiker Ruf. Die Größe des alten Rom übersetzt Gabriele in die Größe des künftigen Italiens!»
Aber jetzt im Keller der Trattoria sprach der Fliegerheld unter dem Beifall der Anwesenden abfällig über Pasta. Nur die Französin klatschte nicht, entweder war sie zu hungrig oder ihr Italienisch zu schlecht.
«Pasta asciutta ist eine Speise, die man hinunterschlingt, ohne zu kauen», sagte D’Annunzio und verzog sein Gesicht, als hätte man ihm eine Zitrone im Gaumen ausgepresst. «Das führt zu Schlappheit, Pessimismus, nostalgischer Untätigkeit und Neutralismus. Die Verteidiger der Pasta asciutta tragen eine Kugel im Magen, wie Zuchthäusler oder Archäologen. Die Pasta ist außerdem unmännlich, weil der beschwerte und beengte Magen niemals der physischen Begeisterung für die Frau und die Möglichkeit, sie geradewegs zu besitzen, förderlich ist.»
Er schnappte sich eine Flasche Lambrusco, rief: «Der Treibstoff der Futuristen!», und entkorkte sie. «Wir haben», fuhr er nach einem großen Schluck fort, «einen neuen Gegner unserer futuristisch geprägten Zukunft. Zweimal täglich lähmt dieser Gegner die Italiener und droht sie zu vernichten. Ist dieser Gegner der Kommunismus? Nein, es sind die Spaghetti, diese absurde Religion der italienischen Gastronomie. Aber was wird es in deiner Taverna del Santopalato geben, Corrado?»
«Ein Fenchelviertel, eine Olive, eine kandierte Frucht und einen Berührungsapparat», zählte Corrado das Angebot seines zukünftigen Lokals vor. «Man schluckt erst die Olive herunter, dann die Frucht, dann den Fenchel. Gleichzeitig führt man die Kuppe des Zeigefingers und des Mittelfingers der linken Hand mit großer Zartheit an dem rechteckigen Apparat vorbei, der aus einem Flecken von rotem Damast, einem Viereck von schwarzem Samt und einem Stückchen Schleifpapier zusammengesetzt ist.»
Bravos wurden gerufen, und während mein Hunger ins Unerträgliche wuchs, wurden weitere Gerichte der Speisekarte der Taverne von Corrado eingefordert.
«Gerne. Ein Gericht werde ich Ultramännliches nennen. Wir werden uns hier nicht in eingehenden Erläuterungen verbreiten. Es wird genügen hinzuzufügen, dass es sich um ein Gericht für Damen handelt.»
Alle blickten Colette an, die lächelte, als wünschte sie sich nach Paris zurück, zu einem Topf voll Pasta.
«Weiter, Corrado, weiter. Uns läuft das kristallklare Wasser im Mund zusammen!»
«Wie wäre es mit exaltiertem Schwein? Eine normale gekochte Salami, eingetaucht in eine konzentrierte Lösung von Espresso-Kaffee und mit Eau de Cologne angerichtet.»
Marinetti klatschte begeistert in die Hände. «Das ist mein Gericht! Nicht umsonst nennt man mich Koffein Europas.»
«Je ne sais pas», sagte Colette. «Ich bin ein Kind der französischen Cuisine, und Eau de Cologne ist ein Wasser der Primitiven.»
«Dein Napoleon hat es benutzt», rief D’Annunzio. «Auch wenn ich dir recht gebe, Colette. Ich bevorzuge momentan Crab Apple und Borgia für meinen Körper. Aber ich bin ja auch kein exaltiertes Schwein!»
Jetzt erst wurde mir bewusst, dass es D’Annunzio war, den ich überall roch. Selbst auf der Straße, als er meterweit vor mir ging. Der Keller dunstete wie ein Flakon Eau de Toilette, der Tisch war von einer Duftwolke umhüllt. An der Wand hing eine Uhr.
«Geht die richtig oder ist sie auf Zukunft eingestellt?», fragte ich den Direktor. Er schien vom Lambrusco und von der ausgelassenen Runde selig beschwipst und zog seine Taschenuhr.
«Die Zeit stimmt. Diese Wanduhr ist noch nicht so weit, sie gibt noch die alte Zeit an, doch ihre Zeit läuft ab, ist das nicht herrlich?», fragte er mich, aber ich war froh, dass die Uhr noch die richtige Zeit anzeigte.
Weil ich zum Bahnhof musste, verabschiedete ich mich von Dr. Garbini. Die anderen bemerkten meinen Aufbruch gar nicht, so vertieft waren sie in ihre Gespräche, die für mich völlig unverständlich waren. Nur die Französin schien mir sehnsüchtig hinterherzuschauen. Wahrscheinlich dachte sie, ich würde ins nächstgelegene Lokal gehen und mir ein Nudelgericht bestellen.
In einer kleinen Osteria am Bahnhof kaufte ich mir eine Salami ohne Duft, ein Brot und ein paar Oliven. Der Zug nach Padua war schon auf dem Gleis eingefahren. Im Bahnhofsgebäude standen Kinder bettelnd vor bettelnden Kriegsinvaliden, Witwen und Greisen. Der Krieg hatte aus Italien einen Bettler gemacht. Ich gab einem kleinen Mädchen, das sein Geschwisterchen auf dem Arm hielt, ein Stück von meinem Brot und meiner Salami.
Ein Mann lief schreiend an den Zügen vorbei und entkleidete sich dabei. Ein Soldat offenbar. Ich kannte solche Fälle aus Teramo. Der Zug brachte ihn in seiner Fantasie an die Front zurück, und seine Kleidung war die Uniform, die er verzweifelt abzustreifen versuchte. Niemand nahm Notiz von ihm, und drinnen im Zug beachtete niemand die Kriegszitterer. Die gab es ja überall.
In Padua stieg ich um in den Zug nach Verona, dort wiederum in den nach Trient. Einen Tag und eine Nacht war ich insgesamt unterwegs in den Wirren unseres Nachkriegslandes. Vom Bahnhof Trient ging ich zweieinhalb Stunden zu Fuß nach Pergine. Die letzten Kilometer nahm mich freundlicherweise ein Bauer in seinem Eselskarren mit.
Er hustete stark. Wahrscheinlich Pellagra, die Ursache für Demenz, Nervenschwächungen und alle möglichen anderen Beschwernisse, die schwarze Zungenseele. Das ist die Maispolenta, sagte Dr. Garbini. Zu viel Mais, zu wenige Vitamine, davon nährt sich die Schlange Pellagra. Bei dem Bauern schienen die Symptome aber leicht zu sein. In ihm sah ich keinen neuen Patienten, nur einen einfachen Mann, der nach Kriegsende vom Österreicher zum Italiener geworden war.
Vor uns lag das Valsugana-Tal, meine neue Heimat. Der Alte hielt die Zügel in der Hand, und wir holperten schweigend über die schlechten Wege. Gezauste Obstbäume mit löchrigen Kronen säumten den Weg, mächtige Berge umgaben das Tal. Von dort oben hatte das Deutsche Alpenkorps heruntergeschossen, auf die Hochebene von Lavarone über der Astico-Schlucht. Ich blickte zu den zahlreichen monströsen Festungen auf beiden Seiten des Weges empor.
«Hier war die Grenze», nuschelte der Alte, und sein ausgemergelter Esel bog nach links ab, auf deren Seite, die jetzt auch uns gehörte. Er sprach einen Dialekt, den ich kaum verstehen konnte. Richtiges Italienisch war das nicht, aber er und seine Leute hatten viele Jahre mit den Habsburgern zusammenleben müssen und ein merkwürdiges Bergitalienisch entwickelt.
«Wer schießt denn auf Obst?», fragte ich ihn, als wir an einem explodierten Apfelbaum vorbeikamen.