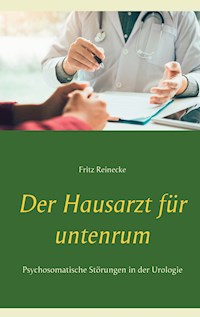
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Es geht um Krankheitsbilder, über die Männer nicht gerne sprechen und die in der Gesellschaft tabuisiert werden: Psychosomatik in der Urologie; psychosoziale Aspekte sexueller Funktionsstörungen; Aktivierung von Selbstheilungskräften; die Arzt-Patienten-Beziehung, Umgang mit bösartigen Tumoren, z.B. Prostatakarzinom; Was tun, wenn das Leben zu Ende geht? Die Beiträge geben einen Einblick, wie Ärzte und Patienten für eine andere Sichtweise auf Krankheit sensibilisiert werden können.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 166
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
In Memoriam Cornelia
Dr. Fritz Reinecke, Facharzt für Urologie und Psychotherapie, war 30 Jahre lang als Urologe in eigener Praxis tätig. Anschließend folgte eine 15-jährige privatärztliche psychotherapeutische Beratertätigkeit in der urologischen Abteilung der Asklepios Klinik Hamburg-Barmbek.
Inhalt
EINFÜHRUNG
INTERVIEW
PSYCHOSOMATIK IN DER UROLOGIE
Konflikte im kleinen Becken
Hyperaktivität und überaktive Blase im Spiegel der Psychosomatik
Warum weinen Kinder durch die Blase?
Das hilflose innere kleine Kind in Gestalt eines 2,04 Meter großen hünenhaft und kräftig wirkenden Mannes
Fachbezogene Psychosomatik in der urologischen Klinik
Wer viel trinkt, muss viel zur Toilette!
Der wunde Punkt
Was haben chronische Prostatitis und interstitielle Cystitis gemeinsam?
Nicht der Text, sondern der Kontext entscheidet
Wie subjektive Einstellungen Krankheitsgefühle prägen
Hilflosigkeit und Verzweiflung – Was ist jetzt zu tun?
Die Schwierigkeiten von Migranten, sich in der neuen Umgebung zurechtzufinden
SEXUELLE STÖRUNGEN
Erektile Dysfunktion – Somatischer Defekt oder lädierte Männlichkeit?
Impotenz und Viagra
Wenn Gefühle überfordert werden, hilft kein Viagra
Vorzeitiger Samenerguss – Serotoninmangel oder Beziehungsstörung?
Erektile Dysfunktion – Ausdruck einer lädierten Männlichkeit?
Wie viel Emanzipation braucht der Mann – Oder die deprimierte Männlichkeit
Männer von heute: Das schwache Geschlecht?
PATIENTEN MIT BÖSARTIGEN TUMOREN
Was tun, wenn das Leben zu Ende geht? Kommunikation mit Tumorpatienten
Panikattacke als Folge einer Krebsdiagnose
Die Lebensqualität bei Patienten mit Prostatakarzinom
Die Entfernung der Harnblase als lebensrettende Maßnahme
Woran sterben wir, an der Diagnose oder am Tumor?
Meine Meinung zur zweiten Meinung
Penile Rehabilitation ist ein Zusammenspiel aus Körper und Psyche
Abwarten und zurückhaltend agieren als Behandlungsalternative
Zusammenarbeit mit Selbsthilfegruppen
Leben und sterben – Wo ich hingehöre
I. EINFÜHRUNG
Volksmeinungen und intuitives Wissen treffen die Wahrheit über ein Geschehen oft genauer als medizinische Untersuchungen. „Wenn wir uns vor Angst in die Hose machen“, handelt es sich nicht um ein urologisches Inkontinenzproblem. Wir müssen die Ursache klären und Lösungen finden, wie die Angst zu beheben ist. Nur so ist es möglich, das unangenehme Symptom der Inkontinenz zu unterbinden.
Jeder weiß, was gemeint ist, wenn wir sagen: „Das geht mir an die Nieren“. Selten sind krankhafte urologische Veränderungen ursächlich. Viel häufiger können Patienten die umweltbedingten Belastungen nicht mehr (er-)tragen. Auch hier müssen weniger belastende Lösungen gefunden werden. Aus unterschiedlichen Blickwinkeln wird in den Beträgen dieses Buches veranschaulicht, wie psychogene Veränderungen (Alterationen) körperlich zu spüren sind und krankmachend gedeutet werden.
Die Harnblase ist ein Organ, mit dem wir Druck ablassen. Ist ein Harnwegsinfekt oder eine Blasenentleerungsstörung ausgeschlossen, wird selten an die Möglichkeit gedacht, dass auch psychogener Druck ursächlich für den ständigen Druck im Bereich der Blase sein könnte.
Selbst stressbedingte Belastungen aus der Vergangenheit sind hier von Bedeutung. Viele von uns gehen lieber vor einer Veranstaltung schnell noch einmal zur Toilette, um die Blase zu entleeren, weil sie sich unbewusst daran erinnern, wie unangenehm es sein könnte, eingepfercht in einer Kinoreihe zu sitzen, wenn eine volle Blase drängt, entleert zu werden.
Wie psychosoziale Konflikte nicht nur zu funktionellen Störungen, sondern auch zu körperlichen Beschwerden führen können, wird in einzelnen Beiträgen und anhand von Fallgeschichten in diesem Buch erläutert.
Wir sind als soziale Wesen in einer Gemeinschaft darauf angewiesen, die Gefühle von anderen wahrzunehmen, weil die Kommunikation mit anderen vorrangig auf emotionalem Weg und wesentlich weniger auf rationalen Wegen stattfindet. Sind andere traurig und beginnen zu weinen, ist es schwierig, sich den Gefühlen zu entziehen. Ähnlich wirken sexuell stimulierende Gefühle und bewirken die gewünschten sexuellen Funktionen. Ein liebevolles Aufeinanderzugehen ist oft wirksamer als die Reparatur von vermuteten körperlichen Defekten, wie anhand von Beispielen gezeigt wird.
Es wird erläutert, wie sexuelle Funktionen als körperliche Reaktionen auf sexuell stimulierende Gefühle entstehen wie beispielsweise Weinen eine somatische Reaktion auf ein Gefühl von Traurigkeit bedeutet und nicht als eine Überfunktion der Tränendrüsen einzustufen ist. So können bei Gefühlen von Angst, den Erwartungen nicht zu entsprechen, sexuell stimulierende Gefühle verdrängt werden und die davon abhängigen sexuellen Funktionen nicht zustande kommen.
Ständige Sorgen schwächen das Immunsystem, das nicht nur vor krankmachenden Faktoren schützt, die von außen kommen, es übernimmt auch eine schützende Funktion bei Veränderungen, die im eigenen Organismus stattfinden. Es kommt fortwährend zu Umbauprozessen, indem nach einem genetisch festgelegten Muster durch Zellteilungen ständig neue Zellen entstehen. Fehlerhafte Zellteilungen machen die Bildung von „bösartigen“, also Krebszellen nicht nur möglich, sondern diese Abläufe vollziehen sich jederzeit. Für ein gesundes Immunsystem ist es kein Problem, derartige Unregelmäßigkeiten zu korrigieren.
Es wird aufgezeigt, wie Krebserkrankungen verhindern werden können, wenn wir nicht nur schädigende Umweltfaktoren, sondern auch seelische Belastungen meiden. Frauen, die an Brustkrebs erkrankt sind, wird geraten, den Mann zu wechseln. Zudem erkranken Frauen, die von ihren Männern geliebt werden, wesentlich seltener an Brustkrebs.
Die Beiträge werfen einen anderen Blick auf das Arzt-Patienten-Verhältnis. Ärzte glauben immer zu wissen, was den Patienten fehlt, und empfehlen eine Therapie, deren Anwendung auf der eigenen subjektiven Sichtweise und auf individuellen Erfahrungen basiert und die daher als richtig angenommen wird.
Dabei sind Ärzte jeweils nur Experten für Erkrankungen. Im Gegensatz dazu sind Patienten und bleiben, solange sie bei klarem Verstand sind, Experten für ihren individuellen Organismus, den keiner besser kennt als sie selbst. Das, was diese beiden Experten mit jeweils einer anderen Perspektive verbindet, ist die jeweilige Krankheit.
Ärzte im Umgang mit Erkrankungen verfügen über Erfahrungen und empfehlen im Gespräch eine Therapie, die für Patienten hilfreich sein könnte. Patienten sollten bei Ärzten Gefühle dafür entwickeln, dass Ärzte merken, was ihren Patienten gut tun könnte. Dabei sollte Aufklärung als ein langwieriger Prozess in Gang kommen, der erst endet, wenn in einem so gestalteten Aufklärungsgespräch Patient und Arzt als Experten für unterschiedliche Bereiche eine Lösung gefunden haben, die von beiden Seiten gleichermaßen akzeptiert wird. Nur so kann es zu einer vertrauensvollen Arzt-Patienten-Beziehung kommen, die eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine erfolgreiche therapeutische Intervention ist.
Wie lassen sich Selbstheilungskräfte aktivieren?
Vertrauen und der Glaube an den Erfolg der gewählten Therapie sind für Patienten wichtige Faktoren, die zusammen individuelle Selbstheilungskräfte mobilisieren. Die Aktivierung von Selbstheilungskräften ist bei Therapieerfolgen von enormer Bedeutung und wird häufig unterschätzt.
Ich erwarte, dass behandelnde Ärzte die subjektive Entscheidung der Betroffenen geduldig abwarten, auch wenn objektiv die Indikation für einen Eingriff bereits gegeben ist. Bei Patienten darf nicht der Eindruck entstehen, dass er zu einem therapeutischen Eingriff überredet worden ist. Eventuell auftretende Komplikationen sind wesentlich besser zu verkraften, wenn sich der Patient selbst für den Eingriff entschieden hat.
Was ist zu tun, damit Patienten die besondere Fürsorge nicht nur spüren, sondern Ärzte auch dazu verpflichtet sind, ihre Bemühungen ständig zu verbessern?
Bei invasiven Eingriffen ist es unumgänglich, dass der ausführende Arzt sein Vorgehen ausgiebig mit Betroffenen in einem persönlichen Gespräch darlegt. Wenn Patienten anderen Personen die Kontrolle über ihren Körper überlassen, ist absolutes Vertrauen in diese Person wichtig. Nur in einem persönlichen Gespräch ist es möglich, die notwendige Vertrauensbasis herzustellen.
Ärzte, die in ihrer Funktion bei Patienten intervenieren, sollten nur aktiv werden, wenn sie absolut sicher sind, dass ihr Vorgehen die Gesundheit und Lebensqualität des Patienten verbessert. Wenn diese Voraussetzung nicht gegeben ist, müssen Ärzte die geplante Intervention ablehnen. Sie handeln unethisch, wenn Ärzte aus anderen Gründen agieren, als dem Patienten zu helfen. Sind besorgte Angehörige involviert, sollten sie über den Erfolg bei Eingriffen umgehend informiert werden.
Es wird aufgezeigt, wie wichtig es ist, während des Arztgesprächs die Emotionen des Patienten zu berücksichtigen. Der alleinige Austausch von Informationen ist nicht ausreichend. Arzt und Patient müssen in Beziehung treten und es fortwährend bleiben. Ärzte müssen lernen, mit den Gefühlen ihrer Patienten umzugehen. Viel zu häufig werden von Ärzten die Gefühle ihrer Patienten ignoriert.
Es darf nicht die Situation eintreten, dass Patienten mit Ängsten und Sorgen zurückgelassen werden. Die menschliche Zuwendung ist von allergrößter Wichtigkeit. Es wird darauf hingewiesen, dass bei der Aufklärung in kleinen Schritten vorzugehen ist, weil sich Patienten bei zu vielen Information häufig überfordert fühlen.
Ärztliches Handeln sollte in schwierigen Situationen immer eine begleitende Funktion einnehmen und letztlich sollten Ärzte auch die Rolle eines „Seelsorgers“ übernehmen.
Auch wenn keine Therapie mehr möglich ist, beginnt die eigentliche ärztliche Tätigkeit: Dem Patienten begleitend dabei zu helfen, diese Welt in Würde zu verlassen. Leider fehlt dieser wichtige Punkt in der Ausbildung von Ärzten, ist aber von eminenter Bedeutung und sollte in keinem Weiterbildungspragramm der Zukunft fehlen.
In den einzelnen Beiträgen werden unabhängig voneinander Störungen im unteren Körperbereich nach unterschiedlichen Gesichtspunkten dargestellt. Jeder Beitrag steht für sich und kann auch als solcher unabhängig von anderen Beträgen gelesen werden. Dabei sind Wiederholungen wichtiger Fakten ausdrücklich erwünscht.
II. INTERVIEW
Sieben Fragen an Dr. med. Fritz Reinecke, Facharzt für Urologie und Psychotherapie aus Hamburg, der nach 30-jähriger Tätigkeit in eigener Praxis im Alter seine berufliche Erfüllung als privatärztlich tätiger Psychotherapeut gefunden hat.
Herr Dr. Reinecke, warum haben Sie sich für das Fach Urologie entschieden?
Fasziniert haben mich vor 45 Jahren die diagnostischen Möglichkeiten in der Urologie zu einer Zeit, in der es noch keine Sonografie, Computer- oder Magnetresonanztomografie gab. Die Endoskopie in Verbindung mit der Radiologie ermöglichte einerseits eine exakte somatische Diagnostik, andererseits ist aber auch viel Einfühlungsvermögen erforderlich, um Betroffene mit diesen invasiven Untersuchungsverfahren nicht zu verschrecken.
Wie kam es zu dem Entschluss, sich als Urologe niederzulassen?
Im Verlauf meiner Weiterbildung an der urologischen Universitätsklinik war ich vorrangig in der Poliklinik im Rahmen der ambulanten Diagnostik tätig. Mich hat begeistert, Patienten in ihrer ureigenen Problematik zu erleben und gemeinsam mit den Betroffenen Lösungswege zu finden. Besonders spannend fand ich Patienten, die mit umfangreichen Beschwerdebildern kamen und schon mehrfach andernorts voruntersucht wurden. Herausfordernd war für mich speziell in diesen Fällen, für die jeweilige Problematik zufriedenstellende Lösungen zu finden. Um in diesem Sinne unabhängiger tätig zu sein, bot sich 1976 eine Gelegenheit, eine urologische Praxis in Hamburg zu übernehmen.
Wie sind Sie zu Ihrem heutigen Schwerpunkt der psychotherapeutischen Medizin und Psychotherapie gekommen?
In der eigenen Praxis wurde ich mit Krankheitsbildern konfrontiert, denen ich trotz qualifizierter Weiterbildung glaubte, nicht gerecht werden zu können. Viele Patienten klagten über wiederholt auftretende diffuse Beschwerden ohne entsprechende somatische Befunde. Sensibilisiert durch die Fortbildung „Psychosomatische Grundversorgung“ fiel mir auf, dass diese Beschwerden insbesondere auftraten, wenn belastende Umwelteinflüsse im Vordergrund standen. Die Symptome wurden deutlich weniger, wenn es gelang, für die negativen Umwelteinflüsse andere stressfreiere Lösungen zu finden. Ich entschloss mich zu einer 4-jährigen berufsbegleitenden Weiterbildung in tiefenpsychologisch fundierter Psychotherapie, um diese Erkenntnisse in qualifizierter Form nicht nur diagnostisch, sondern auch therapeutisch nutzen zu können.
Wie wichtig ist aus Ihrer Sicht die Psychosomatik für das Fachgebiet Urologie?
Für mich ist es wichtig, bei Erkrankungen nicht nur nach somatischen Defekten zu suchen, die wie bei Maschinen repariert werden müssen. Es ist immer zu bedenken, dass es sich bei Patienten um Individuen handelt, bei denen auch Konflikte zu körperlichen Beschwerden führen können. Anstatt Symptome medikamentös zu beseitigen, sollten für Probleme und Konflikte andere weniger krank machende Lösungen gefunden werden. Symptome sind keine Defizite, sondern oft wertvolle Hinweise auf die Art einer Störung. So wie sexuelle Lustlosigkeit kein Hormonmangelsyndrom ist, sondern lediglich besagt, dass unter den herrschenden Bedingungen Sexualität keinen Spaß macht.
Wie sieht ihr Arbeitsalltag aus?
Nach 30-jähriger Tätigkeit in eigener Praxis habe ich meine Praxis vor zehn Jahren an einen Nachfolger übergeben. Aufgrund meiner Doppelkompetenz als Facharzt für Urologie und Psychotherapie wurde ich gebeten, auch weiterhin für besondere Fälle zur Verfügung zu stehen. Besonders anerkennend fand ich, dass auch eine Hamburger urologische Klinik diese Kompetenz in Anspruch genommen hat. Auch dort stehe ich wöchentlich einen Nachmittag für Patienten zu Verfügung. Seit Jahren treffe ich mich regelmäßig mit dem leitenden Oberarzt. Gemeinsam suchen wir nach Wegen, um den individuellen Bedürfnissen der Patienten gerechter zu werden. Es ist eine schönes Gefühl, im Alter noch gefragt zu sein, die gemachten Erfahrungen weitergeben zu können und als Belohnung viel Zuwendung zurückzubekommen.
Wie lautet Ihr Arbeitsmotto?
Geprägt durch frühere Erfahrungen reagieren Menschen unbewusst mit individuellen Verhaltensweisen. Eine Erkrankung hat für jeden Betroffenen eine andere Bedeutung. Das sollte bei allen Patienten immer berücksichtigt werden. Auch Ärzte sollten ihr unbewusstes Verhalten reflektieren und die subjektiven Bedürfnisse der Patienten mit einbeziehen. Leitlinien sind hierbei wenig hilfreich.
Wenn Sie noch einmal am Anfang Ihrer Berufsausbildung stünden, gäbe es etwas, das Sie anders machen würden und wenn ja, was wäre das?
Mit der Facharztausbildung würde ich aus heutiger Sicht gleichzeitig eine psychotherapeutische Weiterbildung anstreben. Bei gleichwertiger Berücksichtigung der psychosozialen Aspekte bietet die Urologie in Verbindung mit vielen funktionellen Störungen ein spannendes Fachgebiet. Symptome wie bei einer überaktiven Blase oder partnerschaftsbedingten sexuellen Störungen sind dann wesentlich besser zu verstehen, wenn nicht nur somatische Aspekte berücksichtigt werden.
III. PSYCHOSOMATIK IN DER UROLOGIE
1. Konflikte im kleinen Becken
Ob Reizblase, rezidivierende Harnwegsinfekte, chronische Prostatitis oder Frust mit der Lust – eine ganze Reihe urologischer Krankheitsbilder kann durch psychosoziale Konflikte verursacht sein. Im Folgenden werden die wichtigsten Beispiele von Interaktionen zwischen Psyche und Soma im Urogenitaltrakt beschrieben.
Psychosomatische Beschwerden treten auf, wenn sich psychosoziale Konflikte in körperlichen Symptomen äußern. Wie schon der Volksmund sagt, schlagen Sorgen auf den Magen. Die, die es im Kopf nicht mehr aushalten, bekommen Kopfschmerzen, andere machen sich vor Angst in die Hose. Typisch ist, dass als Erklärung für die Beschwerden kein krankhafter Befund vorliegt. Bei Frauen lauten die Diagnosen: Reizblasensymptomatik oder Rezidivneigung von Harnwegsinfekten; bei Männern: vegetatives Urogenitalsyndrom oder oft fälschlicherweise chronische Prostatitis. Wenig Beachtung findet dagegen der Hinweis, dass funktionelle sexuelle Störungen wie Lustlosigkeit, vorzeitiger Samenerguss und erektile Dysfunktion eine Folge psychosozialer Konflikte sein können.
Zwischen Spannung und Entspannung
Die Blase als Urinreservoir füllt sich bei entspannter Blasenmuskulatur kontinuierlich, ohne das wir etwas davon merken. Eine muskuläre Verspannung im Becken-Boden-Bereich verhindert den unwillkürlichen Urinverlust. Beim Entleeren der Blase kommt es umgekehrt zu einer Anspannung des Blasenmuskels und zu einer Entspannung des Beckenbodens. Man lässt los! Dieser Wechsel zwischen Verspannung und Entspannung im Blasen-Becken-Boden-Bereich ist für vegetative Dysregulationen äußerst anfällig, die von psychosozialen Konflikten ausgehen (z. B. häufiger Harndrang in Stresssituationen).
Die Tatsache, dass wir auf der Toilette unsere Blase entleeren, ist eine Frage der Erziehung. Dabei lernen wir, den Entleerungsreflex zu unterdrücken, bis ein geeigneter Ort für die Blasenentleerung gefunden worden ist. Bei nachlassender Hirnleistung im Alter greift die Erziehung nicht mehr. Wie nach der Geburt wird die Blase reflexartig unkontrolliert entleert. Wir werden wieder inkontinent.
Eine strenge und nicht einfühlsame Sauberkeitserziehung kann zeitlebens das Miktionsverhalten (die Blasenentleerung) beeinflussen. Das Bettnässen (Enuresis) bei Kindern zeigt, welchen Einfluss unser soziales Umfeld auf die Blasenentleerung hat. Ohne somatischen Befund ist das Einnässen als Ringen um Anerkennung und Aufmerksamkeit zu verstehen. Betroffene Kinder „weinen“ durch die Blase. Sie machen so auf ein psychosoziales Problem aufmerksam, das von engen Bezugspersonen ausgeht. Behandelt werden sollte nicht das Symptom bei den Kindern, sondern die Störung im sozialen Umfeld.
Bei nicht vorhandenem Harnwegsinfekt und restharnfreier Blasenentleerung müssen bei Miktionsproblemen psychosoziale Ursachen berücksichtigt werden. Ein Miktionsprotokoll liefert Hinweise auf die Art der Störung: Häufiger Harndrang tagsüber, der ein Durchschlafen nachts erlaubt, muss, weil die Psyche nachts im Schlaf gleichermaßen ruht, eine psychische Ursache haben. Wird nachts mehrmals eine volle Blase entleert, ist eine kardiale Nykturie ursächlich, oder es handelt sich nach dem Motto: Wer viel trinkt, muss viel zur Toilette, um ein abnormes Trinkverhalten.
Dramatische Bemerkungen der Betroffenen wie oft, häufig und ständiger Harndrang sind subjektive Wahrnehmungen und ungenaue Angaben, die mithilfe des Miktionsprotokolls objektiviert werden.
Die psychischen Ursachen bis hin zur Urge- bzw. Dranginkontinenz sind vielfältig und können von erlerntem Fehlverhalten über nicht wahrgenommene und körperlich transformierte Affekte bis hin zu umfassenden seelischen Erkrankungen reichen.
Psychologie der überaktiven Blase
Ursächlich für eine Reizblasensymptomatik können sein:
ein erlerntes Fehlverhalten
Aufgrund einer rigiden Blasenkontrolle und häufigen Blasenentleerungen aus Sicherheitsgründen („Geh lieber noch einmal zur Toilette!“) konnte sich keine ausreichende Blasenkapazität ausbilden. Bereits bei geringen Blasenfüllungen treten Symptome einer vollen Blase auf. Umgekehrt gibt es Patienten mit einer antrainierten sehr großen Blasenkapazität von bis zu 500 ml, die in extremen Fällen nur ein- oder zweimal täglich zur Toilette gehen.
lavierte Sexualstörung
Eine kranke Blase wird sozial besser akzeptiert als eine kranke Sexualität. Betroffene schützen sich mit krankhaft empfundenen Blasenbeschwerden vor nicht gewolltem Geschlechtsverkehr. Das Ziel der Behandlung sollte die sexuelle Störung und nicht die kranke Blase sein.
ins Körperliche transformierter psychischer Affekt
Patienten, die keinen Zugang zu ihren psychischen Affekten wie Ärger, Zorn oder Angst haben, somatisieren die nicht wahrgenommenen Affekte in Form von körperlichen Beschwerden. Gelingt es, den unbewussten psychischen Affekt bewusst zu machen, indem der Patient lernt, darüber zu reden, kommt es zur Desomatisierung.
Kombination mit anderen Miktionsstörungen und vegetativen Dysfunktionen
Miktionsstörungen können in Verbindung mit anderen vegetativen Dysfunktionen wie Migräne, Angstzuständen und allgemeiner Reizbarkeit auftreten.
Kommunikationsprobleme in Partnerschaft und Familie
Der Rückzug auf die Toilette ist ein Appell an den Partner oder die Familienmitglieder nach mehr Rücksicht, Wärme und Zuwendung.
Umfassende seelische Erkrankungen
Patienten, deren seelisches Gleichgewicht gestört ist, reagieren häufig mit somatischen Krankheitserscheinungen in Form von Überregbarkeit auch im Bereich der Blase.
Neigung zu rezidivierenden Harnwegsinfekten:
Aufgrund der kürzeren weiblichen Harnröhre neigen Frauen häufiger zu rezidivierenden Harnwegsinfektionen als Männer. Aufsteigende Infekte sind die Folge einer immunologischen Abwehrschwäche bei Virusinfektionen oder einer verminderten peripheren Durchblutung aufgrund von Kälte (kalte Füße, Frösteln). Außerdem gelangen beim Geschlechtsverkehr Mikroorganismen rein mechanisch von außen in die Blase, die nicht, wie häufig vermutet, vom Partner stammen müssen. Gezielt eingesetzte prophylaktische Maßnahmen sind sinnvoll.
Harnwegsinfekte, die immer am Wochenende, vor einem besonderem Ereignis wie kurz vor einer Urlaubsreise oder in Verbindung mit einem neuen Partner auftreten, sind jedoch auf andere Ursachen zurückzuführen.
Oft lässt sich eine Traumatisierung in der Vergangenheit finden. Die Unsicherheit, von einem Harnwegsinfekt überrascht zu werden, wie sie schon einmal in einer ungewohnten Situation erlebt wurde, bewirkt eine weitere Verunsicherung und macht Angst. Der Stress, einer solchen Situation erneut ausgesetzt zu sein, führt zu einer Verspannung im Becken-Boden-Bereich. Ein nicht entspanntes, unverkrampftes „Loslassen können“ ist nicht möglich und die Ursache für Miktionsbeschwerden wie bei der Reizblasensymptomatik führt aber auch zu aufsteigenden Infektionen bei stressbedingter veränderter Blasenentleerungsdynamik.
Beruhigend und stressreduzierend wirkt ein Antibiotikum, das Patientinnen für Notfälle dabei haben sollten. Sie dürfen jederzeit davon Gebrauch machen. Nicht von Bedeutung ist, wenn eine Tablette unbegründet eingenommen wurde, wichtiger ist, jederzeit auf ein Medikament zurückgreifen zu können. Die Sicherheit der Betroffenen, geschützt zu sein, schafft Erleichterung und reduziert die Rezidivneigung.
Vegetatives Urogenitalsyndrom (chronische Prostatitis)
Im Gegensatz dazu liegt beim vegetativen Urogenitalsyndrom des Mannes keine Infektion vor, obwohl immer wieder eine chronische Prostatitis vermutet wird. Bei nicht vorhandenem Harnwegsinfekt und restharnfreier Blasenentleerung müssen die unklaren verunsichernden ziehenden Unterbauchschmerzen von unterschiedlicher Qualität eine andere Ursache haben.
Wenn danach gefragt wird, fällt auf, dass die Beschwerden besonders in Konflikt- oder Stresssituationen auftreten. Konfliktbedingte Affekte wie Ärger, Zorn, Angst oder Enttäuschungen werden wie bei der Reizblasensymptomatik auf die körperliche Ebene transformiert, und zwar dort, wo früher seelische, aber auch körperliche Traumatisierungen stattgefunden haben. Es sind kriminalistische Fähigkeiten notwendig, um diese Ursachen ausfindig zu machen. Wie wir es von stressbedingten Rückenschmerzen kennen, kommt es im Becken-Boden-Bereich zu Verspannungen oder Verkrampfungen im Sinne einer Beckenbodenmyalgie.
Die Art der Beschwerden im Unterbauch lässt Erkrankungen in unterschiedlichen Fachgebieten vermuten. Bei Ausstrahlung in den Kreuzbeinregion ist der Orthopäde gefragt. Der Proktologe findet Hämorrhoiden bei Ausstrahlung in den Enddarm. Der Chirurg vermutet ein weiche Leiste, wenn die Schmerzen dort auftreten. Patienten haben Angst vor einem Hodentumor, wenn es dort weh tut, oder vermuten eine sexuell übertragbare Erkrankung, wenn Brennen in der Harnröhre beunruhigt. Urologen denkt in erster Linie an Erkrankungen, die von der Prostata ausgehen.
Aufwendige Diagnostikververfahren wie die Cystoskopie, Manometrie, Magnetresonanz- oder Computertomografie verunsichern zusätzlich, besonders, wenn ein vermuteter krankhafter Befund nicht entdeckt wird. Therapeutisch werden Antibiotika verabreicht, die wirkungslos bleiben, weil keine Infektion vorliegt.
Für die Patienten setzt ein Teufelskreis (Circulus vitiosus) ein, weil weder die Diagnostik noch Therapieversuche weiterhelfen können. Patienten sind zusehends ängstlicher und beunruhigter, sodass sich die Schmerzen verstärken.
Eine Linderung bewirkt die glaubhafte Versicherung, dass keine gravierende Erkrankung vorliegt. Wenn es gelingt, über die auslösende Konfliktsituation zu reden, kommt es wie bei der Reizblasensymptomatik zu einer Desomatisierung. Das Thema ist der zu bewältigende innere oder zwischenmenschliche Konflikt. Patienten müssen nicht mehr mit körperlichen Symptomen darauf hinweisen, dass es ihnen nicht gut geht, sie sich nicht wohl oder sich krank fühlen.
Sexuelle Störungen – Der Frust mit der Lust





























