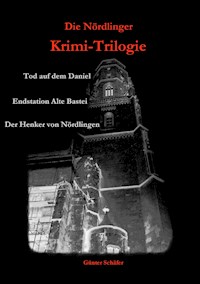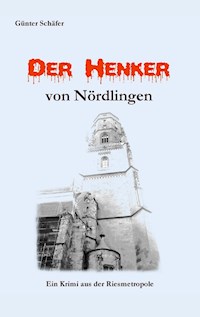
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nachdem im Nördlinger Stadtmuseum der enthauptete Leichnam von Martina Karrer entdeckt wird, beauftragt die Augsburger Staatsanwaltschaft das Ermittlerteam um KHK Robert Markowitsch. Fundgegenstände aus dem Nachlass von Dr. Michael Akebe im Büro der Museumsleiterin wecken Erinnerungen an den Fall des Nördlinger Türmers Markus Stetter, der sechs Jahre zuvor unter mysteriösen Umständen ums Leben kam. Den ermittelnden Beamten der Augsburger Mordkommission stellt sich nun die Frage: Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem aktuellen Mordfall und dem Tod auf dem Daniel?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 188
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort des Autors
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
Vorwort des Autors
Der neue Fall des Augsburger Ermittlerteams. Wie immer eine rein fiktive Story, gespickt mit reellen Bezügen zu Örtlichkeiten aus der Riesmetropole Nördlingen.
Ich möchte hiermit ausdrücklich darauf hinweisen, dass die gesamte Handlung dieser Geschichte mit allen darin vorkommenden Personen ausnahmslos meiner Fantasie entsprungen und somit frei erfunden ist.
Jede Übereinstimmung mit Abhandlungen bzw. lebenden oder verstorbenen Personen wäre rein zufällig und nicht beabsichtigt.
1. Kapitel
Mehr als fünf Jahre lag es nun schon zurück, dass Christine Akebe nach dem tragischen Tod ihres Mannes auch ihren Sohn verloren hatte.
Man sagt zwar immer, die Zeit heile alle Wunden, jedoch musste sie feststellen, dass es sich in ihrem Fall um sehr tiefe Wunden handelte.
Die Bilder über das furchtbare Geschehen wollten einfach nicht verblassen.
Schweren Herzens erinnerte sie sich immer wieder daran, wie es dazu kommen konnte, dass sie ihren eigenen Sohn verraten hatte.
Damals kämpften zwei Seelen in ihrer Brust.
Die eine stand für ihr Gerechtigkeitsempfinden, die andere für die Familientradition ihres Sohnes, ihres verstorbenen Mannes und dessen Angehörigen in Afrika.
Nachdem Michael Akebe durch Zufall herausgefunden hatte, dass der Tod seines Vaters Abedi keineswegs ein tragischer Unfall war, besann er sich auf die alten Zeremonien seiner Vorfahren.
Er machte sich die schwarzmagischen Rituale des Voodoo zu eigen und verschuldete so den Tod mehrerer Menschen.
Christine ahnte damals schon geraume Zeit, dass Michaels Leben aus den Fugen geraten war.
Sie wollte es jedoch erst wahrhaben, als es schon zu spät war.
Letztendlich siegte der Sinn für Gerechtigkeit in ihr. So stellte sie schließlich das Recht auf Leben über das von Rachsucht verblendete Handeln ihres Sohnes.
Als sie festgestellt hatte, dass Michael wieder dabei war, sich mit Hilfe der schwarzmagischen Voodoo-Rituale ein weiteres Mal zum Herrn über Leben und Tod zu machen, verständigte sie die damals ermittelnden Beamten der Augsburger Kriminalpolizei.
Christine selbst kam auf Grund ihres langen Zögerns wegen Mitwisserschaft vor Gericht.
Nachdem jedoch die ganzen Umstände über die Vorgeschichte aufgeklärt waren, erhielt sie ein relativ mildes Urteil mit einer Bewährungsstrafe.
Im Kreise der Familie ihres verstorbenen Mannes stieß das Handeln von Christine Akebe zwar durchaus auf Verständnis, doch rief der Verrat des eigenen Kindes, der sogar dessen Tod zur Folge hatte, bei einigen Familienmitgliedern ihres Mannes auch Unmut hervor.
Christine hatte seit mehr als zwei Jahren keinen Kontakt mehr zu den Verwandten in Afrika.
Sie versuchte so gut als möglich, sich in das Alltagsleben in Nördlingen zu integrieren.
Lange hatte sie mit sich gekämpft, um sich nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch in ihrem Inneren von den Taten ihres Sohnes zu distanzieren.
Sie engagierte sich für wohltätige Zwecke und erreichte, dass sie bei den Mitmenschen der Stadt wieder akzeptiert wurde.
Kürzlich erst konnte sie sich dazu entschließen, den Dachboden wieder zu betreten.
Diesen Ort, an den sie damals die beiden Augsburger Kripobeamten geführt hatte, damit sie gemeinsam dem unheilvollen Treiben ihres Sohnes ein Ende bereiten konnten.
Als sie die Stufen nach oben ging, durchzog ein Schaudern den Körper von Christine Akebe.
Für einen kleinen Moment hielt sie inne, bevor sie mit einem kurzen Druck die Klinke nach unten drückte und die Türe öffnete.
Beim Eintreten durchzogen wirre Gedanken ihren Kopf.
Was würde sie dort drin erwarten?
War die unheilvolle Aura noch vorhanden, die alle Beteiligten zu jener Zeit in ihren Bann gezogen hatte?
Christine schloss für einen Moment die Augen, versuchte irgendetwas wahrzunehmen.
Doch abgesehen von den Alltagsgeräuschen, die von der Innenstadt herauf drangen, war da nichts außer Stille.
Christine Akebe öffnete die Augen und atmete erleichtert aus.
Die von dichten Spinnennetzen verhangenen Dachfenster dimmten die hereinfallenden Sonnenstrahlen wie ein grauer Vorhang.
Es dauerte einige Sekunden, bis sich ihre Augen an das dämmrige Licht gewohnt hatten.
Rechts von ihr stand neben einem alten Schrank ein Besen, den sich Christine nun griff.
Es ist langsam an der Zeit, die Zeichen der dunklen Vergangenheit zu beseitigen dachte sich die Frau und ging auf die beiden Dachfenster zu.
Entschlossen zerstörte sie die bizarren Gebilde der kleinen Dachbewohner, von denen sich einige in den Ecken der Fenster aufhielten.
Feiner Staub wirbelte vor den Augen Christine Akebes umher.
Das nun eindringende Tageslicht reichte noch immer nicht aus, alles in der hinteren Ecke des Dachbodens zu erkennen.
Christine überlegte kurz, schüttelte anschließend den Kopf.
„Du wirst alt“, murmelte sie leise vor sich hin, als sie die wenigen Schritte zurück zur Türe ging und den dort an der Seite befindlichen Lichtschalter drückte.
Augenblicklich erhellte sich das einst dunkle Reich ihres Sohnes Michael.
Christine Akebe stellte den Besen an seinen Platz zurück und sah sich um.
Ein kurzes Zittern durchfuhr ihren hageren Körper, als sie die Utensilien auf dem kleinen Tisch entdeckte, die Michael einst für seine dunklen Taten verwendete.
Die Beamten der Augsburger Mordkommission hatten damals darauf verzichtet, all diese Dinge einzusammeln.
Alle waren froh, dass das unselige Treiben des Doktor Michael Akebe ein Ende gefunden hatte.
Sein Tod brachte wieder Ruhe in den Nördlinger Alltag.
Seine Mutter Christine jedoch fand immer noch keinen Frieden.
Zuviel erinnerte an das für sie unbegreifliche Leid, das ihr eigener Sohn damals in dieser Stadt verbreitet hatte.
Deshalb hatte sie nun auch den Entschluss gefasst, sich wenigstens von den materiellen Erinnerungen zu trennen.
Sie stellte alles auf dem Tisch zusammen, um sie zu entsorgen.
Dabei sah sie sich nach einem passenden Behälter um, konnte im ersten Moment jedoch nichts entdecken.
Ihr Blick fiel auf die alte Truhe in der hinteren Ecke des Raumes.
In ihr hatte Michael all das aufbewahrt, das ihn mit seiner Heimat verbunden hatte.
Dinge, die er von seinem Großvater und seinem Vater bekommen hatte.
Christine Akebe kaute nervös auf ihrer Unterlippe, als sie langsam den Deckel öffnete und sich den Inhalt der Truhe betrachtete.
Fetische, Talismane, sowie verschiedene kleine, handgefertigte Kleidungsstücke.
Sollte sie diese Dinge wirklich so einfach in den Müll werfen?
Nach einem erneuten, kurzen Zögern stand ihr Entschluss jedoch fest. Sie würde sonst niemals Ruhe finden.
Bei jedem Betreten des Dachbodens kämen die Erinnerungen wieder hoch.
Entschlossen griff sie in die Kiste hinein, nahm Stück für Stück daraus hervor, ohne es länger zu betrachten, und legte es neben sich auf dem staubigen Boden ab.
Die Truhe war das Einzige, das sie behalten würde, denn sie stammte nicht aus Michaels Heimat.
Christine würde anderweitig Verwendung dafür finden.
Das letzte Teil, welches sie auf dem schon etwas verstaubten Boden der Kiste fand, war eine alte Waffe.
Es handelte sich um ein Kurzschwert. Christine nahm es vorsichtig heraus und betrachtete sich den mit Schnitzereien verzierten Holzgriff.
Auch auf der einschneidigen, leicht nach oben gebogenen Klinge entdeckte sie diverse Gravuren, denen sie jedoch keine Bedeutung zuweisen konnte.
Dennoch wusste sie, um welche Waffe es sich hierbei handelte.
Das Stammesschwert der Yoruba, dachte sie bei sich. Christine Akebe erinnerte sich noch genau an den Tag, als Michael das Schwert von seinem Vater überreicht bekam.
„Ich habe es von deinem Großvater bekommen. Nun soll es Dir gehören, denn es wird stets an den ältesten Sohn der Familie weiter gegeben.
Halte es in Ehren, denn eines Tages wird es deinem Sohn gehören.
So will es die Tradition unseres Stammes, die nicht unterbrochen werden darf, auch wenn wir nicht mehr in Afrika leben.“
Michael nahm das Schwert damals aus den Händen seines Vaters wie ein Heiligtum entgegen.
Sie erinnerte sich genau daran, dass er es immer wieder einmal hervor holte, es lange und andächtig betrachtete.
Christine fuhr mit den Fingern vorsichtig über die Schneide.
Nach all den Jahren hatten sich zwar leichte Korrosionsflecken auf der Klinge gebildet, die jedoch nichts von ihrer Schärfe verloren zu haben schien.
Christine Akebe überlegte.
Michael konnte das Schwert seiner Vorfahren nicht mehr weiter vererben.
Würde sie es vernichten, einfach in den Müll werfen, so wäre diese Stammestradition wohl für alle Zeiten beendet.
Nicht Michaels wegen, sondern auch ihrem geliebten Mann Abedi und seinen Vorfahren zu Ehren entschloss sie sich dazu, das Yoruba-Schwert an einen geeigneten Platz zu geben.
Welcher Ort dies sein sollte, darüber musste sie nicht lange nachdenken.
Christine war sich schon seit längerem darüber im Klaren, dass die Geschehnisse von damals eines der dunkleren Kapitel in der Geschichte der Stadt Nördlingen einnehmen würden.
Dass das Böse allgegenwärtig sein kann, daran sollten spezielle Stücke aus dem Besitz ihres Sohnes zur Erinnerung und Abschreckung dienen.
Sie hatte in den vergangenen Tagen Kontakt zu den Verantwortlichen der Stadtverwaltung aufgenommen, um ihnen dies vorzutragen.
Zu keiner Stunde verlor sie einen Gedanken daran, dass diese schrecklichen Ereignisse sie irgendwann noch einmal einholen würden.
2. Kapitel
Oboshie Keita ließ sich erschöpft in den alten Sessel ihres kleinen Wohnzimmers sinken und legte die Medikamentenpackung auf den Tisch.
Nach der Rückkehr mit dem Taxi aus der Women‘s Health Clinic in Wagga Wagga an diesem Vormittag schienen ihre letzten Kraftreserven zu Ende zu gehen.
Die Diagnose der Kollegen auf der onkologischen Station bestätigte ihr, dass ihr nun mittlerweile vierundsechzig Jahre dauerndes Leben wohl bald zu Ende sein würde.
Ausgerechnet ihren Körper hat sich diese verfluchte Krankheit ausgesucht.
Sie, die sie sich ein Leben lang für die Kranken eingesetzt hatte.
Trotz der vorherrschenden Temperaturen dieses Spätsommers spürte die Frau, wie ihr immer wieder kleine Kälteschauer über den Rücken liefen.
Warum jetzt schon?
Teils erschüttert, teils ungläubig fragte sie sich dies immer wieder und horchte dabei in die Stille der Mittagsruhe, hoffend, dass ihr irgendjemand eine Antwort darauf geben würde.
Doch nichts geschah.
Weder tröstende noch erklärende Worte erreichten ihre leicht benebelten Sinne.
Die letzte Dosis der Schmerzmedikamente, deren Wirkung sich nun mehr und mehr entfaltete, schien nicht nur ihren Körper, sondern auch ihren Geist wie in Watte zu packen.
Innerhalb weniger Augenblicke spürte Oboshie die aufkommende Müdigkeit, die unaufhaltsam Besitz von ihr ergriff.
Schlafen dachte sie sich. Einfach einschlafen und nicht mehr aufwachen.
Was blieb ihr denn noch von der restlichen Zeit, die ihr die Ärzte gegeben hatten?
Bettlägerigkeit? Schmerzen? Siechtum?
Sollte so das Ende aussehen, das sie sich doch so ganz anders vorgestellt hatte?
Sicher, die hochdosierten Medikamente machten ihr die Situation erträglich.
Noch!
Doch was würde in drei oder vier Monaten sein? Vielleicht waren es ja auch nur ein paar Wochen.
Wer konnte schon vorhersagen, wie sich diese verfluchte Krankheit entwickeln würde?
Oboshie fühlte sich wie auf Wolken gebettet, versank nun in einem Meer aus Wärme und Geborgenheit.
Kein Lärm, kein Sturm, ja nicht einmal ein Erdbeben hätte in diesen Sekunden ihr Eintauchen in die Traumwelt verhindern können.
Eine angenehme Schwere durchzog ihre Glieder, ließ ihren Kopf zur Seite rutschen, wobei sie ruhig atmend im Sessel versank.
*
Bilder aus der Vergangenheit zogen herauf und sie sah sich als junge Frau im weißen Kittel am Bett eines Mannes stehen.
In seinen Augen erkannte sie, dass er sich den tragischen Folgen seines Schicksals bewusst war.
Als Krankenschwester auf der Unfallstation einer Klinik in Lomé hatte sie oft mit Menschen zu tun, denen keiner mehr Hoffnung geben konnte.
Nur das Leid mindern, die Schmerzen erträglich halten und die Patienten bis zum unausweichlichen Ende begleiten.
Dies war die Aufgabe, die sie gemeinsam mit anderen als Aufgabe sah.
Ein anderes Gesicht erschien in Oboshies nebelverhangen Träumen.
Doktor Abedi Akebe, der leitende Arzt der Unfallstation.
Nur wenig älter als sie selbst, kam er vor einem Jahr aus Deutschland zurück in seine Heimat, um hier mit seinem erworbenen Wissen zu helfen.
Oboshie bewunderte diesen Mann für sein Engagement im Umgang mit den Patienten.
Moderne Behandlungsmaßnahmen aus Europa hatte er sich zu Eigen gemacht, was vielen hier im Krankenhaus Erleichterung brachte.
Natürlich war man zunächst auch skeptisch gegenüber den modernen Wissenschaften, ließ sich durch deren Erfolge jedoch mehr und mehr überzeugen.
Abedi Akebe war nicht nur klug und erfolgreich als Arzt, nein, er war als gutaussehender Mann auch ein begehrtes Flirtobjekt bei allen weiblichen Angestellten der Klinik.
Auch Oboshie konnte es sich nicht verkneifen, ihm hin und wieder begehrende und vielversprechende Blicke zuzuwerfen.
Dass sie selbst von dem einen oder anderen Kollegen öfter mit einer Einladung bedacht wurde, blieb auch Doktor Akebe nicht verborgen.
So stand er eines Tages im Stationszimmer, um sie, voll des Lobes für ihre Arbeit, zum Abendessen einzuladen.
Natürlich ließ sich die junge Frau diese Gelegenheit, Abedi Akebe auch privat näher kennenzulernen, nicht entgehen.
Besser als die folgenden Monate hätte sich eine klassische Liebesgeschichte wohl nicht entwickeln können.
Diesem ersten Abendessen folgten weitere Treffen, wobei beide aber stets darauf bedacht waren, Arbeit und Privates zu trennen.
Nach gut einem halben Jahr bemerkte Oboshie, dass sie sich veränderte.
Ihre berufliche Erfahrung als Krankenschwester brachte sie recht schnell auf deren Ursache.
Ein Schwangerschaftstest mit positivem Ergebnis ließ die Freude in ihrem Inneren noch größer darüber werden, scheinbar den richtigen Mann fürs Leben gefunden zu haben.
Es brauchte nun lediglich noch einen passenden Rahmen um Abedi mitzuteilen, dass sie beide in wenigen Monaten Eltern sein würden.
Da sich zu dieser Zeit relativ viele Touristen in Lomé aufhielten, wobei sich der eine oder andere von ihnen auch in ärztliche Behandlung begeben musste, waren die Arbeitstage in der Klinik oft ungeplant lang.
Doch wussten sowohl Oboshie als auch Abedi, dass dies untrennbar mit ihrem gewählten Beruf zusammenhing.
Diesem Umstand allein schrieb sie zu, dass Abedi in den vergangenen Tagen irgendwie abwesend wirkte.
Seine, trotz eines arbeitsreichen Tages ungeteilte, Aufmerksamkeit vermisste sie nun schon seit einigen Abenden.
Doch die Vorfreude auf ihr gemeinsames Kind ließ Oboshie diesen Umstand ertragen.
Als Abedi eines Nachmittags wieder einmal länger auf sich warten ließ, musste Oboshie jedoch erfahren, dass eine klassische Liebesgeschichte auch weniger schöne Momente enthält, ja sogar in einer Tragödie enden konnte.
Sie wollte ihren Liebsten aus der Klinik abholen, musste jedoch erfahren, dass er noch einen Nachsorgetermin wahrnahm.
Seufzend begab sie sich in Abedis Büro, um so lange auf ihn zu warten.
Als sie die Türe öffnete, sah sie sich einer Situation gegenüber, die in ihren Augen nicht der Wirklichkeit entsprechen konnte.
Doktor Abedi Akebe behandelte die scheinbare Fußverletzung seiner Patientin alles andere als nur fachgerecht.
Durch die offen stehende Türe zum Behandlungsraum betrachtete Oboshie mit stummer Verzweiflung die Szene, die sich vor ihren Augen abspielte.
Abedi saß auf seinem Stuhl vor der Behandlungsliege, auf der eine junge Frau Platz genommen hatte.
Ihren Fuß hatte sie über seinen Oberschenkeln liegen und Abedi schien ihn zärtlich zu streicheln.
Dass es sich um eine Frau aus Deutschland handeln musste, schlussfolgerte Oboshie aus der Sprache, in der sich die beiden unterhielten.
Sie kannte diese Sprache nur aus einigen Worten oder Sätzen, die ihr Abedi an manchen Tagen beigebracht hatte.
Worte wie Liebe oder Sehnsucht verstand sie jedoch sehr wohl.
Aus den Blicken und Gesten der beiden zog sie augenblicklich die für sie einzigen Schlussfolgerungen.
Im Innersten verletzt und traurig verließ sie unbemerkt von Arzt und Patientin das Büro und machte sich auf den Heimweg.
Dort angekommen wollte sie nur noch schlafen, nahm in ihrer Verzweiflung mehrere Schlaftabletten und legte sich ins Bett.
Irgendwann spürte sie, dass eine Hand sie aus ihrem traumlosen Tiefschlaf rüttelte.
*
Oboshie schlug langsam die Augen auf und sah das Gesicht eines Mannes vor sich.
„Abedi?“, flüsterte sie verwirrt.
„Nein, Mutter“, vernahm sie die Stimme des Mannes, die wie durch einen Nebelschleier zu ihr drang.
„Ich bin es, Baako. Du warst so unruhig in Deinem Schlaf, dass ich schon beinahe Angst bekam.“
Besorgt betrachtete der hochgewachsene Mann seine Mutter im Sessel.
„Wie war es in der Klinik? Was haben die Ärzte zu den Ergebnissen der letzten Untersuchungen gesagt?“
Langsam kehrte nun auch der Geist von Oboshie in die Gegenwart zurück.
„Baako, mein Sohn“, sprach sie mit leiser Stimme.
„Ich habe Dich gar nicht hereinkommen gehört.“
„Das ist ja auch kein Wunder.“
Baako Keita sah die auf dem Tisch liegende Medikamentenpackung und deutete mit dem Finger darauf.
„Um diese Dinger würde Dich jeder Junkie auf dieser Welt beneiden.“
Sorgenvoll richtete sich sein Blick auf die zusammengekauerte Frau.
„Wenn Dir Dein Doc diesen Hammer verschrieben hat, scheinen sich unsere Befürchtungen wohl bestätigt zu haben.“
Er trat an die Seite des Sessels, setzte sich auf die Lehne und zog den in diesem Augenblick so zerbrechlich scheinenden Oberkörper der Frau mit seinen Armen sanft an sich.
„Ja, Baako“, antwortete sie mit schwerem Schlucken. „Es bleibt mir wohl nicht mehr allzu viel Zeit.“
„Aber Du kriegst scheinbar Alpträume von diesen Dingern“, meinte ihr Sohn und deutete wieder auf das Medikament.
„Sie sollten Dir besser etwas anderes verschreiben.“
Oboshie betrachtete ihren Sohn lange, bevor sie ihm antwortete.
„Das sind bestimmt nicht die Tabletten, Baako. Die Erinnerungen lassen sich nicht einfach wegschieben. Auch nicht mit Medikamenten.“
„Welche Erinnerungen, Mom?“, wollte Baako wissen.
Oboshie zögerte zunächst mit einer Antwort, entschloss sich angesichts ihrer Situation doch dazu, mit ihrem Gewissen endlich reinen Tisch zu machen.
„Du wirst mir böse sein, Baako. Du wirst mich vielleicht sogar verfluchen, für das, was ich Dir nun sagen werde.
Aber ich sehe ein, dass es sein muss, und bin auch bereit, die Konsequenzen dafür zu tragen.
Viel schlimmer als in meiner jetzigen Situation kann es für mich sowieso nicht kommen.“
3. Kapitel
Martina Karrer stand mit ihrer Mutter an der Fußgängerampel der Baldinger Straße und wartete darauf, dass sie mit der im Rollstuhl sitzenden Frau die Vordere Gerbergasse überqueren konnte.
Nach einem langen Spaziergang war es Zeit, mit ihr ins Nördlinger Pflegezentrum Bürgerheim zurückzukehren.
Die langsam untergehende Sonne warf an diesem Frühlingstag mit ihren letzten Strahlen lange Schatten in die Stadt.
Während die ersten Fahrzeuge nun in die Kreuzung in Richtung Baldinger Tor einbogen, bemerkte Martina, dass ein Zittern durch den Körper der gebrechlich wirkenden Frau ging.
Sie befand sich seit ihrem leichten Schlaganfall vor drei Monaten zwar wieder auf dem Weg der Besserung, jedoch bereiteten ihr die Folgen daraus verständlicherweise wohl noch für längere Zeit Probleme.
Da sie mit ihrer Mutter allein in einer kleinen Wohnung am Stadtrand von Nördlingen lebte, war eine Pflegeeinrichtung für die beiden Frauen die einzig sinnvolle Alternative.
Beruflich war Martina Karrer im Nördlinger Stadtmuseum beschäftigt. Aus diesem Grund bedurfte es für sie bei der Wahl eines passenden Heimes keiner langen Überlegung.
Das Nördlinger Bürgerheim und das Stadtmuseum grenzen direkt aneinander.
So konnte Martina im Bedarfsfall ihre Mutter auch innerhalb der Arbeitszeit kurzfristig besuchen.
Ich hoffe nur, dass du wieder einigermaßen auf die Beine kommst, dachte sie sich, während sie mit dem Rollstuhl etwas von der Straßenkante zurückging und anschließend die Feststellbremse betätigte.
„Trotz der Sonne noch ganz schön kalt“, meinte sie zu ihrer Mutter, indem sie nun vor ihr stehend die wärmende Decke liebevoll über deren Körper zurechtzog.
Sie bekam zwar keine Antwort, da ihrer Mutter das Sprechen immer noch schwerfiel, doch ein dankbares Lächeln aus den Augen der alten Dame bestätigte ihr diesen Satz.
Als Martina die nun etwas leiser werdenden Fahrgeräusche ausmachte, drehte sie den Kopf zur Seite und sah, dass die nächsten Autos wartend vor der Lichtanlage angehalten hatten.
Sie löste die Bremse des Rollstuhls und überquerte mit ihrer Mutter die Straße.
Kurz darauf hatten sie das Gebäude des Seniorenheims erreicht und Martina Karrer meldete sich mit ihrer Mutter bei den Pflegekräften zurück.
„Pünktlich zurück“, sagte die Pflegedienstleitung zu Martinas Mutter, indem sie mit einem Lächeln die beiden Hände der alten Dame in ihre eigenen nahm.
„Wir werden Ihnen jetzt erst einmal helfen sich etwas frisch zu machen und dann gibt’s auch schon bald Abendessen.“
Sie deutete einer Kollegin an, die Bewohnerin in ihr Zimmer zu bringen.
„Der Spaziergang scheint Ihrer Mutter richtig gut getan zu haben“, sprach sie zu Martina.
„Ja“, gab diese zur Antwort. „Sie glauben gar nicht, wie froh ich darüber bin, dass sie bei Ihnen hier einen Platz bekommen hat.
So kann ich mich nun in Ruhe um meine Arbeit kümmern. Ich muss drüben noch einige Unterlagen vorbereiten.
Herr Lauer, der Leiter der Tourist-Info kommt nachher noch vorbei, um einige Details für die zukünftige Ausrichtung des Museums zu besprechen.“
„Klingt interessant“, sagte Andrea, ohne es wirklich so zu meinen.
Was die Vergangenheit Nördlingens betraf, ging ihr Interesse nicht wirklich über das Standardwissen hinaus.
„Na, dann wünsche ich Ihnen noch viel Spaß und einen kurzweiligen Abend.“
Mit diesen Worten verabschiedete sie sich von Martina Karrer, ohne zu ahnen, dass sie die Frau an diesem Spätnachmittag zum letzten Mal lebend sehen würde.
*
Mit einem Seufzer blickte Andrea Kahling auf die dreieckige Wanduhr gegenüber ihrem Schreibtisch, ließ sich in ihrem Stuhl zurückfallen und rieb sich die leicht geröteten Augen.
Seit drei Tagen saß sie nun schon überwiegend an ihrem PC, um die Dokumentationsunterlagen auf ihre Aktualität zu überprüfen.
Im Großen und Ganzen war sie mit dem Ergebnis zufrieden. Einige Kleinigkeiten würde sie morgen noch mit den zuständigen Bereichsleitungen abklären.
Schluss für heute - ein Privatleben gibt’s schließlich auch noch.
Nachdem sie sich am PC abgemeldet hatte, fuhr sie ihn herunter und schaltete den Bildschirm aus.
Während Andrea sich ihre warme Daunenjacke überzog, ging ihr Blick noch einmal über den Schreibtisch.
Zufrieden mit dem Ergebnis griff sie sich ihre Tasche und ging aus dem Büro.
Bevor sie das Haus ganz verließ, verabschiedete sich auf dem Weg nach draußen noch kurz von einer Kollegin.
Vor der Eingangstüre streifte sie ein kalter Windhauch und sie zog sich den Kragen ihrer Jacke etwas nach oben.
Nachdem sie die letzte Stufe der Eingangstreppe hinter sich gelassen hatte, fiel Andrea Kahlings Blick auf die erleuchteten Fenster des, dem Heim gegenüberliegenden Stadtmuseums.
In diesem Moment dachte sie wieder daran, dass die Tochter von Frau Karrer an diesem Abend ebenfalls noch länger zu tun hatte.
Um diese Uhrzeit in einem historischen Gemäuer wär nicht mein Ding, ging der Pflegedienstleiterin durch den Kopf.
Ein leichtes Frösteln durchzog sie, was in diesem Moment aber nicht nur auf den kalten Frühlingsabend zurückzuführen war.
4. Kapitel
Als Andrea Kahling am darauffolgenden Morgen kurz nach sieben Uhr mit ihrem Fahrrad in Richtung Ampelkreuzung der Baldinger Straße fuhr, vernahm sie bereits den Lärm eines Martinshorns.
Kurz darauf bog ein Rettungswagen mit eingeschaltetem Blaulicht aus der Vorderen Gerbergasse um die Kurve.
Andrea dachte sich in diesem Moment noch nichts Besonderes, bis sie wenige Augenblicke später das Nördlinger Bürgerheim betrat.
Eine Kollegin des Frühdienstes kam ihr entgegen und an ihrer Seite erkannte sie Doktor Sterner, den Hausarzt verschiedener Bewohnerinnen und Bewohner des Pflegeheimes.
„Guten Morgen Frau Kahling“, begrüßte er die Pflegedienstleitung freundlich, aber mit etwas besorgtem Blick.