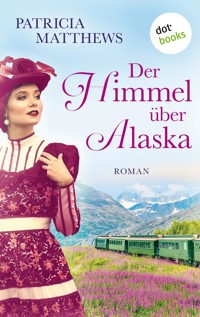
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Liebe im Goldrausch: Die große historische Saga »Der Himmel über Alaska« von Patricia Matthews jetzt als eBook bei dotbooks. Alaska im Jahr 1898: Der Goldrausch zieht unzählige hoffnungsvolle Männer an den Klondike River. Allen Gefahren zum Trotz reist auch die junge Belinda Lee zusammen mit ihrer Schwester Annabelle in die unbarmherzige Kälte des Nordens, um dort ihrer Berufung als Fotografin zu folgen. Doch nicht nur die tosenden Schneestürme stellen eine Bedrohung dar, auch die skrupellosen Goldsucher haben alles andere als ehrbare Absichten … Einzig dem mysteriösen Joshua Rogan scheinen die beiden jungen Frauen in der Wildnis vertrauen zu können. Schon bald verliert Belinda ihr Herz an ihn. Aber warum ist Joshua wirklich nach Alaska gekommen – und wird ausgerechnet er Belinda zum Verhängnis werden? Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der dramatische Liebesroman »Der Himmel über Alaska« von Patricia Matthews. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 429
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Alaska im Jahr 1898: Der Goldrausch zieht unzählige hoffnungsvolle Männer an den Klondike River. Allen Gefahren zum Trotz reist auch die junge Belinda Lee zusammen mit ihrer Schwester Annabelle in die unbarmherzige Kälte des Nordens, um dort ihrer Berufung als Fotografin zu folgen. Doch nicht nur die tosenden Schneestürme stellen eine Bedrohung dar, auch die skrupellosen Goldsucher haben alles andere als ehrbare Absichten … Einzig dem mysteriösen Joshua Rogan scheinen die beiden jungen Frauen in der Wildnis vertrauen zu können. Schon bald verliert Belinda ihr Herz an ihn. Aber warum ist Joshua wirklich nach Alaska gekommen – und wird ausgerechnet er Belinda zum Verhängnis werden?
Über die Autorin:
Patricia Matthews (1927–2006) wurde in San Francisco geboren, studierte in Los Angeles und lebte später viele Jahre in Prescott, Arizona. Nach dem Scheitern ihrer ersten Ehe begann sie, sich intensiv dem Schreiben zu widmen – so lernte sie nicht nur ihren zweiten Ehemann, den Schriftsteller Clayton Matthews kennen, sondern legte auch den Grundstein zu einer internationalen Karriere. Patricia Matthews, die unter zahlreichen Pseudonymen veröffentlichte, schrieb zwischen 1959 und 2004 über 50 Bücher, vom Liebesroman bis zum Krimi. Für ihr Werk wurde sie mit dem »Reviewers Choice Award« und dem »Affaire de Coeur Silver Pen Readers Award« ausgezeichnet.
Bei dotbooks erschienen Patricia Matthews Romane »Wenn die Magnolien blühen«, »Der Wind in den Zypressen«, »Der Traum des wilden, weiten Landes«, »Der Stern von Mexiko«, »Das Lied der Mandelblüten«, »Die Brandung von Cape Cod«, »Der Duft von Hibiskusblüten«, »Die Jasmininsel«, »Wo die Anemonen blühen« und die »Virginia Love«-Saga mit den Einzelbänden »Der Traum von Malvern Hall« und »Das Vermächtnis von Malvern Hall«.
***
eBook-Neuausgabe Dezember 2021
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 1979 unter dem Originaltitel »Love’s Golden Destiny« bei Pyewacket Corporation, New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 1981 unter dem Titel »Leidenschaft im Goldrausch« bei Heyne.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1979 by Pyewacket Corporation, New York
Copyright © 2020 Robert Thixton
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1981 Wilhelm Heyne Verlag, München
Copyright © der Neuausgabe 2021 dotbooks GmbH, München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Pinder Lane & Garon-Brooke Associates, Kontakt: [email protected]
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/Mike Redwine, Kareryna Upit, emperorcosar
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ah)
ISBN 978-3-96655-604-0
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Liebe Leserin, lieber Leser, in diesem eBook begegnen Sie möglicherweise Begrifflichkeiten, Weltanschauungen und Verhaltensweisen, die wir heute als unzeitgemäß oder diskriminierend verstehen. Bei diesem Roman handelt es sich um ein rein fiktives Werk, das vor dem Hintergrund einer bestimmten Zeit spielt oder geschrieben wurde – und als solches Dokument seiner Zeit von uns ohne nachträgliche Eingriffe neu veröffentlicht wird. Diese Fiktion spiegelt nicht unbedingt die Überzeugungen des Verlags wider.
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Der Himmel über Alaska« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Patricia Matthews
Der Himmel über Alaska
Roman
Aus dem Amerikanischen von Hans-Erich Stroehmer
dotbooks.
Kapitel 1
Man schrieb das Jahr 1898. Aber als Belinda Lee vom Schiffsdeck aus landeinwärts blickte, schien es ihr hundert Jahre früher zu sein. Berge umsäumten den schmalen Hafen von Dyea. Er war überfüllt mit jeder Art von Schiffen. Manche von ihnen wirkten so alt und verrottet, daß Belinda sich fragte, wie sie überhaupt die Fahrt hierher überstanden hatten. Vor den Schiffen lag ein kleiner, schlammbedeckter Kai, auf dem Männer arbeiteten. Sie wirkten in der schweren Winterkleidung wie große Bären, die Ausrüstungen und Vorräte wegschleppten.
Am Klondike war Gold entdeckt worden, der Ansturm setzte ein und brachte Tausende von Goldsuchern in diesen kleinen Hafen. Hier begann der mühsame Marsch über den Chilkoot-Paß nach Kanada und zu den Goldfeldern am Klondike.
Belinda fröstelte und zog die Hände bis unter die Ärmel zurück. Es war eiskalt. Das Gebirge war tief verschneit, obwohl bereits der April begonnen hatte. Seit der Abreise von Seattle bezweifelte Belinda zum erstenmal, ob es eine kluge Entscheidung war, diese Tour zu unternehmen.
Schon an Bord wurde viel über die Schwierigkeiten der Landung in Dyea geredet. So schlimm allerdings hatte es sich Belinda nicht vorgestellt. Zwar besaß das Schiff verschiedene Landungsboote, aber es waren ziemlich morsche Kähne. Außerdem enthielt die Passage nicht die Landungskosten. Jeder Passagier mußte das für sich selbst regeln.
Belinda wandte sich zu ihrer Schwester Annabelle, die neben ihr stand, Wangen und Nase unter der dunklen Pelzhaube stark gerötet. Annabelle blickte sich verächtlich um, und Belinda seufzte leise auf. Immer wieder fragte sie sich, was sie wohl veranlaßt hatte, sich dem Drängen ihrer Schwester zu fügen und sich von ihr auf dieser für ihr Leben so wichtigen Reise begleiten zu lassen.
Das hier war gewiß keine Gegend für Annabelle mit ihren dunklen, kunstvoll arrangierten Locken, ihren Stiefmütterchenaugen und dem ewigen Schmollmund. Annabelle gehörte einfach nach New York, wo sie mit ihren Beaus tanzen und Theater und Luxusrestaurants besuchen konnte. Sie brauchte die ständige Bewunderung ihrer meist männlichen Bekannten. Warum hatte sie nur darauf gedrängt, diese Reise mitzumachen?
Ringsum wuchs der Lärm, während das Schiff entladen wurde. Die Männer rannten hin und her, schrien, fluchten und schleppten ihre Ausrüstung von Bord. Alles schien vor Aufregung nur so zu beben, aber seltsamerweise empfand Belinda nichts davon.
Es gab nur wenige Frauen hier. Man hatte Belinda zuvor gewarnt, daß es für eine Frau nicht einfach sein würde, hier zu leben. Aber sie war entschlossen, nicht aufzugeben.
Schon wollte sie ein Gespräch mit Annabelle beginnen, aber dann zögerte sie, als sie das schöne und dennoch ständig gereizt wirkende Gesicht ihrer Schwester sah. Einen Augenblick lang überlegte Belinda, was für einen Eindruck wohl ihre Schwester von ihr selbst hatte.
Fand Annabelle sie attraktiv? In Gedanken stellte Belinda sich ihr Gesicht vor. Sie hatte ein stärker ausgeprägtes Kinn als Annabelle, ihre Nase war nicht ständig gerümpft, und ihre Augen waren grau und nicht blau. Sie besaß auch keine so volle Unterlippe, die ihrer Schwester diesen ständig schmollenden Ausdruck verlieh.
Wenn man es genau besah, war Annabelle schöner als sie. Aber Belinda hatte mehr Entschlußkraft und einen eisernen Willen. Wenn sie sich ihre Schwester jetzt so von der Seite betrachtete, ahnte sie schon, daß es gewiß ein Fehler gewesen war, sie in dieses wilde Land mitzunehmen.
Belinda hielt ihr Fernglas vor die Augen und betrachtete den Landungskai. Kleine, untersetzte Männer schleppten ständig irgendwelche Lasten hin und her. Sie mußten zu den hier lebenden Indianern, den Chilkats, gehören. Diese Männer wurden angeworben, um Frachten über den Chilkoot-Paß zu transportieren. Bei dieser Arbeit sollten sie unglaubliche Kräfte zeigen.
Jetzt berührte Belinda den Arm ihrer Schwester. »Wir sollten uns um unsere Ausrüstung kümmern. Hoffentlich bekommen wir Hilfe. Vor der nächsten Flut muß das Schiff entladen sein.«
Annabelle lächelte strahlend. »Oh, man wird uns schon helfen. Ich habe bereits mehrere junge Männer darum gebeten.«
Bei diesen Worten wirkte sie so selbstzufrieden, daß Belinda ihre Schwester am liebsten wegen ihres so flatterhaften Wesens ausgescholten hätte. Aber Belinda unterdrückte ihren Zorn und meinte lediglich etwas sarkastisch: »Wie reizend! Wie können wir es ihnen jemals danken?«
Annabelle warf ihr zwar einen scharfen Blick zu, verzichtete aber auf eine Antwort. Dann folgte sie Belinda zu den ordentlich an der Reling aufgestapelten Reisekoffern und Kisten. Die Leinwandhüllen wurden bereits von zwei jungen Männern abgestreift. Beide tippten grüßend an ihre Hutkrempen, als die zwei Mädchen herantraten.
»O Ned!« rief Annabelle fröhlich. »Und auch Freddy! Wie nett, daß Sie beide uns helfen. Allein hätten wir das sicher nicht geschafft.«
Belinda biß die Zähne zusammen. Natürlich stimmte es – allein konnten sie ihr Gepäck nicht von Bord bringen. Aber es widerstrebte einfach ihrer Anschauung, sich männliche Unterstützung mit flatternden Wimpern und schwingenden Hüften zu besorgen. Was waren diese Männer doch für Narren! Ein hübsches Gesicht schenkte ihnen ein Lächeln, und schon überschlugen sie sich vor Eifer. Als Freddy, der kleinere der Männer, eine Kiste anheben wollte, wäre sie ihm fast aus den Händen gerutscht. Belinda rief: »Ganz vorsichtig, bitte! Da drin ist meine Ausrüstung. Sie ist unersetzlich.«
Freddy errötete und packte die Kiste nun mit sicherem Griff. »Verzeihung, Miß! Jetzt halte ich sie ganz fest.«
Belinda seufzte erleichtert auf, und ihr Atem stand wie eine Wolke in der frostigen Luft. Der Grayflex-Fotoapparat befand sich in ihrem Handkoffer. Er hatte ein kleines Vermögen gekostet. Die restliche Kameraausrüstung und Filmplatten steckten in der Kiste, alles äußerst zerbrechliche Gegenstände. Sie wußte, wie schwierig es in diesem Klima hier sein würde, belichtete Platten zu entwickeln. Daher hatte sie sich zusätzlich diese neue Kamera gekauft, mit der man leichter umgehen konnte.
Ned und Freddy wurden nun von zwei weiteren jungen Männern unterstützt, die den beiden Mädchen zunickten und danach ihr eigenes Gepäck in den Kahn luden. Belinda hatte jeden Koffer und jede Kiste mit den großen Buchstaben LEE beschriftet. Trotz ihres heftigen Einspruchs hatte Annabelle zwei Reisekisten voller Kleider mitgenommen.
Endlich war alles im Kahn verstaut, und Belindas Mut wuchs. Die Schwierigkeiten beim Ausladen waren bewältigt, also mußte sich auch der Transport schaffen lassen. Sie landeten mit dem Boot unmittelbar am Ufer und nicht am Landungssteg. Belinda sprang hinaus und versank sofort bis zu den Knöcheln im Schlamm. In diesem Augenblick sah sie einen Rollwagen, der von zwei müden Gäulen gezogen wurde. Der Besitzer unterhielt sich mit einem breitschultrigen Mann in einem schweren Pelzparka. Beide Männer gestikulierten heftig, und Belinda nahm an, daß sie sich über den Fuhrlohn stritten.
Sofort faßte sie einen Entschluß und lief zu den Männern hin. »Entschuldigen Sie«, sagte sie zu dem Besitzer der Karre. »Was dieser Mann Ihnen auch anbieten mag – ich bezahle mehr!«
Jetzt erst betrachtete sie den anderen Mann im Pelzparka genauer. Er war älter als sie, aber immer noch verhältnismäßig jung. Seine Gestalt wirkte groß und wuchtig, sein Gesicht war glattrasiert, besaß eine kühngeschwungene Nase und seltsam stahlblaue Augen.
Etwas verwirrt wich Belinda seinem Blick aus. »Tut mir leid«, meinte sie dann nachgiebig, »aber es ist wichtig, daß mein Gepäck sicher abtransportiert wird.«
Der Mann lachte heiser. »In der Lage befinden sich nur Sie allein, was? Zum Teufel, was denken Sie, warum ich hier bin? Ist meine Ausrüstung etwa weniger wert als die Ihre?«
Natürlich hatte der Fremde recht. Belinda fiel es schwer, sich unhöflich zu benehmen, aber hier in dieser Lage blieb ihr keine andere Wahl. »Tut mir leid«, entgegnete sie und wandte sich dann an den Wagenbesitzer. »Nun, Sir?«
Der Mann kratzte sich am Kopf. »Der Transportpreis beträgt zwanzig Dollar in der Stunde – und zwar, bevor die Flut einsetzt. Wenn jedoch dieser Bursche hier mit mir noch länger herumfeilscht, beginnt die Flut, und der Preis steigt auf fünfzig in der Stunde.«
»Ich bezahle Ihnen dreißig Dollar in der Stunde«, erklärte Belinda mutig. »Aber Sie müssen gleich losfahren.«
»Der Handel ist abgeschlossen, kleine Lady. Wo liegt Ihr Zeug?«
Belinda drehte sich um und zeigte zu Annabelle, die neben ihrer Ausrüstung stand. Freddy trug soeben die letzte Kiste an Land. So setzte sich Belinda auf den Sitz neben den Fahrer und warf ihrem Opfer – anders konnte sie den Mann nicht bezeichnen – noch einen Blick zu.
Zwar wirkte sein Gesicht verärgert, aber seine Augen betrachteten sie dennoch belustigt. Warum wohl? Nun, das war jetzt gleichgültig. Und schon wurden die Gepäckstücke mit Hilfe von Annabelles ›Freunden‹ auf den Karren geladen. Danach wurde Segeltuch darübergezogen, und der Wagen transportierte alles etwa eine Viertelmeile landeinwärts, wo man sich außerhalb der Flutlinie befand.
Ein eiskalter Wind umfauchte sie. Überall türmten sich Vorräte und warteten auf die Kontrolle. Die kanadische Regierung verlangte nämlich, daß jeder, der sich zu den Goldfeldern wagte, wenigstens Vorräte für ein Jahr bei sich führte.
Ned und Freddy errichteten ein Zelt. Natürlich protestierte Annabelle dagegen zu übernachten. Aber Belinda erklärte ihr: »Ich beabsichtige nicht, unsere Ausrüstung dem Zugriff von Dieben zu überlassen. Selbst wenn ich mir einen Wächter nehme – kann ich ihm trauen?«
»Aber wir könnten doch ein Hotel in der Stadt finden«, meinte Annabelle.
»In dieser Stadt herrscht wilder Betrieb, Annabelle. Die Zimmer sind unerschwinglich, primitiv und wimmeln vor Ungeziefer. In deinem Schlafsack wirst du dich warm und bequem fühlen. Jetzt bleibst du erst einmal hier und bewachst unsere Sachen, während ich Träger anwerbe.«
Ohne auf den Schmollmund ihrer Schwester zu achten, marschierte Belinda entschlossen los, obwohl sie gar nicht wußte, wohin sie sich wenden sollte. Der Strand war ein einziges Durcheinander. Zahllose Gepäckstücke standen herum – Öfen, Vorratsfässer, Bettgestelle aus Messing und sogar Klaviere. Es sah so aus, als ob alle Dinge von einer Sturmflut an Land gespült worden wären.
Sie drehte sich zum Meer um und sah, daß die Flut kam. Etwa eine Viertelmeile weiter landeinwärts entdeckte sie eine schlammverschmutzte Straße und auf beiden Seiten primitive Häuser. Bis hierhier konnte sie leise, trunkene Stimmen hören, und auch ein Schuß krachte.
Belinda erschauerte. Wie gut war es doch, daß sie mit Annabelle zusammen die Nacht im Zelt verbringen konnte … Ein Aufenthalt in dieser Hafenstadt wäre für zwei alleinstehende Frauen gewiß unerträglich und sicher auch gefährlich geworden.
Plötzlich erklang eine heisere Stimme an ihrer Seite. »Na, kleine Lady?«
Als sie sich umblickte, erkannte sie das Gesicht des Fuhrmanns, der ihre Ausrüstung transportiert hatte. »Ja, was wollen Sie?« fragte Belinda.
»Sie haben gesagt, daß Sie Träger benötigen, um über den Paß zu kommen. Da habe ich jemanden für Sie. Ich habe ihm gesagt, daß Sie gut bezahlen.«
Ein dunkelhäutiger, grinsender Mann tauchte jetzt neben ihm auf. Er wirkte untersetzt und kräftig, und ein Schnurrbart zierte sein rundes Gesicht. Er hatte schlitzförmige dunkle Augen. Dem Aussehen nach mußte es sich um einen Indianer handeln. Er stützte sich auf einen wuchtigen Stock.
Der Kutscher erklärte: »Das ist einer der hiesigen Chilkats. Sein indianischer Name ist ein Zungenbrecher, daher nenen ihn alle einfach Charlie. Begrüß mal die kleine Lady, Charlie.«
Charlie neigte etwas verschüchtert den Kopf. »Hallo, kleine Lady.«
Freundlich erwiderte Belinda: »Ich heiße Belinda Lee, Charlie, und ich brauche Träger. Welchen Preis fordern Sie denn?«
Grinsend erwiderte Charlie: »Fünfunddreißig Cent für das Kilo, Miß Belinda. Die Sachen müssen rechteckig verpackt sein, sonst kostet es mehr. Zweihundert Pfund können wir schleppen.«
Schnell rechnete Belinda nach. »Wie weit tragen Sie das Gepäck für diesen Preis?«
»Bis zum Ende vom Lake Linderman. Siebenundzwanzig Meilen.«
»Ich brauche Sie für eine größere Strecke und außerdem noch zwei Träger. Haben Sie die?«
»Was zahlen Sie?«
»Sie sagten fünfunddreißig Cents … Oh! Ihnen gebe ich vierzig Cents. Die anderen erhalten den üblichen Lohn.« Insgeheim bereute Belinda schon diese erneute Ausgabe, sie hatte bereits ein Vermögen ausgegeben, seit sie New York verlassen hatten. Dabei mußte sie allerdings an die Worte ihres Vaters denken: »Geld ebnet jeden Weg auf dieser Welt, Mädchen!« Nun, wenn sie das Geld richtig anlegte, würde es sich schon auszahlen. Jetzt erst bemerkte sie, daß der lächelnde Indianer seine Hand ausgestreckt hatte.
»Ein guter Handel, Miß Belinda. Geben wir uns die Hand darauf?«
Sie reichte ihm ihre Hand und konnte nur mühsam ein Aufstöhnen unterdrücken, als er fest zudrückte. Fast glaubte sie, ihre Finger wären gebrochen. Dann sah sie jedoch, wie Charlies Augen aufblitzten, und sie wußte, daß sie mit diesem Händedruck eine Art Mutprobe bestanden hatte.
»Jetzt schlafen Sie«, sagte der Chilkat. »Charlie findet noch andere Träger. Wir gehen am Morgen los, sehr früh. Und wir kommen bis nach Sheep Camp.« Er neigte seinen Kopf und wanderte stolz wie ein Hahn davon.
»Charlie ist der beste Träger in der ganzen Umgebung, Miß Lee«, sagte der Fuhrmann. »Damit habe ich Sie guten Händen übergeben.«
Nun kehrte Belinda zu ihrem Zelt zurück. Vor der Reise hatte sie sich über alles in der Gegend informiert und wußte daher, daß Sheep Camp der Ausgangsplatz für die Überquerung des Chilkoot-Passes war. Er lag etwa dreizehn Meilen von Dyea entfernt, und man mußte durch das schmale Tal des Dyea-Flusses gehen. In dieser Enge würde alles voller Tragtiere und Menschen sein, die zu den Goldfeldern wollten. Belinda war nur zu froh, daß sie nun einen erfahrenen Träger als Anführer besaß.
Als sie das Zelt betrat, sah sie, daß Annabelle bereits in ihrem Schlafsack eingeschlummert war. Belinda zog lediglich Kleid und Schuhe aus. Dann kroch sie in ihren Schlafsack und freute sich über die Wärme.
Allerdings fand sie keinen ruhigen Schlaf. Sie hatte diese Reise bereits einige Monate zuvor geplant. Jetzt sah sie das Ziel in verlockender Nähe, und ihre Erregung wuchs.
Eigentlich war ihr Vater der Anlaß zu dieser abenteuerlichen Reise gewesen. Seltsam genug – denn dieser Mann hatte seine Familie verlassen, als Belinda erst sieben Jahre alt gewesen war. Aber Morgan Lee war eine imponierende Persönlichkeit, die das Leben in vollen Zügen genoß. Und so hatte ihn seine Tochter auch in Erinnerung behalten.
Belinda erinnerte sich an ihren Vater als einen blendend aussehenden Mann, der stets voller Fröhlichkeit lachte, wenn er seine Tochter in die Arme schloß. Sein Bart kitzelte köstlich, wenn er sie küßte. Belinda hing sehr an ihm und weinte nächtelang, als er plötzlich Frau und Kinder verlassen hatte.
»Dein Vater ist ein Tunichtgut, ein lasterhafter, ruchloser Schurke. Verantwortungsbewußtsein besitzt er nicht. Niemals hätte ich ihn heiraten dürfen.« Das war die einzige Erklärung, die Belindas Mutter nach dem Verschwinden des Vaters abgab.
Lange Zeit glaubte Belinda, ihr Vater wäre längst verstorben. Dann fand sie einige Jahre später heraus, daß ihre Mutter Banküberweisungen erhielt, und zwar ein- bis zweimal im Jahr. Die Beträge waren manchmal enorm hoch, manchmal auch nur sehr niedrig. Sie kamen von Banken, überall in den USA. Die letzte Überweisung vor vier Monaten jedoch war in Dawson City aufgegeben worden.
Als Belinda das erfuhr, beschloß sie, zum Klondike zu reisen. Natürlich war es ihr klar, daß sich ihr Vater inzwischen ganz woanders befinden konnte. Aber ihre Arbeit im fotografischen Atelier in New York langweilte sie immer mehr. Durch ihre Tätigkeit dort hatte sie drei Jahre lang den Unterhalt für sich und Annabelle bestritten, weil ihre Mutter plötzlich gestorben war. Belindas Träume jedoch gingen in einer anderen Richtung. Sie wollte weite Reisen machen und vom Verkauf ihrer Fotos leben.
Als ihr die Idee kam, am Yukon Aufnahmen vom Goldrausch zu machen, stellte sie zunächst fest, daß die meisten Zeitschriftenverleger sehr zögerten, eine Frau mit dieser ungewöhnlichen Aufgabe zu betrauen. Die meisten lachten laut und hielten die Idee einfach für lächerlich. Aber Leslies Wochenmagazin zeigte sich nicht abgeneigt. Die Bilder wollte man ihr abkaufen – die Reise jedoch sollte sie selbst finanzieren. So kratzte Belinda ihre letzten Ersparnisse zusammen, um sich für dieses Abenteuer auszurüsten.
Annabelles Wunsch, die Schwester zu begleiten, erschien ihr zwar völlig absurd, aber Annabelle ließ sich nicht von ihrem Vorhaben abbringen. Vielleicht war das auch besser so, denn eine Frau allein im Kreis der goldgierigen Männer hätte gewiß viele Komplikationen heraufbeschworen.
Belinda wußte, daß ihr finanzieller Rückhalt so gut wie erschöpft wäre, wenn sie den Yukon erreichten, aber sie hoffte, daß sie mit ihren Fotografien genügend Geld verdienen konnte. Sicherlich gab es hier viele Männer, die ihren Familien ein Bild senden wollten und dafür gut bezahlen würden. Außerdem bestand natürlich die Gelegenheit in diesem wilden Land ungewöhnliche Aufnahmen zu machen, um die sich Zeitungen und Magazine reißen würden. Wurden die Bilder erfolgreich, würde auch niemand etwas dagegen einwenden, daß sie von einer Frau stammten.
Eins allerdings interessierte Belinda überhaupt nicht – das Gold …
Früh am nächsten Morgen erschien Charlie und weckte Belinda. Er hatte zwei jüngere indianische Träger mitgebracht, die er ihr allerdings nicht vorstellte. »Sprechen nicht so gut Englisch wie ich«, sagte er. »Sind aber gute Träger. Nicht so stark wie ich.« Er hob seine muskulösen Schultern. »Aber dennoch gut. Jetzt fangen wir an.«
Und schon wollte er beginnen, das Zelt abzubauen. Annabelle schlief drinnen immer noch und wachte mit einem entsetzten Schrei auf. »Belinda!«
»Meine Schwester ist noch nicht auf, Charlie«, sagte Belinda und konnte kaum ihr Lachen unterdrücken. »Transportiert erst die anderen Dinge. Wenn ihr vom ersten Marsch zurückkommt, haben wir das Zelt abgebaut und sind fertig.«
Der Chilkat nickte verständnisvoll. Mit Hilfe der beiden anderen verstaute er die Kisten in Tragenetzen, und sie marschierten los. Belinda war erstaunt, welches Gewicht die Männer mit solcher Leichtigkeit schleppen konnten. Sie hatten mehr als die Hälfte ihrer Ausrüstung mitgenommen.
Dann betrat sie das Zelt und stellte fest, daß sich Annabelle wieder in ihren Schlafsack verkrochen hatte und erneut eingeschlafen war. Ungerührt stieß sie ihre Schwester mit der Schuhspitze an. »Auf, liebe Schwester. Es wird Zeit!«
Murrend erhob sich Annabelle und zog sich an. Belinda bereitete inzwischen das Frühstück auf dem Spirituskocher zu. Dann baute sie das Zelt ab und faltete es zusammen. Dabei half ihr die Schwester nur gelegentlich. Nach Belindas Taschenuhr war es bereits zwölf, als die drei Träger zurückkehrten.
Mit erstaunlicher Schnelligkeit luden Charlie und seine Männer die restliche Ausrüstung auf. Belinda nahm lediglich den Dreifuß für ihre Kamera und den Apparat selbt mit, denn sie wollte noch einige Aufnahmen von Dyea machen.
Seufzend schlenderte Annabelle neben ihr her. Verärgert betrachtete sie ihre schlammbeschmutzten Schuhe. »Was für ein verdreckter Ort! Nur Strolche passen hierher.« Sie zeigte auf die Träger, »und wilde wie diese Burschen.«
»Sei still! Sie können dich noch hören!« schalt Belinda. »Und hör auf zu jammern! Ich brauch dich ja wohl nicht daran zu erinnern, daß es deine Idee war, mich zu begleiten.«
»Daß es so schlimm würde, hatte ich nicht geglaubt. Die Männer hier sind so vom Gold besessen, daß sie einer Dame nicht den nötigen Respekt erweisen.«
Jetzt kamen sie an den letzten Schlafzelten vorbei und erreichten eine verschmutzte Straße. Auf jeder Seite standen Zelte, die als Saloons oder Spielhöllen eingerichtet waren, primitive Hotels und billige Restaurants. Belinda wußte, daß der Hafen Dyea früher etwa zweihundert Bewohner gehabt hatte. Seit dem Goldrausch war die Bevölkerung wenigstens auf fünftausend angewachsen.
Aasgeier, dachte sie, Tausende von Aasgeiern, die sich nur an den Goldsuchern bereichern wollten.
Durch diese sogenannte Hauptstraße wanderten pausenlos Männer mit Lasten, Tragtieren und Hundeschlitten. Vor den Saloons und Spielkasinos standen viele verwegen geschminkte Frauen, die den Männern herausfordernd zuwinkten und Versprechungen flüsterten.
Belinda zog ihre Schwester am Arm zur Seite und sagte: »Charlie holen wir immer noch ein. Ich möchte hier ein Foto machen.«
Sie stellte den Dreifuß hin und setzte ihre Kamera darauf. Gegenüber befand sich ein hölzernes Gebäude, das nicht so verkommen wie die anderen aussah. Was Belinda zu der Aufnahme reizte, war eine Art von primitivem Gemälde. Es stellte eine Barszene dar. Männer saßen trinkend vor der Theke, ein Roulettrad schien sich zu drehen, Spieler hielten Goldstücke in der Hand, und abenteuerlich aussehende Frauen in kurzen Röcken standen herum. Über diesem Wandgemälde standen zwei Worte – Lesters Saloon.
Belinda fand die dargestellte Szene typisch für eine Stadt, die sich im Goldrausch befand. Sie war überzeugt, daß ihr eine gute Aufnahme gelingen würde. Während sie ihre Kamera vorbereitete, beobachtete sie einen großen Mann, der einen flachen Hut und einen Mantel mit Perlmuttknöpfen trug. Auf der Oberlippe seines schmalen Gesichts befand sich ein kühn gezwirbelter Schnurrbart. Auf den Wangen erkannte man Pockennarben.
Er stand vor Lesters Saloon, und Belinda wurde bewußt, daß er sie mit seinen kalten schwarzen Augen aufmerksam beobachtete. Etwas Bedrohliches lag in seinem Blick, und sie war froh, als er dann den Saloon betrat. Wenige Augenblicke später kam er jedoch mit einem anderen Mann wieder heraus. Dieser zweite Kerl war ungewöhnlich dick. Sein Bauch quoll förmlich aus dem Hosenbund.
Mit leichtem Schrecken bemerkte Belinda, wie der schnurrbärtige Mann auf sie zeigte. Jetzt überquerten die beiden die Straße und bahnten sich einen Weg durch die Menschenmassen. Natürlich wollten sie zu ihr. Aber was konnte das bedeuten? Schließlich tat sie doch nichts Verbotenes.
Inzwischen waren die beiden so nahe herangekommen, daß Belinda genau das Gesicht des fetten Mannes erkennen konnte – bartlos, rund, rosa und fröhlich lächelnd. Seine kleinen braunen Augen blinzelten ihr zu. Belinda atmete erleichtert auf. Trotz der wuchtigen Gestalt wirkte er nicht so bedrohlich wie sein Begleiter.
Sein Atem ging keuchend, als er zu ihr trat, seinen Hut zog und sich verbeugte. Nur mühsam konnte Belinda ein Lachen unterdrücken. Er hatte eine Glatze, und sein Kopf sah aus wie ein Ei.
Mit salbungsvoller Stimme fragte er: »Madam, darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Lester Pugh, und ich bin Besitzer des Etablissements, das Sie fotografieren wollen. Dieser Mann neben mir ist mein Freund und Teilhaber Chet Harter.«
Der pockennarbige andere Mann verzog keine Miene.
»Ich bin Belinda Lee«, entgegnete sie zurückhaltend. »Und das hier ist meine Schwester Annabelle. Gibt es einen Grund, warum ich Ihr Haus nicht fotografieren darf?«
»Das, Miß Lee, ist natürlich von dem Zweck abhängig.«
»Ich bin Fotografin von Beruf«, erklärte Belinda. »Während meines Aufenthaltes hier möchte ich Porträtaufnahmen herstellen und verkaufen. Gleichzeitig hoffe ich, Fotos von interessanten Objekten an Zeitungen und Magazine verkaufen zu können.«
Belinda fiel jetzt auf, mit was für kühnen Blicken dieser Chet Harter Annabelle musterte. Aber was sollte sie tun? Schließlich war Annabelle alt genug und pflegte Männer stets zu einem Flirt herauszufordern.
Annabelle gab sich völlig gelassen. Aber dieser pockennarbige Mann mit den kühnen Augen beeindruckte sie. Irgendwie erschien er ihr faszinierend, und sie war überzeugt, daß dies nicht ihr erstes und letztes Zusammentreffen mit Chet Harter sein würde.
Jetzt bemerkte Belinda, wie Lester Pughs Augen strahlten. »Also, Miß Lee, mit diesem Zweck wäre ich schon einverstanden. Sozusagen eine kostenlose Werbung für mein Etablissement! Machen Sie also Aufnahmen, so viele Sie wollen!«
»Vielleicht möchten Sie mit Ihrem Teilhaber im Vordergrund der Aufnahme stehen?« schlug Belinda vor.
Seine Augen verengten sich sekundenlang, dann antwortete er in verbindlichem Ton: »Das muß ich ablehnen. Sagen wir mal, ich bin zu schüchtern, um mich fotografieren zu lassen. Jedenfalls wünsche ich Ihnen alles Gute bei Ihrer Reise durch unser nördliches Land, Miß Lee.« Er verneigte sich und setzte seinen Hut wieder auf. »Ach, ehe ich’s vergesse, natürlich würde ich gern Exemplare der gedruckten Bilder sehen. Schicken Sie es postlagernd an Lester Pugh in Dyea. Hier kennt mich jeder … Kommen Sie, Mr. Harter, wir wollen die Lady nicht länger bei ihrer Arbeit stören.«
Als Lester Pugh keine Antwort bekam, fiel ihm auf, wie interessiert sein Kompagnon diese Annabelle betrachtete. Daher sagte er etwas schärfer: »Mr. Harter!«
Lässig blickte Harter ihn an. »Ja, ja. Ich habe Sie vorhin nicht gehört, Lester.«
Nun entfernten sich die beiden und verschwanden wieder in Pughs sogenanntem Etablissement. Was für ein seltsames Paar, überlegte Belinda. Besonders verwirrend wirkt dieser Chet Harter.
Annabelle kicherte leise. »Der große schlanke Mann ist recht attraktiv.«
»Attraktiv!« Belinda schüttelte sich vor Ekel. »Der abscheulichste Kerl, den ich jemals gesehen habe!«
»Ich weiß«, entgegnete Annabelle selbstzufrieden. »Das macht ihn ja so anziehend.«
Da Belinda solche Reden ihrer Schwester gewöhnt war, dachte sie nicht mehr länger an Harter, sondern sie beschäftigte sich wieder mit ihrem Fotoapparat. Geduldig wartete sie ab, bis zwischen den vorbeiflutenden Menschen eine Lücke entstand. Dann erst drückte sie auf den Auslöser, um so ein vollständiges Bild von Lesters Saloon zu bekommen. Sie legte die Kamera wieder in ihre Tasche und klappte den Dreifuß zusammen. Dann ging sie mit ihrer Schwester weiter.
Obwohl Charlie und seine Männer längst außer Sicht waren, fanden die beiden Frauen leicht den Weg nach Sheep Camp. Sie brauchten nur dem Strom der Goldsucher zu folgen, der sich durch eine enge Bergschlucht wälzte.
Als sie ankamen, war ihr Zelt bereits aufgebaut. Das Lager hier machte einen unglaublich verwahrlosten Eindruck. Es gab lediglich zwei Holzhütten und unzählige Zelte, die so dicht nebeneinander lagen, als wären sie zusammengekrochen, um sich vor den Naturgewalten zu schützen.
Charlie hatte den kleinen Lagerherd bereits aufgebaut und kochte das Abendessen. Die beiden anderen Träger waren nirgends zu sehen.
»Aber es ist noch nicht nötig, daß Sie auch noch für uns kochen, Charlie«, sagte Belinda.
Der Chilkat-Indianer zuckte mit den Schultern. »Aber Charlie ist ein guter Koch, und er kocht auch gern.«
Belinda spürte, daß Charlie sie und ihre Schwester auf seine Weise anerkannte. Dabei überlegte sie, ob es wohl möglich war, ihn für den ganzen Weg nach Dawson City anzuheuern.
Sie betrachtete jetzt die Vorderfront eines der Holzhäuser und erkannte, daß sie Charlie noch dankbarer sein mußte. So müde, wie Belinda war, hatte sie nämlich beabsichtigt, sich das Essen hier zu kaufen. Sie las auf der Tafel, daß jedes Gericht einen Dollar kostete.
Zwar hatte man Belinda schon in New York vor den Preisen hier gewarnt. Aber nach den bisherigen Ausgaben erschien es ihr nun unmöglich, auch noch zwei Dollar für das Abendessen auszugeben.
So verspeiste sie Charlies Gericht mit großem Appetit – Corned beef, Soße, Keksbrocken und hinterher Pfirsiche aus der Büchse. Mehr denn je war sie nun entschlossen, Charlie mitzunehmen.
Übermüdet krochen beide Mädchen unmittelbar nach dem Essen in ihre Schlafsäcke. Die Augen fielen ihnen sofort zu.
Am nächsten Morgen, es war der 3. April, stand Belinda am späten Vormittag auf. Mit einer gewissen Angst betrachtete sie die Berge von Ausrüstungsgegenständen, die sich um das Zelt häuften. Sie hatten in dem engen Tal Scales am Fuß des Chilkoot-Passes übernachtet. Noch dazu war sie allein. Annabelle war mit Charlie und den anderen Trägern schon vorausmarschiert. Wenn das Ziel erreicht war, würde Charlie ihre Schwester zurücklassen, die das Gepäck bewachen mußte, und zu Belinda zurückkehren, um die restlichen Dinge zu holen.
Den frühen Aufbruch hatte der Chilkat-Indianer durchgesetzt, denn der tagelange Schneefall erschwerte den Weg. Charlie wollte den Paß überqueren, bevor sich der Schnee bei den Mittagstemperaturen in unüberwindlichen Matsch verwandelte.
Belinda starrte zu den Bergen hinauf. Endlose Kolonnen von Männern arbeiteten sich mühsam bergaufwärts und schienen förmlich im Schnee zu versinken.
Auch als sie sich nach der anderen Richtung umblickte, wälzte sich ein Strom von Männern durch Sheep Camp. Plötzlich fesselte sie dieser Anblick. Was für ein wunderbares Foto mußte das werden!
Schnell holte sie ihre Grayflex-Kamera aus der Tasche. Der Schneeuntergrund war hier fest, und es fiel ihr nicht schwer, das Gerät mit dem Gestell aufzubauen.
Einen Augenblick lang überlegte sie noch, in welcher Richtung sie fotografieren sollte. Dann fiel ihr in der Reihe der Männer eine besonders große und breitschultrige Gestalt auf. Sie erkannte den Mann, dem sie den Fuhrmann weggeschnappt hatte. Er trug auf dem Rücken eine Last, die wenigstens zweihundert Pfund wiegen mußte. Aber er bewegte sich so leichtfüßig, als ob das eine Kleinigkeit wäre. Offenbar schien er Belindas Blick zu fühlen, denn nun sah er sie an. Seine hellblauen Augen wirkten so kalt wie der Schnee.
Schnell schaute sie zur Seite, und ihre Wangen röteten sich. Dann richtete sie das Objektiv ihrer Kamera zur oberen Hälfte des Chilkoot-Passes.
Als der Verschluß schnarrte, hörte sie über sich ein knallendes Geräusch. Schnell blickte sie auf und sah, wie eine hohe Schneewand herabstürzte und zum Paßweg herunterfiel.
Die Reihe der Männer vor ihr verschwand wie weggefegt, und nun kam die Lawine wie eine riesige Flutwelle auf sie selbst zu.
Kapitel 2
Wie gelähmt blieb Belinda stehen. Sie starrte auf die Wand aus Schnee und Eis, die auf sie zuraste. Natürlich mußte sie weglaufen, aber ihr Verstand schien auszusetzen. Sie dachte nur daran, was das für eine großartige Fotografie werden könnte.
Dann bemerkte sie, wie sich auf ihrer linken Seite etwas Dunkles bewegte. Aber bevor sie etwas erkannte, erhielt sie einen Schlag und taumelte in den Schnee. Schließlich hob sie den Kopf und erkannte einen Mann in einem Parka, der nach ihrer Kamera auf dem Stativ griff.
Schreck und Zorn überkamen sie. Was ging hier vor? Was bezweckte dieser Mann?
Schnell raffte sie sich auf. Der Mann drehte ihr den Rücken zu, während er an der Kamera herumhantierte. Ohne weiter zu überlegen, stürzte sich Belinda auf ihn.
Der Fremde taumelte kurz, und dann warf er sie, ohne sich umzuwenden, mit erstaunlicher Leichtigkeit von sich. Belinda schlug hart auf dem Boden auf und konnte kaum noch atmen. Aber sie sah, wie der Mann Kamera und Stativ ergriff. Dann lief er einfach davon. Belinda blickte ihm fassungslos nach:
Jetzt hörte sie einen Ruf hinter sich und beobachtete, wie eine zweite Gestalt den Mann mit der Kamera verfolgte. Der andere blickte sich erschrocken um und versuchte, noch schneller zu laufen. Dabei beachtete er die Lawine nicht, und plötzlich umgaben ihn Schneewolken.
Voller Hoffnung sah Belinda, wie der andere Mann den Dieb eingeholt hatte und bei den Schultern packte. Vor Schreck stöhnte sie leise auf, als der Dieb jetzt die kostbare Kamera fallen ließ und sich seinem Verfolger zuwandte.
Mein Gott, flehte Belinda, hoffentlich ist die Kamera nicht kaputt. Aber eigentlich mußte sie vor allem ihrem Retter dankbar sein, und so sandte sie auch für ihn ein Stoßgebet zum Himmel.
Die beiden Männer rangen miteinander im eisigen Schnee, und Belinda konnte nicht mehr erkennen, wer nun der Dieb und wer der Retter war.
Schon wollte sie hinlaufen, um wenigstens die Kamera aufzuheben, als der eine Mann dem anderen einen heftigen Schlag versetzte, und damit war der Kampf beendet.
Der eine Kerl lag bewegungslos im Schnee, während der andere ihre Fotoausrüstung aufhob. Hoffentlich handelte es sich nicht um den ursprünglichen Dieb, dachte Belinda. Atemlos wartete sie ab, was nun weiter geschehen würde.
Als ihr Retter unmittelbar vor ihr stand, erkannte sie ihn. Sie sah den dunklen Pelzparka, und eisblaue Augen blickten sie an. Es war der Mann vom Strand in Dyea. Der Mann, den sie so schlecht behandelt hatte. Trotz der beißenden Kälte stieg ihr die Schamröte ins Gesicht.
Er blieb vor ihr stehen, und sein Atem umgab ihn in der kalten Luft wie eine Wolke.
»Ich glaube, das gehört Ihnen, Miß.« Er hielt ihr Stativ und Kamera entgegen. Belinda griff ungebührlich hastig danach.
Dann untersuchte sie die Kamera. Nichts war zerbrochen, und der belichtete Film befand sich noch darin. Es war wie ein Wunder.
Jetzt erst lächelte Belinda den Mann dankbar an. »Ich verdanke Ihnen sehr viel«, sagte sie. »Und ich muß Sie auch um Verzeihung bitten.«
»Na, das ist aber eine erfreuliche Überraschung«, erwiderte er grinsend. »Als wir uns beim erstenmal trafen, waren Sie nicht so höflich. Den Grund für diese Feststellung können Sie sich ja wohl denken, nicht wahr?«
Wieder röteten sich Belindas Wangen. Warum behandelt er mich eigentlich wie ein Schulmädchen, fragte sie sich. Aber sie war ihm dennoch zu Dank verpflichtet.
»Ich entschuldigte mich doch bei Ihnen«, entgegnete sie etwas schroff. »Und meinen Fehler habe ich auch eingesehen.«
Er schob die Pelzkappe seines Parkas zurück, und im schwachen Sonnenlicht leuchtete sein Haar goldfarben auf. »Na ja, wenn wir schon von einer Schuld sprechen, möchte ich mich erkundigen, wie Sie diese zurückbezahlen wollen.«
Sein Ton klang ernst, aber seine Augen blickten sie amüsiert an. Solche Reden kannte Belinda, und sie fühlte sich ein wenig enttäuscht von diesem Mann. Er war also nicht besser als alle anderen, die jede Gelegenheit ausnutzten, um unsittliche Annäherungsversuche zu machen. Nun, sie war nicht wie ihre Schwester Annabelle, die Spaß an solchen Spielen fand. Wenn er eine Zurückzahlung wollte, so sollte er sie erhalten, aber nicht auf die von ihm erhoffte Art.
»Was verlangen Sie?« fragte Belinda kalt. »Meine Geldreserven sind im Augenblick ziemlich erschöpft, aber wenn Sie sich etwas gedulden …«
Er blickte sie seltsam an und trat einen Schritt zurück, als ob er sie genauer betrachten wollte. »Ich nehme an, Sie mißverstanden den Sinn meiner Worte«, erwiderte er höflich und kühl. »Eigentlich wollte ich nur ein wenig plaudern, aber in solchen Dingen bin ich offenbar nicht gut. Eine Bezahlung ist natürlich nicht nötig. Betrachten Sie mich als einen guten Samariter, wie man das so schön nennt.«
Diese Antwort verwirrte Belinda vollends, und als sie sich von ihm abwenden wollte, stolperte sie, verlor das Gleichgewicht und saß plötzlich im tiefen Schnee. Zornig und mühsam richtete sie sich auf, während er ihr gelassen zuschaute.
»Ich hätte Ihnen ja geholfen«, meinte er ernst. »Aber ich nahm an, daß Sie sich dann noch tiefer in meiner Schuld fühlen würden. Mit solchen Gewissensnöten wollte ich ein junges Mädchen wie Sie nicht belasten.«
Es gelang Belinda, ihn eiskalt anzublicken. »Ihre Bedenken begrüße ich, und ich verstehe sie durchaus.«
»Jetzt also doch«, meinte er zynisch.
In der Bergwelt hinter ihnen herrschte völlige Ruhe, die nur gelegentlich von Rufen unterbrochen wurde. Belinda fröstelte innerlich, als sie Männer beobachtete, die sich durch den Schnee vorankämpften. Die Männer und ihre Lasten schienen förmlich in der weißen Flut des Schnees zu versinken.
Belinda fühlte sich unendlich müde. Sie brauchte Ruhe, und sie hatte Hunger. Dann blickte sie wieder den Bergpfad hinauf. Alles, was sie besaß – außer der Kamera und dem Stativ – befand sich bereits auf der Höhe des Passes. Verzweifelt ließ sie die Schultern sinken.
»Fühlen Sie sich nicht wohl?«
Sie hatte völlig vergessen, daß dieser Mann noch immer neben ihr stand. »Doch, mir geht’s gut.« Sie zeigte zum Paß. »Aber die armen Männer dort … Einige wurden sicherlich unter dem Schnee begraben.«
»Vermutlich sogar viele. Dies ist eben ein hartes Land. Aber jetzt zu Ihnen … Wo sind Ihre Vorräte und die Ausrüstung?«
Wortlos zeigte sie zur Spitze des Zuges am Paß.
»Die Männer werden die Höhe frühestens morgen erreichen«, meinte er. »Der Pfad ist völlig verschneit. Sie brauchen einen Unterschlupf, um die Nacht zu verbringen und auch etwas zu essen.«
Ungewollt stiegen Belinda die Tränen in die Augen. Sie blinzelte verbittert und war sich zum erstenmal ihrer augenblicklichen Lage bewußt. Dennoch bemühte sie sich um ein Lächeln. »Na ja, vermutlich muß es mir irgendwie gelingen, das zu schaffen. Es findet sich ja immer ein Weg …«
Bei den letzten Worten fühlte sie sich wie benommen, taumelte und wäre fast wieder hingefallen.
Sofort legte sich seine Hand um ihre Taille, und sie spürte, wie sie sich hilfesuchend an ihn lehnte. Dann vernahm sie seine Stimme durch die dichte Pelzhaube ihres Parkas. »Ich habe ein kleines Zelt und einige Nahrungsmittel in meinem Gepäck. Bis morgen früh können Sie bei mir bleiben.«
Wider Erwarten klangen seine Worte keineswegs spöttisch, und Belinda war für seine Aufmerksamkeit dankbar. So ließ sie sich ohne jeden Einwand zu einer Höhlung zwischen zwei Felsen führen.
»Das ist kein schlechter Platz«, meinte er und ließ sie auf einem Felsblock niedergleiten. »Ich heiße übrigens Joshua Rogan. Meine Freunde nennen mich einfach Josh.«
»Und ich bin Belinda Lee.«
»Gut, Belinda Lee«, entgegnete er kurz. »Sie bleiben jetzt hier sitzen, bis ich mein Zelt aufgebaut habe.«
Sobald das kleine Zelt errichtet war, erschien es Belinda unmöglich, daß darin zwei Menschen Platz finden könnten. Aber Josh befahl einfach: »Kriechen Sie hinein, und wickeln Sie sich in die Decken. Ich mache inzwischen Feuer und koche.«
Belinda verschwand in dem dunklen Zelt, hüllte sich in die Decken und streckte sich auf dem Boden aus. Zunächst war ihr noch kalt, aber das gab sich bald. Ganz ungewollt döste sie ein.
Der Geruch des Essens weckte sie. Ihr Magen rebellierte vor Hunger. Belinda richtete sich auf und zog sich eine Decke um die Schultern. Josh kroch rückwärts ins Zelt, und sie erkannte, daß auf dem kleinen Herd etwas in einem Blechtopf schmorte.
»Hallo, Josh!« begrüßte sie ihn fröhlich.
Er wandte sich um und blickte sie an. »Fühlen Sie sich nun besser?«
»Ja. Aber ich bin fast am Verhungern. Der Duft hat mich geweckt.« Sie zeigte auf den brodelnden Topf.
»Einem Gourmet dürfte dieses Essen kaum schmecken«, erwiderte er, »aber wir bekommen so wenigstens etwas Heißes in den Bauch. Das Essen ist fast fertig. Würden Sie Teller und Bestecke aus meinem Gepäck holen, Belinda?«
Belinda nahm zwei Blechteller und Löffel aus Joshs Gepäck. Dann reichte sie ihm die Teller, damit er sie füllte. Es gab einen brennendheißen Eintopf und dazu je eine dicke Scheibe Brot.
Danach saßen sie vor dem noch warmen Herd und tranken Tee, der mit Schneewasser zubereitet war. Belinda kam es vor, als ob sie sich beide seit Jahren kannten. Dieser Josh war wirklich ein netter Bursche, der wußte, wie man andere Menschen zu behandeln hatte.
»Wie kommt es eigentlich, daß Sie mit Ihrer Schwester hierhergekommen sind?« fragte Josh. »Junge, schöne Frauen sind in dieser Gegend sehr ungewöhnlich – und dann noch zwei auf einmal.«
Belinda berichtete ihm ohne Zögern von ihrer Absicht.
»Dann kann ich Ihnen nur von ganzem Herzen Glück wünschen«, erwiderte Josh. »Und ich hoffe, daß Sie Ihr Ziel erreichen. Sie sind eine sehr tatkräftige Frau, Belinda Lee.«
Dieses Kompliment bereitete ihr große Freude. »Und wie ist es mit Ihnen?« erkundigte sie sich. »Warum sind Sie hier? Auf der Jagd nach Gold? Den Eindruck habe ich von Ihnen eigentlich nicht.«
Josh blickte zur Seite, schwieg eine Weile und antwortete dann: »Nun, man könnte sagen, daß ich in meinem bisherigen Leben immer nach etwas gesucht habe. Und ich tue es noch. Damit bin ich vermutlich kein Einzelfall. Hier gibt es viele Hundert von professionellen Goldsuchern sowohl Schurken als auch ehrenhafte Männer.« Sein Gesichtsausdruck verhärtete sich, und er blickte zum Chilkoot-Paß, der jetzt nicht mehr so übervölkert zu sein schien. »Manche füllen sich auch durch Mord die Taschen, anstatt dafür zu arbeiten.« Er schlug sich mit der Hand aufs Knie. »Aber jetzt sollten wir beide schlafen. Morgen steht uns ein harter Tag bevor, und wir brauchen unsere ganze Kraft.« Dabei reckte er sich und gähnte. Schließlich stellte er den Spirituskocher ab. »Gehen Sie schon mal ins Zelt.«
Belinda starrte in das Zelt. Der Gedanke, dort neben ihm zu liegen, trieb ihr die Röte ins Gesicht.
Verärgert fuhr Josh sie an: »Es ist eine Frage des Überlebens, Belinda. Persönliche Gefühle darf man dabei nicht beachten oder empfinden. Ich gebe Ihnen mein Wort, daß ich ein Gentleman bin und die Situation nicht ausnutzen werde.«
Sie nickte, brachte aber kein Wort heraus. Dabei kam sie sich linkisch wie ein Provinzmädchen vor. So bückte sie sich schnell und kroch durch die kleine Öffnung ins Zelt. Als sie sich in die Decken rollte, spürte sie, wie auch Josh hereinkam.
Belinda versuchte, sich möglichst klein zu machen. Aber das Zelt war so eng, daß sein Körper sich beängstigend nahe an sie drückte. Sie hatte das Gefühl, vom Kopf bis zu den Zehenspitzen zu erröten. So zog sie die Decke noch fester wie einen Schutzschild um sich. Da spürte sie, wie seine Finger behutsam an der Decke zupften.
Nur mühsam konnte sie einen Aufschrei unterdrücken und klammerte sich an der Decke fest.
»Belinda«, sagte er leise, »ich möchte Sie nicht berühren, aber wir müssen uns die Decken teilen. Unsere Körperwärme verstärkt sich, wenn wir dicht nebeneinander liegen. Es ist besser, wenn man gemeinsam unter den Decken liegt als allein.«
Belinda befreite sich sofort von den Decken und schalt sich selbst eine Närrin. Natürlich hatte er mit seiner Bemerkung recht. Das war ja eine uralte Weisheit, wenn man im Freien übernachtete.
Eine Weile zog er die Decken zurecht. Dann lag er endlich still, und die Wärme seines Atems streifte ihren Nacken.
Belinda lag wie erstarrt da. Was würde jetzt kommen, fragte sie sich. Da hörte sie plötzlich sein leises Schnarchen. Er war also wirklich eingeschlafen. Da lag sie hier, steif wie ein Brett, und dieser Mann schlief. Eigentlich enttäuschend, aber das war natürlich ein verwegener Gedanke. Insgeheim mußte sie lachen. Danach fühlte sie sich erleichtert und schlief bei der angenehmen Wärme langsam ein.
Während der Nacht wachte Belinda mehrmals auf, und dann ließ sie das gellende Aufheulen eines Wolfes hochschrecken. Schnell zog sie sich die Decken über den Kopf.
Hinter ihr bewegte sich Josh, und nun lagen sie beide Rücken an Rücken wie Löffel in der Schublade. Er stöhnte mehrmals leise auf.
Und dann verspürte sie plötzlich seine tastende Hand. Wohlige Wärme überkam sie. Jetzt erreichte seine Hand ihre Brust und tastete darüber. Ein Gefühl des Verlangens erfüllte sie, obwohl das sich natürlich nicht gehörte.
Panik ergriff sie. Was für ein Mann war dieser Fremde? Belinda hatte kaum Erfahrungen mit Männern, außer gelegentlichen flüchtigen Küssen und hastigen Umarmungen. Allerdings hatte sie viel gelesen und wußte daher, was zwischen einem Mann und einer Frau in einer solchen Situation passieren konnte.
Aus Romanen und von den Belehrungen ihrer Mutter wußte sie, daß sich Männer in solchen Fällen unkontrollierbar wie Tiere verhielten. Am besten sollte man sich nicht gegen sie wehren.
Dieser Josh Rogan schien sich wirklich in einer starken Erregung zu befinden, und sie war allein mit ihm in einem Zelt. Was sollte sie tun? Und wenn sie floh – wohin in dieser Einsamkeit?
Josh murmelte etwas Unverständliches und streichelte sie. Ganz ungewollt empfand sie seine Hände als angenehm und wurde schwach. Was würde er mit ihr tun, wenn sie sich zu ihm umdrehte?
Langsam wandte sie sich um und lag nun auf dem Rücken. Sein Arm umfaßte ihre beiden Brüste. Das war gewiß nicht besser. Aber dann warf er sich mit ungeahnter Heftigkeit über sie.
Belinda versuchte, sich aufzurichten, aber es war zu spät. Und vielleicht wollte sie es auch gar nicht mehr. Es mußte geschehen. Zwar schrie sie laut auf, aber wer sollte hier schon ihren Ruf hören?
Es geschah also, was geschehen mußte, und danach fühlte Belinda sich irgendwie schuldig. Konnte eine Frau sich ohne Überlegungen so hemmungslos hingeben?
Mit schuldbewußter Stimme fragte er dann: »Belinda?«
Sie gab keine Antwort.
»Belinda? Verzeih – habe ich dir auch nicht weh getan?«
Schwer atmend erwiderte sie: »Nein, ich – glaube nicht.«
Josh stöhnte auf. »Himmel, es tut mir so leid, Belinda. Glaubst du mir das? Ich gab dir mein Wort, und ich wollte es auch halten. Das kann ich beschwören. Natürlich ist das keine Entschuldigung, aber ich befand mich im Halbschlaf. Habe ich dich sehr erschreckt?«
»Ja«, erwiderte sie leise.
»Himmel! Gib mir eine der Decken.«
Sie fühlte, wie er sich erhob und dabei gegen ihren Fuß trat. Dann kroch er aus dem Zelt.
Leise und zögernd sagte er draußen: »Es tut mir wirklich leid. Ich muß das noch einmal sagen. Aber du mußt auch wissen, daß es bei einem Mann gewisse Grenzen gibt, Belinda, und wenn man dann im Halbschlaf liegt, tut der Körper etwas, ohne den Verstand zu fragen. Ich hoffe nur, daß du mir vergibst.«
Er duzt mich also, dachte sie und hörte seine im Schnee knirschenden Schritte.
Bedrückt zog Belinda die restlichen Decken um sich. Stimmte es wirklich, daß Josh keine Kontrolle mehr über das besaß, was sein Körper getan hatte? Ihr Körper verspürte immer noch die so schöne und betäubende Hitze seiner Leidenschaft. Und in Gedanken fühlte sie wieder, wie seine Hand über ihre Brust glitt.
Kapitel 3
Wegen seines schweren Körpergewichts marschierte Lester Pugh breitbeinig daher. Er holte eine weitere Zigarette hervor und zündete sie am Ende der aufgerauchten an.
Er inhalierte den Rauch tief, während er in seinem Büro auf und ab wanderte. Dabei blickte er durch das beschlagene Fenster. Vor ihm lag die Hauptstraße von Dyea. Zwar umspielte ein Lächeln seine vollen Lippen, aber die kleinen braunen Augen blickten so hart wie das Eichenholz des Spazierstockes, der neben ihm an der Wand hing.
Wie eine richtige Stadt wirkte Dyea noch nicht. Aber sie wuchs ständig, und alles, was hier entstand, gehörte ihm – Lester Pugh.
Jetzt wippte er auf den Füßen auf und ab. Ja, Dyea war seine Stadt. Jedes Haus, Faß und Whiskyglas gehörte ihm
Dieser Gedanke tat ihm gut. Stück für Stück hatte er sich die Stadt angeeignet. Die Spielhallen, die Saloons und die Bank. Hier waren ja alle anderen ins Gold vernarrt und kümmerten sich um sonst nichts. Aber man konnte ja Gold auch auf eine andere Art scheffeln. Er würde reicher sein als alle diese Narren. Und dabei konnte er sich auch keine Schwielen an seinen so gepflegten Händen zuziehen.
Lester Pugh kicherte leise, und die goldene Uhrkette über seinem feisten Bauch wippte. Diese Stadt würde ihm bald ganz gehören – so wie Skagway diesem Soapy Smith.
Diesen Kerl konnte man eigentlich nur bewundern. Dem fielen Dinge ein, von denen die meisten Männer nichts ahnten, auch wenn sie einen ganzen Monat voller Sonntage verbrachten.
Da hatte er sich dieses Stückchen mit einem Telegrammbüro in Skagway ausgedacht. Die Männer stürmten sein Büro. Jedes Telegramm nach Hause kostete fünf Dollar. Am nächsten Tag konnten sie wieder erscheinen und sich die Antwort abholen. Nochmals für fünf Dollar.
In Wirklichkeit gab es überhaupt keinen Telegrafen. Im Hinterraum des Büros wurden die Telegramme weggeworfen, und ein ständig betrunkener ehemaliger Journalist dichtete Antworten.
Das Geheimnis dieses Profits war allerdings langsam bis an die Öffentlichkeit gedrungen. Das ganze Land lachte darüber.
Lester Pughs Gedanken kehrten zu seinen eigenen Plänen zurück. Sobald er ganz Dyea in der Tasche hatte, galt es, sich auszudehnen. Daher hatte er bereits Grundbesitz in Dawson City erworben, dazu einen Saloon und eine Spielhölle.
Zunächst mußte man mit reinen Geldquellen seine Geschäfte beginnen. Später konnte man sich mit anderen Dingen beschäftigen. Mit der Aufsicht in Dawson City hatte er Montana Leeds beauftragt – einen sehr freundlichen, aber dennoch eiskalten Mann.
Wieder mußte Lester Pugh lachen, und er gab einen perfekten Rauchring von sich. Jetzt wanderte eine Frau in schwerem Rock und Parka auf der anderen Straßenseite vorüber. Frauen gab es hier nur wenige, und die meisten wollten ihr Gold bei den Männern holen.
Der gestrige Vorfall war recht ungewöhnlich – zwei Mädchen mit rosigen Wangen und großen Augen. In früheren Zeiten, als seine sexuelle Gier noch größer gewesen war, hätte er sich den beiden sofort genähert, um sie zu verführen.
In den letzten Jahren war jedoch sein Begehren geschwunden. Immer mehr interessierten ihn Macht und Geld. Natürlich waren diese beiden Mädchen hübsche Dinger gewesen, aber Lester Pugh hatte eben zu viele geschäftliche Dinge im Kopf, um noch irgendwelche Gedanken an sie zu verschwenden. In diesem vom Goldrausch erfaßten Land gab es nämlich eine Gefahr. Diese verdammten Schnüffler der Regierung mußten endlich beseitigt werden.
Lester Pugh hatte das Glück, gute Freunde in Washington zu besitzen. Von denen hatte er erfahren, daß sich hier insgeheim ein Marshal aufhielt, der sich um alle Formen der Gesetzlosigkeit kümmern sollte – um Mord, Diebstähle und Menschen wie ihn und Soapy Smith.
Als Lester Pugh Soapy von der Anwesenheit dieses Marshalls informiert hatte, war der Mann in schallendes Gelächter ausgebrochen. »Soll der doch machen, was er will. Ich rege mich darüber nicht auf.«
Dennoch machte sich Pugh seine Gedanken, und er würde sich wesentlich leichter fühlen, wenn sich dieser Schnüffler nicht hier blicken ließe.
Nun zog er seine große goldene Taschenuhr hervor und ließ den Deckel aufschnappen. Zwei Uhr. Lester Pugh seufzte ungeduldig auf. Um diese Zeit mußte es längst erledigt sein. Aber wo war Chet Harter?
Schließlich trat er vom Fenster zurück und ging zu seinem schweren eichenen Schreibtisch. Darauf stand in einem Silberrahmen das Bild eines bärtigen Mannes. Pugh hob es hoch und betrachtete das Bild des Mannes, der sein Vorbild für Erfolg und Größe war. »Alter Soapy«, murmelte er. »Ich bin noch gerissener und vorsichtiger als du. Mein Besitz wird größer sein, als du es jemals zu träumen wagtest. Niemand wird mich daran hindern.«
Bei den letzten Worten öffnete sich die Tür seines Büros. Trotz seiner Beleibtheit fuhr Pugh mit erstaunlicher Schnelligkeit herum. Chet Harter schlenderte herein, den Hut ins Genick geschoben, mit hochnäsigem Blick.





























