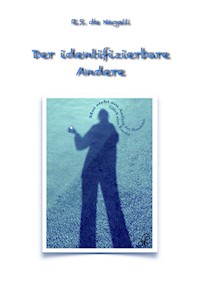
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Als wissenschaftliche Zusammenfassung zeigt das Buch deutlich auf, welche Funktionen und Mechanismen, damals und heute, das Bildungswesen zu erfüllen haben und bedienen. Diese statischen festgelegten Rollen, im schulischen als auch im gesellschaftlichen Rahmen, garantieren nach wie vor, daß Minderheiten - allen voran ethnische Minderheiten - immer noch diskriminiert und selektiert werden. Diese zeitlose wissenschaftliche Studie ist aktueller denn je. Sie bezeugt die unwandelbare Haltung von Behörden, Bildungseinrichtungen und Politik im 21 Jh.. Trotz einer dazwischen liegenden zwölfjährigen Zeitspanne entspricht das Geschriebene immer noch der aktuellen sozialen Konstellation – in Hinsicht auf Bildung und Gesellschaft. Diese Publikation findet scheinbar in jeder Epoche einen Platz.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhaltsangabe
Impressum
1. Einleitung
1.1. Vorwort
1.2. Einleitende Gedanken
1.3. Zielvorstellungen
2. Begriffsbestimmung
2.1. Integration
2.2. Segregation
2.3. Das Alltagsverständnis von „Vorurteil“
3. Definition und Vorurteilsforschung
3.1. Funktionsweise von Vorurteilen
3.1.1. Der Gruppenprozeß als vorurteilsbildender Prozeß
3.2. Das Vorurteil im Fokus der Wissenschaft
3.2.1. Der konflikttheoretische Ansatz
3.2.2. Der lerntheoretische Ansatz
3.2.3. Der kognitive Ansatz
3.2.4. Der psychodynamische Ansatz
3.2.4.1 Der Sündenbock nach Nolting (1993)
3.3. Änderung von Vorurteilen
4. Die Anderen – Außenseiter und Minderheiten
4.1. Außenseiter
4.2. Minderheiten - Mehrheiten
4.2.1. Der Fremde, der identifizierbare Andere
4.2.1.1 Fremdheit im geschichtlichen Überblick
5. Zur Situation der Sinti und Roma
5.1. Kurzer historischer Hintergrund
5.2. Der Name
5.3. Die Kultur der Sinti und Roma
5.3.1. Kulturelle Besonderheiten der Sinti in Straubing
5.4. Sinti und Roma als Feindbilder
5.5. Systematische Segregation und Vorurteilsbildung
6. Soziale Diskriminierung
6.1. Der Fremde
6.2. Funktionalisierung von Diskriminierung durch Behörden und Medien
6.2.1. Dokumentation der behördlichen Diskriminierung
6.2.2. Der „identifizierbare Andere“ in den Medien
6.3. Die Lage Ende der 70er
6.3.1. Neue „alte“ Ängste seit 1989
7. Darstellung der Situation des Bildungs- und Berufserfolgs von Sinti und Roma
7.1. Funktionsbestimmung der Schule
7.1.1. Gesellschaftliche Funktionen von Schule
7.1.2. Die emanzipatorische Funktion von Schule
7.2. Bildungssituation der Sinti und Roma
7.2.1. Suche nach den Ursachen des Schulversagens
7.2.2. Berufliche Situation
7.3. Begründung von Schulversagen
7.3.1. Schulische Selektion
7.3.2. Diskriminierung der Muttersprache
7.3.3. Lösungsansätze
7.4. Ein Projekt der Zukunft
8. Schlußgedanken
Literatur
Copyright © 2021 by R.S. de Nagell
ALLE RECHTE VORBEHALTEN
1. Auflage 2021
Die schriftlichen Werke sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, auch einzelner Teile, ist ohne Zustimmung des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für fotomechanische oder grafische Vervielfältigung sowie Übernahme und Verarbeitung in EDV-Systemen. Alle Bilder und Fotografien sind urheberrechtlich geschützt. Sie stammen nachweislich aus dem eigenen Archiv und unterliegen dem Urheberrecht: Copyright © 2021 by R.S. de Nagell; ALLE RECHTE VORBEHALTEN.
Jedes Website-Design, jeder Text, alle Grafiken, jede Auswahl bzw. jedes Layout davon und jede Software sind rechtlich geschütztes Eigentum von R.S. de Nagell (Copyright © 2021 by R.S. de Nagell; ALLE RECHTE VORBEHALTEN). Jede Verwendung der auf dieser Website verfügbaren Materialien bzw. Informationen -- inklusive der Reproduktion, des Weitervertriebs, der Veränderung und der Veröffentlichung zu einem anderen als dem oben genannten Zweck -- ist untersagt.
Impressum
Ansprechpartner
R.S. de Nagell
c/o AutorenServices.de
Birkenallee 24
36037 Fulda
Sie können uns auch per E-Mail erreichen:
oder im Internet:
www.denagell.de
E-Book-Formatierung: Daniela Rohr: www.skriptur-design.de
1. Einleitung
„Es sind nicht Dinge, die uns beunruhigen, sondern die Meinungen, die wir von den Dingen haben.“ (Epiktet)
Was man nicht kennt, kann man fürchten - aber nicht hassen. Ist das so?
Seit Menschengedenken sind Vorurteile ein tragendes Element um Gewalt und Aggressionen gegenüber Minderheiten zu legitimieren. Die manipulierte und aufgehetzte Gesellschaft wird durch tradierte soziale Vorurteile, Ängste und irrationale Überzeugungen, verblendet. Selbsternannte Panikmacher nutzen jede Gelegenheit dafür, die kuriosesten Märchen über das Unbekannte oder Beängstigende zu verbreiten. Eine erfolgreiche Strategie, welche machtbesessene Prediger, Zauberer, Priester oder Politiker schon immer nutzten, um Menschen zu verängstigen und zu manipulieren.
Auch über die Sinti und Roma dominiert ein „Hören - Sagen“, welches jeder glaubwürdigen Grundlage entbehrt. Sobald diese Gruppe auftrat, verschwanden plötzlich Gegenstände, Tiere und sogar Kinder. Unglaublich - oder? Ihre Denunzierung beginnt mit ihrer Vertreibung und Flucht aus Nordindien - ihrem ehemaligen Heimatland - und hält bis heute an.
1.1. Vorwort
Vorurteile fallen nicht einfach vom Himmel, sondern verfestigen sich von Generation zu Generation, oder werden aufgrund sozialer Konfliktsituationen im wahrsten Sinne des Wortes „entworfen“. Früher bezog sich das „praejudicium“ (lat.: das Vorurteil; vorhergehendes Urteil) auf Erfahrungen und Entscheidungen. Vorurteile wurden in der Metaphysik (s. Descartes, Leibniz usw.) zur philosophischen Wahrheit erklärt. Was dem Vorurteil eher eine positive Deutung gab, im Gegensatz zur heutigen Darstellung des Vorurteils, als eine negative stereotype Aussage oder Meinung, wie z.B. bei Allport (1971):
„Ein ethnisches Vorurteil ist eine Form von Feindseligkeit in zwischenmenschlichen Beziehungen…“ (zit. nach Six,1978, S. 14).
Als kollektives vorurteilsbeladenes Generationenbild trifft dies bei Sinti und Roma zu; denn ich kann mich noch erinnern, wie Eltern und Großeltern über diese marginalisierte Volksgruppe sprachen. Regelrechte Diskriminierungskampagnen, wie: „Achtung die Zigeuner kommen, alles wegschließen“ oder „sei vorsichtig, Zigeuner sind gefährlich“ usw., folgten.
Während meiner einjährigen Arbeit mit Sinti und Roma in Straubing konnte ich dieses negativ tradierte Bild immer noch spüren. Fast resignierend musste ich feststellen, dass sich an den Erfahrungen meiner Kindheit bis heute kaum etwas geändert hat. Diese erschreckende Erkenntnis gab mir den Anstoß, mich mit den Mechanismen des Phänomens Vorurteil intensiver auseinanderzusetzen. Denn nur durch Kenntnis der psychologischen und sozialen Zusammenhänge von Vorurteils- und Stereotypenbildung ist es m.E. möglich effektiv Gegenmaßnahmen und Umdenkungsprozesse einzuleiten.
Die nun vorliegende Magisterarbeit stellt das Ergebnis meiner Bemühungen zur wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Thema Vorurteil dar.
1.2. Einleitende Gedanken
Die Herabsetzung bzw. soziale Benachteiligung des Individuums, wegen seiner Herkunft, Religion oder Hautfarbe ist in Deutschland schon länger unter den Begriffen „Vorurteil“ und „Stereotypenbildung“ in den Wissenschaften ein Thema geworden.
Beeinflussende Faktoren zur Vorurteilsbildung sind Selbsterhaltung, Eigenliebe (positive Vorurteile über sich selbst), Ansehen, das Streben nach Wohlstand, Triebe wie Neid, Machtgier oder der Wettkampf innerhalb von Gruppen und Völkern.
In zahlreichen Medien (Printmedien oder Fernsehen) wird in diesem Zusammenhang viel von fehlgeschlagener Integration berichtet. Die Bilder von allnächtlichen Krawallen, brennenden Autos, randalierenden Jugendlichen erregen schon länger die Öffentlichkeit.
Die Abschiebung unerwünschter Bürger, an den Rand der Gesellschaft, womit sie sich selbst überlassen bleiben, schürte Vorurteile und Segregation. Diese Ausgrenzung führte letztendlich zum Aufstand der Benachteiligten. Die Revolution der Minderheiten für mehr Gleichberechtigung konnte man in allen Medien verfolgen (vgl. Arte-tv vom 27. Mai 2004).
Auch wenn man in Deutschland versucht, aus der eigenen Geschichte und den Ereignissen im Nachbarland zu lernen und nach Ursache und Wirkung misslungener Eingliederung zu forschen, wird auf viele Minoritäten in unserem Land heute noch zu wenig geachtet.
Um eine dieser Minderheiten und den historischen und gegenwärtigen Folgen ihrer Brandmarkung geht es in dieser Arbeit. Trotz jahrhundertelanger Ansässigkeit werden Sinti und Roma durch hartnäckig bestehende Vorurteile weiter ausgegrenzt und sowohl schulisch als auch wirtschaftlich benachteiligt.
Der Politik ist es nicht gelungen dieser Kultur einen Platz in der Gesellschaft einzuräumen. Das negativ tradierte Bild des „Zigeuners“ steckt noch immer fest in den Köpfen der Menschen und scheint unauslöschbar. Sie sind die größte ethnische Minderheit (ca. 110.000 bis 130.000 in Deutschland) auf die das zutrifft (Hansen, 2003, S. 100ff).
Die gängigen Bilder von „Zigeunern" beziehen sich nicht auf persönliche Erfahrungen, sondern festigten sich kulturell. Die Schulbücher begnügen sich mit der Darstellung der Sinti und Roma als „Zigeuner". Sie befassen sich nicht mit deren wirklichen Lebensweisen. Als Vorlagen dienen literarische Quellen, wie z.Bsp. das „nächtliche Zigeunerlager" Goethes aus dem Werk „Götz von Berlichingen".
Zahlreiche negative Zuschreibungen der „Zigeuner" gibt es seit dem späten Mittelalter. In der Volksliteratur, in Märchen, Sagen und Legenden finden wir die „fahrenden Zigeuner" immer wieder. Luther verurteilte dieses Volk im 16. Jahrhundert als Bettler, Betrüger und Diebe. Ebenso werden sie als listige Gauner und Abenteurer porträtiert. Die Bezeichnung Zigeuner hat sich als eine diskriminierende Bezeichnung (Vorurteil) verbreitet (Körte, 2005, S. 62ff).
War die Figur des „Zigeuners" vor 1770 nur eine Randerscheinung, so haben sich danach die feindlichen „Zigeunerbilder" ebenso wie die Judenbilder schlagartig vermehrt und verschärft. Seit ihrer Vertreibung aus ihrem indischen Heimatland grassieren die verschiedensten Vorurteile über Sinti und Roma. Sie wurden als kriminell beschrieben und wegen ihrer Andersartigkeit rassistisch verfolgt. Diese Vorurteile sind durch die Literatur verbreitet worden und haben sich in den Köpfen der Menschen gefestigt.
In Westeuropa sind Sinti und Roma seit über 600 Jahren sesshaft und üben bürgerliche Berufe aus. Trotzdem zeigen die Medien immer noch den „Zigeuner" als fremdartige Wesen. Würden sie als ganz normale, in die Gesellschaft eingebundene, Individuen gezeigt werden, würde langsam ein völlig anderes Bild über diese Gruppe entstehen (Körte, 2005, S. 63). Die gängigen Zigeuner-Stereotype haben mit der tatsächlichen Lebensweise der Sinti und Roma nichts zu tun.
1.3. Zielvorstellungen
In dieser Arbeit sollen die gängigen „Stereotypen“ über Sinti und Roma „entzaubert“ und die Entstehung von „Vorurteilen“ und deren Folgen dargelegt werden. Die daraus resultierenden negativen Auswirkungen auf die sozialen und ökonomischen Lebensbedingungen dieser marginalisierten Gruppe werden aufgezeigt. Dazu gehören Diskriminierung, Segregation, (fehlgeschlagene) Integration, sowie ihre beruflichen und schulischen Chancen.
Zuvor setze ich mich mit den Begriffen Integration, Segregation und mit dem Alltagsverständnis von Vorurteil auseinander; um dann die wissenschaftlichen Ansätze und Ergebnisse der interdisziplinären Vorurteilsforschung zu beschreiben.
Der „identifizierbare“ Andere begreift sich als „der Andere“ im Sinne von sichtbar anders sein. Diesem „anders sein“ widme ich den Abschnitt 4, da es meines Erachtens (m.E.) wichtig ist, erst einmal klarzustellen, wer und was die Anderen eigentlich sind.
Darauf folgt die historische Auseinandersetzung mit der Volksgruppe der Sinti und Roma und ihrer Leidensgeschichte (s. P. 5).
Ergänzend zu P. 5 wird im Abschnitt 6 aufgezeigt, wie sich ein „fremdes“ Bild verinnerlicht und wie Behörden und Medien an Vorurteilsbildung und Diskriminierung mitwirken.
Die Auswirkung dieser Benachteiligung im Schul- und Bildungswesen erfolgt im Abschnitt 7.
Abschließend gehe ich auf positive Impulse verschiedener Projekte im Abschnitt 8 ein, welche zukunftweisend nicht nur für Sinti und Roma, sondern alle Randgruppen sein könnten.
2. Begriffsbestimmung
Um Missverständnisse zu vermeiden muss auf bestimmte Formulierungen eingegangen werden. Was bedeutet im wissenschaftlichen Sinne Integration oder Segregation? Wie kann das Alltagsverständnis für Vorurteil beschrieben werden?
2.1. Integration
Bauböck und Volf (2001, S. 11-39) beschreiben Integration als einen Umstand, in dem Migranten als Mitglieder einer Gesellschaft anerkannt werden. Voraussetzung wäre eine wechselseitige Anpassung und Veränderung zwischen der aufnehmenden und aufzunehmenden Bevölkerung. Dazu gehört die Anerkennung der sozialen Regeln und Gesetzte von seitens der Immigrierten, aber auch die Akzeptanz der Mehrheit kulturelle Differenzen anzunehmen.
Das Überleben gelang den Roma und Sinti, weil die heimische Bevölkerung von ihnen einen wirtschaftlichen Nutzen hatte. Die „Zigeuner“ vertrieben die verschiedensten Waren und boten Unterhaltung durch Musik und Tanz. Dieses Angebot verschiedener Waren und Dienstleistungen ist heute noch Mittelpunkt ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit. Die ständige Angst vor behördlichen Zugriffen (Bsp. Gefangennahme, Gefängnisse) veranlasste sie sich permanent im Hintergrund zu halten, sich zu verstecken, was wiederum eine Integration unmöglich machte.
Da sie sich immer wieder verstecken (unentdeckt bleiben) mussten, aus Angst ins Gefängnis geworfen oder bestraft zu werden, konnten sie sich in die herrschende Gesellschaft nicht integrieren. Misstrauen und Ablehnung führten zu einer Konzentration auf die eigene Gruppe, während die Mehrheitsbevölkerung ihrerseits durch vorurteilsgeladene Einstellungen und anhaltende Diskriminierung durch Behörden Abstand hielt.
Im Europäischen Netz gegen Rassismus (ENAR) heißt es dazu, dass ständige Flucht und Verfolgung zu einer Hier- und Jetzt – Philosophie führen, da langfristige Planungen nicht möglich sind. Diese Einstellung wirkt sich auf die Vorliebe zur Selbstständigkeit, mangelnde Gesundheitsfürsorge oder andere Lebensbereiche, wie unregelmäßiger Schulbesuch, aus (ENAR, 2002, S.9).
Mangelnde Integration von Minderheiten wird von der Mehrheitsbevölkerung als Bewahrung ihrer Kultur und Sprache gesehen und die Segregation somit toleriert und erwünscht.
Einerseits schließt sich die Fremd-Gruppe damit aus dem gesellschaftlichen Leben aus und separiert sich mit der Zeit selbst (Hansen, 1997, S. 12ff). Andererseits ist die Forderung nach Integration berechtigt, da eine Gesellschaft nur dann existieren kann, wenn die Menschen einigermaßen zusammenhalten. Das wiederum sollte Vielfalt nicht ausschließen, damit eine Weiterentwicklung möglich wird. Integration und Segregation stehen demnach in einem Wechselverhältnis zueinander (Hansen, 2001, S. 27).
Betrachten wir Integration vom persönlichen Standpunkt aus, dann bedeutet Integration auch eine Anpassung an die Mehrheitsbevölkerung, die mit Zwang und Unterdrückung verbunden ist. Ipsen (1983) kritisiert, dass das Wort Integration „Herrschaft“ außer Acht lasse und suggeriere eine positive Wahrnehmung von Integration in einem herrschaftsfreien Raum. D.h. Integration umfasst nicht nur die Einbindung eines Individuums in die Majorität, sondern Integration wird ebenso als Herrschaftsinstrument ge- oder missbraucht (Hansen, 1997, S. 16ff).
Um Ungleichheiten zu vermeiden und Integration möglich zu machen ist es notwendig Minderheiten und Einwanderern den Zugang zu gesellschaftlichen Einrichtungen und Positionen zu erleichtern. Politisch gesehen muss das Selbstbild einer Nation verändert werden (Bauböck & Volf, 2001).
Bei den Sinti und Roma, als deutsche Staatsbürger, führten Verarmung und Abgrenzung (Segregation) zu einem Diaspora-Dasein. Wodurch Fremdheit verstärkt wird und somit auch die Andersartigkeit des Fremden. Deshalb sollte Integrationspolitik darauf achten, dass sich über niedrige Löhne, Ghettosituation, Arbeitslosigkeit und mangelnde Bildung die Segregation nicht verfestige (Bauböck & Volf, 2001).
Eine Lösung des Problems sahen Bauböck und Volf in einem umfassenden Antidiskriminierungsgesetz, verbunden mit einer Beweislastumkehr. Unabhängige Einrichtungen haben die Pflicht Verstöße zu überprüfen und zu dokumentieren. Zwar wurde diese Forderung 2006 mit dem Inkrafttreten des Schutzgesetzte im Privatrechtsverkehr - eine Erweiterung des Gleichheitsgrundsatzes (AAG) aus Art. 3 G1. Zwar ist das Gesetz nun privatrechtlich verankert, jedoch auf eine Kommission der Überwachung dieses Gesetztes wurde verzichtet. Ebenso liegt die Beweiskraft beim Kläger. Damit hat dieses Gesetz keinerlei besondere Auswirkung - im Prinzip bleibt es wie immer. Es finden sich kaum Kläger, da jene, die benachteiligt werden wohl kaum die nötigen Mittel aufbringen können, um ihre Rechte auf Gleichbehandlung durchsetzten zu können.
Für Sinti und Roma wäre es angemessen Arbeitgeber, die sich ablehnend und diskriminierend verhalten, verklagen zu können und dürfen, sowie die Möglichkeit, über Behörden rechtliche Schritte einzuleiten. Doch woher sollten sie die Mittel haben und wie beweist man Diskriminierung?
Integration bedeutet also auch sinnvolle Regeln aufzustellen, die die Bedürfnisse des Anderen respektieren. Dazu gehören die Sprache und kulturelle Eigenarten jeder Volksgruppe. Aufgabe der Politik ist es daher ein Klima der Toleranz zu schaffen, Stigmatisierungen und Segregation zu verhindern bzw. abzubauen. Aber nicht Gesetze zu ergänzen bzw. zu erweitern, welche wieder auf Ungleichbehandlung zielen, da sie die Opfer nicht wirklich schützt (Bauböck & Volf, 2001).
2.2. Segregation
Hansen schreibt dazu: „Segregation ist die Vorgabe der relativ Mächtigeren für die relativ Ohnmächtigeren. Segregation ist die Antwort der Außenseiter, die von den Etablierten daran gehindert werden, dazuzugehören“ (zit. nach Hansen, 1997, S. 71).
Geschieht Segregation freiwillig, d.h. Personen ähnlichen Lebensstils und ähnlicher Milieus (s. Künstler, Senioren usw.) finden in Wohngebieten zusammen, können Netzwerke entstehen oder gegenseitige Unterstützungsstrukturen. Beispiele hierfür sind die Studentenviertel, Armutsviertel, Stadtteile, in denen überwiegend Migranten, ältere Menschen oder Familien leben.
Segregation ist demnach nichts anderes als eine räumliche Abbildung sozialer Ungleichheit oder freiwilliger Gleichheit in einer Gesellschaft. Ihre räumliche Absonderung begleiten Merkmale wie soziale Schicht, ethnisch-kultureller Hintergrund oder Lebensstil.
Verbindet sich Segregation mit einer Ungleichverteilung von Lebenschancen und gesellschaftlichen Privilegien kommt es unweigerlich zu Ausgrenzung, Gettoisierung und Diskriminierung (z.B. Putschversuche, Revolten oder Personen anderer Ethnien). Diese unfreiwillige Form der Segregation ist Ergebnis von Zwängen des Wohnungsmarktes und der Politik.
Sozial und ökonomisch benachteiligt, unter anderem durch die räumliche Konzentration auf Randgebiete, sind Sinti und Roma. Dadurch wird soziale Ungleichheit verstärkt.
2.3. Das Alltagsverständnis von „Vorurteil“
Gerade in Bezug auf Roma und Sinti hat sicherlich jeder als Kind die tradierten Vorurteile gegenüber dieser Volksgruppe zu hören und spüren bekommen. Den meisten wurde jeglicher Kontakt strengstens untersagt (bei Missachtung unter Androhung von Prügel). Kamen sie um ihre Waren zu verkaufen, schlug ihnen Verachtung und Misstrauen entgegen. So werden wir mit Vorurteilen schon in frühester Kindheit konfrontiert und tragen sie in unseren Alltag.
Im Laufe des Lebens vergessen wir, wie wir von unseren Vorurteilen geprägt wurden und bemerken nicht mehr, wenn wir uns an alltäglichen Klischees (Vorurteilen) beteiligen. Werden wir jedoch auf unsere Vorurteile angesprochen, verteidigen wir uns vehement gegen diesen Vorwurf. Es stellt sich die Frage, warum wir uns von dem Vorwurf des Vorurteils gerne befreien, bzw. uns dagegen wehren und wir unbewusst mit dem Begriff Vorurteil etwas Negatives bzw. Schlechtes verbinden.
Im Alltagsverständnis gebrauchen wir den Begriff Vorurteil, wenn Mitmenschen positive und negative Urteile über ein Objekt fällen, die wir nicht für real halten und der Betreffende trotz Gegenargumenten nicht von seiner Meinung abrückt. Da Urteile subjektiv sind und gewisse Verallgemeinerungen enthalten, sind in jedem Urteil „Vor“urteile zu finden (Bergmann, 2005, S.4).
Geprägt wird der Vorurteilsbegriff durch seinen normativen, moralischen Charakter. Demnach unterscheiden sich Vorurteile von anderen Einstellungen nicht durch spezifische innere Qualitäten, sondern durch ihre soziale Unerwünschtheit.
Vorurteile erscheinen als soziale Urteile, die gegen anerkannte menschliche Wertvorstellungen verstoßen und gegen die Regeln der Vernunft. D.h., wer über andere Menschen vorschnell urteilt, ohne geprüft zu haben, ob dies der Realität entspricht, verstößt gegen die gesellschaftlichen Norm- und Moralvorstellungen. Ohne genauere Kenntnis des Sachverhaltes verletzen Vorurteile diese Rationalitätsnorm. Ebenso werden Gegenargumente nicht anerkannt, indem Einzelfälle generalisiert werden.
Ein differenziertes individuelles Urteil erlaubt keine Verallgemeinerung. Wenn z.B. jemand behauptet „Zigeuner sind musikalisch od. dumm“ ist dies eine verallgemeinernde individuelle Äußerung, die empirisch kaum zu verifizieren sein dürfte (Bergmann, 2005, S. 5ff).
Die Vorurteilsforschung grenzt den Begriff Vorurteil stärker ein. Wesentlichen Anteil daran tragen die Psychologie, die Sozialpsychologie und die Soziologie. Diese Disziplinen versuchen diesen Begriff von anderen Urteilen und Einstellungen zu separieren.
1 Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Allgemeines_Gleichbehandlungsgesetz
3. Definition und Vorurteilsforschung
In einer Kurzformel lassen sich Vorurteile als sozial nicht akzeptable Bewertungsmuster bezeichnen, die sich auf soziale Sachverhalte (Bsp. Nationen, Parteien, Wissenschaft usw.) beziehen lassen. Wobei Personen, Personengruppen und ethnische Minderheiten (Ausländer, Behinderte, kriminelle usw.) in der Vorurteilsforschung als soziale Objekte bezeichnet werden, wozu auch andere soziale Sachverhalte gehören, wie Politik, Religion, Schule etc. (Güttler, 2003, S. 110ff).
Damit waren die Fragestellungen der traditionellen Vorurteilsforschung vorgegeben: Wie lassen sich Vorurteile erfassen, welche Funktionen erfüllen sie, wie entstehen sie, wie beeinflussen sie das Verhalten und wie lassen sie sich verändern?
Güttler (S. 111) beschreibt den Begriff Vorurteil wie folgt:
„Vorurteile sind Urteile über Individuen oder Gruppen, die falsch, voreilig, verallgemeinernd und klischeehaft sind. Sie wurden nicht an der Realität überprüft und beinhalten meist eine negative Bewertung. Vorurteile lassen sich kaum eliminieren, d.h. sie sind durch neue Informationen nur schwer zu verändern und zeichnen sich durch eine hohe Stabilität aus“ (zit. nach Güttler, S. 111).
Eine Definition von Allport (1971) lautet:
„Ein ethnisches Vorurteil ist eine Antipathie, die sich auf eine fehlerhafte und starre Verallgemeinerung gründet“ (zit. Güttler, S. 112). Diese Abneigung gegenüber anderen Personen oder Gruppen kann verbalisiert oder gefühlt werden.
Vorurteile werden unter sozialwissenschaftlichen Bezugssystemen nicht nur zur Erklärung individuellen sozialen Verhaltens genutzt, sondern vor allem zur Erklärung der Beziehungen zwischen Gruppen. Z.B. betont Westie (1964) den normativen Gehalt von Vorurteilen und das dadurch festgelegte Gruppenverhalten, welche Mitglieder einer Gruppe gegenüber Mitgliedern von Fremdgruppen zu zeigen haben (Six, 1978, S. 14-17).
Ebenso betonen Sherif und Sherif (1956) den festgelegten Normengehalt von Gruppen. In den Norm- und Wertvorstellungen liegen ihrer Meinung nach die negativen Einstellungen (Vorurteile) von Gruppenmitgliedern gegenüber Fremdgruppen (Güttler, S. 112).
Seit ca. einem Jahrzehnt lässt sich jedoch in der sozialpsychologischen Forschung eine Verschiebung des Interesses sowohl am Konzept des Vorurteils als auch an dem hier aufgestellten Definitionenkatalog feststellen. Dieser neue Trend ist eng verknüpft mit der kognitiven Wende in der Sozialpsychologie, die primär an der Untersuchung der kognitiven Funktionen und Prozesse interessiert ist.
Das derzeit vorherrschende Interesse an den Mechanismen menschlicher Informationsverarbeitungsprozessen und ihren Resultaten, in Form von Entscheidungen und Urteilen, hat für die traditionelle Vorurteilsforschung zu nicht unerheblichen Veränderungen geführt. Einerseits zu einer Belebung des Stereotypen-Konzepts und andererseits zu einer Verknüpfung mit Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der sozialen Wahrnehmung und der sozialen Urteilsprozesse. Dazu kommen das Intergruppenverhalten und die neu entdeckten Minoritäten, die mehr sein können und mehr zu bieten haben als nur Angriffspunkte von Majoritäten (Six, 1978, S. 18-24).
Schwerpunktmäßig werden in der kognitiven Theorie die psychischen und individuellen Auslöser für Vorurteile bzw. Stereotypen untersucht. Eine grundlegende Rolle spielt hier der hohe Informationstransfer (s. Medien, Internet usw.) und die dadurch entstehende kognitive Belastung.
Zusammenfassend werden in den Wissenschaftstheorien der Vorurteil- und Stereotypforschung unterschiedliche Prozesse zugeordnet (Lin, 1999, S. 29ff):
der konflikttheoretische Prozess: Sherif, 1967, Theorie des realen Gruppenkonflikts; Tajfel 1982, Theorie der sozialen Identität (s. Kapitel 3.1.1. - Gruppenprozesse).
Der konflikttheoretische und der psychodynamische Ansatz gehen von einem Abwertungsmotiv aus. Diese Annahme wird damit begründet, dass in der Theorie des realen (Gruppen-)Konflikts, Vorurteile das Ziel haben Fremdgruppen auszugrenzen, um eigene Interessen zu verfolgen. Dieses Abwertungsprinzip erfolgt meistens in Wettbewerbs- und Konkurrenzsituationen.
Persönliche Vorurteils- und Stereotypenbildung haben häufig ihren Ursprung in dynamischen Gruppenprozessen, wie sie Tajfel und Sherif erforschten. Vorurteile über Fremdgruppen sind daher immer in Beziehung einer Ingroup – Outgroup Interaktion zu verstehen. D.h. Mitglieder einer sozialen Gruppe haben ein Bild von dem Anderen sozial konstruiert und zugleich das Bild von der Eigengruppe festgelegt.
Das Ferienlagerexperiment von Sherif oder die „Soziale-Identitäts-Theorie“ (SIT) von Tajfel belegen diese Annahme (Güttler, 2003, S. 112; Six, 1978, S. 30ff).
der lerntheoretische Prozess: Rosenfield, 1982 (Rassenstereotyp), Bandura, 1969 (Lernen am Modell).
Die Lerntheorie geht von erlernten Vorurteilen aus, die durch den Sozialisationsprozess bereits im Elternhaus übernommen wurden. Ebenso sind gesellschaftliche und kulturelle Eigenschaften für bestimmte Verhaltensweisen verantwortlich (s. tradierte Sinti- und Romavorurteile).
Einer derlerntheoretischen Ansätze bezieht sich auf das Lernen am Modell nach Bandura (1969). Nach den klassischen Lernprinzipien des Konditionierens und Beobachtens und durch direkt und indirekt (z.B. Medien) beeinflusste Kommunikation werden Stereotype und Vorteile erworben (Frey & Greif, 1997, S. 368).
der psychodynamische Prozess: Dollard et.al; Frustrations-Aggressions-Theorie (s. Sündenbocktheorie).
Die Psychologie setzt psychoanalytische Schwerpunkte, wie die innerpsychischen und individuellen Prozesse. Psychische Konflikte können zur Vorurteilsbildung führen. D.h. auch hier wird ein Abwertungsmotiv vorausgesetzt (Lin, 1999, S. 29 – 138).
Psychodynamische Ansätze (Adorno et al., 1950) gehen von einer generellen ethnozentrischen Reaktionsbereitschaft aus. Überlegenheitsgefühle gegenüber anderen können in den politischen, ökonomischen und sozialen Überzeugungen einer Person ein ideologisches Antwortmuster bilden, das als Ergebnis bestimmter Konstellationen von Es, Ich und Über-Ich aufgefasst wird. Diese Muster sind durch elterliche Erziehungspraktiken entstanden und können zu einer vorurteilsvollen Persönlichkeitsentwicklung führen.
Allport (1971) beschreibt in seinem psychodynamischen Ansatz verhaltensbestimmende unbewusste Steuerungsmuster der Vorurteilsfunktion. Persönlichkeitseigenschaften und psychodynamische Prozesse, wie Aggression, Hass, Ängste und Unsicherheiten, sind beeinflussende Faktoren zur abwertenden Vorurteilsbildung (Six, 1978 , S. 118 – 121; Frey & Greif, 1997, S. 368)
Ein weiterer wichtiger entwicklungspsychologischer Ansatz besagt, daß Vorurteile bereits in frühester Kindheit erworben werden. Ablehnung oder Gleichgültigkeit erzeugen ein negatives Selbstwertgefühl bei Kindern oder Jugendlichen. Werden Kinder vernachlässigt kann es dann zur Flucht zu einer Ersatz-Gruppe kommen.
der kognitive Prozess: Tajfel und Vilkes 1963 (die Akzentuierungstheorie); Gifford 1976 (die Theorie der illusorischen Korrelation).
Kognitive Prozesse der Informationsaufnahme und -verarbeitung sind die Basis für den Kategorisierungsprozess, während die Vorurteilsmechanismen wiederum kognitive Prozesse steuern. So z. B. die Wahrnehmung, Kodierung, Speicherung und langfristige Abrufbarkeit von Informationen über soziale Sachverhalte und ihrer Bedeutung.
Innerhalb der kognitiven Erklärungsansätze zeigen Arbeiten auf dem Gebiet der Reizklassifikationstheorie, dass bei vorgegebenen Kategorien Zuordnungen von Gegenständen dazu führen, dass die Unterschiede innerhalb der Kategorien minimiert, während die Differenzen zwischen den Kategorien maximiert wurden. Diese Annahmen basieren auf Kombination von Theorien zur Reizklassifikation, Reizdifferenzierung und der Hypothesentheorie der sozialen Wahrnehmung. Die Theorien gehen davon aus, dass Urteils- und Denkprozesse auf Fehlern und Irrtümern basieren. Gründe dafür sind mangelnde Information oder zu schnelles (Ver-)Urteilen (Frey & Greif, 1997, S. 368).
der situationsorientierte Prozess versucht über Korrelationen zwischen Vorurteilsausprägungen und Situationsvariablen (wie Gruppenkonflikte, sozioökonomischer Wettbewerb, Arbeitslosigkeit, Gruppen- oder schichtbezogene Probleme) Aussagen zur Ursache-Wirkungs-Relation zu machen. Hier wird die Meinung vertreten, dass Vorurteile und Stereotypen wandelbare situationsangepasste Orientierungsmuster sind (Frey & Greif, 1997, S. 368).
Feststellen lässt sich, dass Einstellungstheorien, wie klassisches / instrumentelles Konditionieren (Belohnung/Bestrafung), Modelllernen (z.B. wie verhalten sich Vorbilder gegenüber Minoritäten) und Lernen im sozialen Kontext (Gruppenprozesse) wichtige Bezugspunkte für negative Einstellungen sind. Andererseits schützen Vorurteile vor Orientierungslosigkeit und stärken den Selbstwert, haben also eine bestimmende Funktion.
3.1. Funktionsweise von Vorurteilen
Welche Funktionen erfüllen Vorurteile? Welcher ideologische Gehalt verstärkt sie und welchen Bedingungen unterliegen Vorurteile?
Frey & Greif (1997, S.





























