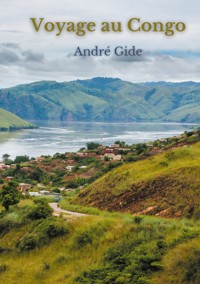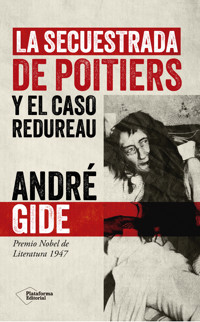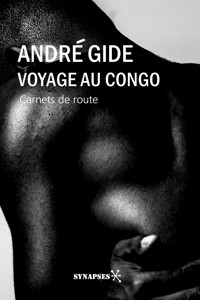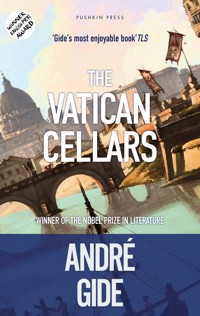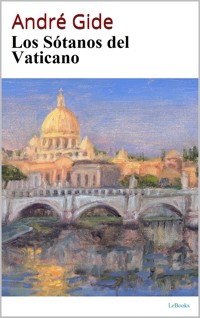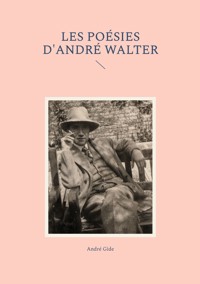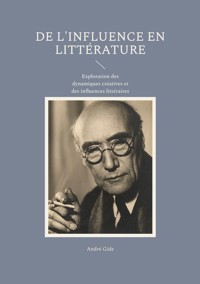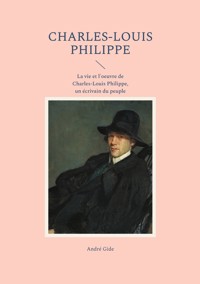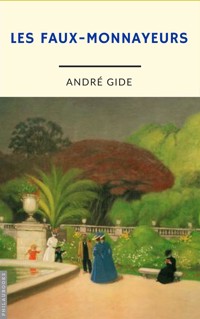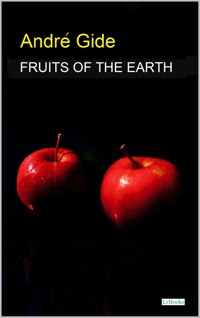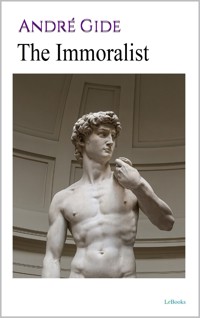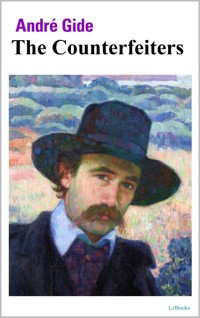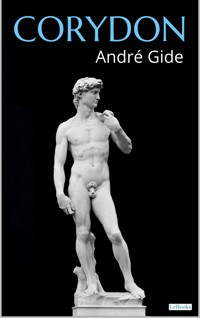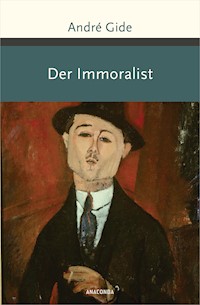
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Anaconda Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Große Klassiker zum kleinen Preis
- Sprache: Deutsch
Nach endlich überstandener Schwindsucht möchte der Handschriftenkundler Michel nur noch frei sein – frei von gesellschaftlichen Konventionen und unbeschränkt im Ausleben seiner Sexualität mit beiderlei Geschlecht. Während er mit seiner engelsgleichen Frau Marceline in die Schweiz reist und dann quer durch Italien bis in die Wüste Algeriens, scheint er seinem Ziel immer näher zu kommen. Doch die Freiheit, anders zu sein, hat ihren Preis, wie André Gide, der Literaturnobelpreisträger von 1947, in diesem kühnen, provokanten Roman einer Befreiung vor Augen führt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 197
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
André Gide
Der Immoralist
Aus dem Französischen übertragenvon Gisela Schlientz
Roman
Anaconda
André Gides Roman »L’immoraliste« erschien zunächst 1902 in der Literaturzeitschrift Mercure de France in Paris. In deutscher Übersetzung erschien der Roman erstmals 1905. Die Übersetzung von Gisela Schlientz erschien erstmals 1991 in Band VII der Werkausgabe »Gesammelte Werke in zwölf Bänden«, Deutsche Verlags-Anstalt. Ihr liegt die erste französische Fassung von 1902 zugrunde. Orthografie und Interpunktion wurden unter Wahrung von grammatischen Eigenheiten auf neue Rechtschreibung umgestellt.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter http://dnb.d-nb.de abrufbar.© dieser Ausgabe 2022 by Anaconda Verlag, einem Unternehmen der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München © der Übersetzung 1991 Deutsche Verlags-AnstaltAlle Rechte vorbehalten.Umschlagmotiv: Amedeo Modigliani (1884–1920) »Portrait of Paul Guillaume« © Bridgeman Images / Photo JosseUmschlaggestaltung: www.katjaholst.deSatz und Layout: Fotosatz Amann, MemmingenISBN 978-3-641-29229-4V002www.anacondaverlag.de
Für HENRIGHÉONmeinen freimütigen GefährtenIch danke dir dafür, o Herr,dass ich wunderbar gemacht bin.Psalm 139, 14
Vorwort
Ich gebe dieses Buch hin für das, was es wert ist. Es ist eine Frucht voll bitterer Asche; es gleicht den Koloquinten der Wüste, die an ausgedörrten Stellen wachsen und den Durst nur noch schrecklicher brennen lassen, doch auf dem Goldsand nicht ohne Schönheit sind.
Hätte ich meinen Helden als Beispiel ausgegeben, so wäre mir das, ich muss es eingestehen, schlecht gelungen; die wenigen, die sich für Michels Abenteuer überhaupt interessierten, wollten ihn nur verhöhnen mit der ganzen Kraft ihrer Güte. Nicht umsonst habe ich Marceline mit so vielen Tugenden geschmückt; man mochte es Michel nicht verzeihen, dass er sie nicht sich selbst vorzog.
Hätte ich dieses Buch als eine Anklageschrift gegen Michel ausgegeben, so wäre mir das kaum besser gelungen, denn niemand hat mir Dank gewusst für den Unwillen, den er gegen meinen Helden empfand, es schien sogar, als empfände man diesen Unwillen ohne mein Zutun; von Michel ging er auf mich über; um ein Weniges hätte man mich mit ihm verwechselt.
Ich habe jedoch aus diesem Buch weder eine Anklageschrift noch eine Apologie machen wollen und habe mich jeden Urteils enthalten. Das Publikum verzeiht dem Autor heute nicht mehr, wenn er sich nach dem Schildern der Handlung nicht für oder wider erklärt; selbst mitten im Fortgang des Dramas soll er Partei ergreifen, soll er sich eindeutig äußern, entweder für Alceste oder für Philinte, für Hamlet oder für Ophelia, für Faust oder Gretchen, für Adam oder Jahwe. Ich will gewiss nicht behaupten, die Neutralität (fast möchte ich sagen, die Unentschiedenheit) sei das sichere Zeichen für einen großen Geist; aber ich glaube, manche großen Geister waren wenig geneigt zu … entscheiden – und wer geschickt ein Problem stellt, hat es noch lange nicht im Voraus gelöst.
Nur widerwillig benutze ich hier das Wort »Problem«. Eigentlich gibt es in der Kunst keine Probleme – deren hinlängliche Lösung nicht das Kunstwerk lieferte.
Wenn man unter »Problem« jedoch »Drama« versteht, möchte ich meinen, dass das in diesem Buch erzählte, nur weil es sich in der Seele meines Helden abspielt, nicht weniger zu allgemeingültig ist, um nur auf sein besonderes Erleben begrenzt zu bleiben. Ich maße mir nicht an, dieses »Problem« erfunden zu haben; es existierte schon vor meinem Buch; ob Michel siegt oder unterliegt, das »Problem« besteht weiter, und dem Autor gilt weder der Sieg noch die Niederlage als ausgemacht.
Wenn einige kluge Köpfe in diesem Drama nichts anderes sehen wollten als die Darstellung eines bizarren Falles und in seinem Helden einen Kranken; wenn ihnen entgangen ist, dass etliche bedrängende Gedanken von ganz allgemeinem Interesse darin enthalten sind – so liegt die Schuld nicht bei diesen Gedanken oder bei diesem Drama, sondern beim Autor, und damit meine ich: bei seinem Ungeschick – auch wenn er in dieses Buch all seine Leidenschaft, alle seine Tränen und alle Sorgfalt eingebracht hat. Aber das wirkliche Interesse eines Buches und jenes, das ihm das Tagespublikum entgegenbringt, sind zwei sehr verschiedene Dinge. Ich glaube, man kann ohne allzu große Überheblichkeit eher riskieren, dass man am ersten Tag mit interessanten Dingen kaum interessiert – als dass man ohne Aussicht auf ein Morgen ein nach Plattheiten gierendes Publikum begeistert.
Im Übrigen ging es mir nicht darum, etwas zu beweisen, sondern darum, mein Gemälde gut auszumalen und zu beleuchten.
Herrn Präsident D.R.
Sidi b.M., 30. Juli 189 …
Ja, Du hast richtig vermutet, mein lieber Bruder: Michel hat mit uns gesprochen. Hier folgt, was er uns erzählt hat. Du hast danach verlangt; ich habe es Dir versprochen. Aber nun, da ich es abschicken will, zögere ich noch, und je öfter ich es lese, umso schrecklicher scheint es mir. Ah, was wirst Du von unserem Freund denken? Was soll ich übrigens selbst von ihm denken? Sollen wir ihn einfach verdammen und damit leugnen, dass man auch Fähigkeiten, die sich grausam äußern, zum Guten leiten kann? – Doch ich fürchte, es gibt heute mehr als einen, der sich in diesem Bericht zu erkennen wagt. Kann man für so viel Intelligenz und Kraft ein Amt finden – oder muss man dem das Bürgerrecht verweigern?
Auf welche Weise kann Michel dem Staat dienen? Ich gebe zu, ich weiß es nicht … Er braucht eine Beschäftigung. Werden es die Macht, über die Du verfügst, die hohe Stellung, die Dir Deine großen Verdienste eingebracht haben, ermöglichen, sie ihm zu finden? – Beeile Dich. Michel ist ergeben, noch ist er es; bald wird er es nur noch sich selber sein.
Ich schreibe Dir unter einem vollkommen blauen Himmel; in den zwölf Tagen, die Denis, Daniel und ich hier verbringen, keine Wolke, kein Nachlassen der Sonne. Michel sagt, der Himmel sei seit zwei Monaten so klar.
Ich bin weder traurig noch heiter; die Luft hier erfüllt dich mit einer schwer zu fassenden Erregung und lehrt dich einen Zustand kennen, der so weit von der Heiterkeit entfernt ist wie vom Schmerz; vielleicht ist das Glück.
Wir bleiben bei Michel, wir möchten ihn nicht allein lassen. Lies bitte diese Seiten, und Du wirst verstehen, warum. Hier, in seiner Wohnung, erwarten wir Deine Antwort; zögere nicht.
Du weißt, dass eine schon anfangs sehr enge Schulfreundschaft, die sich mit jedem Jahr festigte, Michel mit Daniel, mit Denis, mit mir verband. Unter uns vieren wurde eine Art Pakt geschlossen: Auf den geringsten Hilferuf des einen sollten die drei anderen antworten. Als ich dann von Michel diesen mysteriösen Notschrei erhielt, habe ich sogleich Daniel und Denis benachrichtigt, und alle drei ließen wir alles hinter uns und brachen auf.
Wir hatten Michel seit drei Jahren nicht wiedergesehen. Er hatte sich verheiratet, war mit seiner Frau auf Reisen gegangen, und während seines letzten Aufenthalts in Paris war Denis in Griechenland, Daniel in Russland gewesen und ich, wie Du weißt, bei unserem kranken Vater festgehalten. Wir waren indes nicht ohne Nachrichten geblieben; doch was uns Silas und Will, die ihn wiedergesehen hatten, von ihm berichteten, konnte uns nur erstaunen. Ein Wandel ging in ihm vor, den wir noch nicht erklären konnten. Das war nicht mehr der hochgelehrte Puritaner von einstmals, dessen Gesten im Eifer der Überzeugung linkisch, dessen Augen so klar waren, dass vor ihnen unsere oft allzu freien Reden verstummten. Das war … aber warum soll ich Dir schon andeuten, was Dir sein Bericht selbst sagen wird?
Ich schicke Dir also den Bericht, wie ihn Daniel, Denis und ich gehört haben. Michel erzählte auf der Terrasse, wo wir in seiner Nähe im Dunkel und in der Sternenhelle ausgestreckt lagen. Am Schluss seines Berichtes sahen wir den Tag über der Ebene aufsteigen. Sie wird von Michels Haus beherrscht, und vom Dorf, das nur wenig entfernt liegt. Durch die Hitze und weil die Ernte eingebracht ist, gleicht diese Ebene einer Wüste.
Trotz seiner Armut und Absonderlichkeit ist das Haus von Michel bezaubernd. Im Winter litt man unter der Kälte, denn seine Fenster haben keine Scheiben, oder vielmehr hat es gar keine Fenster, sondern riesige Löcher in den Mauern. Es ist so schön, dass wir draußen auf Matten schlafen.
Ich muss Dir noch erzählen, dass wir eine gute Reise hatten. Wir sind hier gegen Abend angekommen, von der Hitze erschöpft und trunken von neuen Eindrücken, nachdem wir uns weder in Algier noch in Constantine lange aufgehalten hatten. Von Constantine brachte uns eine neue Bahn bis nach Sidi b.M., wo ein Wagen wartete. Die Straße hört weit vom Dorf entfernt auf. Dieses nistet hoch oben auf einem Felsen wie gewisse Marktflecken in Umbrien. Wir stiegen zu Fuß hinauf; zwei Maultiere hatten unsere Koffer übernommen. Wenn man auf diesem Weg ankommt, ist Michels Haus das erste des Dorfes. Ein von niedrigen Mauern umschlossener Garten, oder eher ein Vorplatz, umgibt es, in dem drei schiefe Granatapfelbäume und ein prächtiger Oleander wachsen. Ein Kabylenkind war da, das bei unserer Ankunft flüchtete, indem es kurz entschlossen über die Mauer kletterte.
Michel empfing uns ohne sichtbare Freude; er schien jede Äußerung der Zärtlichkeit zu fürchten; aber gleich auf der Schwelle umarmte er jeden von uns dreien mit Ernst.
Bis zum Einbruch der Nacht wechselten wir keine zehn Worte. Ein fast frugales Mahl war in einem Salon vorbereitet, dessen aufwendige Dekoration uns erstaunte, was Dir jedoch der Bericht Michels erklären wird. Dann servierte er uns den Kaffee, den er selbst zubereitet hatte. Danach stiegen wir auf die Terrasse, wo sich der Blick bis ins Unendliche erstreckte, und warteten alle drei, gleich den drei Freunden Hiobs, während wir über der flammenden Ebene das rasche Schwinden des Tages bewunderten.
Als es Nacht war, sprach Michel:
Erster Teil
I
Meine lieben Freunde, ich war eurer Treue gewiss. Auf meinen Ruf hin seid ihr herbeigeeilt, ganz wie ich es auf den euren hin getan hätte. Indes habt ihr mich drei Jahre lang nicht gesehen. Möge eure Freundschaft, die die Trennung so gut übersteht, ebenso gut den Bericht überstehen, den ich euch liefern will. Denn wenn ich euch so plötzlich rief und euch bis zu meiner fernen Behausung reisen ließ, so geschah das allein, um euch zu sehen, und damit ihr mich anhören könnt. Ich will keine andere Hilfe als: zu euch sprechen. Denn ich bin an einem Punkt meines Lebens angelangt, den ich nicht mehr überschreiten kann. Doch das ist nicht Überdruss. Ich begreife nichts mehr. Ich möchte … Ich möchte mich aussprechen, sage ich euch. Sich befreien ist nichts; frei sein können ist das Schwierige. – Ihr müsst es ertragen, dass ich von mir spreche; ich will euch einfach mein Leben erzählen, ohne Bescheidenheit und ohne Hochmut, viel einfacher, als wenn ich zu mir selbst spräche. Hört mich an:
Das letzte Mal sahen wir uns, so erinnere ich mich, in der Gegend von Angers, in der kleinen Dorfkirche, in der meine Hochzeit gefeiert wurde. Das Publikum war nicht sehr zahlreich; nur die guten Freunde machten aus dieser banalen Zeremonie eine bewegende Zeremonie. Mir scheint, man war gerührt, und das rührte mich selbst. Nach dem Kirchgang versammelte uns eine kurze Mahlzeit ohne Lachen und Lärm im Hause jener, die meine Frau wurde. Dann entführte uns beide der bestellte Wagen, gemäß dem Brauch, der in unserem Geist den Gedanken an eine Hochzeit mit der Vision eines abfahrenden Zuges verbindet.
Ich kannte meine Frau nur wenig und dachte, ohne viel darunter zu leiden, dass sie mich nicht besser kenne. Ich hatte sie ohne Liebe geheiratet, hauptsächlich meinem Vater zu Gefallen, der sich im Sterben sorgte, mich allein zu lassen. Ich liebe meinen Vater zärtlich; mitgenommen von seinem Todeskampf, dachte ich in diesen trüben Augenblicken nur daran, ihm sein Ende zu erleichtern; und so verpfändete ich mein Leben, ohne über das Leben Bescheid zu wissen. Unsere Verlobung am Bett des Sterbenden war ohne laute Fröhlichkeit, aber nicht ohne ernste Freude, so groß war der Friede, den mein Vater darin fand. Wenn ich, wie ich sagte, meine Braut auch nicht liebte, so hatte ich wenigstens niemals eine andere Frau geliebt. Das genügte in meinen Augen, um unser Glück zu sichern; da ich mich selbst noch nicht kannte, glaubte ich mich ihr ganz hinzugeben. Auch sie war Waise und lebte mit ihren beiden Brüdern zusammen. Marceline war kaum zwanzig Jahre alt, ich vier Jahre älter.
Ich habe gesagt, dass ich sie nicht liebte; wenigstens empfand ich für sie nicht das, was man Liebe nennt, aber ich liebte sie, wenn man darunter Zärtlichkeit, eine Art Mitleid und schließlich Hochachtung verstehen will. Sie war katholisch, und ich bin Protestant … doch ich glaubte es so wenig zu sein! Der Pfarrer nahm mich hin, ich nahm den Pfarrer hin: Wir spielten mit offenen Karten.
Mein Vater war das, was man einen »Atheisten« nennt; wenigstens vermute ich es, da ich aus einer Art unüberwindbarer Scheu, die er wohl teilte, niemals mit ihm über seinen Glauben habe reden können. Die ernsten hugenottischen Lehren meiner Mutter waren mit ihrem schönen Bild langsam in meinem Herzen verblasst; ihr wisst, dass ich sie jung verloren habe. Ich ahnte noch nicht, wie sehr uns diese erste Kindheitsmoral beherrscht, noch welche Narben sie im Geist zurücklässt. Jene Art Strenge, an der mich meine Mutter Geschmack finden ließ, indem sie mir ihre Prinzipien einprägte, übertrug ich ganz auf meine Studien. Ich war fünfzehn Jahre alt, als meine Mutter starb; mein Vater nahm sich meiner an, umsorgte mich und unterwies mich mit Leidenschaft. Ich beherrschte schon recht gut Latein und Griechisch; bei ihm lernte ich schnell Hebräisch, Sanskrit und schließlich Persisch und Arabisch. Gegen mein zwanzigstes Jahr war ich so gedrillt, dass er mich an seinen Arbeiten teilnehmen ließ. Es machte ihm Spaß, mich als seinesgleichen anzusehen, und er wollte mir dafür den Beweis liefern. Der Essay über die phrygischen Kulte, der unter seinem Namen erschien, war mein Werk; er hatte ihn kaum durchgesehen; nichts hatte ihm je solche Anerkennung eingebracht. Er war entzückt. Ich jedoch war verwirrt, als ich diese Täuschung gelingen sah. Aber von nun an gehörte ich dazu. Die kenntnisreichsten Gelehrten behandelten mich als ihren Kollegen. Heute muss ich lächeln über all die Ehren, die mir zuteilwurden … So erreichte ich mein fünfundzwanzigstes Jahr, hatte fast nichts gesehen außer Ruinen und Büchern und wusste nichts vom Leben. In der Arbeit bewies ich einen ungewöhnlichen Eifer. Ich liebte einige Freunde (ihr gehörtet dazu), aber mehr die Freundschaft als sie selbst; meine Neigung für sie war groß, aber sie war Bedürfnis nach Adel; ich pflegte jedes schöne Gefühl in mir. Im Übrigen wusste ich von meinen Freunden so wenig, wie ich von mir selbst wusste. Keinen Augenblick kam mir der Gedanke, ich könnte ein anderes Dasein führen oder man könnte anders leben.
Meinem Vater und mir genügten einfache Dinge; wir gaben beide so wenig aus, dass ich mein fünfundzwanzigstes Jahr erreichte, ohne zu wissen, dass wir reich waren. Ohne häufig darüber nachzudenken, nahm ich an, wir hätten zum Leben gerade genug; und neben meinem Vater hatte ich so sparsame Gewohnheiten angenommen, dass ich mich fast genierte, als ich begriff, dass wir viel mehr besaßen. Ich war in diesen Dingen derart nachlässig, dass mir nicht einmal nach dem Tod meines Vaters, dessen einziger Erbe ich war, die Größe meines Vermögens klar bewusst wurde, sondern erst beim Abschluss meines Ehevertrags, der mir gleichzeitig entdeckte, dass Marceline fast nichts in die Ehe einbrachte.
Noch eine andere, vielleicht wichtigere Sache war mir unbekannt: dass ich eine sehr schwächliche Gesundheit hatte. Wie konnte ich das ahnen, da ich sie nie der Probe ausgesetzt hatte? Von Zeit zu Zeit hatte ich Erkältungen, die ich nachlässig kurierte. Das allzu ruhige Leben, das ich führte, schwächte und schützte mich zugleich. Marceline dagegen schien kräftig; und dass sie kräftiger war als ich, sollten wir bald entdecken.
Am Abend unserer Hochzeit schliefen wir in meiner Wohnung in Paris, wo man uns zwei Zimmer hergerichtet hatte. Wir blieben nur so lange in Paris, wie es für unerlässliche Einkäufe nötig war, dann reisten wir nach Marseille, wo wir uns alsbald nach Tunis einschifften.
Die dringlichen Besorgungen, der Trubel der letzten, sich überstürzenden Ereignisse, die unerlässlichen Empfindungen der Hochzeit, die so rasch auf die echteren meiner Trauer folgten: all das hatte mich erschöpft. Erst auf dem Schiff fühlte ich meine Müdigkeit. Bis dahin lenkte mich jede Beschäftigung, die sie verstärkte, gleichzeitig von ihr ab. Die erzwungene Muße an Bord gab mir Gelegenheit zu überlegen. Mir schien, es war das erste Mal. Zum ersten Mal auch war ich bereit, mich für lange Zeit von meiner Arbeit zu trennen. Ich hatte mir bisher nur kurze Ferien bewilligt. Eine Reise nach Spanien mit meinem Vater, kurze Zeit nach dem Tod meiner Mutter, hatte allerdings über einen Monat gedauert; eine andere nach Deutschland sechs Wochen; auch alle übrigen waren Studienreisen; mein Vater war von seinen ganz gezielten Forschungen durch nichts abzubringen; und ich las, sobald ich ihn nicht begleitete. Und doch belebten sich manche Erinnerungen an Granada und Sevilla, kaum dass wir Marseille verlassen hatten, an einen klareren Himmel, schärfere Schatten, an Feste, an Gelächter und Gesang. Das wollen wir wiederfinden, dachte ich. Ich stieg auf die Brücke des Schiffes und sah, wie Marseille zurückblieb.
Dann kam mir plötzlich in den Sinn, dass ich Marceline ein wenig vernachlässigte.
Sie saß vorn; ich näherte mich und betrachtete sie zum ersten Mal wirklich.
Marceline war sehr hübsch. Ihr wisst es, ihr habt sie gesehen. Ich machte mir Vorwürfe, dass ich das nicht früher bemerkt hatte. Ich kannte sie zu gut, um sie mit neuen Augen zu sehen; unsere Familien waren schon immer verbunden gewesen; ich hatte sie heranwachsen sehen; ihre Anmut war mir vertraut … Zum ersten Mal staunte ich, so groß schien mir diese Anmut.
Von einem schlichten schwarzen Strohhut ließ sie einen Schleier flattern. Sie war blond, wirkte jedoch nicht zart. Ihr Rock und die passende Korsage waren aus einem schottischen Tuch gemacht, das wir zusammen ausgesucht hatten. Sie sollte sich von meiner Trauer nicht verdüstern lassen.
Sie fühlte meinen Blick und wandte sich nach mir um … Bis dahin hatte ich gegen sie nur bemühten Eifer gezeigt; ich ersetzte mehr schlecht als recht die Liebe durch eine Art kalter Galanterie, die sie, wie ich sah, ein wenig belästigte. Fühlte Marceline in diesem Augenblick, dass ich sie zum ersten Mal auf andere Weise betrachtete? Nun blickte sie mich ihrerseits fest an, dann lächelte sie zärtlich. Ich setzte mich neben sie, ohne etwas zu sagen. Ich hatte bis dahin für mich oder zumindest mir gemäß gelebt. Ich hatte mich verheiratet, ohne in meiner Frau etwas anderes als eine Gefährtin zu sehen, ohne recht zu bedenken, dass durch unsere Verbindung mein Leben verändert werden könnte. Jetzt endlich hatte ich begriffen, dass der Monolog hier zu Ende ging.
Wir beide waren allein auf dem Deck. Sie neigte ihre Stirn zu mir, ich presste sie sanft an mich; sie sah zu mir auf, ich küsste sie auf die Lider und fühlte plötzlich, begünstigt durch meinen Kuss, ein neues Mitleid; es überkam mich mit solcher Gewalt, dass ich meine Tränen nicht zurückhalten konnte.
»Was hast du denn?«, fragte mich Marceline.
Wir begannen miteinander zu sprechen. Ihr liebenswürdiges Plaudern entzückte mich. Ich hatte mir, soweit ich es vermochte, eine Vorstellung von der Dummheit der Frauen gemacht. Neben ihr kam ich mir an diesem Abend linkisch und töricht vor.
Also hatte auch jene, an die ich mein Dasein band, ein eigenes, wirkliches Leben! Die Bedeutung dieses Gedankens weckte mich mehrere Male in dieser Nacht; mehrere Male richtete ich mich in meiner Koje auf, um in der anderen, tieferen Koje Marceline, meine Frau, schlafen zu sehen.
Am nächsten Tag war der Himmel strahlend, das Meer fast ruhig. Auch einige ungezwungene Gespräche verminderten unsere Scheu. Jetzt begann die eigentliche Ehe. Am Morgen des letzten Tages im Oktober gingen wir in Tunis an Land.
Es war meine Absicht, dort nur wenige Tage zu verweilen. Ich will euch meine Dummheit gestehen: Nichts als Karthago und etliche römische Ruinen interessierten mich an diesem neuen Land: Timgad, von dem mir Octavian berichtet hat, die Mosaiken von Sousse und vor allem das Amphitheater von El Djem, wohin ich unverzüglich eilen wollte. Zuerst galt es Sousse zu erreichen, dann von Sousse aus den Postwagen zu nehmen; bis dahin sollte nichts meiner Aufmerksamkeit wert sein.
Doch Tunis überraschte mich sehr. In der Berührung mit neuen Eindrücken erwachten jene Teile in mir, jene schlummernden Fähigkeiten, die noch nicht genutzt worden waren und dadurch ihre geheimnisvolle Jugendlichkeit ganz bewahrt hatten. Ich war eher erstaunt, bestürzt, als amüsiert, und was mir besonders gefiel, war die Freude von Marceline.
Indessen wurde meine Erschöpfung mit jedem Tag größer; aber ihr nachzugeben, hätte ich als beschämend empfunden. Ich hustete und fühlte oben in der Brust einen seltsamen Schmerz. Wir gehen nach Süden, dachte ich, die Wärme wird mich kurieren. Der Postwagen nach Sfax verlässt Sousse um acht Uhr abends; er passiert El Djem um ein Uhr morgens. Wir hatten Plätze im Coupé belegt. Ich hatte mich auf ein unbequemes Vehikel gefasst gemacht; dementgegen waren wir jedoch recht bequem untergebracht. Aber die Kälte! … In welchem kindlichen Vertrauen auf die milde Luft des Südens hatten wir, beide leicht bekleidet, nur einen Schal mitgenommen? Sobald wir Sousse und seine schützenden Hügel hinter uns gelassen hatten, begann der Wind zu blasen. Er jagte in großen Sprüngen über die Ebene, er heulte, pfiff, drang durch jeden Spalt des Wagenschlags; nirgends war man vor ihm sicher. Wir kamen ganz kältestarr an; ich war überdies mitgenommen vom Rütteln der Kutsche und von einem fürchterlichen Husten, der mich noch stärker schüttelte. Was für eine Nacht! – In El Djem angekommen, gab es keinen Gasthof; ein grässliches Bordj diente als Ersatz. Was tun? Der Postwagen fuhr weiter. Das Dorf schlief; in der Dunkelheit, die unermesslich schien, konnte man die ungestalte Masse der Ruinen erkennen; Hunde heulten. Wir gingen zurück in einen erdverdreckten Raum, wo zwei klägliche Betten aufgestellt waren. Marceline zitterte vor Kälte, aber hier waren wir wenigstens vor dem Wind geschützt.
Der folgende Tag war trüb. Als wir hinaustraten, wurden wir von einem einheitlich grauen Himmel überrascht. Der Wind blies noch immer, aber nicht mehr so mächtig wie am Tag zuvor. Der Postwagen würde erst am Abend wiederkommen … Ich sage euch, das war ein heilloser Tag. Das Amphitheater war in wenigen Augenblicken durchmessen und enttäuschte mich; es schien mir sogar hässlich unter diesem trüben Himmel. Vielleicht unterstützte, vielleicht steigerte meine Erschöpfung meinen Verdruss. Um die Mitte des Tages ging ich aus Langeweile noch einmal hin und suchte vergeblich nach Inschriften auf den Steinen. Marceline las im Windschutz ein englisches Buch, das sie zum Glück mitgenommen hatte. Ich kam zurück und setzte mich zu ihr.
»Was für ein trostloser Tag! Langweilst du dich nicht zu sehr?«, fragte ich sie.
»Nein, du siehst, ich lese.«
»Warum nur sind wir hierhergekommen? Dich friert hoffentlich nicht?«
»Nicht zu sehr. Und du? Wirklich, du bist ganz blass.«
»Nein …«
Als es Nacht wurde, begann der Wind mit neuer Kraft … Endlich kam der Postwagen. Wir fuhren ab.