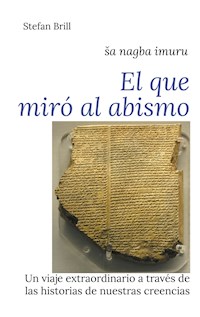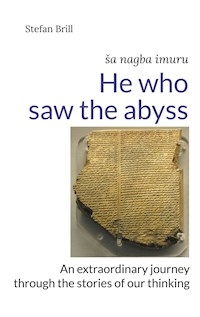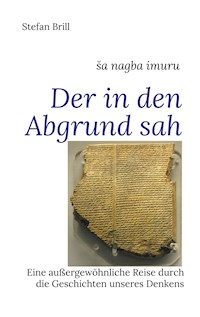
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Eine humorvolle Reise durch vier Jahrtausende Ideengeschichte, gespickt mit einer ordentlichen Portion Ironie und einer Prise Erotik. Von Noah bis Kant, von Uruk bis Ulm, von Aschenputtel bis zu fliegenden Orang-Utans, die Geschichten sind so zahlreich, dass sicherlich das ein oder andere Souvenir von der Reise durch die Zeit bleibt. Die Bibel als Fundament des christlichen Glaubens, die griechische Philosophie als Grundlage des Denkens, die Zeit der Aufklärung als Basis wissenschaftlicher Erkenntnis - die drei Säulen der heutigen Auffassung der Welt. Dass die Philosophie mit den alten Griechen begann ist ebenso erfunden wie der Mythos der Seevölker, die das Ende der Bronzezeit einleiteten. Auch die Geschichte der Sintflut stammt nicht aus der Bibel. Die Zeit der Aufklärung zerstörte nicht nur ein mittelalterliches Weltbild, sondern schuf zugleich neue Mythen, die bis heute nur selten hinterfragt werden. Mit einer gehörigen Portion Ironie werden jene Geschichten unter die Lupe genommen und filetiert, die noch immer dieses Denken bestimmen. Woher diese Geschichten stammen und seit wann sie erzählt werden hält die ein oder andere Überraschung bereit. Wir begleiten die ersten Archäologen nach Ninive, und nehmen mit Herodot an einem griechischen Symposium teil. Wir treffen Rousseau in Annecy und erfahren, was Haute Cousine und Guillotine gemein haben. Wir nehmen an Hegels Vorlesungen in Berlin teil und begleiten Wallace nach Borneo. Außer amüsanten Geschichten bleibt von manchen Überzeugungen nicht viel übrig.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 361
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Buch
Die Bibel als Fundament des christlichen Glaubens, die griechische Philosophie als Grundlage des Denkens, die Zeit der Aufklärung als Basis wissenschaftliche Erkenntnis - die drei Säulen der heutigen Auffassung der Welt. Dass die Philosophie mit den alten Griechen begann ist ebenso erfunden wie der Mythos der Seevölker, die das Ende der Bronzezeit einleiteten. Auch die Geschichte der Sintflut stammt nicht aus der Bibel. Die Zeit der Aufklärung zerstörte nicht nur ein mittelalterliches Weltbild, sondern schuf zugleich neue Mythen, die bis heute nur selten hinterfragt werden.
Mit einer gehörigen Portion Ironie werden jene Geschichten unter die Lupe genommen und filetiert, die noch immer dieses Denken bestimmen. Woher diese Geschichten stammen und seit wann sie erzählt werden hält die ein oder andere Überraschung bereit. Wir begleiten die ersten Archäologen nach Ninive, und nehmen mit Herodot an einem griechischen Symposium teil. Wir treffen Rousseau in Annecy und erfahren, was Haute Cousine und Guillotine gemein haben. Wir nehmen an Hegels Vorlesungen in Berlin teil und begleiten Russel Wallace nach Borneo. Von Noah bis Kant, von Uruk bis Ulm, von Aschenputtel bis zu fliegenden Orang-Utans, die Geschichten sind so zahlreich, dass sicherlich das ein oder andere Souvenir von der Reise durch die Zeit bleibt.
Der Autor
Dr. Stefan Brill (1967) ist Philosoph, Wirtschafts- und Politikwissenschaftler. Er lebte lange in Mittelamerika, Europa und Asien, verbringt seine Zeit heute jedoch lieber in seinem Haus im sonnigen Süden, in der Hoffnung, nicht wieder allzu viel Geld an der Börse zu verlieren.
Einladung
Ich lade Sie ein zu einer bunten Reise durch ganz verschiedene Geschichten der Zeit, die manchmal uralt, und doch überraschend aktuell sind. Manche klingen vollkommen absurd, und viele sind wahr, weil sie für wahr gehalten werden. Und doch sind es nur unterhaltsame Geschichten.
Es ist eine Reise an Orte, von denen man nicht vermutet hätte, was sich dort zutrug, und in die Zeiten, in denen sie entstanden. Es sind oftmals wunderbare Geschichten, die heute noch unsere Vorstellungen der Welt prägen. Wenn man fragt, woher sie stammen und seit wann wir sie uns erzählen, erhält man oft überraschende Antworten.
Wenn Sie neugierig geworden sind, kommen Sie mit. Es ist nur eine Geschichte, die Sie glauben können oder auch nicht. Steigen Sie ein, es geht zunächst nach ...
...Bodenwerder!
Für Anna
Titelbild:
11. Tafel des Gilgamesch-Epos, bekannt als Flut-Tafel, aus der Bibliothek des Ashurbanipal. Britisches Museum, K3375
Inhalt
Vorgeschichte
Ein Schloss in Bodenwerder
Der Anfang der Geschichte
Ein Spaziergang im Park
Coitus Interruptus in Arabien
Kaffee wie Dinde so schwarz
Rendezvous in Bagdad
Gute Luft in Persien
Die Wette
Gesuchte Geschichte
Ninive retrouvée
Assurbanipals Bibliothek
Nackt im Museum
Babel-Bibel-Streit
Geschichten rund um Gilgamesch
Die Geschichte der dreißig fruchtbaren Frauen
Scheibenwelt
Die Geschichten des Sîn-lēqi-unninni
Seevölker mit Nudelsieb
Geschichten von Mythen
Geschichten der Bibel
Ochse-Haus-Kamel
Astrucs Messer
Von Smartphones und Kamelen
Die verkaufte Braut
Bibelsex
Das Schaf 'Daisy'
Geschichten aus alter Zeit
Im Café Levante
Aschenputtel für Erwachsene
Va pensiero Babylon
Aidas Ende
Geschichten aus Griechenland
Weißen Schwänen traut man nicht
Frau mit Stockholm-Syndrom
Hellenische Phantastereien
Furzende Philosophen
Vorsokratische Lebensgestaltung
Die skurrilsten Todesfälle der Philosophie
Herodot in Bodenwerder
Griechisches Symposion
Das Athener Dreigestirn
Geschichten aus neuer Zeit
Hermann der Lahme
In Ulm, um Ulm und um Ulm herum
Die Geschichte vom neuen Denken
Falling Stones
Der Himmel auf Erden
Es werde Licht
Stadtluft macht frei
Ich stinke also bin ich
Bouillon Rectal
Lac du Annecy
Geschichte der Haute Cuisine
Interesting Times
Gemachte Geschichten
Erzengel Francesco
Göttingen macht Geschichte
Das unvollendete Zeitalter
Cocktail Fatal
Die Geschichte der deutschen Griechen
Braune Suppe zum Nachtisch
Geschichten von Inseln
Present Not Voting
Aufklärung im Schottenrock
Ein Blick in den Abgrund der Zeit
Homo Diluvii Testis
Von wachsenden Giraffenhälsen
Segeltörn im Pazifik
Die Geschichte vom fliegenden Orang-Utan
Willkommen im Bermuda-Dreieck
Das Malaiische Archipel
Von Flachköpfen und dicken Bohnen
Der in den Abgrund sah
Von falschen Hasen und Maushunden
Ark of a Dream
Ein Schloss in Bodenwerder
Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht,
und wenn er auch die Wahrheit spricht
Jeder kennt wahrscheinlich die haarsträubenden Lügengeschichten des Baron Münchhausen, in der er sich auf einer Kanonenkugel über eine Stadt schießen ließ, umsattelte, und auf einer anderen Kugel gleich wieder hinausflog. Obwohl die Geschichten des Barons wohl etwas geflunkert waren, wissen doch die wenigsten, dass es sich bei Hieronymus Carl Friedrich Freiherr von Münchhausen tatsächlich um eine real existierende Person handelte, der seine kuriosen Geschichten gern vor einem kleinen, sehr privaten Publikum auf seinem 'Schloss' in Bodenwerder kund tat. Und wenn der sommerliche Abend draußen in seinem Pavillon sich einigermaßen nett gestaltete und der Tokajer zur Neige ging, ritt er schon mal gern auf seinem halben Pferd los, um für Nachschub zu sorgen. Der Baron war ein meisterhafter Geschichtenerzähler, und bald kursierten seine Anekdoten überall rund um Bodenwerder.
Jener Baron Münchhausen war einer der 'Braunschweig-Kürassiere', der von seinem Landesherrn zum Dienst nach Russland geschickt wurde. Eigentlich erging es ihm nach seiner Rückkehr recht gut. Er lebte über Jahrzehnte recht ruhig und zufrieden auf seinem kleinen Landsitz und erfreute sich bester Gesundheit. Aus Russland brachte er neben seiner ersten Frau auch einige alte Goldmünzen mit der Prägung von Iwan III. mit. Als Zarin Elisabeth wenig später an die Macht kam, ließ sie möglichst alles vernichten, was an ihren Vorgänger erinnerte, wozu auch all die Münzen mit dem Konterfei des bisherigen Herrschers gehörten. Münchhausen geriet damit unverhofft an einen seltenen Schatz seiner Zeit, der ihm noch einigen Ärger bereiten sollte.
Zu seinen aufmerksamsten Zuhörern gehörte auch ein Herr Rudolf Raspe, ein echter Universalgelehrter und Lebemann, der sich mit allem beschäftigte, was gerade modern war. Dazu gehörte neben der Münzsammlung des Barons auch dessen neue, junge Frau. Der nochmals brunftig gewordene Greis hatte sich nämlich in hohem Alter in sein erst zwanzig Jahre altes Patenkind, die Majorstochter Bernhardine Brunsig von Brunn verguckt. Geld und junge Frauen haben schon manch älteren Herrn in den Ruin getrieben, und auch der Lügenbaron sollte davon nicht verschont bleiben. Was das alles mit dem Herrn Raspe zu tun hat, ist wohl den wenigsten bekannt.
Raspe war ein Kind der Aufklärung, hatte an der Universität Göttingen studiert und wurde schließlich Kurator am Ottoneum in Kassel. Mit seiner 'Dissertatio Epistolaris de Ossibus ei Dentibus Elephantum' – der Abhandlung über die vorgeschichtliche Existenz des Mammuts, wurde er sogar Mitglied der hoch angesehenen Royal Society in England. Eigentlich konnte er zufrieden sein, nur wollten seine privaten Ausgaben als Lebemann nicht so recht mit seinen Einnahmen als Kurator korrespondieren. So ließ er sich zum sprichwörtlichen Griff in die Kasse verleiten, und befand sich bald auf der Flucht nach England, steckbrieflich gesucht als 'rothaariger Mann mittlerer Größe'. In seiner neuen Heimat erinnerte sich Raspe an die Geschichten des Barons und veröffentlichte sie bald unter dem Titel 'Baron Munchausen’s Narrative of his Marvellous Travels and Campaigns in Russia'. Das Buch schlug sprichwörtlich ein wie eine Bombe. Die ersten Auflagen waren schnell vergriffen, und da das Geschäft so gut lief, dichtete er gleich noch ein paar Seefahrergeschichten für sein englisches Publikum hinzu. Für den eigentlichen Baron sollte dies fatale Auswirkungen haben.
Die Vorstellung von Ehe waren bei den Münchhausens verständlicher Weise nicht gerade Deckungsgleich. Was der eine als sein letztes Liebesabenteuer betrachtete, wertete die andere eher als Versorgungseinrichtung pflegebedürftiger Senioren. Die junge Bernhardine benötigte denn auch sehr bald ein wenig Geld für eine recht umfassende Erholungskur in Bad Pyrmont. Raspe nutzte seine Chance, besuchte die junge Frau und gelangte für wenig Geld in den Besitz der wertvollen Münzsammlung des Barons. Was immer man nun auch unter einer 'umfassenden Kur' verstehen mag, für Bernhardine war es eine äußerst fruchtbare Zeit. Neun Monate später sollte ihre Tochter das Licht der Welt erblicken, und es ist nicht auszuschließen, dass Raspe damit in Verbindung stand.
Dem gehörnten Greis aus Bodenwerder war sofort klar, dass er nicht für dieses Malheur verantwortlich zu machen war. Er bezichtigte seine junge Gattin des Ehebruchs und reichte unverzüglich die Scheidung ein. Im nun anstehenden langen Scheidungsprozess rächte sich sein neu erworbener Titel als 'Lügenbaron'. Seine hochschwangere Frau beschuldigte ihn vor Gericht, dass alle seine Anschuldigungen erstunken und erlogen seien. Als Beweis legte sie jene Geschichten vor, die Raspe in Umlauf gebracht hatte. Dem 'Lügenbaron' sollten denn auch die Richter nicht mehr glauben, und so endete das letzte Abenteuer des Barons in einem finanziellen Desaster.
Natürlich muss diese Geschichte mit dem Baron Münchhausen beginnen, mit ihm und einer Universität, die gerade erst gegründet wird. Sein Onkel, Gerlach Adolph Freiherr von Münchhausen war es, der 1734 die Universität von Göttingen gründete, an der auch später Rudolf Raspe sein Studium absolviert hatte. Sie sollte in Kürze zu einer weltweit anerkannten Institution werden, an der auch Gestalten wie die Humboldts, die Grimms, ein Freiherr von Stein, und selbst die englischen Kronprinzen studieren sollten.
'Auf Männer wie Heyne, Michaelis und so manchem anderen ruhte mein ganzes Vertrauen; mein sehnlichster Wunsch war, zu ihren Füßen zu sitzen und auf ihre Lehren zu merken', wird Goethe Jahre später über die Professoren dieser Einrichtung schreiben.
Was es mit dieser Universität und den genannten Personen auf sich hatte und welche immense Bedeutung ihr zukommt, werden wir bald sehen. Aber fangen wir unsere Geschichte endlich richtig an. Reisen wir in einen kleinen Park in Göttingen.
Der Anfang der Geschichte
Spaziergang im Park
Coitus Interruptus in Arabien
Kaffee wie Dinde so schwarz
Rendezvous in Bagdad
Gute Luft in Persien
Die Wette
Spaziergang im Park
Willkommen in der berühmten Stadt Göttingen. Setzen wir uns ein wenig und genießen die wärmende Sommersonne. Man ist noch recht ungestört, denn gerade erst hat das neue Jahrhundert begonnen, das neunzehnte, wohlgemerkt. Um die Ecke kommt gerade ein junger Student namens Georg Grotefend, der sich lautstark mit seinem väterlichen Freund Fiorillo darüber streitet, was gerade in der Welt passierte.
Man befand sich mitten in der Zeit der Aufklärung, und man war sich dessen durchaus bewusst. Wem das bislang noch nicht klar war, dem schmetterte aus Königsberg ein gewisser Immanuel Kant, schon damals bekannt wie ein bunter Hund, seinen Zuhörern entgegen, sie sollten doch zur Abwechslung mal ihr Hirn einschalten und sich aus ihrer 'selbstverschuldeten Unmündigkeit' befreien, wie er es nannte.
'Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Sapere aude! Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! ist also der Wahlspruch der Aufklärung'.
Langsam begann man zu erkennen, warum die Welt so war wie sie ist. Die Menschheit begann nach der Sintflut, und die Weisheit mit den Griechen. So stand es geschrieben und so musste es sein.
Die Welt veränderte sich gerade gewaltig. Bevor Georg geboren wurde herrschte noch Ordnung. In Frankreich trug der König seinen Kopf noch auf den Schultern und saß fest auf dem Thron. Ludwig XVI. war Frankreich, Frankreich war riesig, und Paris der Nabel der Welt. Jetzt aber war das Chaos ausgebrochen. Der König lag nun auf dem Schafott, sein Kopf im Korb davor, und mit ihm schien die ganze alte Ordnung gefallen zu sein. Plötzlich redete man von Bürgern, von Nation, und von Freiheit und Gleichheit, die mit der Revolution gekommen waren.
Auch im Heiligen Römischen Reich deutscher Nationen gab es kein anderes Thema, und natürlich wurde von Napoleon geredet, der gerade aus Ägypten zurückgekommen war. In den Salons und an der Universität gab es kein anderes Thema. Man sprach von einer 'deutschen Nation', und viele wünschten sich, dass der Franzose endlich käme, und mit ihm die ersehnte Veränderung.
Der junge Student hatte damit einige Schwierigkeiten. Sein Landesherr war Georg III., und der war deutscher Kurfürst und zugleich englischer König. Welcher Nation sollte man da schon angehören? England war früher ein Zwerg, jetzt aber entwickelte es sich rasend schnell zur Weltmacht. Georg III. besaß Kolonien in der ganzen Welt, von Amerika bis Indien. Dampfmaschinen nebelten ganze Städte ein und trieben die 'industrielle Revolution' an. Wirtschaft war das Top-Thema auf der Insel, und neue Fabriken schossen wie Pilze aus dem Boden. Es rumorte derzeit gewaltig in Europa.
Georg hatte in den letzten Wochen die Archive der Bibliothek durchforstet und war auf alte Reiseberichte aus dem Orient gestoßen. In den Büchern waren Zeichnungen von alten Ruinen, und auf diesen Ruinen war eine uralte Schrift notiert, die noch niemand entziffern konnte. Dass diese wenigen Zeilen den Schlüssel zu einem außergewöhnlichen Schatz bargen, konnte Georg natürlich nicht wissen. Niemand ahnte, dass diese alte Schrift bald ein ganzes Weltbild zum Einsturz bringen sollte. Wie dieser Schlüssel in den Besitz der Göttinger Universität gelangt war, ist wiederum einer Geschichte von Zufällen zu verdanken.
Coitus Interruptus in Arabien
Heynes Vorgänger, der ehrenwerte Professor Michaelis, den der Onkel des Lügenbarons seinerzeit an die neu gegründete Universität in Göttingen geholt hatte, hatte es nämlich vierzig Jahre zuvor fertig gebracht, die erste wissenschaftliche Forschungsexpedition nach Arabien auf die Beine zu stellen. Den Bericht dieser Reise hatte Georg nun in den verstaubten Gefilden der Universitätsbibliothek wiedergefunden. Es war eigentlich eine gescheiterte Expedition, und Professor Michaelis hatte schließlich keine weitere Notiz davon genommen. Der alte Professor wollte seinerzeit nachprüfen, was denn an den Geschichten der Bibel wahres dran war. Er zweifelte keinesfalls an der heiligen Schrift, und es gab auch keinen Grund dafür, vielmehr suchte er nach wissenschaftlicher Evidenz für die Echtheit der Bibel. Man lebte in der Zeit der Aufklärung, und niemand, der einigen Verstandes war, zweifelte wirklich an der Schrift Gottes, der Geschichte der Schöpfung und der Sintflut. Aufklärung hieß ja schließlich auch, den Verstand zu benutzen.
Wie viele seiner Kollegen war Professor Michaelis der Auffassung, dass sich Arabien seit den biblischen Zeiten nicht sehr verändert habe. Was wäre also einfacher und einleuchtender, als jemanden dort hinzuschicken und die Angaben der Schrift zu überprüfen. So setzte er sich also bald auf seine vier Buchstaben, nahm seine Bibel zur Hand und notierte all die Fragen, die ihm für seine Forschung wichtig erschienen.
Es gab Fragen zum allgemeinen Klima in Arabien, nach Städten und Landschaften, nach den Tieren die dort lebten und auch den Pflanzen, die man dort antreffen könnte. Ihn interessierte, woher das Rote Meer seine Farbe habe, ob es fliegende Schlangen gäbe, wie das Manna zubereitet werde, oder ob die Araber, ähnlich der Hottentotten, ihre Ochsen mit ihren Hörnern zum Schutz gegen wilde Tiere in Reihe dicht aneinander stellten.
Die Vorstellungen vom Orient waren, gelinde gesagt, noch etwas dürftig. Sehr wahrscheinlich hatte der Professor den Norden Europas niemals verlassen und bezog seine Kenntnisse hauptsächlich aus der heiligen Schrift. Vielen seiner Kollegen ging es nicht anders. Seine Forschungsziele fasste er in einem Buch zusammen, den 'Fragen an die Gesellschaft gelehrter Männer', ein wahres Kabinett von Köstlichkeiten. Ob Zahnschmerzen in Arabien seltener seien, wurde dort gefragt, und was dies mit dem Gebrauch von warmen Kaffee zu tun habe. Oder ob 'Unbeschnittene' im warmen Klima Arabiens häufiger von Karbunckeln geplagt würden als 'Beschnittene', und was das ganze schließlich mit der Hautfarbe zu tun habe. Natürlich interessierte er sich auch für die unterschiedlichen Arten der Entmannung, speziell, ob die 'Testikel nun ausgedrückt oder die Ruthe abgeschnitten' werde. Er kannte nämlich seine Bibel auswendig, und dort steht ja auch, dass kein Mann mit zerquetschten Hoden oder verstümmelten Glied in die Gemeinde darf (5 Mose 23.1).
Wenn den Professor schon so etwas interessierte, dann ganz bestimmt auch, ob in Arabien die verschmähte Schwägerin noch immer ihren Schwager anspucken, den Schuh ausziehen, und als 'Barfüßler' beschimpfen dürfe. Was uns heute eher befremdlich erscheint, war für die damalige Zeit eine durchaus verständliche Frage. Dazu muss man nur die biblische Geschichte von Juda und Tamar kennen, und die geht folgendermaßen:
Tamer hatte damals nämlich Judas ältesten Sohn Ger geheiratet, beide lebten glücklich und zufrieden, nur hatten sie noch keinen männlichen Nachkommen gezeugt, als Ger plötzlich starb. Ohne Sohn steht die Witwe nun auch ohne Erbanspruch da, und folglich schickte ihr ihr Schwiegervater seinen zweiten Sohn Onan, um sich der Sache anzunehmen. Die beiden bemühten sich zwar nach Kräften, aber immer wenn es so weit war, ließ ihr Schwager den Samen lieber auf den Boden fallen, so steht es in der Bibel. Dieser erste 'coitus interruptus' der Weltgeschichte passte dem HERRN nun gar nicht, und so muss Onan sterben.
Interessanter Weise jedoch steht 'Onanie' heute als Synonym für 'Masturbation', mit der der biblische Onan so gar nichts zu tun hatte. Hingegen wird noch heute der 'coitus interruptus', dem Onan letztendlich zum Opfer fiel, in vielen christlich-religiösen Kreisen als einzig zulässige Methode der Empfängnisverhütung angesehen. Eigentlich eine vollkommen verkehrte Welt, aber so ist das manchmal mit der Religion. Aber zurück zur Geschichte.
Tamer war noch immer ohne Erbe und wartete nun vergebens auf Sohn Nummer drei, um endlich einen männlichen Nachkommen zu produzieren. Der kleine Schela war offensichtlich noch nicht so weit für derartige Erfahrungen, und so vergaß Papa Juda denn auch bald, seiner Verpflichtung nachzukommen. Tamer war darüber naturgemäß weniger begeistert, und beschloss daher, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Sie verkleidete sich als Prostituierte, in dem sie sich ein Kopftuch auftat - so einfach ging das damals - setzte sich vor die Stadt und wartete auf ihren Schwiegervater. Der kam auch tatsächlich vorbei, und scheinbar war Tamers Tarnung so gut, dass selbst der Schwiegervater sie nicht erkannte. Er buchte sie für eine Nacht, schwängerte sie, bezahlte brav, und zog von dannen. So erhielt Tamer endlich ihr Erbe, so steht es in der Bibel, und wenn es schon in der Bibel steht, dann muss es auch so sein (1 Mose 38).
Bleibt noch die Sache mit dem 'Schuh' zu klären, den die Verschmähte ihrem Schwager auszieht. Auch das ist natürlich Teil der Bibelgeschichten. Weigert sich nämlich der Schwager mit seiner Schwägerin ins Bett zu gehen, was ja durchaus einmal vorkommen kann, dann: 'soll seine Schwägerin zu ihm treten vor den Ältesten und ihm den Schuh vom Fuß ziehen und ihm ins Gesicht speien und soll antworten und sprechen: So soll man tun einem jeden Mann, der seines Bruders Haus nicht erbauen will! Und sein Name soll in Israel heißen 'des Barfüßers Haus'' (5 Mose 25, 9-10).
Wunderbar absurde Dinge stehen in der alten Schrift, aber kommen wir wieder zurück zu unserer Geschichte.
Ausgestattet mit einem ganzen Katalog derlei unfreiwillig komisch erscheinender Fragen machte sich die Expedition am 4. Januar 1761 mit dem Schiff von Kopenhagen aus auf den Weg. Sie bestand aus sechs ehemaligen Göttinger Studenten, und unter ihnen befand sich ein gewisser Herr Carsten Niebuhr. Die Aufzeichnungen dieses Herrn berichten von einem totalen Fiasko. Wie es nicht anders zu erwarten war prallten schon bei der Abfahrt Anspruch und Wirklichkeit jäh aufeinander.
Bei der Abreise aus Kopenhagen wehte es die Matrosen in den Winterstürmen aus den Masten und sie starben wie die Fliegen in der eisigen See. Es dauerte neun Monate, ehe man endlich in einem Hafen in Ägypten anlandete. Schon bald führte die Reise die sechs Expeditionsteilnehmer nach 'Arabia Felix', ins 'glückliche Arabien', in den Süden der Saudi-arabischen Halbinsel, wo man die 'ursprünglichen' Lebensweisen anzutreffen erwartete. Wen man hingegen antraf waren ganz 'ursprüngliche' Schwärme von Malariamücken, die nun über die vollkommen ahnungslosen und unvorbereiteten Reisenden herfielen und sich nach bester Manier an ihnen gütlich taten.
Im Mai starb der erste Teilnehmer, Friedrich Christian von Haven in Mokka an Malaria, und sechs Wochen später Peter Forskal auf dem Weg nach Sanaa. Die Überlebenden beschlossen daraufhin, so schnell wie möglich Mücken und Region zu verlassen und nach Bombay weiter zu reisen, aber noch auf See starben zwei weitere Teilnehmer, Baurenfeind und Berggren. Als die Expedition nach gerade einmal einem Jahr effektiver Forschungsreise durch Arabien im September 1763 in Indien landete, waren schon vier der sechs Teilnehmer verstorben.
Die britische Ostindien-Kompanie hatte im Siebenjährigen Krieg gerade ihre französische Konkurrenz vom Subkontinent vertrieben. Indien war nun eine der Kolonien des englischen Königs, und der war auch Landesvater der Universität Göttingen, womit sich auch das Reiseziel Indien erklärt.
In Bombay stirbt nach kurzer Zeit auch Niebuhrs letzter Reisegefährte, der nun beschließt, für die nächsten vier Jahre allein und anonym unter dem Namen 'Abdallah' weiterzureisen. Langsam mag es dem letzten Überlebenden wohl gedämmert haben, dass die Vorstellungen seines Auftraggebers nur wenig mit der Realität gemein hatten. Seltenere Zahnschmerzen hatten die Araber denn auch weniger wegen des Konsums warmen Kaffees, sondern weil sie sich ganz einfach nach jedem Essen Mund und Zähne reinigten, eine Einsicht, die sich später auch langsam in Europa durchsetzen sollte. Von Michaelis Fragenkatalog schien er inzwischen allerdings nicht mehr viel zu halten.
'Wenn es wahr ist, dass die Ochsen der Hottentotten sich gewöhnen lassen sich des Nachts in einer Reihe dicht an einander zu stellen, um den ankommenden wilden Thieren eine ganze Linie von Hörnern entgegen zu setzen (Michaelis 46te Frage), so müssen die arabischen Ochsen wohl dümmer sein; denn dergleiche Tugenden habe ich niemals von ihnen gehört'
Niebuhr notierte und kartographierte alles, was er zu sehen bekam. Als er im März 1765 schließlich die Ruinen von Persepolis erreichte, fertigte er einige Zeichnungen an, darunter eine detaillierte Kopie einer Schrift, die in Europa bislang noch niemand zu lesen vermochte. Folgendes notiert er in seinen Notizen:
'Von der schönen keilförmigen Schrift, findet man fast beständig drey Inschriften von drey verschiedenen Alphabeten neben einander... Das Siegel kann dem Sprachforscher vielleicht nützlich seyn; denn dass darin befindliche Thier ist gewiß ein Fabelthier der Perser, und also die Schrift um dasselbe gleichfalls persisch'.
Niebuhr kommt auf seiner Rückreise auch nach Mossul, ahnt allerdings noch nichts von den archäologischen Schätzen unter den Hügeln unweit der Stadt. Die alten reiche Babylon und Assyrien kennt er zwar nur aus den Geschichten in der Bibel, es gelingt ihm aber tatsächlich die Standorte der beiden Städte Ninive und Babylon einigermaßen genau zu bestimmen.
Als er 1767 schließlich in seine Heimat zurückkehrt, waren all die Aufzeichnungen und Antworten aus dem Fragenkatalog ohne Wert. Verbittert darüber, dass die Berichte nicht seinen Vorstellungen entsprachen, bezeichnete Professor Michaelis die Expedition für gescheitert, und so landeten viele seiner Karten und Zeichnungen in den Archiven der Bibliothek. Genau diese Aufzeichnungen fielen nun dem jungen Studenten Grotefend in die Hände, als er sich durch die Untiefen der Bibliothek seiner Universität wühlte.
Dazu gab es noch drei weitere Bücher, auf die der junge Student gestoßen war, und die Hinweise auf die alte Geschichte Mesopotamiens gaben. Eine von einem alten Augsburger Kaufmann, eine andere von einem italienischen Adeligen, und eine schließlich von einem Pariser Juwelier. Alle drei wundervolle Geschichte, die deshalb auch kurz erzählt werden sollen.
Kaffee wie Dinten so schwarz
Das erste Buch wurde 1582 von einem Leonhart Rauwolf verfasst, und trug den Titel: 'Aigentliche Beschreibung der Raiß, so er vor diserzeit gegen Aussgang inn die Morgenländer, fürnemlich Syriam, Judeam, Arabiam, Mesopotamiam, Babyloniam, Assyriam, Armeniam, und nicht ohne geringe mühe und grosse gefahr selbst volbracht: neben vermeldung vil selzamer und denckwürdiger sachen, die alle er auff solcher erkundigt, gesehen und observiert hat'.
Damals trugen Bücher noch Titel, die unzweideutig verrieten worum es geht. Rauwolf war Medicus und Fachmann für Heilkräuter aus Augsburg, und erfüllte sich mit seiner Reise 1573 einen Kindheitstraum. Der Orient mit seinem Wissen über Medizin und Heilkräuter hatte ihn schon lange fasziniert. Aber erst als das Handelskontor seines Schwagers jemanden sucht, der mehr Informationen aus Arabien verschaffen soll, schlägt Leonhardt zu.
Knapp drei Jahre dauert seine Reise und er ist wahrscheinlich einer der ersten Europäer, der den Genuss von Kaffee in seinem breiten schwäbischen Akzent beschreibt: 'Under andern habens ein gut getränck, welliches sie hoch halten, Chaube von inen genenet, das ist gar nahe wie Dinten so schwarz und in gebieten sonderlich des Magens gar dienstlich'.
Im Süden beschreibt Leonhardt den Turm zu Babel als Schloßberg mit einer seit langem verfallen Festung 'hinderdem in der nehe der Babylonische hohe Thurn gestanden, den die Kinder Noah (welche erstlich dies landschafft nach der Sündflut bewohnet) biß an Himmel zu erbawen angefangen'.
Für Leonhardt ist es die biblische Landschaft und das erste bewohnte Land nach der Sintflut. Es war wohl das erste mal, dass ein Reisender die einigermaßen korrekte Lage des biblischen Babylon in einem Buch beschreibt. Auf der Rückreise passiert auch er Mossul und bemerkt die schöne hügelige Landschaft, nicht ahnend, welch archäologische Schätze sich darunter befinden. Es wird noch lange dauern, bis man herausfindet, was sich dort verbirgt.
Heute ist Rauwolf jedoch weniger für die Beschreibung des Turms zu Babel, als vielmehr für die nach ihm benannten Rauwolfgewächse bekannt.
Rendezvous in Bagdad
Einen weiteren Hinweis auf die Keilschrift hatte Georg in der Reisebeschreibung eines Pietro della Valle aus dem Jahr 1674 gefunden. Es ist nicht nur das Tagebuch einer ungewöhnlichen Reise zu einer Zeit, zu der man in Europa geradewegs auf den dreißigjährigen Krieg zusteuerte und Hexenverbrennungen und Aberglaube Hochkonjunktur hatten, es ist gleichzeitig auch eine schaurig schöne Liebesgeschichte zweier Menschen die unterschiedlicher nicht hatten sein können.
Pietro della Valle war ein junger Adeliger Ende zwanzig, als er sich bis über beide Ohren in eine überaus schöne Dame verliebt, 'von welcher er das gewisse und aufrichtige Versprechen ihrer Treue gehabt, aber lißtiglich hintergangen und geäfft' wurde, schreibt der Abt Filippo Maria Bonini in der Lebensbeschreibung della Valles.
Was für ein Charakter della Valle war, lassen wir uns ebenfalls von Abt Bonini erzählen, denn trefflicher kann man nur selten eine Person beschreiben. Der Abt wählt also folgende Worte:
'Es war der Herr Pietro della Valle feuchten und warmen Temperaments welches dann, weil es in großer Übermaß bei ihm geweßt, verursacht, daß er hohe Gedanken geführet, hurtigen Entschlusses eifrig in seinen Geschäften, und über alle Maßen hizig in seinen Sinn-Leistungen gewesen, umb welcher Willen er alles andere für einen Scherz gehalten und in den Wind geschlagen hat'.
Was das mit dem feuchten Temperament auf sich hat, bleibt wohl der Phantasie des Leser überlassen, dass er jedoch das Leben nicht allzu ernst und eher als großen Scherz aufgefasst hat, macht ihn sehr sympathisch. Boninis Charakterbeschreibung ist einfach nur köstlich. Es ist die Sprache des üppigen und schwülstigen Barock, die hier dargeboten wird.
In Neapel versuchte della Valle zunächst Abstand von den zermürbenden Gedanken an seine verlorene Liebschaft zu gewinnen. Schließlich rät ihm sein Freund Schipano zu einer Pilgerreise nach Palästina, um seinen Liebeskummer zu vergessen. Schipano ahnte 1614 nicht, dass sein Freund nun fast 12 Jahre auf Reisen sein und bis nach Indien vorstoßen sollte.
Pietro schreibt seinem Freund regelmäßig seine 'Sendschreiben' und will schon fast heimkehren, als er sich in Aleppo in eine überaus schöne aber vollkommen unbekannte Aurora verliebt, die er nur vom Hörensagen kennt. Und so schreibt er an seinen Freund folgendes:
'Wisset demnach, daß in diesem Land das Gerücht der schönen Aurora mir zu Ohren kommen ist, daß ich aus inbrünstiger Begierde sie zu sehen, sie gar zu besitzen, gezwungen bin, eine andere, wo nicht so langwierige, jedoch ebenso weite und mühsame, und dannhero nicht weniger merkwürdige Reise in die Hand zu nehmen'.
Gleich Tags darauf macht er sich auf den Weg nach Bagdad, beschreibt noch schnell den Turm zu Babel und die Löwengrube, in welche Daniel geworfen wurde, und trifft schließlich auf seine Aurora, die sich als Sitti Ma'ani Gioerida herausstellt und die er folgendermaßen beschreibt:
'Sie ist von Geburt Assyrerin, aus uraltem christlichen Blut entsprossen, ohngefähr achtzehen Jahr alt, und, neben ihren Gemüths-Gaben, welche bei ihrer Person ganz ungemein sein, von so annehmlicher Leibs-Gestalt, daß ich, wann es einem Eheman nicht unanständig wäre, seine Frau zu rühmen, ohne Ruhmredigkeit wol sagen könnte, daß sie liebens werth wäre.'
Ja, sie haben ganz richtig gelesen, 'veni, vidi, nupsi', würde der alte Lateiner sagen, ich kam, sah und heiratete. Kaum angekommen, ehelicht er seine Angebetete, die er zuvor noch nie gesehen hatte. Spätestens jetzt hatte er wohl all seine Verzweiflung vergessen und hört gar nicht mehr auf, von seiner neuen Gemahlin zu schwärmen:
'Sie ist selbiger Landesart nach lebhaffter Farb, welche in den Augen der Italiener mehr bräunlicht, als weiß scheinen würde, schwärzlicht von Haaren und Augenliedern, die sehr anmuthig gleich einen Bogen gewölbt sein, über welchen zwei lange Augbraun stehen, die mit Spießglas, nach morgenländischem Gebrauch, gefärbet sein, welche dann eine majestätische Schattirung machen. Ihre Augen sind ebensolcher Farbe und hell glänzend, jedoch mit einer ernsthafften Bescheidenheit nidergeschlagen. Ihre Leibslänge ist für ein Weibsbild weder zu groß noch zu klein, sondern ihr ganzer Leib in allen Stücken in behöriger Ebenmass, nebst seiner wolziemenden Hurtigkeit, adelichen Gebärden, und wundersamen Annehmlichkeit wann sie redet, und noch mehr, wann sie lächelt, und ihre kleine und schneeweiße Zähne sehen lässet, und andere dergleichen Umbstände, darein ich mich verliebet'
So, und nicht anders, schreibt ein junger italienischer Edelmann des Barock 'feuchten und warmen Temperaments' von seiner jungen Gemahlin. Pietro und seine wunderhübsche Frau Ma'ani ziehen in den folgenden Jahren gemeinsam weiter und gelangen ebenfalls nach Persepolis, wo Della Valle wohl die erste dokumentierte Abschrift der Keilschrift anfertigt. Es sind diese wenigen Zeilen, um deren Willen er später in die Geschichtsbücher eingehen sollte. Nur hatte Pietro della Valle davon noch überhaupt keine Ahnung.
Bereits auf dem Rückweg nach Italien stirbt seine Ma'ari an einem Fieber, und als Pietro della Valle nach zwölfjähriger Reise wieder in Rom eintrifft, hat er in seinem Gepäck nicht nur einige Andenken, die Abschriften aus Persepolis mit der sonderbaren Keilschrift, sondern auch die mumifizierte Leiche seiner verstorbenen und innig geliebten Frau, die er in der Familiengruft begraben lässt. Er war halt ein Hallodri, dieser Pietro, aber ein überaus Sympathischer.
Gute Luft in Persien
Das letzte Buch mit Hinweisen auf die Keilschrift, dass Georg gefunden hatte war der Bericht eines Juweliersohnes aus Frankreich namens Jean Chardin. Dieser hatte seinen Beruf im Geschäft seines Vaters an der Place Dauphine in Paris erlernt. Als er 1643 geboren wird, ist der dreißig jährige Krieg schon vorbei, und der erst fünfjährige Ludwig der XIV, der spätere 'Sonnenkönig', sitzt auf dem französischen Thron, während in England gerade erst der Bürgerkrieg ausbricht. Frankreich entwickelt sich zu der Zeit zur europäischen Großmacht und baut seine Kolonien und Handelsbeziehungen in alle Welt aus, so auch nach Ostindien. Auch der französische König hatte zu dieser Zeit Kolonien in Indien, wenn man es auch inzwischen vergessen zu haben scheint.
Chardin war gerade erst einundzwanzig Jahre alt, als sein Vater Anteilseigner der frisch gegründeten 'Compagnie des Indes Orientales' wurde, der französischen Ostindienkompanie. Der schickte seinen Sohn denn auch gleich darauf nach Persien, um neue Handelsbeziehungen aufzubauen.
Der junge Mann wurde schnell Hofjuwelier des persischen Königs und bringt aus Persepolis einige Abschriften der Keilschrift mit nach Hause. Noch weitere sechsundzwanzig Bücher mit dieser uralten Keilschrift sollen in Isfahan liegen, schreibt er in seinem Buch 'Des vortrefflichen Ritters Chardin, des großen Königs in Persien Hoff-Handelsmanns Curieuse Persian und Ost-Indische Reise-Beschreibung'.
Im Jahr 1674 beschreibt er in seinem Buch unter anderem 'den Untergang und die Bruchstücke der berühmten Stadt Persepolis, so in zwei und zwanzig Kupfferfiguren und einer weitläuffig und ausführlichen Beschreib und Auslegung sothaner kläglichen Reste, befindlich, welche billich für die berühmtesten Monumenta und Denkmale der Antiquität zu achten' sind.
Und während im pestverseuchten London 1665 fast einhunderttausend Menschen ihr Leben verlieren, schwärmt der junge Chardin von der reinen Luft im fernen Persien. 'Jedoch ist die Luft, ins gemein davon zu reden in diesem Land kühl, und diese kühle Luft hat die wundersame Eigenschaft, daß die Leuthe, ausgenommen an den Grenzen gegen Süden und Norden, insgesamt sehr gesund, schöner Farb, und beiderlei Geschlechts von Leibs Stärke gliederig und wolgestalt sein'.
Frische Luft und ein wenig Sonne helfen halt ungemein bei der Erhaltung der Gesundheit, das wusste man schon damals.
Die Wette
Kommen wir zurück an die Universität nach Göttingen, wo Georg Grotefend schon seit Stunden mit seinem Freund Fiorillo über all das diskutierte, was er in den Niederungen der Bibliothek gefunden hatte. Alte Schriften zu entziffern war gerade 'en-vogue'. Für die alte Keilschrift, die Georg in den verstaubten Korridoren der Universitätsbibliothek gefunden hatte, interessierte sich jedoch niemand. Um der ganzen Diskussion ein Ende zu setzen, schlug Fiorillo seinem jugendlichen Freund eine Wette vor. Sollte er es tatsächlich schaffen die Zeichen zu entziffern, winke dem jungen Forscher seine erste wissenschaftliche Veröffentlichung. Das war natürlich eine Herausforderung, die Georg gern annahm, und so schloss er sich im Sommer 1802 in seinem Studentenzimmer ein, setzte sich vor seinen überfüllten Schreibtisch, nahm sich die alten Keilschriften zu Brust, und begann zu puzzeln.
Wofür Fachleute Jahre brauchen, Georg löste das Rätsel innerhalb nur weniger Wochen und konnte tatsächlich rund ein Drittel aller Zeichen dieser bislang vollkommen unbekannten Keilschrift decodieren. Im September 1802 präsentierte er den Professoren der Universität seine bahnbrechenden Erkenntnisse, und was auf diese Sensation folgte, können sie sicherlich schon erahnen. Es geschah absolut garnichts. In der wissenschaftlichen Fachwelt nahm man so gut wie keine Notiz von ihm und seinen Ergebnissen. Er erhielt einen aufmunternden Schulterklopfer, und damit war die sich anbahnende steile, wissenschaftliche Karriere auch schon beendet. Georg Grotefend war der richtige Mann, am richtigen Ort, aber leider zur falschen Zeit.
Das Dumme an der Sache war nämlich, dass er einen Schlüssel zu einem Geheimnis gefunden hatte, das noch unter meterdicken Schichten zusammengefallener Lehmbauten bei Mossul begraben lag. Die eigentliche Sensation sollte Georg schon nicht mehr erleben, die hängt nämlich mit einem jungen Engländer zusammen, der splitterfasernackt im Britischen Museum steht. Aber zu dieser Geschichte kommen wir später.
In der Zwischenzeit müssen wir noch ein wenig Archäologie betreiben, ein ganz neues Forschungsfeld, dass bis dato noch gar nicht existierte. Die bisherigen Texte der Keilschrift gaben wirklich nicht allzu viel her, aber das sollte sich bald ändern. Die Sprengkraft, die damit verbunden war, ist heute kaum noch vorstellbar. Verabschieden wir uns also vorerst aus Göttingen, und begleiten wir zwei der berühmtesten 'Archäologen', die die alten Ruinen in Mesopotamien ausgegraben haben. Ihre Funde machten sie wohl eher aus Zufall und aufgrund unendlicher Langeweile. Aber schauen sie selbst.
Fangen wir an in Frankreich, zu einer Zeit, da Napoleon schon Geschichte war...
Gesuchte Geschichte
Ninive retrouvée
Assurbanipals Bibliothek
Nackt im Museum
Babel-Bibel-Streit
Ninive retrouvée
Im Europa des frühen neunzehnten Jahrhunderts war man vom Wahrheitsgehalt der Bibel noch immer felsenfest überzeugt. Die Geschichten der göttlichen Schöpfung galten als allgemein akzeptiert, und die biblischen Berichte über die Assyrer, die Babylonier, und die Ägypter wurden in keiner Weise angezweifelt. Es gab zwar einige Wissenschaftler, die behaupteten, dass irgendetwas nicht so ganz stimmen könne, aber mit kleineren Modifikationen waren auch die neuen Beobachtungen wieder mit der Schrift in Einklang zu bringen. Kein Grund also, sich in irgend einer Weise zu beunruhigen.
Seit Napoleons Ägyptenfeldzug 1798 hatte man zudem Unmengen antiker ägyptischer Inschriften mitgebracht, die nun nach und nach entziffert wurden. Der Franzose Champollion konnte damals als erster die alten ägyptischen Hieroglyphen richtig deuten. Die Ereignisse, die diese Schriftzeichen nun schilderten, stimmten häufig mit den Berichten aus der Bibel überein.
Was bislang noch fehlte waren Beweise aus Mesopotamien, dort wo die alten biblischen Reiche der Assyrer und Babylonier gelegen haben mussten, die Region aus der Abraham stammte, und wo Noah die Sintflut überlebte. Der Urspung der Menschheit lag in Mesopotamien, davon war man felsenfest überrzeugt, denn so stand es in der Bibel, und so musste es sein. Es wurde also Zeit, sich intensiver mit der Region zu beschäftigen und nach Belegen zu suchen.
Begeben wir uns also auf die 'Heros', ein französisches Handelsschiff, auf dem wir den ersten Protagonisten dieser Geschichte treffen werden. Nachdem das Schiff in Frankreich abgelegt hatte, ging es im Atlantik auf Südkurs, man umsegelte Cap Horn, und tauchte schließlich in Kalifornien wieder auf. Was die 'Heros' hier machte, wusste auch ihr Kapitän August Bernard Duhaut-Cilly nicht so ganz genau. Seit zwei Jahren versuchte er, seine Waren zu verkaufen, und schipperte ständig zwischen Hawaii und San Francisco hin und her.
Sein Schiffsarzt, Paul-Émile Botta, hatte vor lauter Langweile schon begonnen, ein französisch-hawaiianisches Wörterbuch zu erstellen. Dass er einmal das biblische Ninive finden würde, davon wusste er natürlich noch nichts, auch nicht als er nach drei Jahren Weltumsegelung schließlich nach Frankreich zurückkehrte. Er war wahrscheinlich ebenso unbedarft wie jener junge Charles Darwin, der sich in Kürze mit seiner Beagle ebenfalls auf den Weg in den Pazifik machen sollte.
Viele große Entdeckungen, so möchte man meinen, werden aus purer Langeweile gemacht. Als der nicht mehr ganz so junge Botta nämlich Jahre später Konsul in Mossul wurde, war ihm wohl schon wieder langweilig. Diesmal fertigte er allerdings kein Wörterbuch an, sondern schnappte sich einen Spaten, und grub sich durch die schönen Hügel außerhalb der Stadt östlich von Mossul. Man schrieb das Jahr 1842.
Wie sich schnell herausstellte, waren diese schönen Hügel, 'Tells' genannt, keine natürlichen Erhebungen, sondern nichts weiter als die überwucherten Überreste längst zerfallener Städte. Botta fand auch schnell die ersten Scherben, aber dummerweise brachte ihn sein Begleiter auf die Idee, doch lieber auf einem anderen 'Tell' weiter nördlich zu graben. Es sei dort weit mehr zu finden, teilte er dem Franzosen mit, und so machte sich Botta auf Weg nach Norden und setzte dort sein Werk fort. Botta hatte gerade das lang gesuchte Ninive entdeckt, und es dann einfach achtlos liegen gelassen. Aber das wusste er damals ja noch nicht.
Mit seiner neuen Grabung nördlich von Mossul hatte er denn auch gleich Erfolg. Er stieß dicht unter der Oberfläche auf Palastmauern, dessen Wände mit Reliefs und Inschriften in Keilschrift verziert waren, und an dessen Haupteingängen riesige, knapp fünf Meter hohe geflügelte Stierplastiken standen.
'Ich glaube ich bin der erste, der Skulpturen entdeckt hat, die, wie man annehmen darf, in jene Zeit gehören, in der Ninive in Blüte stand', notierte er später in seinem Buch. Er war so begeistert und überwältigt, dass er nach Frankreich telegraphierte: 'Ninive etait retrouvée' – Ninive wurde gefunden.
Dumm war lediglich nur, dass noch niemand die Keilschriften entziffern konnte, die nun überall in den Ruinen gefunden wurden. Georg Grotefends Entdeckung hatte ja damals niemanden interessiert, sonst nämlich hätte man feststellen können, dass es sich nicht um Ninive, sondern um Dûr-Sharrûkin, den Palast von Sargon II. handelte. Auf einer der Tontafeln, die dort ausgegraben wurden, stand nämlich folgendes in Keilschrift vermerkt: 'Sargon, König des Universums, hat diese Stadt gebaut: Dûr-Sharrûkin ist ihr Name; in ihrem Innern ließ er diesen unvergleichlichen Palast errichten'. So einfach ist das manchmal in der Archäologie. Man muss nur lesen können.
Botta jedenfalls ließ alles in Kisten verpacken, sandte es in den Louvre, und löste damit einen wahren Volksauflauf in Paris aus. Jeder wollte mit eigenen Augen sehen, was von Ninive übrig geblieben war. Es war also wirklich wahr, was in der Bibel stand, davon war man nun überzeugt.
Als man kurze Zeit später die Keilschrift vollständig entziffert und den Fehler festgestellt hatte, fachte dies die Begeisterung allerdings nur noch mehr an. Denn plötzlich hatte man einen klaren wissenschaftlichen Beweis vor sich liegen, dass die Geschichten der Bibel wirklich stimmten.
In der heiligen Schrift stand schließlich: 'Im Jahr, da der Tartan nach Aschdod kam, als ihn gesandt hatte Sargon, der König von Assyrien....' (Jesaja 20.1). Sargon hatte es also tatsächlich gegeben, und Botta hatte seinen Palast entdeckt.
Noch bevor er sich allerdings aufmachen konnte, um seinen Fehler zu korrigieren und das richtige Ninive zu suchen, geriet er in die Mühlen der Politik. Nach der Februarrevolution 1848 verlor er seinen Posten in Mossul. Ihm blieb nichts weiter übrig, als Austen Henry Layard bei seinen Grabungen zuzuschauen. Was ihn vielleicht ein wenig tröstete war, dass auch dieser sich irren sollte, zunächst einmal zumindest.
Es wird also Zeit, sich dem anderen großen Entdecker zuzuwenden. Fahren wir also nach London, wo gerade ein sehr deprimierter, junger Rechtsanwalt an seinem Schreibtisch sitzt und kurz davor ist, sich vor Langeweile eine Kugel in den Kopf zu jagen. Ein gutes Indiz also, dass bald eine große Entdeckung bevorsteht. In der Tat sollte sich sein Leben in Kürze so gewaltig verändern, dass es ihn fast aus den Schuhen gehauen hätte. Er musste nur auf einen Herrn Mitfort warten, damit es endlich los geht.
Assurbanipals Bibliothek
Austen Henry Layard war sicherlich nicht der Mensch, der als junger Mann gern Zuhause blieb. Nun ja, er blieb auch in späteren Jahren nicht gern an einem Ort, und ein Leben im Anwaltsbüro seines Onkels war für ihn nicht gerade eine reizvolle Vorstellung seiner künftigen Lebensgestaltung.
Layard wurde 1817 auf der Durchreise in einem Pariser Hotel geboren. Ein Umstand, der wohl tiefgreifende Auswirkungen auf sein späteres Leben gehabt haben muss. Er wuchs in Florenz, Genf und in Frankreich auf, und wurde mit zwölf Jahren schließlich in ein Internat nach England verschickt.
Mit zweiundzwanzig wurde er Anwalt und verständlicher Weise recht depressiv. Seine Möglichkeit zu einem Leben als Abenteurer und Entdecker ergab sich erst, als ein Bekannter seines Onkels, Edward Mitfort, eine Begleitung für die Reise nach Ceylon suchte, um dort eine Kaffeeplantage aufzubauen. Nur hatte Mitfort panische Angst vor dem Wasser, und so wollte er auf dem Landweg bis nach Indien. Layard war begeistert, endlich aus dem stickigen Büro zu kommen.
Beide entschlossen sich, nur das Notwendigste mitzunehmen, und das waren einige doppelläufigen Pistolen, ein Kompass, ein Sextant und ein Bett. Es muss ein interessanter Anblick gewesen sein, als die beiden mit ihrem Bett auf dem Rücken im April 1840 in Mossul eintrudelten und die großen 'Tells' am Ostufer des Tigris beobachteten. Südlich von Mossul stießen sie später auf einen stattlichen Hügel in Form einer Pyramide und erinnerten sich natürlich an die Geschichte des alten Xenophon, der hier vor gut zweitausend Jahren entlang gekommen sein musste.
Jener Xenophon war Schüler des berühmten Philosophen Sokrates und nahm 401 v. Chr. mit zehntausend griechischen Söldnern an einer Schlacht gegen Atraxerxes II. Teil. Über seine Heldentaten verfasste er denn auch gleich ein Buch mit dem Titel 'Anabasis'.
Hintergrund des ganzen sind Streitigkeiten um die Nachfolge des Perserkönigs Dareios II., denn Kyros der jüngere, ein anderer Sohn und Thronanwärter, hatte in Kleinasien Truppen gesammelt, darunter eben auch zehntausend griechische Söldner, um gegen seinen Bruder Artaxerxes II. zu ziehen, der in Babylon saß.
Dummerweise wurde Kyros der jüngere in der Schlacht nördlich von Babylon getötet, und so oblag es Xenophon, die griechischen Söldner nach Hause zu führen. Dass er dabei den gesamten Tross an Frauen und Kindern, Prostituierten und Lustknaben, Gauklern, Schmieden, Schlachtern, Bäckern, Müllern und wen sonst noch alles zurücklässt, tut seiner Heldentat keinen Abbruch.
Jedenfalls ziehen diese zehntausend Söldner den Tigris entlang nach Norden, und Xenophon berichtet von einer verlassenen Stadt, die vorher den Medern gehörte, mit riesigen Ringmauern und uneinnehmbar. 'In der Nähe der Stadt lag eine Steinpyramide, ein Plethron breit, zwei Plethren hoch'. Und genau hier wähnten sich nun Layard und sein Begleiter, überzeugt davon, dass dies nun das echte, verschollene Ninive sei. Bis zum Beginn einer Grabung sollten aber noch einige Jahre vergehen.
Layard schaffte es übrigens nie bis nach Ceylon. Zwei Jahre lang vagabundierte er mehr oder weniger plan- und ziellos durch den vorderen Orient, verstrickte sich in politische Intrigen, wurde mehrfach überfallen und ausgeraubt, und stand schließlich halbnackt mit blutenden Füßen und ohne Bett vor dem Stadttor Bagdads, wo er ohnmächtig zusammenbrach. Nachdem ihm sein Onkel auch noch den Unterhalt strich, steckte der junge Mann sprichwörtlich in Mesopotamien fest.