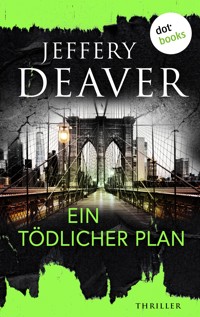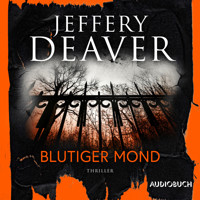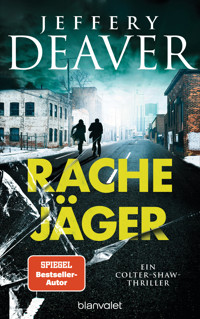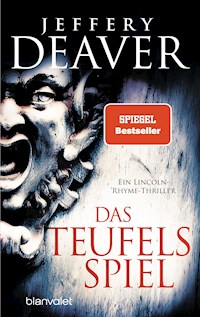9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Lincoln-Rhyme-Thriller
- Sprache: Deutsch
Der 3. Fall für Lincoln Rhyme und Amelia Sachs.
Lincoln Rhyme, der geniale querschnittsgelähmte Ermittler, will sich in North Carolina einer riskanten Operation unterziehen. Doch kaum angekommen, werden er und seine Partnerin Amelia Sachs in einen spektakulären Entführungsfall hineingezogen. Verdächtigt wird ein junger Mann, ein Einzelgänger, den nur der »Insektensammler« genannt wird. Als das Team endlich das Versteck des Jungen in den undurchdringlichen Sümpfen ausfindig macht, geschieht das Unfassbare: Amelia wechselt die Fronten und stellt sich auf die Seite des Entführers ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 675
Veröffentlichungsjahr: 2002
Ähnliche
Jeffery Deaver
Der Insektensammler
Roman
Deutsch von Hans-Peter Kraft
Copyright
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »The Empty Chair« bei Simon & Schuster, Inc., New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © der Originalausgabe 2000 by Jeffery Deaver
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2001 by Blanvalet Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH,Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Umschlaggestaltung: www.buerosued.de Umschlagmotiv: plainpicture/plainpicture-Rauschen/Tanja Luther
ISBN 978-3-894-80713-9V004
www.pep-ebooks.de
ERSTER TEIL...Eins...Zwei...Drei...Vier...Fünf...Sechs...Sieben...Acht...Neun...Zehn...Elf...ZwölfZWEITER TEIL...Dreizehn...Vierzehn...Fünfzehn...Sechzehn...Siebzehn...Achtzehn...Neunzehn...Zwanzig...Einundzwanzig...ZweiundzwanzigDRITTER TEIL...Dreiundzwanzig...Vierundzwanzig...Fünfundzwanzig...Sechsundzwanzig...Siebenundzwanzig...Achtundzwanzig...Neunundzwanzig...Dreißig...Einunddreißig...Zweiunddreißig...DreiunddreißigVIERTER TEIL...Vierunddreißig...Fünfunddreißig...Sechsunddreißig...Siebenunddreißig...Achtunddreißig...Neununddreißig...Vierzig...EinundvierzigFÜNFTER TEIL...Zweiundvierzig...Dreiundvierzig...Vierundvierzig...Fünfundvierzig...SechsundvierzigAnmerkung des AutorsKartenÜber das BuchÜber den AutorCopyright
Für Deborah Schneider –
die beste Agentin
und Freundin
Dem Gehirn, und nur dem Gehirn allein, entspringen unsere Freuden und Wonnen, das Lachen und die Späße, desgleichen unsere Sorgen, der Schmerz, der Kummer und die Tränen... Das Hirn ist überdies der Sitz von Wahnsinn und Delirium, von Ängsten und Schrecken, welche uns bei Tage oder des Nachts befallen...
Hippokrates
ERSTER TEIL
Nördlich des Paquo
...Eins
Sie kam hierher, um Blumen an der Stelle niederzulegen, wo der Junge getötet und das Mädchen entführt worden war.
Sie kam hierher, weil sie eine dickliche junge Frau mit narbigem Gesicht war und nicht viele Freunde hatte.
Sie kam her, weil man es von ihr erwartete.
Sie kam, weil sie es wollte.
Schwitzend und schwerfällig lief die sechsundzwanzigjährige Lydia Johansson auf dem unbefestigten Bankett der Route 112 entlang, an der sie ihren Honda Accord geparkt hatte, und stieg dann vorsichtig die Böschung zu dem sumpfigen Ufer hinab, wo der Blackwater Canal in die trüben Fluten des Paquenoke mündete.
Sie kam hierher, weil sie dachte, es gehöre sich so.
Sie kam her, obwohl sie Angst hatte.
Die Sonne war erst vor kurzem aufgegangen, aber seit Jahren war es in North Carolina im August nicht mehr so heiß gewesen, und Lydia hatte ihre weiße Schwesterntracht schon fast durchgeschwitzt, als sie auf die von Weiden, Tupelo- und breitblättrigen Lorbeerbäumen umstandene Lichtung am Flussufer zuging. Mühelos fand sie die gesuchte Stelle – das gelbe Absperrband der Polizei stach sofort ins Auge.
Frühmorgendliche Geräusche. Haubentaucher; ein Tier, das ganz in der Nähe im dichten Unterholz herumstöberte; der heiße Wind, der durch Schilf und Sumpfgras strich.
Herrgott, ich fürchte mich, dachte sie. Nur zu deutlich standen ihr all die grusligen Szenen aus den Romanen von Stephen King und Dean Koontz vor Augen, die sie spätabends mit ihrem Bettgefährten las – einem Becher Eiscreme.
Wieder raschelte es im Unterholz. Sie zögerte, blickte sich um. Dann ging sie weiter.
»He.« Eine Männerstimme. Ganz in der Nähe.
Lydia keuchte und fuhr herum. Fast hatte sie die Blumen fallen lassen. »Hast du mich erschreckt, Jesse.«
»Tut mir Leid.« Jesse Corn stand hinter einer Trauerweide nahe der abgesperrten Lichtung. Lydia bemerkte, dass sie beide wie gebannt auf das Gleiche starrten: den weiß schimmernden Umriss einer Gestalt am Boden, dort, wo man die Leiche des Jungen gefunden hatte. Rund um die Stelle, wo der Kopf eingezeichnet war, befand sich ein dunkler Fleck – altes Blut, wie sie als Krankenschwester sofort erkannte.
»Hier ist es also passiert«, flüsterte sie.
»So isses.« Jesse wischte sich über die Stirn und strich eine herabhängende blonde Haarsträhne zurück. Seine Uniform – die beigefarbene Kluft der Polizei des Paquenoke County – war staubig und zerknittert. Dunkle Schweißflecken breiteten sich unter den Armen aus. Er war dreißig und auf eine jungenhafte Art süß. »Seit wann bist du schon hier?«, fragte sie.
»Weiß ich nicht genau. Seit fünf etwa.«
»Ich hab ein anderes Auto gesehen«, sagte sie. »Droben an der Straße. Ist Jim hier?«
»Nö. Ed Schaeffer. Er is auf der andern Seite vom Fluss.« Jesse deutete mit dem Kopf auf die Blumen. »Die sind hübsch.«
Lydia zögerte einen Moment, dann blickte sie auf die Margeriten, die sie in der Hand hatte. »Zwei neunundvierzig. Hab sie gestern Abend besorgt. Weil ich nicht gewusst habe, ob so früh schon jemand auf hat. Na ja, Dell's vielleicht, aber dort gibt's keine Blumen.« Wieso fing sie an, dummes Zeug zu faseln? Wieder blickte sie sich um. »Keine Spur von Mary Beth?«
Jesse schüttelte den Kopf. »Nicht die geringste.«
»Von ihm auch nicht, soll das vermutlich heißen.«
»Von ihm auch nicht.« Jesse schaute auf seine Uhr. Dann hinaus auf das dunkle Wasser, den dichten Schilfgürtel, das undurchdringliche Gras, den verfaulenden Bootssteg.
Lydia fand es nicht sehr beruhigend, dass ein Bezirks-Deputy, der einen schweren Revolver trug, anscheinend genauso nervös war wie sie selbst. Jesse stieg den mit Gras überwucherten Hang zur Straße hinauf. Er hielt inne, warf einen weiteren Blick auf die Blumen. »Nur zwo neunundneunzig?«
»Zwei neunundvierzig. Bei Food Lion.«
»Das is günstig«, sagte der junge Polizist, während er mit zusammengekniffenen Augen auf das dichte Meer aus Gras blickte. Er wandte sich wieder der Böschung zu. »Ich bin droben beim Streifenwagen.«
Lydia Johansson ging näher zum Tatort. Sie stellte sich Jesus vor und die Engel, und sie betete ein paar Minuten. Sie betete für die Seele von Billy Stail, der erst gestern Morgen an ebendieser Stelle von seiner sterblichen Hülle erlöst worden war. Sie betete darum, dass das Leid, das Tanner's Corner heimgesucht hatte, bald vorübergehen möge.
Sie betete auch für sich.
Wieder drangen Geräusche aus dem Unterholz. Ein Knacken, Geraschel.
Inzwischen war es heller, aber auch bei Sonnenschein wirkte Blackwater Landing nicht viel freundlicher. Der Fluss war hier ziemlich tief, gesäumt von modrigen schwarzen Weiden und dicken Zedern und Zypressen – einige waren abgestorben, andere noch nicht, aber alle mit Moos und den würgenden Ranken der Kupoubohne überwuchert. Im Nordosten, nicht weit von hier, lag der Great Dismal Swamp, und wie alle Expfadfinderinnen im Paquenoke County kannte sie sämtliche alten Sagen um dieses Sumpfgebiet: die Geschichte von der Frau vom See, dem Eisenbahner ohne Kopf... Aber nicht diese Gestalten waren es, die ihr zu schaffen machten; hier, in Blackwater Landing, ging ebenfalls ein Gespenst um – der Junge, der Mary Beth McConnell entführt hatte.
Lydia öffnete ihre Handtasche und zündete sich mit zittrigen Händen eine Zigarette an. Beruhigte sich etwas und spazierte am Ufer entlang. Blieb neben einem Streifen aus hohem Schilf und Rohrkolben stehen, die sich im sengenden Wind bogen.
Sie hörte, wie oben an der Straße ein Auto angelassen wurde. Jesse fuhr doch nicht etwa ab? Beunruhigt blickte Lydia die Böschung hinauf, sah aber, dass der Wagen nicht wegfuhr. Vermutlich lässt er bloß die Klimaanlage laufen, dachte sie. Als sie sich wieder dem Wasser zuwandte, fiel ihr auf, dass die Rohrkolben und das Schilf immer noch wogten, sich bogen, raschelten.
Als ob dort jemand wäre, der sich auf das gelbe Absperrband zubewegte und sich dabei dicht am Boden hielt.
Aber nein, natürlich nicht. Es ist nur der Wind, sagte sie sich. Und andächtig legte sie die Blumen in die Gabel einer knorrigen schwarzen Weide unweit des grausigen Umrisses der Leiche und der Blutlache, die so schwarz war wie das Wasser des Flusses. Wieder setzte sie zu einem Gebet an.
Auf der anderen Seite des Paquenoke lehnte sich Deputy Ed Schaeffer an eine Eiche und achtete nicht auf die Stechmücken, die seine bloßen Arme umschwirrten. Er ging in die Hocke und suchte den Waldboden erneut nach Spuren des Jungen ab.
Er musste sich an einem Ast abstützen; ihm war schwindlig vor Erschöpfung. Wie die meisten Deputys seiner Dienststelle war er seit fast vierundzwanzig Stunden auf den Beinen und suchte nach Mary Beth McConnell und dem Jungen, der sie entführt hatte. Aber während die anderen heimgefahren waren, um sich zu duschen, etwas zu essen und ein paar Stunden zu schlafen, war Ed vor Ort geblieben. Er war der älteste Deputy des Bezirks und der massigste obendrein (einundfünfzig Jahre alt und einhundertzwanzig Kilogramm schwer, größtenteils überflüssiges Fett), aber Müdigkeit, Hunger und steife Glieder hinderten ihn nicht daran, weiter Ausschau nach dem Mädchen zu halten.
Wieder musterte der Deputy den Boden.
Er drückte auf die Sendetaste seines Funkgeräts. »Jesse, ich bin's. Bist du da?«
»Schieß los.«
»Hier sind Fußspuren«, flüsterte er. »Sie sind frisch. Höchstens eine Stunde alt.«
»Meinst du, die sind von ihm?«
»Von wem denn sonst? So früh am Morgen, auf dieser Seite des Paquo?«
»Sieht so aus, als hättest du Recht gehabt«, sagte Jesse Corn. »Ich wollt's ja erst nicht glauben, aber du hast vielleicht doch den Nagel auf den Kopf getroffen.«
Ed war der Meinung gewesen, dass der Junge hierher zurückkommen werde. Nicht wegen des altbekannten Klischees, wonach der Täter stets zum Tatort zurückkehrt, sondern weil Blackwater Landing seit jeher sein Jagdrevier und er in den letzten Jahren immer hierher gekommen war, wenn er in Schwierigkeiten gewesen war.
Ed schaute sich um, ängstlich jetzt, da die Erschöpfung und die Beschwerden verflogen waren. Mit bangem Blick betrachtete er das heillose Gewirr von Blättern, Ranken und Ästen rundum. Herrgott, dachte der Deputy, der Junge ist hier irgendwo. Er sprach wieder in das Funkgerät. »Die Spur führt scheint's in deine Richtung, aber ganz sicher bin ich mir nicht. Er ist hauptsächlich auf dem Laub gelaufen. Sperr die Augen auf. Ich schau nach, woher er gekommen ist.«
Mit knackenden Knien richtete Ed sich auf und folgte den Fußspuren des Jungen so leise, wie es bei seinem Gewicht ging, in die Richtung, aus der sie kamen – tiefer in den Wald hinein, weg vom Fluss.
Nach rund dreißig Metern sah er, dass sie zu einem alten Unterstand führten – einer grauen Hütte, groß genug für drei bis vier Jäger. Die Schießscharten waren dunkel, der Verschlag wirkte leer und verlassen. Okay, dachte er. Okay... Vermutlich ist er nicht da drin. Aber trotzdem.
Schwer atmend zog Ed Schaeffer seine Waffe, was er seit fast anderthalb Jahren nicht mehr getan hatte. Er hielt den Revolver mit schweißnasser Hand und rückte vor, ließ den Blick fortwährend vom Unterstand zum Boden wandern, bedachte jeden Schritt und achtete darauf, dass er sich so lautlos wie möglich näherte.
Hat der Junge eine Schusswaffe?, fragte er sich, als ihm klar wurde, dass er hier so ungedeckt war wie ein Soldat auf freiem Feld. Er stellte sich vor, dass in den Schießscharten da vorn jeden Moment ein Gewehrlauf auftauchen könnte, der auf ihn gerichtet war. Es wurde ihm mulmig zu Mute. Tief geduckt rannte er die letzten fünf Meter, bis er neben der Hütte war. Er drückte sich an das verwitterte Holz, rang mühsam nach Atem und lauschte eine ganze Weile. Drinnen war nichts zu hören, nur das leise Summen von irgendwelchen Insekten.
Okay, sagte er sich. Schau dich um.
Ed raffte sich auf, ehe ihn der Mut verließ, und blickte durch eine Schießscharte.
Niemand da.
Dann schielte er auf den Boden. Er grinste über das ganze Gesicht, als er sah, was dort lag. »Jesse«, rief er aufgeregt in sein Funkgerät.
»Was is?«
»Ich bin bei einem Unterstand, etwa fünfhundert Meter nördlich vom Fluss. Ich glaub, der Junge hat hier übernachtet. Da drin liegen ein paar leere Lebensmittelpackungen und Wasserflaschen. Außerdem eine Rolle Klebeband. Und rat mal, was noch? Eine Landkarte.«
»Eine Karte?«
»Genau. Anscheinend von der Gegend hier. Vielleicht finden wir dadurch raus, wo er Mary Beth hingebracht hat. Was hältst du davon?«
Aber Ed Schaeffer erfuhr nicht mehr, was sein Kollege zu diesem Fahndungserfolg zu sagen hatte. Der Schrei einer Frau schrillte durch den Wald, und Jesse Corns Funkgerät verstummte.
Lydia Johansson torkelte zurück und schrie erneut auf, als der Junge aus dem hohen Schilf sprang und sie mit grobem Griff an den Armen packte.
»Ach du lieber Gott, bitte tu mir nichts!«, bettelte sie.
»Halt's Maul«, fauchte er sie leise an, schaute sich hektisch um, warf ihr einen bösen Blick zu. Er war groß und schlaksig, wie fast alle Jungs in diesen kleinen Städten in Carolina, und er war stark. Seine Haut war rot und verquollen – allem Anschein nach war er in Giftsumach geraten –, und die kurzen stoppeligen Haare sahen aus, als hätte er sie selbst geschnitten.
»Ich hab bloß Blumen hergebracht... das ist alles! Ich hab nicht –«
»Schscht«, murmelte der Junge.
Aber gleichzeitig grub er seine langen, schmutzigen Nägel schmerzhaft in ihren Arm, und Lydia schrie erneut auf. Wütend presste er ihr die Hand auf den Mund. Sie spürte, wie er sich an sie drückte, nahm den säuerlich abgestandenen Schweißgeruch wahr, den er ausströmte.
Sie wandte den Kopf ab. »Du tust mir weh!«, sagte sie mit weinerlicher Stimme.
»Halt den Mund!« Seine Stimme schnappte über, und Speicheltropfen flogen ihr ins Gesicht. Er schüttelte sie wütend wie einen ungehorsamen Hund. Er verlor bei dem Gerangel einen seiner Turnschuhe, aber er achtete nicht darauf, sondern hielt ihr wieder den Mund zu, bis sie sich nicht mehr wehrte.
»Lydia? Wo bist du?«, rief Jesse Corn oben von der Straße aus.
»Schscht«, warnte der Junge sie erneut und sah sie mit weit aufgerissenen Augen und irrem Blick an. »Wenn du schreist, tu ich dir richtig weh. Verstanden? Hast du verstanden?« Er griff in seine Hosentasche und zeigte ihr ein Messer.
Sie nickte.
Er zog sie zum Fluss.
Nein, nicht dorthin. Bitte nicht, flehte sie ihren Schutzengel an. Lass nicht zu, dass er mich dort hinbringt.
Nördlich des Paquo...
Lydia blickte zurück und sah Jesse Corn, der knapp hundert Meter weiter hinten am Straßenrand stand, mit einer Hand die Augen vor der tief stehenden Sonne abschirmte und Ausschau hielt. »Lydia?«, rief er.
Der Junge zerrte sie weiter. »Herrgott, komm schon!«
»Hey!«, schrie Jesse, als er sie endlich sah, und lief die Böschung hinab.
Aber sie waren bereits am Flussufer, wo der Junge einen kleinen Kahn unter Schilf und Gras versteckt hatte. Er schubste Lydia in das Boot und stieß ab, legte sich in die Riemen und ruderte zum anderen Ufer. Er legte an und zerrte sie heraus. Dann schleifte er sie in den Wald.
»Wo willst du hin?«, flüsterte sie.
»Zu Mary Beth. Ich bring dich zu ihr.«
»Wieso?«, wisperte Lydia schluchzend. »Wieso mich?«
Aber er sagte nichts mehr, schnipste nur geistesabwesend mit den Fingernägeln und zog sie mit sich.
»Ed«, meldete sich Jesse Corn über Funk. Er klang verzweifelt. »Er hat Lydia. Er ist mir entwischt.«
»Er hat was?« Keuchend vor Anstrengung, blieb Ed Schaeffer stehen. Er war in Richtung Fluss gerannt, als er den Schrei gehört hatte.
»Lydia Johansson. Sie hat er jetzt auch.«
»Scheiße«, grummelte der schwergewichtige Deputy, der normalerweise ebenso selten fluchte, wie er die Schusswaffe zog. »Warum macht er das?«
»Er spinnt«, sagte Jesse. »Deswegen. Er is über den Fluss und in deine Richtung unterwegs.«
»Okay.« Ed dachte einen Moment lang nach. »Er kommt vermutlich hierher zurück, um das Zeug aus dem Unterstand zu holen. Ich versteck mich drin und schnapp ihn mir, wenn er reinkommt. Hat er eine Knarre?«
»Konnte ich nicht sehen.«
Ed seufzte. »Okay, na schön... Komm rüber, so schnell du kannst. Sag auch Jim Bescheid.«
»Schon passiert.«
Ed ließ die Sendetaste los und blickte durch das Unterholz in Richtung Fluss. Nirgendwo eine Spur von dem Jungen und seinem neuen Opfer. Keuchend rannte Ed zurück zum Unterstand und trat gegen die Tür. Krachend flog sie nach innen auf, und Ed stürmte hinein und kauerte sich vor die Schießscharte.
Er war so aufgeregt und angespannt, so damit beschäftigt, wie er sich den Jungen schnappen wollte, wenn er herkam, dass er zuerst gar nicht auf die zwei, drei kleinen, gelbschwarzen Tupfen achtete, die vor seinem Gesicht hin und her schossen. Oder auf das Kribbeln, das am Nacken einsetzte und sich am Rückgrat entlang nach unten ausbreitete.
Doch dann schlug das Kribbeln in grellen, glühenden Schmerz um, auf den Schultern, entlang der Arme und darunter. »O Gott«, schrie er, sprang hoch und starrte entsetzt auf die schwärmenden Insekten – wild gewordene Hornissen –, die über ihn herfielen. Panisch versuchte er sie abzustreifen, aber damit reizte er die Tiere nur noch mehr. Sie stachen ihn in die Unterarme, in die Hände, in die Fingerspitzen. Er schrie gellend. Es war der schlimmste Schmerz, den er je erlebt hatte – schlimmer als ein Beinbruch, schlimmer als die Verbrennungen, die er sich seinerzeit zugezogen hatte, als er die schmiedeeiserne Pfanne vom Herd genommen hatte, ohne zu bemerken, dass Jane die Kochplatte angelassen hatte.
Dann wurde es dunkel in dem Unterstand, als eine Wolke Hornissen aus dem großen grauen Nest in der Ecke schwärmte, das durch die auffliegende Tür zerquetscht worden war. Zu Hunderten fielen sie über ihn her. Sie hängten sich in seine Haare, ließen sich auf seinen Armen nieder, in seinen Ohren, krabbelten unter sein Hemd und in die Hosenbeine, als ob sie wüssten, dass es sinnlos war, durch die Kleidung zu stechen, und die bloße Haut suchten. Er stürmte zur Tür, riss das kurzärmlige Uniformhemd herunter und sah voller Entsetzen, dass sich Massen von glänzenden Leibern an seine Brust, seinen Bauch klammerten. Er versuchte gar nicht mehr, sie abzustreifen, sondern rannte einfach los, in den Wald hinein.
»Jesse, Jesse, Jesse!«, schrie er, bis ihm klar wurde, dass er nur ein Flüstern hervorbrachte, dass seine Kehle wegen der Stiche an seinem Hals wie zugeschnürt war.
Lauf, sagte er sich. Lauf zum Fluss.
Und er rannte los. Er rannte so schnell, wie er in seinem ganzen Leben noch nicht gerannt war, brach mit weit ausholenden Schritten durch den Wald. Weiter... lauf weiter, befahl er sich. Bleib nicht stehen. Häng die Mistviecher ab. Denk an deine Frau, denk an die Zwillinge. Weiter, weiter, weiter... Jetzt umschwärmten ihn deutlich weniger Insekten, aber immer noch hingen dreißig oder vierzig von den Biestern an ihm, und er sah, wie sie die gelbschwarzen Hinterleiber krümmten, um ihn erneut zu stechen.
In drei Minuten bin ich am Fluss. Ich springe ins Wasser. Ersäufe sie. Ich komme durch... Lauf! Achte nicht auf die Schmerzen... die Schmerzen... Wie können so kleine Tiere so große Schmerzen verursachen? Ach, tut das weh...
Er rannte wie ein Vollblutpferd, brach durchs Unterholz, das dunstig und verschwommen an seinen tränennassen Augen vorüberhuschte.
Er –
Aber Moment mal, Moment. Was war da los? Ed Schaeffer blickte nach unten und stellte fest, dass er überhaupt nicht rannte. Er stand nicht einmal aufrecht. Er lag am Boden, nur knapp zehn Meter von dem Unterstand entfernt, und trat hilflos mit den Beinen um sich.
Er tastete nach seinem Funkgerät, und obwohl sein Daumen durch das Gift zu doppelter Größe angeschwollen war, schaffte er es, die Sendetaste zu drücken. Doch dann griffen die Krämpfe, die in seinen Beinen eingesetzt hatten, auf den Körper, den Hals und die Arme über, und er ließ das Walkie-Talkie fallen. Einen Moment lang hörte er Jesse Corns Stimme aus dem Lautsprecher, und als sie abbrach, vernahm er nur noch das durchdringende Summen der Hornissen, das allmählich abschwoll, leiser wurde und schließlich verstummte.
...Zwei
Nur Gott konnte ihn heilen. Und Gott ließ sich nicht dazu herab.
Nicht dass es darauf angekommen wäre, denn Lincoln Rhyme war eher den Wissenschaften denn der Theologie zugetan, und daher hatte er sich nicht nach Lourdes, Turin oder in das Missionszelt eines eifernden Wunderheilers begeben, sondern hierher, in diese Klinik in North Carolina, wo er zumindest einen Teil seiner Bewegungsfähigkeit wiederzuerlangen hoffte.
Jetzt fuhr Rhyme mit seinem motorisierten Storm-Arrow-Rollstuhl, rot wie eine rassige Corvette, von der Hebebühne des Kleinbusses, in dem er, sein Betreuer und Amelia Sachs soeben fünfhundert Meilen zurückgelegt hatten – von Manhattan bis hierher. Mit der Strohhalmsteuerung, die zwischen seinen gutgeformten Lippen steckte, wendete er das Gefährt gekonnt, rollte auf den Gehsteig und auf den Eingang des Neurologischen Forschungsinstituts am Klinikum der University of North Carolina in Avery zu.
Thom zog die Hebebühne des glänzend schwarzen Chrysler Grand Rollx ein, eines eigens für den Transport des Rollstuhls ausgerüsteten Kleinbusses.
»Stell ihn auf einem Behindertenparkplatz ab«, rief Rhyme und lachte.
Amelia Sachs wandte sich mit hochgezogener Augenbraue an Thom. »Gut gelaunt«, sagte der. »Nutz es aus. Das hält nicht lange an.«
»Ich habe es gehört«, rief Rhyme.
Der Betreuer fuhr weg, und Sachs ging zu Rhyme. Sie hatte ihr Handy am Ohr, hing in der Warteschleife einer hiesigen Mietwagenfirma. Thom würde sich nächste Woche vermutlich vorwiegend in Rhymes Krankenzimmer aufhalten, und Sachs wollte über ihre Zeit frei verfügen können, vielleicht ein bisschen die Gegend erkunden. Außerdem stand sie auf Sportwagen, nicht auf Kleinbusse, und hatte aus Prinzip nichts für Fahrzeuge übrig, die nicht mal hundert Meilen pro Stunde schafften.
Sachs hing schon seit fünf Minuten in der Leitung, und schließlich unterbrach sie wütend die Verbindung. »Das Warten würde mir ja nichts ausmachen, aber die Dudelmusik ist furchtbar. Ich probier's später noch mal.« Sie schaute auf ihre Uhr. »Erst halb elf. Aber diese Hitze ist zu krass. Ich meine, viel zu krass.« Manhattan ist im August nicht unbedingt der angenehmste aller Orte, aber es liegt viel weiter nördlich als North Carolina, und als sie gestern aus der großen Stadt via Holland Tunnel Richtung Süden aufgebrochen waren, hatte die Temperatur bei knapp über zwanzig Grad gelegen, und die Luft war salztrocken gewesen.
Rhyme schenkte der Hitze keinerlei Beachtung. Er hatte einzig und allein seine Operation im Sinn. Gehorsam schwang die automatische Tür vor ihnen auf (das hier, vermutete er, musste das Tiffany's unter den behindertengerechten Einrichtungen sein), und sie begaben sich in den kühlen Korridor. Während Sachs nach dem Weg fragte, blickte sich Rhyme im Foyer um. Er bemerkte ein halbes Dutzend dicht an dicht stehender Rollstühle, alle eingestaubt. Er fragte sich, was aus den Benutzern geworden war. Vielleicht war die Behandlung so erfolgreich gewesen, dass sie ihre Gefährte ausrangiert hatten und auf Gehhilfen und Krücken umgestiegen waren. Vielleicht hatte sich bei einigen der Zustand so weit verschlechtert, dass sie ans Bett gefesselt oder auf motorisierte Rollstühle angewiesen waren.
Vielleicht waren ein paar gestorben.
»Hier lang«, sagte Sachs und und wies auf das andere Ende des Foyers. Thom stieß beim Fahrstuhl zu ihnen (breite Doppeltür, Handläufe, die Knöpfe knapp einen Meter über dem Boden), und ein paar Minuten später fanden sie die gesuchte Zimmerflucht. Rhyme rollte zur Tür und bemerkte die Freisprechanlage. »Sesam, öffne dich«, sagte er mit Bassstimme, und die Tür tat sich auf.
»Das kriegen wir hier öfter zu hören«, bemerkte die kesse Sekretärin, als sie eintraten. »Sie müssen Mr. Rhyme sein. Ich sag der Frau Doktor, dass Sie da sind.«
Dr. Cheryl Weaver war eine schlanke, elegante Mittvierzigerin. Rhyme fiel sofort auf, dass ihre Augen flink und ihre Hände kräftig waren, wie es sich für einen Chirurgen gehörte. Ihre Nägel waren kurz geschnitten und nicht lackiert. Sie erhob sich von ihrem Schreibtisch, lächelte und schüttelte Sachs und Thom die Hand, nickte ihrem Patienten zu. »Lincoln.«
»Doktor.« Rhyme musterte die zahllosen Buchrücken auf den Regalen. Dann die -zig Zeugnisse und Diplome – alle von guten Universitäten und anerkannten Institutionen, doch das verwunderte ihn nicht weiter. Nach monatelangen Recherchen war er zu der Überzeugung gelangt, dass die Universitätsklinik von Avery eines der besten Krankenhäuser der Welt war. Die Onkologie und die Immunologie zählten zu den bestausgelasteten Abteilungen ihrer Art im ganzen Land, und Dr. Weavers neurologisches Institut galt bei der Erforschung und Behandlung von Rückenmarksverletzungen als wegweisend.
»Ich freue mich, Sie endlich kennen zu lernen«, sagte die Ärztin. Unter ihrer Hand lag ein fast zehn Zentimeter dicker brauner Aktenordner. Der meine, mutmaßte Rhyme. (Und er fragte sich unwillkürlich, was in dieser Akte unter dem Stichwort »Prognose« eingetragen war –»viel versprechend«, »schlecht«, »hoffnungslos«?) »Lincoln, wir haben uns ja schon ein paarmal am Telefon unterhalten. Aber ich möchte die Sache noch einmal gründlich mit Ihnen durchgehen. Uns beiden zuliebe.«
Rhyme nickte kurz und knapp. Er war durchaus bereit, gewisse Formalitäten über sich ergehen zu lassen, hatte aber keine Lust auf irgendwelche rechtlichen Absicherungen. Und genau danach klang dies hier.
»Bestimmt haben Sie die Veröffentlichungen über unser Institut gelesen. Und daher wissen Sie auch, dass wir uns hier an der Erprobung neuer Methoden zur Regeneration und Rekonstruktion des Rückenmarks versuchen. Aber ich muss erneut betonen, dass dies noch rein experimentell ist.«
»Das ist mir bewusst.«
»Die meisten Querschnittsgelähmten, die ich bislang behandelt habe, verstanden mehr von Neurologie als jeder praktische Arzt. Und ich wette, Sie sind da keine Ausnahme.«
»Wenn man wissenschaftlich ein bisschen bewandert ist«, sagte Rhyme abschätzig, »weiß man auch medizinisch halbwegs Bescheid.« Und er bedachte sie mit seinem typischen Achselzucken, einer Geste, die Dr. Weaver offensichtlich zur Kenntnis nahm und sich für die Krankenakte notierte.
»Nun gut«, fuhr sie fort, »entschuldigen Sie, wenn ich das eine oder andere wiederhole, was Sie bereits wissen, aber Sie müssen sich darüber im Klaren sein, was sich mit dieser Methode bewerkstelligen lässt und was nicht.«
»Bitte«, sagte Rhyme. »Nur zu.«
»Wir an diesem Institut konzentrieren uns ganz auf die betroffene Stelle. Wir setzen die herkömmliche Operationsmethode zur Druckentlastung ein, um die Knochenstruktur des Rückenwirbels zu rekonstruieren und die geschädigte Stelle zu schützen. Dann injizieren wir zweierlei in die betroffene Stelle. Einerseits peripheres Nervengewebe des Patienten. Zum anderen Frischzellen aus dem zentralen Nervensystem von gewissen Embryonen, die –«
»Ah, da kommt der Hai ins Spiel«, sagte Rhyme.
»Ganz recht. Der Blauhai, ja.«
»Lincoln hat uns davon berichtet«, sagte Sachs. »Wieso vom Hai?«
»Aus immunologischen Gründen, wegen der Verträglichkeit mit menschlichem Gewebe. Außerdem«, fügte die Ärztin lachend hinzu, »ist es ein verdammt großer Fisch, sodass wir aus einem eine ganze Menge Embryonalgewebe gewinnen können.«
»Wieso Embryonen?«, fragte Sachs.
»Weil sich das zentrale Nervensystem von Erwachsenen auf natürliche Weise nicht mehr regeneriert«, grummelte Rhyme, unwirsch ob der Unterbrechung. »Es versteht sich doch von selbst, dass das Nervensystem eines Babys wachsen muss.«
»Genau. Danach, neben dem Eingriff zur Druckentlastung und der Gewebeverpflanzung, kommt noch etwas – und eben darüber sind wir so begeistert: Wir haben ein paar neue Medikamente entwickelt, die die Aussichten auf eine Regeneration unserer Meinung nach entscheidend verbessern könnten.«
»Gibt es Risiken?«, fragte Sachs.
Rhyme schaute zu ihr in der Hoffnung, ihrem Blick zu begegnen. Er kannte die Risiken. Er hatte seine Entscheidung getroffen. Er wollte nicht, dass sie seine Ärztin ausfragte. Aber Sachs war ganz und gar auf Dr. Weaver konzentriert. Rhyme kannte ihre Miene – so sah sie aus, wenn sie ein Tatortfoto musterte.
»Natürlich gibt es Risiken. Die Medikamente an sich sind nicht besonders gefährlich. Aber bei jedem C4-Querschnittsgelähmten kommt es zu einer Beeinträchtigung der Lungentätigkeit. Sie werden nicht mehr künstlich beatmet, aber durch das Anästhetikum besteht die Gefahr einer respiratorischen Insuffizienz. Der Stress bei dem Eingriff könnte zu einer Dysregulation des autonomen Nervensystems führen, mit der Folge, dass der Blutdruck gefährlich ansteigt – damit sind Sie sicher vertraut –, was wiederum zu einem Schlaganfall oder zu einem anderen zerebralen Ereignis führen könnte. Außerdem besteht die Gefahr eines Operationstraumas an der betroffenen Stelle – Sie haben derzeit keine Zysten und keine Shunts, aber durch die Operation und die daraus resultierende Flüssigkeitsbildung könnte der Druck zunehmen und zusätzliche Schädigungen verursachen.«
»Soll heißen, sein Zustand könnte sich verschlechtern?«, fragte Sachs.
Dr. Weaver nickte und schaute auf die Akte, offensichtlich, um ihr Gedächtnis aufzufrischen, obwohl sie den Ordner nicht aufschlug. Sie blickte auf. »Lincoln kann einen Lumbricalis bewegen – den Ringfinger der linken Hand –, und er beherrscht seine Hals- und Schultermuskulatur. All das oder manches davon könnte verloren gehen. Und die Fähigkeit, aus eigener Kraft zu atmen.«
Sachs blieb völlig ruhig. »Aha«, sagte sie schließlich, und es klang wie ein angespanntes Aufseufzen.
Die Ärztin blickte Rhyme unverwandt an. »Und diese Risiken müssen Sie gegen das abwägen, was Sie sich von dem Eingriff versprechen – Sie werden nicht in der Lage sein, wieder zu gehen, falls Sie sich das erhoffen sollten. Derartige Eingriffe haben bei Rückenmarksverletzungen im lumbalen und thorakalen Bereich einige begrenzte Erfolge erbracht – bei Brust- und Lendenwirbelverletzungen also, die weitaus tiefer liegen und weit weniger schwer sind als Ihre. Bei zervikalen Schäden zeitigten sie nur geringen Erfolg und bei einem C4-Trauma überhaupt keinen.«
»Ich bin eine Spielernatur«, sagte er rasch. Sachs warf ihm einen bedrückten Blick zu. Denn sie wusste, dass Rhyme überhaupt kein Spieler war. Er war ein Wissenschaftler, der sein Leben nach messbaren, nachweislich belegten Prinzipien ausrichtete. »Ich möchte mich operieren lassen«, fügte er schlicht hinzu.
Dr. Weaver nickte, wirkte weder erfreut noch verstimmt ob seiner Entscheidung. »Sie müssen etliche Untersuchungen über sich ergehen lassen, die mehrere Stunden in Anspruch nehmen werden. Der Eingriff ist für übermorgen angesetzt. Ich habe etwa tausend Formulare und Fragebogen für Sie. Ich bin gleich mit dem Papierkram zurück.«
Sachs erhob sich und verließ hinter der Ärztin das Zimmer. Rhyme hört sie sagen: »Doktor, ich habe eine...« Dann fiel die Tür ins Schloss.
»Verschwörung«, grummelte Rhyme Thom zu. »Meuterei in den eigenen Reihen.«
»Sie macht sich Sorgen um dich.«
»Sorgen? Diese Frau fährt hundertfünfzig Meilen die Stunde und spielt in der South Bronx die Revolverheldin. Ich bekomme schließlich Babyfischzellen gespritzt.«
»Du weißt genau, was ich sagen will.«
Rhyme warf unwirsch den Kopf zurück. Sein Blick wanderte zu einer Ecke von Dr. Weavers Zimmer, wo eine Wirbelsäule – eine echte vermutlich – auf einem Metallständer ruhte. Sie wirkte viel zu zerbrechlich für den komplizierten menschlichen Körper, den sie einst getragen hatte.
Die Tür ging auf, und Sachs trat in das Büro. Jemand kam hinter ihr herein, aber es war nicht Dr. Weaver. Der Mann war groß und schlank, abgesehen von einem leichten Bauchansatz, und trug die braune Uniform eines Bezirkssheriffs. »Du hast Besuch«, sagte Sachs mit ernster Miene.
Als er Rhyme sah, nahm der Mann seinen breitkrempigen Hut ab und nickte. Er ließ den Blick kurz über Rhymes Körper wandern, wie die meisten Menschen, die ihm zum ersten Mal begegneten, sah dann aber sofort zu der Wirbelsäule auf dem Stativ hinter Dr. Weavers Schreibtisch. Dann wieder zu Rhyme. »Mr. Rhyme. Ich bin Jim Bell. Roland Bells Cousin. Er hat mir erzählt, dass Sie hierher kommen, und deshalb bin ich von Tanner's Corner herübergefahren.«
Roland war beim New York Police Department und hatte mit Rhyme mehrere Fälle bearbeitet. Derzeit war er der Partner von Lon Sellitto, einem Kriminalpolizisten, den Rhyme seit Jahren kannte. Roland hatte Rhyme die Namen einiger Verwandter genannt, die er anrufen sollte, falls er Besuch haben wollte, während er zur Operation in North Carolina weilte. Jim Bell war, wie Rhyme sich erinnerte, einer von ihnen. »Freut mich, Sie kennen zu lernen«, sagte Rhyme geistesabwesend, während er am Sheriff vorbei zur Tür blickte, durch die Dr. Weaver, sein gnädiger Engel, zurückkehren musste.
Bell schenkte ihm ein grimmiges Lächeln. »Ehrlich gesagt, Sir, ich weiß nicht, ob Sie lange dieser Meinung sein werden.«
...Drei
Es gab eine gewisse Ähnlichkeit, wie Rhyme feststellen konnte, als er den Besucher genauer betrachtete.
Die gleiche schlanke Gestalt, die langen Hände und das schüttere Haar, die gleiche umgängliche Art wie sein Cousin Roland in New York. Dieser Bell hier wirkte bräuner und markiger. Vermutlich ging er oft zum Angeln und auf die Jagd. Ein Stetson hätte ihm besser gestanden als der Sheriffhut. Bell nahm auf einem Stuhl neben Thom Platz.
»Wir haben ein Problem, Mr. Rhyme.«
»Nennen Sie mich Lincoln. Bitte.«
»Nur zu«, sagte Sachs zu Bell. »Erzählen Sie ihm, was Sie mir erzählt haben.«
Rhyme warf Sachs einen kühlen Blick zu. Sie hatte diesen Mann vor drei Minuten kennen gelernt, und schon standen sie auf vertrautem Fuß miteinander.
»Ich bin Sheriff des Paquenoke County. Das liegt etwa zwanzig Meilen östlich von hier. Wir haben da einen Fall am Hals, und ich musste an etwas denken, was mir mein Cousin erzählt hat – er spricht in den höchsten Tönen von Ihnen, Sir...«
Rhyme nickte unwirsch, damit er fortfuhr, und dachte: Wo, zum Teufel, ist meine Ärztin? Wie viele Formulare muss sie denn noch hervorwühlen? Ist sie auch an dieser Verschwörung beteiligt?
»Jedenfalls, dieser Fall... Ich dachte, ich schau mal vorbei und frag Sie, ob Sie ein bisschen Zeit für uns erübrigen könnten.«
Rhyme lachte, doch er klang nicht im mindesten amüsiert. »Ich stehe kurz vor einer Operation.«
»Oh, ich weiß schon. Ich möchte Ihnen da auf keinen Fall dazwischenfunken. Ich dachte bloß an ein paar Stunden... Wir brauchen keine große Hilfe, hoffe ich jedenfalls. Sehen Sie, mein Cousin Rol hat mir ein paar Dinge erzählt, die Sie bei Ihren Ermittlungen oben im Norden gemacht haben. Wir haben in unserem Polizeilabor eine gewisse Grundausstattung, aber der Großteil der forensischen Arbeit hier in der Gegend läuft über Elizabeth City – dort sitzt die nächste Dienststelle der Staatspolizei – oder Raleigh. Dauert wochenlang, bis wir von dort ein Ergebnis bekommen. Wir haben aber nicht wochenlang Zeit. Nur ein paar Stunden. Bestenfalls.«
»Wozu?«
»Um zwei Mädchen zu finden, die entführt worden sind.«
»Für Entführungen ist der Bund zuständig«, bedeutete ihm Rhyme. »Rufen Sie das FBI an.«
»Ich weiß nicht mal mehr, wann wir zum letzten Mal einen Bundesagenten im Bezirk hatten, von den Jungs vom ATF mal abgesehn, die gegen die Schwarzbrenner vorgehen. Bis jemand vom FBI hier runterkommt und mit der Suche anfängt, sind die Mädchen tot.«
»Erzählen Sie uns, was passiert ist«, sagte Sachs. Sie hatte ihre interessierte Miene aufgesetzt, wie Rhyme spöttisch – und voller Missvergnügen – festellte.
»Gestern wurde einer von unseren Oberschülern ermordet und eine Studentin entführt«, sagte Bell. »Heute Morgen ist der Täter zurückgekommen und hat noch ein Mädel gekidnappt.« Rhyme bemerkte, dass der Mann dunkelrot anlief. »Er hat eine Falle gelegt, und einer meiner Deputys wurde schwer verletzt. Er liegt hier im Klinikum, im Koma.«
Rhyme sah, dass Sachs aufgehört hatte, mit den Fingernägeln in ihren Haaren herumzuwühlen und sich die Kopfhaut zu kratzen, und Bell ihre ganze Aufmerksamkeit widmete. Nun ja, vielleicht steckten sie nicht unter einer Decke, aber Rhyme wusste genau, warum ihr so viel an einem Fall gelegen war, für den sie keine Zeit hatten. Und der Grund dafür passte ihm überhaupt nicht. »Amelia«, setzte er an und warf einen kühlen Blick zu der Uhr an der Wand von Dr. Weavers Büro.
»Wieso nicht, Rhyme? Was kann es schon schaden?« Sie zog die langen roten Haare von ihrer Schulter, auf die sie wie ein Wasserfall wogten.
Bell warf noch einen Blick auf die Wirbelsäule in der Ecke. »Wir sind eine kleine Dienststelle, Sir. Wir haben getan, was wir konnten – meine sämtlichen Deputys und ein paar andere Leute waren die ganze Nacht unterwegs, aber wir konnten ihn oder Mary Beth einfach nicht finden. Wir glauben, dass Ed – der Deputy, der im Koma liegt – eine Karte gesehen hat, auf der womöglich eingezeichnet ist, wohin der Junge gegangen sein könnte. Aber die Ärzte wissen nicht, wann und ob er wieder zu sich kommt.« Mit beschwörendem Blick wandte er sich wieder an Rhyme. »Wir wären Ihnen sehr zu Dank verpflichtet, wenn Sie mal einen Blick auf die Spuren werfen würden, die wir gefunden haben, und uns einen Anhaltspunkt geben könnten, wo der Junge abgeblieben ist. Wir wissen nicht mehr weiter. Ich brauche unbedingt Unterstützung.«
Doch Rhyme verstand gar nichts. Ein Kriminalist ist dazu da, Spuren und Beweismittel auszuwerten, den Ermittlern dabei zu helfen, einen Verdächtigen zu überführen, und dann beim Prozess gegen ihn auszusagen. »Sie wissen, wer der Täter ist, Sie wissen, wo er wohnt. Ihr Staatsanwalt hat einen absolut wasserdichten Fall an der Hand.« Selbst wenn sie bei der Untersuchung des Tatorts gepatzt hatten – und Kleinstadtpolizisten war diesbezüglich allerhand zuzutrauen –, sollten jede Menge Beweise vorliegen, die für eine Verurteilung ausreichen müssten.
»Nein, nein – wegen dem Prozess machen wir uns keine Sorgen, Mr. Rhyme. Es geht darum, dass wir sie finden, bevor er die Mädchen umbringt. Oder zumindest Lydia, Mary Beth ist womöglich schon tot. Sehen Sie, als die Sache passierte, hab ich im Handbuch der Staatspolizei über die Ermittlungen bei Kapitalverbrechen nachgeblättert. Dort heißt es, dass man bei einer Entführung mit sexuellem Hintergrund normalerweise vierundzwanzig Stunden Zeit hat, um das Opfer zu finden – danach betrachtet es der Kidnapper nicht mehr als menschliches Wesen und zögert nicht, es zu töten.«
»Sie haben ihn als Jungen bezeichnet«, sagte Sachs. »Wie alt ist er?«
»Sechzehn.«
»Ein Jugendlicher also.«
»Rein rechtlich«, sagte Bell. »Aber er hat mehr auf dem Kerbholz als die meisten unserer erwachsenen Taugenichtse.«
»Haben Sie seine Angehörigen überprüft?«, fragte sie, als wäre es bereits beschlossene Sache, dass sie und Rhyme den Fall übernahmen.
»Die Eltern sind tot. Er hat Pflegeeltern. Wir sind bei ihnen gewesen und haben sein Zimmer durchsucht. Haben weder geheime Falltüren noch Tagebücher oder so gefunden.«
Ist doch nie der Fall, dachte Rhyme, der sich sehnlichst wünschte, dass dieser Mann mitsamt seinem Anliegen wieder in diesen Bezirk mit dem unaussprechlichen Namen abschwirren möge.
»Ich glaube, wir sollten das machen, Rhyme«, sagte Sachs.
»Sachs, die Operation...«
»Zwei Opfer in zwei Tagen?«, sagte sie. »Es könnte sich um einen Serientäter handeln.« Serientäter sind wie Süchtige. Um ihr steigendes Verlangen nach Gewalt zu befriedigen, begehen sie in immer kürzerem Zeitabstand immer schwerere Taten.
Bell nickte. »Ganz genau. Und es gibt da ein paar Sachen, die ich noch gar nicht erwähnt habe. In den letzten zwei Jahren gab es im Paquenoke County drei weitere Todesfälle, dazu einen fragwürdigen Selbstmord, der sich erst vor ein paar Tagen ereignet hat. Wir glauben, dass der Junge womöglich hinter all dem steckt. Wir haben bloß nicht genug Beweise gefunden, um ihn einzusperren.«
Ich habe diese Fälle ja auch nicht bearbeitet, oder?, dachte Rhyme, ehe er sich darauf besann, dass der Stolz die Todsünde war, die ihn vermutlich ins Verderben stürzen würde.
Wider Willen stellte er fest, dass er bereits angebissen hatte, dass ihn dieser Fall faszinierte, weil er so rätselhaft war. Wenn er seither, nach dem Unfall, nicht den Verstand verloren hatte – wenn er sich nicht mehr nach Sterbehelfern vom Schlage eines Jack Kevorkian umtat –, dann nur wegen geistiger Herausforderungen dieser Art.
»Die Operation ist doch erst übermorgen«, setzte Sachs nach. »Und bis dahin musst du nur ein paar Untersuchungen durchführen lassen.«
Ach, Sachs, deine Hintergedanken sind offensichtlich...
Aber ihr Einwand war nicht schlecht. Bis zu dem Eingriff musste er viel Zeit totschlagen. Und all das vor einer Operation – was wiederum hieß, dass er ohne achtzehn Jahre alten Scotch auskommen musste. Was sollte ein Querschnittsgelähmter in einer Kleinstadt in North Carolina überhaupt anstellen? Lincoln Rhymes größter Feind waren nicht die Krämpfe, die Phantomschmerzen oder die Dysregulationen, die jedem Rückenmarkspatienten zusetzten – es war die Langeweile.
»Meinetwegen einen Tag«, sagte Rhyme schließlich. »Solange die Operation nicht verzögert wird. Ich stehe wegen dieses Eingriffs schon seit vierzehn Monaten auf der Warteliste.«
»Einverstanden, Sir«, sagte Bell. Er wirkte sichtlich erleichtert.
Aber Thom schüttelte den Kopf. »Hör mal, Lincoln, wir sind nicht hier, um zu arbeiten. Wir sind hier, damit du dich operieren lässt, und danach reisen wir wieder ab. Ich habe nicht annähernd die Geräte, die ich brauche, wenn du arbeiten willst.«
»Wir sind in einer Klinik, Thom. Es würde mich nicht wundern, wenn der Großteil dessen, was du brauchst, vorhanden ist. Wir sprechen mit Dr. Weaver. Sie hilft uns bestimmt gern.«
Der Betreuer, wie üblich tadellos gekleidet, mit weißem Hemd, gebügelter brauner Hose und Schlips, sagte: »Damit das klar ist – ich halte davon überhaupt nichts.«
Doch Lincoln Rhyme ging es wie jedem Jäger, auch wenn er sich nicht bewegen konnte – sobald er sich dazu entschlossen hatte, einer Beute nachzustellen, konnte ihn nichts mehr davon abhalten. Ohne auf Thom zu achten, begann er Jim Bell auszufragen. »Wie lange ist er schon auf der Flucht?«
»Erst seit zwei Stunden«, antwortete Bell. »Ich lasse von einem Deputy die Beweisstücke rüberbringen, die wir gefunden haben, und dazu vielleicht noch eine Karte von der Gegend. Ich hab gedacht...«
Aber Bell verstummte, als Rhyme den Kopf schüttelte und die Stirn runzelte. Sachs musste sich ein Grinsen verkneifen. Sie wusste, was jetzt kam.
»Nein«, sagte Rhyme entschieden. »Wir kommen zu Ihnen. Sie müssen uns irgendwo bei sich unterbringen. Wie heißt die Stadt noch mal?«
»Äh, Tanner's Corner.«
»Bringen Sie uns irgendwo unter, wo wir arbeiten können. Außerdem brauche ich einen Assistenten... Haben Sie in Ihrer Dienststelle ein Labor?«
»Bei uns?«, fragte der Sheriff verdutzt. »Wohl kaum.«
»Na schön, wir stellen Ihnen eine Liste mit den Geräten auf, die wir benötigen. Sie können sich die Sachen von der Staatspolizei ausborgen.« Rhyme blickte zur Uhr. »In einer halben Stunde können wir da sein. Stimmt's, Thom?«
»Lincoln...«
»Stimmt's?«
»In einer halben Stunde«, murmelte Thom schicksalsergeben.
Wer war hier schlecht gelaunt?
»Hol die Formulare von Dr. Weaver. Nimm sie mit. Du kannst sie ausfüllen, während Sachs und ich arbeiten.«
»Okay, okay.«
Sachs stellte eine Liste mit der technischen Grundausstattung für ein Kriminallabor zusammen. Sie hielt sie hoch, damit Rhyme sie lesen konnte. Er nickte. »Füge einen Dichtegradienten dazu. Ansonsten ist sie in Ordnung.«
Sie schrieb das Gerät auf die Liste und reichte sie Bell. Er las sie, nickte unsicher. »Das lässt sich sicher machen. Aber ich will wirklich nicht, dass Sie sich zu viel Mühe –«
»Jim, ich hoffe, ich kann offen mit Ihnen sprechen.«
»Klar.«
»Es bringt überhaupt nichts«, sagte Rhyme mit gesenkter Stimme, »wenn wir uns nur ein paar wenige Spuren vornehmen. Wenn die Sache laufen soll, müssen Amelia und ich die Fahndung leiten. Und zwar in vollem Umfang. Sagen Sie mir ganz offen, ob wir damit irgendjemandem ins Gehege kommen.«
»Ich sorge dafür, dass es nicht der Fall sein wird«, sagte Bell.
»Gut. Und jetzt sollten Sie sich lieber um die Geräte kümmern. Wir müssen uns ranhalten.«
Und Sheriff Bell stand einen Moment lang da und nickte, den Hut in der einen Hand, Sachs' Liste in der anderen, ehe er sich zur Tür begab. Rhyme meinte sich zu entsinnen, dass Cousin Roland, ein Mann, der viele typische Redensarten aus dem Süden parat hatten, einen Ausdruck gebrauchte, der bestens zu der Miene des Sheriffs passte. Rhyme konnte sich nicht mehr an den genauen Wortlaut erinnern, aber es hatte mit einem Bären zu tun, den man am Schwanz gepackt hatte.
»Ach, noch eins«, sagte Sachs an Bell gewandt. Er blieb in der Tür stehen und drehte sich um. »Der Täter? Wie heißt er?«
»Garrett Hanlon. Aber in Tanner's Corner wird er nur der Insektensammler genannt.«
Das Paquenoke County ist ein kleiner Bezirk im Nordosten von North Carolina. Tanner's Corner, die größte Stadt, liegt etwa in der Mitte des Bezirks und ist von etlichen kleineren, noch nicht eingemeindeten Wohn- und Gewerbegebieten umgeben, darunter auch Blackwater Landing, das ein paar Meilen nördlich des Verwaltungssitzes unmittelbar an den Fluss Paquenoke – von den meisten Einheimischen nur Paquo genannt – angrenzt.
Südlich des Flusses befindet sich der Großteil der Wohn- und Einkaufsgegenden des Bezirks. Die Landschaft dort ist geprägt von Mooren, lichten Wäldern, Feldern und Teichen. Fast alle Einwohner leben in diesem Teil. Nördlich des Paquo wiederum ist das Land trügerisch. Der Great Dismal Swamp hat Wohnwagenparks und Häuser sowie die wenigen Mühlen und Fabriken auf dieser Seite des Flusses verschlungen. Wo sich einst Felder und Teiche befunden hatten, erstreckten sich nun verzweigte Sumpfgebiete, und die Wälder, zumeist uralt, waren undurchdringlich, es sei denn, man hatte Glück und fand einen Pfad. Niemand lebt auf dieser Seite des Flusses, von Schwarzbrennern, Drogenbrauern und ein paar verrückten Sumpfbewohnern einmal abgesehen. Selbst Jäger meiden für gewöhnlich die Gegend, seit Tal Harper vor zwei Jahren von wilden Schweinen angefallen und, obwohl er das halbe Rudel erschossen hatte, verspeist worden war, ehe ihm jemand zu Hilfe kommen konnte.
Wie die meisten Menschen im Bezirk begab sich Lydia Johansson nur selten auf die Nordseite des Paquo, und wenn, dann entfernte sie sich nicht allzu weit von der nächsten Siedlung. Umso verzweifelter war sie nun, da ihr bewusst wurde, dass sie beim Überqueren des Flusses die Grenze zu einem Gebiet überschritten hatte, aus dem sie womöglich nie mehr zurückkehrte – eine Grenze nicht nur in geographischer Hinsicht, sondern auch im übertragenen Sinn.
Natürlich war sie entsetzt, weil sie von dieser Kreatur verschleppt wurde – ihr graute vor den Blicken, mit denen er sie musterte, vor seiner Berührung, und sie hatte panische Angst davor, einen Hitzschlag zu erleiden oder von einer Schlange gebissen zu werden –, aber am schlimmsten waren die Gedanken an das, was sie auf der Südseite des Flusses zurückgelassen hatte: all die kleinen Annehmlichkeiten ihres Lebens, so bescheiden sie auch sein mochten, die wenigen Freunde und Kolleginnen in der Klinik, die Ärzte, mit denen sie vergebens flirtete, die Pizzapartys, die Seinfeld-Wiederholungen im Fernsehen, ihre Horrorromane, Eiscreme, die Kinder ihrer Schwester. Selbst die düsteren Seiten ihres Daseins kamen ihr jetzt geradezu verlockend vor – der ewige Kampf mit den Pfunden, die mühseligen Versuche, das Rauchen aufzugeben, die einsamen Nächte, das endlose Warten auf einen Anruf von dem Mann, mit dem sie sich gelegentlich traf (sie bezeichnete ihn als ihren »Freund«, doch sie wusste, dass dies lediglich Wunschdenken war)... Selbst danach sehnte sie sich jetzt, weil es einfach etwas Vertrautes war.
Aber hier gab es nichts, weder Trost noch Annehmlichkeiten.
Sie musste an den schrecklichen Anblick bei dem Jägerunterstand denken – wie Deputy Ed Schaeffer bewusstlos dagelegen hatte, Arme und Gesicht durch die Hornissenstiche bis zur Unkenntlichkeit angeschwollen. »Er hätte ihnen nichts tun sollen«, hatte Garrett gemurmelt. »Hornissen greifen nur an, wenn ihr Nest in Gefahr ist. Es war seine Schuld.« Langsam war er hineingegangen, ohne dass ihn die Insekten behelligten, und hatte ein paar Sachen geholt. Er hatte ihr die Hände mit Klebeband vor dem Körper gefesselt und sie dann in den Wald geführt, durch den sie jetzt schon etliche Meilen marschierten.
Der Junge stellte sich sonderbar an, zerrte sie mal in diese Richtung, mal in jene. Er redete mit sich selbst. Er kratzte an den roten Flecken in seinem Gesicht. Einmal blieb er an einem Tümpel stehen und glotzte in das Wasser. Er wartete, bis irgendein Käfer oder eine Spinne davongehuscht war, tauchte dann das Gesicht hinein und benetzte die gereizte Haut. Er schaute auf seine Füße, zog dann den verbliebenen Schuh aus und schleuderte ihn weg. Anschließend hetzte er sie weiter durch die heiße Morgenluft.
Sie warf einen Blick auf die Karte, die aus seiner Hosentasche ragte. »Wo gehen wir hin?«, fragte sie.
»Halt den Mund. Okay?«
Zehn Minuten später befahl er ihr, die Schuhe auszuziehen, und führte sie durch einen seichten, verschmutzten Wasserlauf. Auf der anderen Seite musste sie sich hinsetzen. Er hockte sich vor sie hin, schaute auf ihre Beine und ihr Dekolleté und trocknete ihr mit einem Packen Kleenex, die er aus seiner Hosentasche geholt hatte, die Füße ab. Sie ekelte sich vor seiner Berührung genauso, wie sie sich damals geekelt hatte, als sie zum ersten Mal in der Pathologie der Klinik eine Gewebeprobe von einer Leiche entnehmen musste. Er zog ihr die weißen Schuhe wieder an, band die Schnürsenkel, hielt ihre Wade eine Idee länger fest als nötig. Dann zog er die Karte zu Rate und führte sie wieder in den Wald.
Schnipste mit den Nägeln, kratzte sich an der Backe...
Nach und nach wurde die Moorlandschaft immer undurchdringlicher und das Wasser dunkler und tiefer. Sie vermutete, dass sie zum Great Dismal Swamp marschierten, hatte allerdings keine Ahnung, wieso. Gerade als es so aussah, als gäbe es zwischen den verlandeten Tümpeln und Wasserläufen kein Durchkommen mehr, führte sie Garrett in einen Kiefernwald, in dem es zu Lydias Erleichterung weitaus kühler war als draußen im Sumpfgelände.
Wieder leitete er sie einen Pfad entlang, bis sie auf einen steilen Hang stießen. Nach oben hin ragten Felsen auf.
»Da komm ich nicht rauf«, sagte sie und versuchte so trotzig wie möglich zu klingen. »Nicht mit gefesselten Händen. Ich rutsche ab.«
»Quatsch«, versetzte er wütend, als ob sie keine Ahnung hätte. »Du hast deine Schwesternschuhe an. Mit denen hast du guten Halt. Schau mich an. Ich bin barfuß, und irgendwie komm ich da trotzdem rauf. Schau dir meine Füße an, schau!« Er hielt ihr die Sohlen hin. Sie waren gelb und schwielig. »Na los, beweg dich, kletter da rauf. Aber geh nicht weiter, wenn du oben bist. Hast du gehört? He, hast du mich verstanden?« Wieder dieses Zischeln, wieder landete ein Speicheltropfen auf ihrer Wange. Es kam ihr so vor, als ob er wie Säure auf ihrer Haut brannte.
Herrgott, wie ich dich hasse, dachte sie.
Lydia fing an zu klettern. Auf halber Höhe hielt sie inne, schaute zurück. Garrett ließ sie nicht aus den Augen, schnipste mit den Fingernägeln. Glotzte auf ihre Beine, die in weißen Strümpfen steckten, strich sich mit der Zunge über die Schneidezähne. Dann schaute er höher, unter ihren Rock.
Lydia kletterte weiter. Hörte seine zischenden Atemzüge, als er hinter ihr hochstieg.
Oben befand sich eine Lichtung, von der ein Pfad in ein dichtes Kieferngehölz führte. Sie ging darauf zu, in den Schatten.
»Hey!«, rief Garrett. »Hast du nicht gehört? Ich hab gesagt, du sollst nicht weitergehen!«
»Ich will doch gar nicht abhauen!«, schrie sie. »Es ist heiß. Ich will bloß aus der Sonne.«
Er deutete nach vorn, auf den Boden. Fünf Meter weiter lag eine Schicht Kiefernzweige mitten auf dem Pfad. »Du hättest reinfallen können«, krächzte er. »Du hättest alles kaputtmachen können.«
Lydia schaute genau hin. Die Kiefernzweige bedeckten eine breite Grube.
»Was ist das?«
»Eine Fallgrube.«
»Was ist da drin?«
»Du weißt schon – eine Überraschung für alle, die hinter uns her sind.« Er sagte es voller Stolz, grinsend, als ob ihm etwas ganz Schlaues eingefallen wäre.
»Aber da könnte sonst wer reinfallen!«
»Quatsch«, versetzte er. »Wir sind nördlich vom Paquo. Hier kommen nur die Leute vorbei, die hinter uns her sind. Und die haben es verdient, wenn ihnen was passiert. Los, weiter geht's.« Wieder das Zischeln. Er packte sie an den Handgelenken und führte sie um die Grube herum.
»Du brauchst mich nicht so fest zu halten!«, protestierte sie.
Garrett warf ihr einen kurzen Blick zu und lockerte seinen Griff etwas – doch die sanftere Berührung erwies sich als weitaus unangenehmer: Er strich mit dem Mittelfinger über ihr Handgelenk, was sie an eine fette Zecke erinnerte, die über ihre Haut kroch und eine Stelle suchte, an der sie sich festsaugen konnte.
...Vier
Der Rollx-Bus fuhr an einem Friedhof vorbei, den Tanner's Corner Memorial Gardens. Dort fand gerade eine Beerdigung statt, und Rhyme, Sachs und Thom betrachteten den Trauerzug.
»Schaut euch den Sarg an«, sagte Sachs.
Er war klein, ein Kindersarg. Nur wenige Trauergäste, lauter Erwachsene, begleiteten ihn. Etwa zwanzig Personen. Rhyme fragte sich, weshalb die Anteilnahme so gering war. Er blickte über die Grabstätte hinweg auf die sanft gewellten Hügel des Friedhofs, die dunstverhangenen Wälder und das Marschland dahinter, die sich meilenweit erstreckten, bis zum blauen Horizont. »Der Friedhof ist nicht schlecht«, sagte er. »Hätte nichts dagegen, an so einem Ort beerdigt zu werden.«
Sachs, die mit bedrückter Miene auf die Trauergemeinde schaute, warf ihm einen kühlen Blick zu – offenbar wollte sie angesichts der bevorstehenden Operation nichts über Tod und Sterblichkeit hören.
Dann lenkte Thom, der Jim Bells Streifenwagen folgte, den Bus um eine scharfe Kurve und beschleunigte, sobald die Straße wieder geradeaus führte. Der Friedhof verschwand hinter ihnen.
Tanner's Corner lag, wie Bell ihnen versichert hatte, zwanzig Meilen vom Klinikum in Avery entfernt. Auf dem Willkommensschild wurde dem Besucher mitgeteilt, dass die Stadt 3018 Einwohner zählte, was durchaus der Wahrheit entsprechen mochte, doch an diesem heißen Augustmorgen war auf der Main Street nur ein winziger Prozentsatz davon zu sehen. Der staubige Ort wirkte wie eine Geisterstadt. Ein älteres Paar saß auf einer Bank und blickte auf die verlassene Straße. Rhyme entdeckte zwei Männer, die kränklich und ausgezehrt aussahen – offenbar die hiesigen Gemeindesäufer. Der eine saß auf dem Bordstein, den grindigen Kopf in die Hände gestützt, und suchte vermutlich seinen Kater loszuwerden. Der andere hockte an einen Baum gelehnt da und glotzte mit tief eingesunkenen Augen, die selbst von weitem gelbsüchtig wirkten, auf den glänzenden Kleinbus. Eine magere Frau wischte träge das Fenster des Drugstores. Ansonsten sah Rhyme niemanden.
»Friedlich«, stellte Thom fest.
»So kann man es auch ausdrücken«, sagte Sachs, der in dieser Einöde offensichtlich ebenso unwohl war wie Rhyme.
Die Main Street war eine schmucklose Straße, gesäumt von alten Häusern und zwei kleinen Einkaufszentren. Rhyme bemerkte einen Supermarkt, zwei Drugstores, zwei Bars, einen Imbiss, ein Damenbekleidungsgeschäft, eine Versicherungsagentur und eine Videothek mit Süßwarenladen und Nagelstudio. Das hiesige Autohaus, A-OK Car Dealership hieß es, war zwischen einer Bank und einem Unternehmen für Bootszubehör eingequetscht. Überall wurden Köder feilgeboten. Auf einer Reklametafel wurde für ein McDonald's geworben, das sieben Meilen entfernt an der Route 17 lag, eine andere zeigte das sonnenverblichene Abbild der aus dem Bürgerkrieg stammenden Schiffe Monitor und Merriack. »Besuchen Sie das Ironclad-Museum«. Zweiundzwanzig Meilen musste man fahren, wenn man sich die Panzerschiffe ansehen wollte.
Während Rhyme all diese Eindrücke aus dem Alltag einer Kleinstadt in sich aufnahm, wurde ihm schmerzlich bewusst, wie verloren er hier als Kriminalist war. In New York konnte er jederzeit und mit Erfolg Spuren auswerten, weil er dort schon seit vielen Jahren lebte – er kannte die Stadt in- und auswendig, war ihre Straßen entlanggegangen, hatte sich mit ihrer Geschichte, ihrer Flora und Fauna befasst. Aber hier, in Tanner's Corner und Umgebung, wusste er nicht das Geringste über die Beschaffenheit des Bodens, der Luft, des Wassers, hatte keine Ahnung von den Gewohnheiten der Einwohner, wusste nicht, welche Autos sie fuhren, in welchen Häusern sie wohnten, bei welchen Unternehmen sie beschäftigt waren, welche Begierden sie antrieben.
Rhyme musste daran denken, wie er einmal als frisch gebackener Polizist für einen älteren Kripomann beim NYPD gearbeitet hatte. »Kann mir jemand sagen«, hatte der Mann von seinen Untergebenen wissen wollen, »was die Redewendung ‘Wie ein Fisch auf dem Trockenen’ bedeutet?«
»Das bedeutet so viel wie nicht in seinem Element sein«, hatte Jungpolizist Rhyme gesagt. »Verwirrt sein.«
»Also, was passiert denn, wenn ein Fisch auf dem Trockenen landet?«, hatte der ergraute alte Cop ihn angefahren. »Der ist nicht verwirrt. Der geht drauf. Eine ungewohnte Umgebung ist das Gefährlichste, was es für einen Ermittler gibt. Merken Sie sich das.«
Thom parkte den Kleinbus und senkte die Hebebühne mit dem Rollstuhl ab. Rhyme blies in die Strohhalmsteuerung des Storm Arrow und rollte auf die steile Rampe am Gebäude der Bezirksverwaltung zu, die man zweifellos mehr oder weniger widerwillig angebaut hatte, nachdem das Behindertenschutzgesetz in Kraft getreten war.
Drei Männer in Arbeitskleidung und mit Klappmesserscheiden am Gürtel kamen aus der Seitentür der Sheriff-Dienststelle neben der Rampe. Sie gingen auf einen burgunderroten Chevrolet Suburban zu.
Der Dürrste der drei stupste den Größten an, einen Hünen mit Pferdeschwanz und Bart, und deutete mit dem Kopf auf Rhyme. Dann musterten sie alle drei – fast wie auf Kommando – Sachs. Figur. Der Große betrachtete Thom, dessen gepflegte Frisur, die schmächtige Statur, die makellose Kleidung und den goldenen Ohrring. Ohne eine Miene zu verziehen, flüsterte er dem Dritten im Bunde, der aussah wie ein gut situierter Geschäftsmann aus dem Süden der USA, etwas zu. Der zuckte die Achseln. Dann verloren sie das Interesse an den Besuchern und stiegen in den Chevy.
Wie ein Fisch auf dem Trockenen...
Bell, der neben Rhymes Rollstuhl herlief, bemerkte dessen Blick.
»Das ist Rich Culbeau, der Große. Und seine Kumpel. Sean O'Sarian – der dürre Kerl – und Harris Tomel. Culbeau is nicht halb so schlimm, wie er aussieht. Er markiert gern den wilden Mann, aber normalerweise macht er keinen Ärger.«
O'Sarian wandte sich auf dem Beifahrersitz um – aber Rhyme wusste nicht, ob er zu Thom, Sachs oder ihm blickte.
Der Sheriff trabte vor ihnen die Rampe hinauf. Er mühte sich mit der behindertengerechten Treppe ab. Das Schloss war überstrichen worden.
»Hier gibt's nicht viele Krüppel«, stellte Thom fest. Dann wandte er sich an Rhyme. »Wie geht's dir?«
»Bestens.«
»Du siehst aber nicht so aus. Du wirkst blass. Sobald wir drin sind, messe ich deinen Blutdruck.«
Sie kamen in das Gebäude. Etwa um 1950 errichtet, schätzte Rhyme. Im üblichen Amtsgrün gestrichen; Fingerfarbenbilder, offenbar von Grundschülern gemalt, zierten die Flure, dazu Fotos von Tanner's Corner im Lauf seiner Geschichte sowie rund ein halbes Dutzend öffentliche Stellenausschreibungen.
»Geht das in Ordnung?«, fragte Bell, als er eine Tür aufstieß. »Wir benutzen das als Asservatenkammer, aber wir räumen das Zeug raus und schaffen es runter in den Keller.«
Ein gutes Dutzend Kartons säumten die Wände. Ein Polizist karrte gerade mühsam einen großen Toshiba-Fernseher aus dem Raum. Ein anderer schleppte zwei Kisten mit Saftflaschen weg, in denen sich eine klare Flüssigkeit befand. Rhyme betrachtete sie, und Bell lachte. »Das fasst in etwa die kriminellen Aktivitäten in Tanner's Corner zusammen: Diebstahl von elektronischen Geräten und Schwarzbrennerei.«
»Das ist Schnaps?«, fragte Sachs.
»Ganz recht. Höchstens einen Monat alt.«
»Ocean Spray?«, fragte Rhyme spöttisch, als er die Etiketten auf den Flaschen sah.
»Die sind bei den Schwarzbrennern beliebt – wegen dem breiten Hals. Trinken Sie Schnaps?«
»Nur Scotch.«
»Bleiben Sie dabei.« Bell nickte zu den Flaschen hin, die der Polizist aus der Tür schleppte. »Der Bundesregierung und dem Staat Carolina geht's nur um die Steuern. Wir machen uns um die Leute Sorgen. Die Sorte da ist gar nicht übel. Aber Schwarzgebrannter wird oft mit Formaldehyd verschnitten, mit Lackverdünner und Flüssigdünger. Hier bei uns gehen jedes Jahr zwei, drei Menschen an vergiftetem Fusel drauf.«
»Wieso eigentlich Schwarzgebrannter?«, fragte Thom.
»Weil er für gewöhnlich in finsterer Nacht gebrannt wird, damit kein Steuerfahnder es mitbekommt.«
»Aha«, sagte der junge Mann, der, wie Rhyme wusste, eher einen guten St. Emilion, einen Pomerol oder einen weißen Burgunder schätzte.
Rhyme sah sich in dem Zimmer um. »Wir brauchen mehr Steckdosen.« Er nickte zu dem einzigen Anschluss an der Wand.
»Wir können ein paar Kabel verlegen«, sagte Bell. »Ich setze jemand darauf an.«
Er schickte einen Deputy mit dem entsprechenden Auftrag los und berichtete dann, dass er beim Labor der Staatspolizei in Elizabeth City angerufen und dringend um die Bereitstellung der von Rhyme gewünschten Ausrüstung ersucht habe. Die Geräte müssten in einer Stunde eintreffen. Für hiesige Verhältnisse war das blitzschnell gegangen, dessen war sich Rhyme bewusst, und einmal mehr spürte er, wie dringlich dieser Fall war.
Bei einer Entführung mit sexuellem Hintergrund hat man normalerweise vierundzwanzig Stunden Zeit, um das Opfer zu finden – danach betrachtet es der Kidnapper nicht mehr als menschliches Wesen und zögert nicht, es zu töten.
Der Deputy kehrte mit zwei dicken Verlängerungskabeln samt Mehrfachsteckdosen zurück. Er klebte sie am Boden fest.
»Die reichen«, sagte Rhyme. »Wie viele Leute haben Sie auf den Fall angesetzt?«, fragte er dann.
»Drei leitende und acht einfache Deputys. Dazu haben wir zwei Mann in der Funk- und Telefonzentrale und fünf Schreibkräfte. Normalerweise müssen wir uns die mit dem Planungs- und Bauamt teilen – was für uns ein wunder Punkt ist –, aber wegen der Entführung und weil Sie hergekommen sind, kriegen wir jeden, den wir brauchen. Der Vorstand der Bezirksverwaltung steht dahinter. Ich habe schon mit ihm gesprochen.«
Rhyme blickte zur Wand hoch. Runzelte die Stirn.
»Was gibt's?«
»Er braucht eine Schiefertafel«, erklärte Thom.
»Ich habe an eine Karte von der Gegend gedacht. Aber ja, eine Schiefertafel möchte ich auch haben. Eine große.«
»Wird geregelt«, sagte Bell. Rhyme und Sachs lächelten sich zu. Das war einer der Lieblingsausdrücke von Cousin Roland.
»Könnten Sie mir danach Ihre leitenden Leute herschicken? Zu einem kurzen Meinungsaustausch.«
»Und eine Klimaanlage«, sagte Thom. »Hier drin muss es kühler werden.«
»Mal sehn, was wir tun können«, sagte Bell leichthin. Vermutlich verstand er nicht recht, weshalb den Nordlichtern die Temperatur so wichtig war.
»Diese Hitze tut ihm nicht gut«, schob der Betreuer energisch nach.
»Mach dir darum keine Sorgen«, sagte Rhyme.
Thom wandte sich mit hochgezogener Augenbraue an Bell. »Wir müssen das Zimmer abkühlen«, stellte er gelassen fest. »Sonst bringe ich ihn ins Hotel zurück.«
»Thom«, sagte Rhyme warnend.
»Ich fürchte, uns bleibt nichts anderes übrig«, erwiderte der Betreuer.
»Kein Problem«, sagte Bell. »Ich kümmere mich drum.« Er ging zur Tür und rief hinaus in den Flur: »Steve, komm mal einen Moment her.«
Ein junger Mann mit kurz geschnittenen Haaren, der eine Deputy-Uniform trug, kam herein. »Mein Schwager Steve Farr.« Er war der größte Deputy, den sie bislang zu Gesicht bekommen hatten – er maß gut und gern zwei Meter –, und hatte runde, ulkig abstehende Ohren. Er wirkte nur leicht betreten, als er Rhyme sah, und verzog den breiten Mund im nächsten Moment zu einem lässigen Lächeln, das von Selbstvertrauen und Tüchtigkeit kündete. Bell erteilte ihm den Auftrag, eine Klimaanlage für das Labor zu beschaffen.