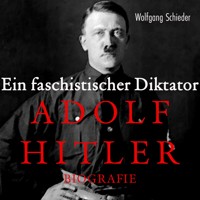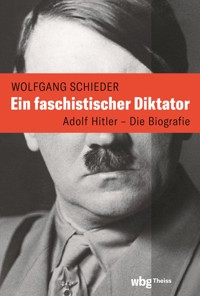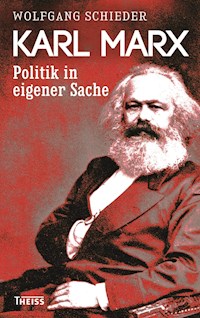9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Es gibt viele Sonderwege in der Geschichte. Einen davon haben die Italiener beschritten, als sie Anfang des 20. Jahrhunderts den Faschismus hervorbrachten. Wolfgang Schieder beschreibt in diesem Band eindringlich den Aufstieg, die Herrschaft und das Ende des Faschismus. Die 'charismatische' Herrschaft Benito Mussolinis und ihre Grenzen werden dabei ebenso in den Blick genommen wie das politische Regime und der faschistische Polizeistaat. Schließlich fragt der Band auch danach, welche Spuren der Faschismus in der kollektiven Erinnerung der Italiener hinterlassen hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Titel
Wolfgang Schieder
DER ITALIENISCHEFASCHISMUS1919–1945
Verlag C.H.Beck
Übersicht
Cover
Inhalt
Textbeginn
Inhalt
Titel
Inhalt
I. Der italienische Faschismus in historischer Perspektive
II. Entstehungsbedingungen des Faschismus
III. Der Faschismus als politische ‹Bewegung› 1919–1922
IV. Die Herausbildung des faschistischen Diktatursystems 1922–1929
V. Das faschistische Diktaturregime Benito Mussolinis 1929–1943
VI. Epilog: Die Italienische Sozialrepublik (Repubblica Sociale Italiana) 1943–1945
VII. Der Faschismus in der kollektiven Erinnerung der Italiener
Anhang
Zeittafel
Literaturverzeichnis
I. Forschungsberichte und Interpretationen
II. Gesamtdarstellungen, Sammelbände und Lexika
III. Historische Voraussetzungen
IV. Der Faschismus als ‹Bewegung› 1919–1922
V. Der Weg in die faschistische Diktatur 1922–1929
VI. Das faschistische Diktaturregime 1929–1943
VII. Das Nachspiel der Italienischen Sozialrepublik 1943–1945
VIII. Der Faschismus in der kollektiven Erinnerung der Italiener
Register
Zum Buch
Vita
Impressum
I. Der italienische Faschismus in historischer Perspektive
Es gibt viele Sonderwege in der Geschichte. Einen davon haben die Italiener beschritten, als sie Anfang des 20. Jahrhunderts den Faschismus hervorbrachten. Auch wer überzeugt ist, daß der Faschismus im 20. Jahrhundert eine gesamteuropäische Bewegung war, muß davon ausgehen, daß diese ihren Ursprung in Italien hatte. So gut wie alle faschistischen Bewegungen in Europa, einschließlich des Nationalsozialismus, orientierten sich bei ihrer Entstehung am italienischen Faschismus, nur dieser hatte kein Vorbild, sondern stellte ein historisches Novum dar. Sich mit dem italienischen Faschismus zu beschäftigen, bedeutet daher, diesen aus sich heraus als ein Ergebnis der Geschichte des italienischen Nationalstaats zu verstehen. Seine europäische Dimension ergibt sich nicht aus seiner Entstehungs-, sondern aus seiner Wirkungsgeschichte.
Der italienische Faschismus kann nicht einfach als ein starres politisches System dargestellt werden, er hatte vielmehr eine Geschichte, im Laufe derer er mehrfach seine Form veränderte. Aufstieg, Herrschaft und Ende des Faschismus müssen als ein historischer Prozeß verstanden werden, in dem mehrere Phasen deutlich voneinander unterschieden werden können. Die Entstehungsgeschichte des Faschismus von 1919 bis 1922 kann zunächst als Phase der ‹Bewegung› bezeichnet werden. Sie ging mit dem ‹Marsch auf Rom› am 28.10.1922 zuende, durch den der Faschismus an die Regierung kam. Die Zeit von 1922 bis 1929 kann als entscheidende Übergangsphase angesehen werden, in der sich der Faschismus zur Diktatur entwickelte. Von 1929 bis 1943 reichte schließlich die eigentliche Diktaturphase des Faschismus, in der dieser sich als ein Regime besonderer Art darstellte. Dieses vom Verfasser schon vor längerer Zeit vorgeschlagene Verlaufsschema läßt sich in Anlehnung an Robert Paxton um eine Vorgeschichte und um einen faschistischen Epilog von 1943 bis 1945 erweitern, womit sich für die Geschichte des Faschismus in Italien insgesamt fünf Phasen ergeben.
Die Darstellung der Vorgeschichte des Faschismus soll verständlich machen, weshalb sich diese historisch neuartige Bewegung gerade in Italien herausgebildet hat. Es geht nicht darum, hier eine historische Zwangsläufigkeit zu unterstellen, wohl aber ist nach den Bedingungen der Möglichkeit zu fragen, weshalb sich gerade in Italien ein spezifisches Diktatursystem herausbilden konnte, das bis dahin in Europa nicht seinesgleichen hatte.
Wenn die Konstituierungsphase des Faschismus als Phase der ‹Bewegung› bezeichnet wird, so entspricht das dem faschistischen Selbstverständnis. Der Faschismus verstand sich in seinem Ursprung als ‹Bewegung›, nicht als ‹Partei›. Das bedeutete im wesentlichen dreierlei: Erstens lehnte er es ab, sich einem bürokratischen Apparat unter einer womöglich oligarchischen Führung zu unterwerfen, er wähnte sich vielmehr in einem Zustand permanenter Mobilisierung. Auf diese Weise stilisierte er sich zur Antipartei gegenüber allen anderen Parteien. Zum zweiten war die faschistische Bewegung ursprünglich nicht programmgesteuert, im Vordergrund stand immer die ‹Aktion›. Wie wohl keine andere politische Bewegung des zwanzigsten Jahrhunderts war der Faschismus praxisorientiert. Diese Praxis war immer gewalttätig, der Faschismus wollte seine politischen Gegner nicht überzeugen, sondern vernichten. Das soll nicht heißen, daß ideologische Elemente keine Rolle spielten, aber die Ideologie war immer nachgelagert. Drittens schließlich hatte der Faschismus als Bewegung einen paramilitärischen Charakter, er verstand sich in erster Linie als eine Bürgerkriegsbewegung. Die militanten faschistischen Kampfgruppen (Squadre d’azione) stellten bis zum ‹Marsch auf Rom› den eigentlichen Kern der Bewegung dar, die politische Organisation trat demgegenüber deutlich zurück. Auch nach seiner Machtübernahme erhielt der Faschismus diesen paramilitärischen Charakter aufrecht, da er neben der politischen Organisation des Partito Nazionale Fascista (PNF) mit der Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale (MVSN) in organisatorischer Hinsicht einen militärischen Flügel beibehielt.
In der Konsolidierungsphase des Faschismus entschied sich, welches Machtgefüge er als Regime annehmen würde. Im Prinzip gab es drei Entwicklungsmöglichkeiten. Vielen Führern des extremistischen Provinzfaschismus schwebte eine Parteidiktatur vor. Die faschistischen Sympathisanten innerhalb des Bürgertums, die sogenannten Fiancheggiatori, gingen dagegen mehrheitlich davon aus, daß die faschistische Bewegung absorbiert und ein monarchisches Diktaturregime errichtet werden könnte. Benito Mussolini, der den Faschismus an die Macht geführt hatte, dachte dagegen weder an die eine noch die andere Diktaturvariante. Er verfolgte vielmehr die politische Doppelstrategie, eine persönliche Führerdiktatur zu errichten, die sich sowohl auf die faschistische Massenpartei als auch auf die nationalmonarchischen Eliten innerhalb des Bürgertums stützte, die seine Machtergreifung unterstützt hatten. Er hat diesen eigentümlichen Herrschaftskompromiß seit 1922 zielstrebig verfolgt und seit seinem Staatsstreich vom 3.1.1925 schrittweise durchsetzen können.
Die lange Regimephase des Faschismus zeichnete sich dadurch aus, daß Mussolini eine Art von Vermittlungsdiktatur ausüben konnte, mit der er sich sowohl über die Partei als auch die monarchisch orientierten faschistischen Sympathisanten stellte und als ‹Duce del fascismo› für beide Seiten unentbehrlich machte. Diese Diktatur war nicht bürokratisch vermittelt, schon gar nicht lag ihr eine klare institutionelle Regelung zugrunde. In Anlehnung an Max Weber kann man Mussolinis persönliche Diktaturausübung deshalb durchaus als ‹charismatische Herrschaft› bezeichnen.
Mussolinis Herrschaft baute auf persönlicher Loyalität auf, nicht auf sachlicher Zuständigkeit und fachlicher Kompetenz. Sie wurde durch einen Personenkult abgesichert, der die Beherrschten zu blinder Unterwerfung bringen sollte. Max Weber spricht in diesem Zusammenhang von «charismatischer Gefolgschaft», die auf der direkten Konfrontation mit dem ‹Führer› beruhte, sei es in medialer Vermittlung oder sei es in persönlicher Begegnung. Mussolinis zahllose öffentliche Auftritte in organisierten Massenversammlungen finden hier ebenso ihre Erklärung wie die internen Audienzen, bei denen seine Entourage fast täglich bei ihm vorsprechen mußte. Als charismatischer Führer erschien Mussolini bei diesen Gelegenheiten stets als Repräsentation seiner selbst.
Mussolinis Führerautorität war jedoch nicht nur ein Ergebnis einer geschickten Performance, sie war vielmehr in hohem Maße erfolgsabhängig. Solange Mussolini politische Erfolge, die er vor allem in imperialistischer Gewaltpolitik suchte, vorweisen konnte, war ihm die Zustimmung der Italiener sicher. Der Massenkonsens ging zurück, als die vermeintlichen Erfolge ausblieben und die sich häufenden militärischen Niederlagen im Krieg den Glauben an den unfehlbaren ‹Duce› dahinschwinden ließen.
Schließlich ist davor zu warnen, das idealtypische Konstrukt ‹charismatischer Führerherrschaft› mit der historischen Realität zu verwechseln. Zunächst einmal ergab sich der Massenkonsens mit dem Faschismus nicht allein aus dem Dialog des ‹Duce› mit der ‹Masse›. Es handelte sich nicht um spontane Begegnungen, sondern durchweg um sorgfältig geplante Inszenierungen. Der Kult um den allgegenwärtigen ‹Duce› wurde von einer gewaltigen Propagandamaschine organisiert und in Gang gehalten. Ebenso wichtig war, daß die propagandistisch zur Schau gestellte Harmonie zwischen ‹Führer› und ‹Gefolgschaft› eine repressive Grundlage hatte. Die Führerherrschaft des ‹Duce› beruhte auf politischer Einschüchterung, polizeilicher Überwachung und unerbittlicher Verfolgung jedes abweichenden Verhaltens. Der charismatische Führerstaat des Faschismus war ein Polizeistaat, was niemand stärker bewußt war als Mussolini selbst. «Konsens» und «Gewalt» waren für ihn zwei Seiten ein und derselben Medaille. Kurz und bündig formulierte er dies am 7.3.1923 in einer seiner ersten Reden als Ministerpräsident: «Wenn der Konsens fehlt, gibt es die Gewalt» (quando mancasse il consenso, c’è la forza).
Mit dem Sturz Mussolinis am 25.7.1943 ging das monarchisch-faschistische Regime zu Ende. Der ‹Duce› konnte jedoch in Oberitalien im Auftrag der deutschen Besatzungsmacht nochmals ein Kollaborationsregime ausüben, das sich vom monarchisch-faschistischen System durch seinen republikanischen Charakter unterschied. Mussolini hatte in diesem republikanisch-faschistischen Regime keine Rücksicht mehr auf Koalitionspartner zu nehmen, um so mehr war er abhängig von den Deutschen. Die von ihm gegründete Repubblica Sociale Italiana (RSI) war ein deutscher Satellitenstaat.
II. Entstehungsbedingungen des Faschismus
Die europäische Zwischenkriegszeit von 1919 bis 1939 war eine Zeit des politischen Umbruchs. In zahlreichen europäischen Staaten gerieten parlamentarisch-demokratische Regierungssysteme in die Krise und wurden durch rechtsorientierte Diktaturregime ersetzt. Je nach historischer Tradition und politischer Ausgangslage handelte es sich dabei um Königsdiktaturen, Präsidialdiktaturen oder Militärdiktaturen. Für alle, so sehr sie sich im einzelnen voneinander unterschieden, war charakteristisch, daß sie ausschließlich von den traditionellen Eliten des Landes (Monarchie, Militär, Beamtenschaft, Kirchen) herbeigeführt worden waren und sich auf keine genuine Massenbewegung stützten. In Italien kam es dagegen durch den Faschismus zur Bildung eines Diktaturregimes eigener Art, bei dem eine rechtsextremistische Massenbewegung mit national-konservativen Gruppierungen zusammenging. Man kann diese widersprüchliche Regimebildung nur damit erklären, daß Italien infolge des Ersten Weltkrieges einer dreifachen gesellschaftlichen Systemkrise ausgesetzt war, wie sie in ähnlicher Form sonst nur noch Deutschland belastet hat. Diese Krisenakkumulation bewirkte sowohl das Entstehen der systemfeindlichen faschistischen Protestbewegung als auch deren politische Machtergreifung mit Hilfe politischer Repräsentanten dieses Systems.
Sie ergab sich aus drei säkularen Entwicklungsprozessen, denen Italien – wie andere europäische Staaten auch – in der Moderne unterworfen war, die aber in diesem Land infolge ihres nahezu gleichzeitigen Auftretens zu einer kumulativen Krise führten. Zum ersten handelte es sich um den Prozeß der nationalen Integration, einerseits im Sinne zwischenstaatlicher Abgrenzung und andererseits im Sinne binnenstaatlicher Nationsbildung. Zweitens ging es um den Prozeß politischer Verfassungsbildung, also um den Weg von der absolutistischen Monarchie zum liberal-demokratischen Verfassungsstaat. Und drittens schließlich stand der Prozeß der Industrialisierung an, durch den sich Italien, zumindest partiell, vom reinen Agrarstaat zum Industriestaat entwickelte. Es war die relative Gleichzeitigkeit von unvollendeter Nationsbildung, ungelösten Verfassungskonflikten und unbewältigten wirtschaftlichen Wachstumskrisen, durch welche die besonderen historischen Rahmenbedingungen für die Entstehung des Faschismus in Italien geschaffen wurden.
Unvollendeter Nationalstaat Als Nationalstaat gehörte Italien wie Deutschland im europäischen Vergleich zu den Nationen, die erst spät (1861/70) zu staatlicher Einheit gefunden hatten. Die als Wiederauferstehung (Risorgimento) interpretierte Gründung des italienischen Nationalstaats wurde von den bürgerlichen und aristokratischen Herrschaftseliten des Landes als unvollendet angesehen. Die Außenpolitik des Landes war deshalb bis zum Ersten Weltkrieg zwanghaft von der Vorstellung geprägt, außerhalb Italiens die ‹unerlösten› Gebiete einer ‹Irredenta› heimholen zu müssen. Dieser irredentistische Nationalismus wurde so lange politisch abgemildert, wie er liberal unterfüttert war. Um die Jahrhundertwende schlug die national-liberale Ideologie jedoch in einen militanten, imperialistisch aufgeladenen Nationalismus um. Es war dieser neue Nationalismus, der Italien 1911 in den Libyenkrieg und 1915 in den Ersten Weltkrieg führte. Die übersteigerten Hoffnungen der Kriegspartei, die Italien in den Krieg gegen Österreich-Ungarn und Deutschland geführt hatte, wurden 1919/20 auf den Pariser Friedenskonferenzen großenteils erfüllt. Italien konnte mit Trient, Südtirol bis zum Brenner, Görz, Triest und Istrien sowie außerdem noch Rhodos und dem Dodekanes enorme Territorialgewinne verbuchen, es mußte lediglich seine Ansprüche auf Dalmatien und Fiume zurückstellen. Die nationale Identität des Landes war jedoch immer noch so ungefestigt, daß dieser beträchtliche Zuwachs als völlig unzureichend empfunden wurde und sich das Gefühl eines ‹verstümmelten Sieges› (Vittoria mutilata), der italienischen Variante der Dolchstoßlegende, breitmachte.
Parlamentarismus ohne Parteien Bei der Gründung des italienischen Nationalstaats wurde 1861 das 1848 im Königreich Piemont-Sardinien vom Regenten Carlo Alberto erlassene Verfassungsstatut (Statuto Albertino) als konstitutionelle Grundlage übernommen. Der italienische König wurde damit an die Verfassung gebunden, behielt jedoch eine Reihe von monarchischen Vorrechten, zu denen vor allem das Ernennungsrecht des Ministerpräsidenten gehörte. Die liberale Bewegung war in Italien jedoch stark genug, in der Praxis nach kurzer Zeit die parlamentarische Ministerverantwortlichkeit durchzusetzen und die Verfassung auf diese Weise zu einem parlamentarischen Regierungssystem umzuformen. Dieses vergleichsweise moderne Regierungssystem stagnierte jedoch seit Ende des 19. Jahrhunderts in seiner Entwicklung, und zwar aus zwei Gründen. Zum einen war der das Parlament beherrschende Liberalismus nicht in der Lage, organisierte Parteien aufzubauen. Im Parlament standen einander vielmehr bis zur Jahrhundertwende lediglich die beiden großen, nicht klar voneinander abgegrenzten Blöcke der ‹Destra› und der ‹Sinistra› gegenüber, die abwechselnd die Regierung stellten. Das führte schon frühzeitig zu Wahlmanipulationen und parlamentarischer Korruption. In der Ära des Ministerpräsidenten Giovanni Giolitti im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts lösten sich die Parlamentsparteien vollends auf. An ihre Stelle trat die Praxis des sogenannten ‹Trasformismo›, in dem der Ministerpräsident sich die Mehrheiten mit Hilfe eines ausgefeilten Systems klientelistischer Abhängigkeiten jeweils zusammensuchte.
Die zweite Schwäche des italienischen Regierungssystems bestand darin, daß die liberalen Führungsschichten sich oligarchisch abschlossen und das Wahlrecht rigoros beschränkten. In einem Land, in dem noch Ende des 19. Jahrhunderts mehr als die Hälfte der Erwachsenen Analphabeten waren, wollte man sich auf diese Weise vor einem unkalkulierbaren Verhalten der Unterschichten schützen. Seit der Gründung des Partito Socialista Italiano (PSI) im Jahr 1892 stand dahinter jedoch auch die diffuse Angst vor der ‹Revolution›, wie sie in den bürgerlichen Schichten der meisten Länder Europas verbreitet war.
Erst in der Nachkriegskrise von 1919 wurde in Italien das allgemeine Wahlrecht für Männer eingeführt. Bei den ersten nationalen, nach dem Verhältniswahlrecht durchgeführten Wahlen stellten der PSI mit 156 und der neuformierte katholische Partito Popolare Italiano (PPI) mit 100 Abgeordneten zusammen die Mehrheit der insgesamt 508 Parlamentsmitglieder. Nur die restlichen 252 Sitze entfielen noch auf das bürgerliche Lager, das damit weit von einer Mehrheit entfernt war. Zu einer Koalition mit den Sozialisten oder den Katholiken waren die bürgerlichen Gruppen ebenso wenig fähig, wie die beiden Massenparteien, die bisher außerhalb jeder politischen Verantwortung gestanden hatten, miteinander koalieren konnten. Alle großen Lager waren zu politischen Kompromissen unfähig, was auch daran lag, daß sie in sich jeweils gespalten waren. Innerhalb des PSI standen sich Reformisten und potentielle Revolutionäre schon unversöhnlich einander gegenüber, bevor es 1921 zur Abspaltung des Partito Comunista d’Italia (PCI) kam. Der PPI wurde zwar von seinem Generalsekretär Don Sturzo straff geführt, die Partei war jedoch tief in Christliche Demokraten und Konservative gespalten. Und das bürgerliche Lager war ohnehin in zahlreiche personenorientierte Gruppierungen zersplittert. Der Schritt in eine demokratische Zukunft des Landes, der mit den ersten Wahlen nach dem allgemeinen Männerwahlrecht getan schien, führte deshalb nur zu einer Lähmung des liberalen Verfassungssystems.
Organisierter Kapitalismus Schließlich wurde Italien nach dem Ende des Ersten Weltkrieges in außergewöhnlicher Weise von der Umstellung von der Kriegs- auf die Friedenswirtschaft getroffen. Das hatte zunächst eine weit in die Vergangenheit zurückreichende Ursache. Entgegen den wirtschaftstheoretischen Grundsätzen des seit der Nationalstaatsgründung politisch vorherrschenden Liberalismus hatte sich die Industrialisierung in Italien unter ungewöhnlich hoher Beteiligung des Staates vollzogen. Man kann daher in Italien im Sinne von Joseph Schumpeter durchaus von einem ‹organisierten Kapitalismus› sprechen. Dieses protektionistische System hatte jedoch eine Schieflage: Es förderte einseitig die Schwerindustrie und benachteiligte die Produktion von Konsum- und sonstigen Investitionsgütern. Vor allem aber vernachlässigte es die Landwirtschaft, die besonders in Süditalien in geradezu archaischen Produktionsbedingungen verharrte. Das war, wie Rosario Romeo in einer berühmten Auseinandersetzung mit den Thesen des kommunistischen Theoretikers Antonio Gramsci argumentiert hat, insofern unvermeidlich, als zum Aufbau des Industriesystems nur ein Kapitaltransfer aus der Landwirtschaft in Frage kam. Da sich der Aufschwung der Industrie jedoch fast ausschließlich im Städtedreieck (Triangolo) zwischen Turin, Mailand und Genua vollzog, wurde durch die Industrialisierung ein für allemal die Rückständigkeit des Südens (Mezzogiorno) zementiert.