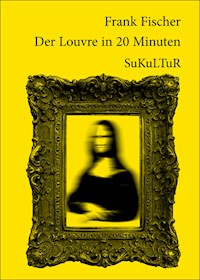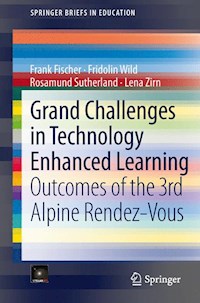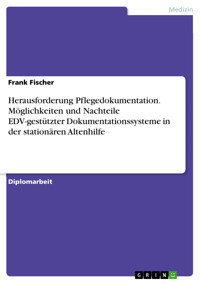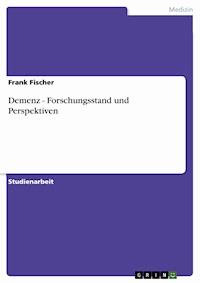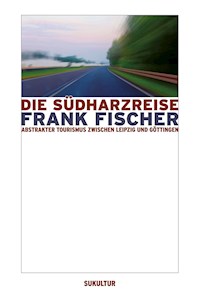7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Kuriose Begegnungen, skurrile Gestalten und urkomische Momente - willkommen in der Welt eines Taxifahrers! In Der Japaner im Kofferraum nimmt uns der Autor Frank Fischer mit auf eine amüsante Reise durch die nächtlichen Straßen deutscher Großstädte. Mit jeder Fahrt offenbart sich ein neues, unvergessliches Kapitel voller Überraschungen und Kuriositäten. Seit über zwei Jahrzehnten chauffiert Fischer seine Fahrgäste von A nach B und hat dabei so manch denkwürdige Situation erlebt. Sei es die Begegnung mit einem verirrten Japaner im Kofferraum, eine turbulente Nachtschicht in der Taxizentrale oder eine unverhoffte Fahrt mit Prominenten - in diesem Buch lässt der Autor die besten und witzigsten Momente seiner Karriere Revue passieren. Mit Humor und Einfühlungsvermögen schildert Fischer die skurrilen Begegnungen und Herausforderungen des Taxifahrer-Alltags. Der Japaner im Kofferraum ist eine unterhaltsame Sammlung wahrer Geschichten und Bekenntnisse, die dem Leser einen authentischen Einblick in das Leben eines Taxifahrers gewähren. Ein Must-Read für alle, die sich nach einer guten Portion Lachen und unglaublichen, aber wahren Erzählungen sehnen!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 192
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Frank Fischer
Der Japaner im Kofferraum
Mein Leben als Taxifahrer
Knaur e-books
Inhaltsübersicht
Taxifahrer – eine Berufung?
Bevor ich von meinem Alltag als Taxifahrer berichte, möchte ich eines klarstellen: Nein, Taxifahrer war nicht mein Traumberuf. Und trotzdem ist es so etwas wie eine Berufung für mich geworden.
Zu meinem elfenbeinfarbenen Vehikel (eierlikörgelb verbitte ich mir) kam ich während meines Studiums, um mir den Besuch ausufernder Soziologie-Vorlesungen leisten zu können. Das ist jetzt sechsundzwanzig Jahre her. Viele Kollegen behaupten, unser Gewerbe mache süchtig – ich bin der Beweis dafür. Wie bei Drogensüchtigen hat es bei mir schleichend angefangen, irgendwann wurde es immer mehr, und schließlich kam ich nicht mehr davon los.
Als Regelstudienzeit müssen bei einem Soziologie-studenten mindestens fünfzig Semester veranschlagt werden. Das sollte allerdings niemanden zu der Überzeugung verleiten, uns würde es an der Uni extrem gut gefallen oder wir würden viel und intensiv studieren. Wir sind nur leichter abzulenken und scheuen uns, die brotlose Kunst in die Realität zu überführen, da sie bare Münze kaum wert ist. Der schnelle Euro – als ich mit dem Taxifahren anfing, war es noch die Mark – ist eine große Versuchung und ein veritabler Lockstoff. Das Studium habe ich aufgegeben.
Ein angehender Soziologe, der Taxifahrer wird? Mir ist klar, dass ich damit das berühmte Klischee erfülle. Aber das macht nichts. Bisher habe ich es nie bereut, studiert zu haben, und es noch weniger bereut, damit aufgehört zu haben. Ich habe während meines Studiums viel graue Theorie über die Menschen gelernt und bekam dann beim Taxifahren die Praxis sozusagen gratis mit dazu. Und da sag noch mal einer, dass das Studium einen nicht auf den Beruf vorbereitet!
Dass mein Beruf spannend ist, haben mir die letzten Jahrzehnte bewiesen, allein der Unterschied zwischen Frankfurt und Berlin! Während in Frankfurt vorwiegend Banker und Unternehmensberater in meinem Taxi saßen, sind es in Berlin Touristen, Rentner und Hartz-IV-Empfänger. Hier dunkle Zweireiher und Business-Kostüme, dort Holzfällerhemden, Jogginganzüge und Ballonseidenblousons. In Frankfurt fahre ich einen nach London reisenden First-Class-Passagier zum Flughafen, in Berlin eher Billigflug-Touristen. Kurz gesagt, in Frankfurt regiert das Geld und in Berlin das Sozialamt. Womit wir wieder bei der Soziologie wären.
Natürlich gibt es Tage, an denen man seinen Job verflucht. Mittlerweile gehört man als Taxifahrer ja nicht mehr gerade zu den Großverdienern. Eigentlich ist seit den Achtzigern alles kontinuierlich ein wenig abwärtsgegangen: weniger Geld, immer mehr Verkehr, unfreundlichere Fahrgäste … Trotzdem, im Grunde darf ich mich nicht beschweren: Ich mag meinen Beruf an den meisten Tagen sehr gerne, und ich kann davon leben. Das Beste daran ist aber, dass man als Taxifahrer jeden Tag etwas Neues erlebt. Jeden Tag neue Menschen kennenlernt, die einem interessante Dinge erzählen. Und natürlich passieren einem im Verkehrsdschungel der Großstadt immer wieder die skurrilsten Dinge.
Wenn Sie Lust haben, diesen Dschungel mit mir zu erobern, dann steigen Sie ein, schnallen Sie sich an – und los geht’s!
Kaffee in Neukölln oder: ein Arbeitstag mit unerwartetem Ende
Wie jeden Morgen verlasse ich direkt nach meinem dreizehnjährigen Sohn die Wohnung, denn bei ihm muss man unbedingt kontrollieren, ob er Hausschlüssel, Handy, Schulsachen und Kopf dabeihat. Dann wird das Taxifahrer-Hirn vor die erste, möglicherweise folgenschwere Entscheidung gestellt: über die Autobahn oder durch die Stadt ins Zentrum? Zwischen Rudow und Neukölln stehen in der Regel selten Horden von Fahrgästen an der Straße und winken, so dass ich geneigt bin, die Autobahn bis Dreieck Neukölln zu nehmen. Der Zubringer hat aber die unheilvolle Tendenz, sich just in dem Moment, wo ich auffahre, auf drei bis vier Kilometer Länge zu verstopfen.
»In der anderen Schlange geht es immer schneller voran«, denken wir oft und stehen uns im Supermarkt genervt die Beine in den Bauch. Edward A. Murphys Lebensweisheiten, besser bekannt als das unheilvolle Murphy’s Law, sind sozusagen mein allmorgendlicher Begleiter: Wenn etwas schiefgehen kann, dann geht es schief (Hauptregel). Wenn etwas auf verschiedene Arten schiefgehen kann, dann geht es immer auf die Art schief, die am meisten Schaden anrichtet. Hat man alle Möglichkeiten ausgeschlossen, bei denen etwas schiefgehen kann, eröffnet sich sofort eine neue Möglichkeit. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein bestimmtes Ereignis eintritt, ist umgekehrt proportional zu seiner Erwünschtheit. Früher oder später wird die schlimmstmögliche Verkettung von Umständen eintreten. Wenn etwas zu schön erscheint, um wahr zu sein, ist es das wahrscheinlich auch.
Komischerweise trifft das alles genau auf mich zu. Wenn Murphy’s Law einmal zugeschlagen hat und ich morgens schon Pech habe, setzt sich das dann meistens den ganzen Tag über so fort. Dann tritt sozusagen das Murphy-Taxifahrer-Gesetz ein:
Am Halteplatz stehe ich mindestens fünfundvierzig Minuten und warte auf einen Fahrgast. Habe ich jedoch Lust, mir beim direkt am Platz befindlichen Bäcker einen Kaffee zu kaufen, kann ich sicher sein: Auch wenn ich beim Reingehen Vierter am Taxistand war, bin ich, sobald ich mit meinem Becher wieder aus dem Laden komme, das einzige Taxi, und der Fahrgast steht schon freudestrahlend an der Tür.
Ich fahre den ganzen Tag leer durch die Straßen unserer Stadt, es winkt garantiert nur jemand, wenn ich mal besetzt bin.
Je länger ich mir an einem Stand die Räder viereckig stehe, umso kürzer wird die nächste Tour sein.
Ich habe nur noch 12 Euro und 35 Cent Wechselgeld in der Tasche – mit tödlicher Sicherheit will der Nächste mit einem »Hunni« bezahlen!
Genauso verhält es sich mit Münzen und Scheinen an sich: Habe ich morgens schon 20 Euro Kleingeld im Sack, zahlt bestimmt den ganzen Tag über jeder passend, so dass ich bis zum Abend bestimmt 50 Euro in Münzen gesammelt habe.
Der Sprit geht bedrohlich zur Neige, und ich beschließe, nach der nächsten Tour zu tanken. Diese geht dann bestimmt über vierzig Kilometer, die ich schweißgebadet und mit ängstlichen Blicken auf die Tankanzeige absolviere.
Am Flughafen lade ich nach Golm, einem Kaff bei Potsdam, ein. Die Straße ist mir und dem Fahrgast völlig unbekannt, aber ich denke beruhigt: »Du hast ja einen Berlin-Brandenburg-Atlas.« Es wird sich herausstellen, dass ausgerechnet diese bestimmte Seite spurlos verschwunden ist!
Glücklicherweise ist dieses Beispiel noch aus der grauen Vorzeit ohne Navigationssysteme. Hier die Navi-Version: Ich habe endlich einmal eine Fernfahrt, von Frankfurt in die Nähe von Gießen. Mitten im Wald zwischen zwei kleinen Dörfern hängt sich das Navigationssystem plötzlich auf und ist auch in der nächsten Viertelstunde nicht zur Arbeitsaufnahme zu bewegen. Ich muss mich mühsam durchfragen.
Der Fahrgast wohnt in einer engen, kleinen Straße, die wahrscheinlich nur von drei Autos pro Tag befahren wird. Ich muss einen Fahrauftrag ausfüllen. Garantiert taucht nach wenigen Sekunden aus dem Nichts ein Wagen hinter mir auf und hupt empört.
Der Rufsäulenauftrag ist äußerst eilig, ein anderer Kollege hat die Adresse nicht gefunden, der Fahrgast hat reklamiert. Ich kann sicher sein, dass mich wie in dem Märchen »Der Hase und der Igel« um die nächste Ecke herum die Müllabfuhr angrinst: »Ick bün al dor!«
Die Straße ist angenehmer zu fahren als die große Hauptstraße; weniger Verkehr, weniger Ampeln, man spart Zeit. Sie hat nur einen kleinen Schönheitsfehler: einen Bahnübergang. Was passiert, wenn ich mal da entlangfahre? Erraten!
Mein Handy habe ich immer dabei – fast immer! Liegt es einmal vergessen zu Hause in der Ladestation, kann ich sicher sein, dass drei Anrufer auf der Mailbox sind, die eine lukrative Tour für mich hatten.
Zum Glück hat mich Murphy und sein blödes Gesetz heute verschont, und ich erreiche schon nach zehn Minuten über die Autobahn Neukölln. Hier liegt zurzeit mein bevorzugtes Revier, weil es nicht allzu weit von meiner Wohnung entfernt ist. Schließlich sollten sich die Leerkilometer in Grenzen halten, bei den Spritpreisen heutzutage. Außerdem gefällt mir das multikulturelle Flair dort, und obendrein ist der Kaffee – eines meiner Grundnahrungsmittel – ziemlich preiswert in Neukölln.
Zunächst versuche ich, schon bevor ich den Taxistand ansteuere, eine erste Tour zu bekommen. Dazu lohnt es sich, den Straßenrand genauer zu beobachten: Der gemeine Neuköllner fährt meist kurze Strecken, denn er ist zu betagt, krank oder mit Einkaufstüten bepackt, um die 500 Meter bis nach Hause (zum Arzt, zum Friedhof, zur S-Bahn) laufen zu können.
Das ziemlich alte Paar beispielsweise, mit etwas abgerissener Kleidung, welches mir unlängst vor einer Arztpraxis gewinkt hatte, brauchte eine halbe Ewigkeit, bis es endlich in meinem Taxi saß. Als der Mann endlich schwerfällig neben mir auf den Sitz geplumpst war, vernahm ich: »Hoidafiemfwansch!«
»Das habe ich jetzt aber gar nicht verstanden.«
»Hoidafiemfwansch!«
»Tut mir leid, welche Adresse?«
Da griff der Opa in die Jackentasche, holte tatsächlich ein Gebiss heraus, steckte es in den Mund und wiederholte: »Reuter 27!«
Heute winkt niemand am Straßenrand (kein Wunder, das passiert ja auch nur, wenn ich besetzt bin!), und ich fahre direkt zum Hermannplatz weiter, wo ich gerne den Tag beginne.
Am Taxistand Hermannplatz ist auf engstem Raum ein Mikrokosmos »Kreuzköllner« Lebens abgebildet – die eine Straßenseite gehört zu Neukölln, die andere zu Kreuzberg. Ein anatolisches Restaurant mit dem wenig einladenden Hinweis »Wir haben keine Gästetoiletten im Innern« an der Tür und der »Ankara-Market« beginnen den Reigen. Der Markt mit seiner riesigen Obst- und Gemüseauswahl auf der Straße, vor dem abwechselnd mehr oder minder marktschreierisch begabte Mitarbeiter die neuesten Angebote feilbieten, fungiert als meine Tomaten-Börse. Jeden Tag verfolge ich hier die Tomatenpreise, deren Kurve manchmal auch schon auf atemberaubende 32 Cent pro Kilo gefallen ist. Wir Taxifahrer sind gute Seismographen für die allgemeine Entwicklung. Wenn es gut läuft und die Tomatenpreise stabil sind, wird auch mehr Taxi gefahren. Natürlich habe ich das nicht empirisch untersucht, aber vom Grundsatz her dürfte es stimmen.
Im Haus neben dem türkischen Obsthändler befindet sich eine »Asia Snack Box«, welche trotz rot-goldenen China-Kitsches und asiatischer Verkäuferin ebenfalls türkische Besitzer hat, worauf das auf Deutsch und Türkisch verfasste Plakat »Hier alles ohne Schweinefleisch« hindeutet. Ein Stück weiter die Straße runter fließt meine bevorzugte Kaffeequelle, ein Tabak- und Zeitungsladen, der natürlich ebenfalls fest in türkischer Hand ist. Zwischen dieser ganzen orientalischen Pracht kümmert »Kräuter-Kühne« vor sich hin. Um die Ecke in der Urbanstraße, wo es etwas ruhiger zugeht, bietet ein »Reisebüro Beirut« seine Dienste an – doch Hand aufs Herz: Klingt ein solcher Name besonders vertrauenerweckend?
Wie jeden Vormittag meldet sich bei mir ziemlich schnell Kaffeedurst. Die Preisspanne für das Lebenselixier des Kutschers bewegt sich in Berlin zwischen 50 Cent und 1,50 Euro. Die Qualität variiert von abgestandener Plörre am Zentralen Omnibusbahnhof bis zum riesigen Eimer (gefühlte drei Portionen!) frisch gebrühten Gebräus für 50 Cent im »Subway« im Ostbahnhof.
Während das anatolische Restaurant den Kaffee für einen Euro abgibt, hat besagter Tabakladen einen speziellen Taxi-Driver-Tarif in Höhe von 50 Cent. Keine Ahnung, warum die Anatolier so stur sind, bei täglich geschätzten zweihundert Taxifahrern vor der Haustür.
Heute nehme ich meinen Becher frischen Kaffee mit ins Auto, manchmal, wenn ich eine längere Pause mache, setze ich mich auch unter eine der schattigen Pergolen, die es hier vor fast jedem Laden gibt. Eine kurze Kaffeepause im Stehen kann dagegen manchmal fatal sein wie bei meinem kettenrauchenden Kollegen Olaf. Er hatte einmal einen frischen Kaffee auf dem Autodach stehen, der übliche Standort, da er ja beide Hände zum Zigarettendrehen benötigt. Als ein Fahrgast nahte, steckte Olaf den Tabak ein und fuhr zum Hauptbahnhof, während der Kaffee vergessen auf dem Wagendach zurückblieb. Anschließend fuhr er wieder zurück zu seinem Stammplatz, und siehe da, der Kaffee stand noch immer unversehrt auf dem Dach herum! Ich kaufe Olaf die Geschichte auf jeden Fall ab, sein bedächtiger Fahrstil ist legendär.
Während ich meinen Kaffee trinke, vergeht die Zeit. Allmählich stehe ich schon fast wieder eine Stunde hier, Zeit, dass etwas geschieht! Mittlerweile habe ich mich immerhin an die erste Position Hermannplatz vorgearbeitet. Somit habe ich jetzt eine doppelte Chance, einen Fahrgast zu bekommen. Entweder es steigt direkt jemand bei mir ein, oder ich nehme einen Auftrag über die Rufsäule entgegen.
Da ich an keine Funkgesellschaft mehr angeschlossen bin, im Fachjargon ein »Stummer« genannt, bin ich auf diese praktischen Dinger angewiesen. Rufsäulen gibt es an vielen Halteplätzen, und sie werden von den Fahrgästen direkt angerufen. Wenn das Einsteiger-Aufkommen nachlässt, kann diese Einrichtung äußerst hilfreich sein. Wie hilfreich, erfuhr ich unlängst am Halteplatz »Schlesisches Tor« in Kreuzberg: Nachdem ich mir fast zwei Stunden lang die Räder viereckig gestanden hatte, fiel mein Blick auf die Rufsäule – das Licht war aus, die Säule defekt, shit happens!
Rufsäulen sind auf jeden Fall sehr praktisch, weil man direkt mit dem Fahrgast kommuniziert, was Übermittlungsfehler minimiert: »Bitte kommen Sie in die Mrbrmmstraße krrmzehn!«
Es herrscht wie immer starker Verkehrslärm am Hermannplatz.
»Können Sie die Adresse noch einmal wiederholen?«
»Waas? Kommt jetzt ein Taxi oder nicht?!«
Heute ist merkwürdigerweise keine »schnelle Taxi-Auflösung« angesagt, wie in Stein gemeißelt verharren die Taxis am Stand. Ausnahmen bestätigen die Regel.
Wieder einmal frage ich mich, woran diese vollkommene Flaute wohl liegen mag. Ich habe weder Aussatz noch Krätze. Mein Bart ist nicht älter als drei Tage. Frisch geduscht bin ich, und saubere Klamotten trage ich auch. Mein Taxi ist im Gegensatz zu allen anderen auf dem Halteplatz frisch gewaschen. Heute will sich partout keiner in meine Richtung bequemen, mit dieser übrigens völlig überflüssigen Frage auf den Lippen: »Sind Sie frei?«
Ich weiß ja nicht, was die Leute sich vorstellen, wenn sie mich mit leuchtendem Dachzeichen am Taxistand stehen sehen – alle möglichen Antworten gehen mir durch den Kopf, hier einige Variationen:
philosophisch: »Niemals aber sind wir in unserem Ich und unseren Entscheidungen gänzlich frei. Freiheit in dieser Hinsicht besteht für uns immer nur bis zu einem gewissen Grad.«
frivol: »Leider nicht, ich bin glücklich verheiratet und habe einen wundervollen Sohn und zwei Meerschweinchen.«
vorlaut: »Jetzt nicht mehr!«
frech: »Ja, aber nur auf Bewährung.«
trivial, meistens verwendet: »Ja selbstverständlich!«
Während ich meinen Gedanken nachhänge, beginnt es, an der Säule zu blinken. Ah! – Endlich ein Anruf! Eine Dame nennt mir ihre Adresse, drei Minuten später stehe ich bei ihr vor der Tür.
Sie wartet schon und hält einen Koffer in der Hand. Wenn ich Koffer sehe, macht mein Herz einen freudigen Hüpfer, denn Koffer bedeutet oft eine Fahrt zum Flughafen. Die Dame steigt ein, und ich verstaue ihr gutes Stück im Kofferraum. Es stellt sich heraus, dass sie nur zum S-Bahnhof Neukölln will. Wir fahren trotzdem los, ich kann es ja nicht ändern, bis es hinter mir zu hupen beginnt. Nach dem dritten Mal geht mir das Hupkonzert doch etwas auf die Nerven, was wollen die nur? Plötzlich dreht sich mein Fahrgast um und schreit: »Mein Koffer! Mein Koffer liegt da hinten auf der Straße!!«
Uups! Dreihundert Meter hinter uns liegt das Gepäckstück mitten auf der Fahrbahn. Zum Glück ist noch kein anderes Fahrzeug drübergefahren, so dass ich sofort zurückspurte und das kostbare Teil nahezu unversehrt (bis auf ein paar Dreckflecken) bergen kann. Ich war mir sicher, die Heckklappe geschlossen zu haben – ich weiß immer noch nicht, wie DAS passieren konnte.
Nach dieser Kurzfahrt muss ich wohl oder übel noch einmal zum Hermannplatz zurück. Zum Glück stehen diesmal nur drei Wagen vor mir.
Ich hole mir noch einen Kaffee, diesmal beim Anatolier ohne Klo, weil ich jetzt ziemlich vorne stehe und das andere Lädchen zu weit weg ist. Als ich wieder herauskomme, bin ich auch prompt Erster.
Ich male mir aus, welchen Fahrgast ich als Nächstes kriege. Am besten einen mit einem Fahrtziel, welches im Taxifahrerohr klingt wie himmlische Schalmeien.
Herr mit Koffer: »Sind Sie das Taxi zum Flughafen Schönefeld?«
Geschäftsmann: »Ich muss nach Potsdam. Hätten Sie vielleicht eine Stunde Zeit? Sie könnten mich dann wieder zurückbringen.«
Eiliger Gast: »Schaffen wir es in eineinhalb Stunden nach Leipzig?«
Gehbehinderte Kundin: »Ich muss als Erstes zum Optiker, dann zu Kaiser’s, danach zur Apotheke und dann …«
Es kommt leider anders. Meine Nemesis für heute nähert sich in Gestalt einer mir wohlbekannten alten Dame mit Rollator, ihre Tochter im Schlepptau sowie gefühlten fünfzig Einkaufstüten am Arm. Sie ist schon öfter mit mir gefahren, hält gewissermaßen nach mir Ausschau und steuert mich zielstrebig an. Weil ich immer so nett sei. Deswegen weiß ich allerdings auch, dass das Ein- und Ausladen der ganzen Utensilien länger dauert als die eigentliche Fahrt. Seufzend ergebe ich mich in mein trauriges Schicksal, welches die Vorsehung heute für mich bereithält. So kann ich wenigstens etwas für die Kundenbindung tun.
Plötzlich stürmen vier Männer heran, überholen die Oma und sind schon an meinem Taxi. Alles klar, denke ich, vier Türken, die nach Kreuzberg möchten. Weit gefehlt. An diesem Tag hat sich das Schicksal etwas anderes für mich ausgedacht. Einer der Männer öffnet die Fahrertür:
»Wie viel kostet nach Frankfurt?«
Mühsam die Fassung wahrend, erwidere ich: »Nach Frankfurt/Oder?«
»Nein, Frankfurt am Main!«
Jetzt bin ich sprachlos. Jemand will, dass ich ihn in meine alte Heimat bringe. Ich überschlage schnell im Kopf den Preis. Nach Frankfurt sind es fünfhundertsechzig Kilometer.
»Das wären achthundert Euro.«
»Okay.«
Die vier entern den Wagen. Beim Ausscheren vom Halteplatz beobachte ich genüsslich den Kollegen hinter mir, der immer noch mit dem Einladen der fünfzig Einkaufstüten meiner Spezialfreundin beschäftigt ist.
Ich kann mein Glück kaum fassen und schlage den Weg Richtung Autobahn ein. Als ich einen Blick in den Rückspiegel werfe, stelle ich fest, dass die vier ziemlich finster aussehen. Wie sich kurz darauf herausstellt, sprechen sie auch nicht Türkisch, sondern Albanisch.
Schon schießen mir alle möglichen Gedanken über die albanische Mafia durch den Kopf (wie passend: »schießen« und »Kopf«!). Drogen, Menschenhandel, Prostitution – die Albaner haben im Frankfurter Rotlichtmilieu mittlerweile die Kontrolle übernommen. Wenn das mal gutgeht! Ich male mir schon aus, wie ich um einige Organe erleichtert auf dem Grund einer Kiesgrube liege, mit einem Betonpfosten beschwert. Zum Glück ist es erst früher Vormittag, ich würde also noch im Hellen in Frankfurt ankommen und viele Augenzeugen um mich herum wissen.
An einer Tankstelle halte ich vorsichtshalber an und rufe die Gattin an. Man weiß ja nie, welche die letzten Worte am Ende des Lebens sein werden, aber mein übellauniges Brummen am frühen Morgen soll es dann doch nicht gewesen sein.
»Bin mit vier Albanern nach Frankfurt, nein, nicht Oder, unterwegs. Hoffentlich geht es gut«, raune ich vielsagend in den Hörer.
Die Stunden vergehen, aber beileibe nicht im Fluge. Es ist schon merkwürdig, wenn man von den Gesprächen der Mitfahrer rein gar nichts versteht. Eine vertrauensvolle Atmosphäre baut sich so nicht auf. Ständig mustere ich die unrasierten, dunklen Gesichter im Rückspiegel und versuche, ihre Mienen zu deuten. Ihre Augen sind hinter Sonnenbrillen versteckt. Herr, lass mich heil ankommen! Meine Gedanken überschlagen sich, und ich kann nicht verhindern, dass sich in meinem Kopf ein schlechter Gangsterfilm nach dem anderen abspult. Ich sehe auf einmal keine Koffer oder Einkaufstüten mehr in meinem Kofferraum, sondern mich. Leichenblass. Meine Nemesis bringt zwar kein Geld ein, würde mich aber auch nie in Lebensgefahr bringen.
Endlich erreichen wir Frankfurt. Unser Ziel ist gar nicht das Rotlichtviertel, sondern eine Hochhaussiedlung etwas außerhalb. Als wir an der angegebenen Adresse ankommen, kriege ich nur zu hören: »Moment, muss hole Geld!«
Au weia! Zum Glück hat er das nicht zu Beginn der Reise gesagt, denke ich, sonst wäre mir wohl noch mulmiger gewesen. Nicht auszudenken, wenn ich diesen weiten Ritt pro bono gemacht hätte. Sowieso war es äußerst fahrlässig von mir gewesen, nicht wenigstens einen Teilbetrag als Vorkasse zu verlangen. Es war wohl der Lockruf der Heimat, der mich unvorsichtig werden ließ.
Nach fünf Minuten jedoch kommt der »Man in Black« tatsächlich mit achthundert Euro zurück. Die vier Albaner verabschieden sich und verschwinden im Hochhaus.
Mir fällt das Matterhorn vom Herzen! Erleichtert und euphorisch beschließe ich, meinen früheren Taxibetrieb in Frankfurt aufzusuchen. Als ich dort ohne Vorankündigung hereinschneie, gibt es ein großes Hallo, und meine ehemaligen Kollegen und ich lassen den Abend feuchtfröhlich ausklingen. Natürlich übernachte ich dort und parke meinen elfenbeinernen Weggefährten bei der Zentrale.
Mit der Sänfte fing alles an: Bereits in der Antike wurden in Ägypten und Babylon – natürlich nur begüterte oder mächtige – Personen befördert, in Paris war das seit dem 17. Jahrhundert üblich. Friedrich Wilhelm I. ließ nach dem Pariser Beispiel 1668 Sänften in Berlin einführen.
Die Sänfte wurde dann langsam von der Pferdekutsche abgelöst, auch wieder zuerst in Paris, hier wurden sie »Fiacre« genannt, woraus im deutschsprachigen Raum der Fiaker wurde. Am Anfang des 19. Jahrhunderts wurde die Pferdekutsche in Berlin »Droschke« genannt. Das Taxameter wurde Ende des 19. Jahrhunderts eingeführt, aus diesem Begriff leitete sich im 20. Jahrhundert die Abkürzung »Taxi« für das ganze Fahrzeug ab.
Um die Jahrhundertwende kamen die ersten Kraftdroschken auf. Sie verdrängten die Pferdefuhrwerke immer mehr. Der Droschkenkutscher Gustav Hartmann, bekannt geworden als »Eiserner Gustav«, machte 1928 eine aufsehenerregende Fahrt von Berlin nach Paris mit seinem Gefährt, um gegen die steigende Zahl von Kraftfahrzeugen zu protestieren, aufhalten konnte er den Niedergang der Pferdedroschken aber auch nicht mehr.
Elli Blarr aus Berlin-Friedenau erhielt 1929 als erste Frau die Erlaubnis zum Führen von Autodroschken.
Das beleuchtete Dachzeichen wurde seit 1958 gesetzlich vorgeschrieben, die Farbe der Taxis war Schwarz. 1971 wurde sie in die auch heute noch übliche Farbe »Hellelfenbein« (RAL1015) geändert. Letzteres geschah, weil diese Farbe im Gegensatz zu Schwarz im Verkehr besser erkennbar war.
Im Zuge der Angleichung an EU-Normen – hier kennt kein Land außer Portugal eine einheitliche Taxifarbe – wurde die Taxifarbe mittlerweile in einigen Bundesländern freigegeben.
Mein täglich Brot: der Fahrgast
Wir sehnen ihn herbei und buhlen um seine Gunst, aber wenn er erst mal da ist, möchte man ihn so schnell wie möglich wieder loswerden: den Fahrgast.
Um ihn dreht sich selbstverständlich alles, denn er ist das tägliche Brot des Taxifahrers – und der Kunde ist bekanntlich König.
Manche verhalten sich dann auch tatsächlich wie eine Majestät, die fälschlich annimmt, das ganze Taxi samt Fahrer gekauft zu haben, und andere gebärden sich genauso lächerlich wie der Kaiser in dem Märchen »Des Kaisers neue Kleider«.
Seit einigen Jahren betreibe ich einen Weblog, den »Taxiblogger« (www.taxiblogger.de), in dem ich aus meinem Taxialltag berichte. Da ich offen gestanden auch ein bisschen eitel bin, habe ich mir ein Schild ans Armaturenbrett gehängt: »Achtung, Sie fahren mit dem Taxiblogger!«
Ein Fahrgast bemerkte, nachdem sein Blick auf mein Schild fiel: »Warum heißen Sie Taxiblogger?«
»Ich heiße nicht Taxiblogger, ich betreibe den Taxiblogger!«