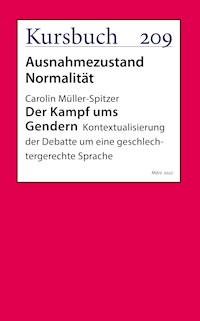
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kursbuch Kulturstiftung gGmbH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ein Argument in der aktuellen Debatte um geschlechtergerechte Sprache ist, dass sich Sprache natürlich entwickele, und solch ein schwerer Eingriff – wie es geschlechtergerechte Sprache sei – in das organische System der Sprache unangemessen und vielleicht sogar gefährlich sei. Carolin Müller-Spitzer zeigt, dass solche politisch motivierten, bewusst herbeigeführten Sprachwandelprozesse aber weder ungewöhnlich noch neu sind. Anhand von zwei sprachpolitisch motivierten Sprachdiskussionen der Vergangenheit beantwortet sie die Fragen, wie diese in der Vergangenheit liefen und was man daraus für die Debatte um geschlechtergerechte Sprache lernen kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 26
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Carolin Müller-SpitzerDer Kampf ums GendernKontextualisierung der Debatte um eine geschlechtergerechte Sprache
Die Autorin
Impressum
Carolin Müller-SpitzerDer Kampf ums GendernKontextualisierung der Debatte um eine geschlechtergerechte Sprache
Wir alle sind derzeit Zeug*innen einer besonderen Form von Sprachwandel, nämlich der Diskussion rund um Sprache und Geschlecht. Verfolgt man die Debatte um geschlechtergerechte Sprache, ist ein wiederkehrendes Argument, dass sich Sprache »natürlich« entwickele, und solch ein »schwerer Eingriff« 1 – wie es geschlechtergerechte Sprache sei – in das organische System der Sprache unangemessen und vielleicht sogar »gefährlich« sei. Es klingt so, als seien solche »Eingriffe« noch nie da gewesen. Allerdings sind politisch motivierte, bewusst herbeigeführte Sprachwandelprozesse weder ungewöhnlich noch neu. Doch wie verliefen sie in der Vergangenheit und was kann man daraus für die Debatte um geschlechtergerechte Sprache lernen? Um diesen Fragen nachzugehen, werde ich zunächst exemplarisch einen kurzen Blick auf zwei sprachpolitisch motivierte Sprachdiskussionen der Vergangenheit werfen, und zwar den Kampf gegen Fremdwörter, vor allem im Kontext der Rechtssprache, und die Selbstbezeichnung schwuler und lesbischer Menschen.
Der Kampf gegen »Fremdwörter«
Nach Gründung des Deutschen Reiches war auch die Sprache ein sehr wichtiger Schauplatz zur Bildung nationaler Identität geworden. Sprachreformer schlossen sich 1885 im »Allgemeinen Deutschen Sprachverein« zusammen, um das »sprachliche Gewissen im Volke zu schärfen« und »mit dem Aufschwung der Nation auch das Sprachgewissen wieder lebendiger« werden zu lassen.2 Wichtigstes Projekt war die Etablierung von »Ersatzwörtern«, um »Fremdwörter« zu vermeiden. Die Mitglieder des Vereins, eher Nationalbegeisterte aus dem akademischen Bildungsbürgertum als Fachwissenschaftler*innen, gewannen recht schnell an Einfluss. Führende Köpfe aus Wissenschaft und Kunst sprachen zwar von »sittenwidriger Schnellprägung von Ersatzwörtern«, doch insbesondere in der Sprache des Rechts fand der Verein ein Betätigungsfeld. Das wichtigste Rechtsprojekt war das neue Bürgerliche Gesetzbuch. Die Mitglieder des Sprachvereins forderten die Eindeutschung aller rechtlichen Begriffe und waren damit so erfolgreich, dass es sie »mit Genugthuung erfüllte«, wie sehr in der finalen Fassung des BGB ihren Bemühungen entgegengekommen wurde. Statt Civilgesetzbuch hieß es nun Bürgerliches Gesetzbuch, statt Domizil Wohnsitz, statt Interessent Beteiligter, statt Publikation Bekanntmachung, statt Dividende Gewinnanteil oder statt Protest Einspruch. Diese Liste ließe sich noch lange fortsetzen. Damit war die Eindeutschung des Privatrechts gelungen und Schwung für weitere Bemühungen vorhanden. So wurden auch die Mitarbeiter*innen des Reichsjustizministeriums der Weimarer Zeit noch als »Wort-Graveure« gerühmt.3
Warum war diese Bewegung so erfolgreich? Die Idee einer »nationalen« Sprache war eingebettet in die Zeit nach der deutschen Reichsgründung: Das neu gewonnene nationale Selbstbewusstsein fand im Bemühen um eine möglichst »reine« deutsche Sprache ein ideales Anwendungsfeld. Sprache und Nation wurden zusammen entwickelt und von vielen zusammengedacht. So hieß es auf der Hauptversammlung des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins 1890 zum Vorwurf der Sprachplanung (der durchaus immer mal wieder erhoben wurde). Das »bewußte Bemühen um die Hebung der Sprache« dürfe man nicht als »unnatürliches Eingreifen« betrachten. Dezidiert richtete sich der Redner dabei gegen Entlehnungen aus dem Französischen wie Coupé. Solche Wörter durch Wörter mit deutschem Stamm wie Abtheil zu ersetzen, sei ein »Grundrecht«, »fremde Wörter« seien »Dirnen«, heimische dagegen »Fleisch von unserem Fleische und Blut von unserem Blute«. Überhaupt habe man Sprache nicht »werden lassen«, sondern gestaltet, und zwar »um der Einheit der Nation willen«.4





























