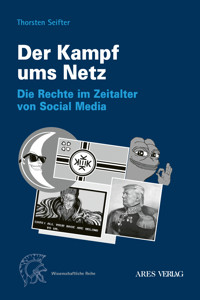
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ares Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Es scheint, dass seitens der Rechten moderne Medien hoffnungsvoll eingesetzt werden, dabei aber eine gewisse Planlosigkeit vorherrscht und es an strategischer Planung mangelt. Die vorliegende extensive Medienanalyse stellt Strukturen, Funktionen, gesetzliche Einschränkungen und kommunikative Möglichkeiten der "digitalen Öffentlichkeit" vor und legt damit den Grundstein für die gezielte Nutzung der gegenwärtigen Online-Ressourcen, statt in bloßes Klagen über mangelnde Meinungsvielfalt zu verfallen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 448
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Thorsten Seifter
Der Kampf ums Netz
Die Rechte im Zeitalter von Social Media
Umschlaggestaltung: Ecotext-Verlag Mag. G. Schneeweiß-Arnoldstein, Wien Umschlagabb. Vorderseite: © gemeinfrei
Wir haben uns bemüht, bei den hier verwendeten Bildern die Rechteinhaber ausfindig zu machen. Falls es dessen ungeachtet Bildrechte geben sollte, die wir nicht recherchieren konnten, bitten wir um Nachricht an den Verlag. Berechtigte Ansprüche werden im Rahmen der üblichen Vereinbarungen abgegolten.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter https://www.dnb.de abrufbar.
Hinweis
Dieses Buch wurde auf chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt. Die zum Schutz vor Verschmutzung verwendete Einschweißfolie ist aus Polyethylen chlor- und schwefelfrei hergestellt. Diese umweltfreundliche Folie verhält sich grundwasserneutral, ist voll recyclingfähig und verbrennt in Müllverbrennungsanlagen völlig ungiftig.
Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne kostenlos unser Verlagsverzeichnis zu:
Ares Verlag GmbH
Hofgasse 5/Postfach 438
A-8011 Graz
Tel.: +43 (0)316/82 16 36
Fax: +43 (0)316/83 56 12
E-Mail: [email protected]
www.ares-verlag.com
ISBN 978-3-99081-103-0
eISBN 978-3-99081-137-5
© Copyright by Ares Verlag, Graz 2022
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger jeder Art, auszugsweisen Nachdruck oder Einspeicherung und Rückgewinnung in Datenverarbeitungsanlagen aller Art, sind vorbehalten.
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Tabellen- und Abbildungsverzeichnis
Tabellen
Abbildungen
Vorbemerkungen
Einleitung
1Medienbegriff und Medientheorien
1.1Medienbegriff
1.2Medientheorien
1.2.1Generelle Medientheorien
1.2.2Generelle Medienontologien
2Mediengeschichte
2.1Allgemeines
2.2Geschichte des Internets
2.2.1Der Einfluss des Militärs
2.2.2Akademischer Einfluss
2.2.3Gegenkultur
2.2.4Öffentliche Dienstleistung
2.2.5Kommerzieller Einfluss
2.2.6Sozialer Einfluss & soziale Medien
2.3Geschichte des Computers
2.3.1Mechanisches Zeitalter
2.3.2Zeitalter der Großrechner
2.3.3Zeitalter der Personalcomputer (PC)
2.3.4Post-PC-Zeitalter
3Mediennutzung und Medienvertrauen
3.1Europäische Union
3.2Republik Österreich
3.3Bundesrepublik Deutschland
4Alte und neue Öffentlichkeit
5Echokammer, Filterblase und Hasssprache – Begriffe aus der Memefabrik?
5.1Echokammer & Filterblase
5.2Hasssprache
5.2.1Messung der Häufigkeit in der Wissenschaft
5.2.2Löschberichte der digitalen Großkonzerne
5.2.3Ausmaß der wahrgenommenen Hasssprache und ihre nutzerbezogenen Dimensionen
5.2.4Anzeigen und Verurteilungen: Daten aus dem Staatsapparat
6Gesetze zur Regulierung des Internets
6.1Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG)
6.1.1Vorlauf
6.1.2Beschluss
6.1.3Gesetzesnovellen
6.1.4Weitere Verschärfungen
6.2Kommunikationsplattformengesetz (KoPl-G) und Hass-im-Netz-Bekämpfungsgesetz (HiNBG)
6.2.1Vorgeschichte
6.2.2Zwischenspiel: Die Taten der schwarz-blauen-Koalition
6.2.3Der vorläufige Endpunkt: Die Gesetze
6.3Gesetz über digitale Dienste (Digital Services Act)
7Aspekte der Medienwirkung
7.1Medien und Gewalt
7.2Einfluss von Medien auf die Meinung
8Die Rechte und das Internet
8.1Zwischen Meinungsäußerungsfreiheit und Zensur
8.2Die juristische und parteipolitische Front
8.2.1Rechtliche Kämpfe
8.2.2Handlungen von FPÖ und AfD
8.3„Alt-Tech“ als tatsächliche Alternative?
8.4Bekämpfen der Fluchtursachen und der mögliche kollektive Nutzen
8.4.1Anrecht auf soziale Medien
8.4.2Ermöglichen einer digitalen Agora
8.5Soziale Medien sind keine Wunderwaffe
8.5.1Die Unveränderlichkeit akzeptieren?
8.5.2Sackgasse digitale 68er?
9Bibliographie
Tabellen- und Abbildungsverzeichnis
Tabellen
Tabelle 1: Übersicht über repressiven und emanzipatorischen Mediengebrauch nach Enzensberger (1970: 173).
Tabelle 2: Darstellung der Entwicklung des Internets hinsichtlich zeitlich geordneter Einflussfaktoren nach Balbi & Magaudda (2018: 70).
Tabelle 3: Schematisierung der Möglichkeiten unterschiedlicher Massenkommunikationsmittel (eigene Darstellung).
Tabelle 4: Übersicht über die Internetentwicklung (angelehnt an Ebersbach et al. 2016: 14).
Tabelle 5: Charakteristika des Web 2.0 im Gegensatz zum Web 1.0 (cf. Taddicken & Schmidt 2017: 8).
Tabelle 6: Die Geschichte des Computers in der Übersicht (cf. Balbi & Magaudda 2018: 28).
Tabelle 7: Vertrauenswerte in Medien im EU-Schnitt sowie für die BRD und Österreich im Jahresvergleich.
Tabelle 8: NetzDG-Beschwerden bzw. -Maßnahmen (Löschungen/ Sperren) gesamt und für behauptete Volksverhetzungen für Twitter.
Tabelle 9: NetzDG-/ KoPl-G-Beschwerden bzw. -Maßnahmen (Löschungen/ Sperren) gesamt und für behauptete Volksverhetzungen/ Verhetzungen für Facebook.
Tabelle 10: NetzDG-/ KoPl-G-Beschwerden bzw. -Maßnahmen (Löschungen/ Sperren) gesamt und für behauptete Volksverhetzungen/ Verhetzungen für Instagram.
Tabelle 11: NetzDG-/ KoPl-G-Beschwerden bzw. -Maßnahmen (Löschungen/ Sperren)
gesamt und für behauptete Volksverhetzungen/ Verhetzungen für YouTube.
Tabelle 12: NetzDG-/ KoPl-G-Beschwerden bzw. -Maßnahmen (Löschungen/ Sperren) gesamt und für behauptete Volksverhetzungen/ Verhetzungen für TikTok.
Tabelle 13: Daten aus LAMNRW (2021: 4) für die angegebenen Jahre in Prozent.
Tabelle 14: Prozentwerte aus LAMNRW (2021: 7) für die angegebenen Jahre.
Tabelle 15: Zustimmungsangaben ausgewählter Aussagen und Jahre in Prozent aus LAMNRW (2021: 10).
Tabelle 16: Jahresvergleich der Anzeigen politisch motivierter Delikte (gebündelt und gesondert für links- und rechtsextrem) sowie der Gesamtanzahl der jährlichen Anzeigen in Österreich.
Tabelle 17: Übersicht über die Anzeigen bzw. Verurteilungen bezüglich Verstöße gegen das Verbotsgesetz und den Verhetzungsparagraphen im Jahresvergleich inkl. Verurteilungsraten.
Tabelle 18: Anzahl an jährlichen Anzeigen in der Deliktgruppe „Politisch motivierte Kriminalität“ (PMK) in der BRD für links- und rechtsmotiviert;
Tabelle 19: Berechnungen zu so genannten „Hasspostings“ im Jahresüberblick. Alle Daten entstammen den bereits zitierten PMK-Statistiken.
Tabelle 20: Darstellung wegen Volksverhetzung verurteilter Personen nach der „Strafverfolgungsstatistik“
Abbildungen
Abbildung 1: „Tägliche oder fast tägliche“ Mediennutzung in den EU-Staaten im Zehnjahresvergleich (cf. EU-Kommission 2021: 9; 2012: 6).
Abbildung 2: Die „tägliche“/ „fast tägliche“ Mediennutzung im Jahr 2021 in der BRD und der Republik Österreich (cf. EU-Kommission 2021).
Abbildung 3: Prozentuelle Zustimmungswerte je Kategorie zum Thema nationale Medien.
Abbildung 4: Meistgenutzte Plattformen des Jahres 2020 für österreichische Jugendliche im Alter von 11 bis 17 Jahren.
Abbildung 5: Ausgewählte, täglich benützte Medien zur medialen Freizeitbeschäftigung der Befragten im Zweijahresvergleich (cf. Feierabend et al. 2020a: 12; 2021: 16).
Abbildung 6: Verteilung der täglichen Internetnutzung nach „konkreten Tätigkeiten“.
Abbildung 7: Inhaltliche Verteilung der Internetnutzung in Prozent im Jahresvergleich (cf. Feierabend et al. 2020b: 34-35).
Abbildung 8: Verteilung der täglichen Nutzung ausgewählter sozialer Medien.
Abbildung 9: „Täglich“ bzw. „mehrmals pro Woche“ genutzte „Online-Angebote“ im Jahresvergleich (cf. Feierabend et al. 2020a: 30; 2021: 38).
Abbildung 10: Monatlich aktive Benutzer weltweit ausgewählter Social-Media-Plattformen 2020, gemessen in Milliarden.
Abbildung 11: Verteilung der Antworten zur Behauptung: „Die Bevölkerung in Deutschland wird von den Medien systematisch belogen“ (cf. Jakobs et al. 2021: 154).
Abbildung 12: Gegebene Antworten zur Aussage: „Die Medien und die Politik arbeiten Hand in Hand, um die Meinung der Bevölkerung zu manipulieren“ (cf. Jakobs et al. 2021: 154).
Abbildung 13: Angegebene Werte zur Behauptung: „Die Medien sind in der Bundesrepublik lediglich ein Sprachrohr der Mächtigen“ (cf. Jakobs et al. 2021: 154).
Abbildung 14: Dargestellt sind Antworten auf die Aussage: „Die Medien untergraben die Meinungsfreiheit in Deutschland“ (cf. Jakobs et al. 2021: 154).
Abbildung 15: Angeführte Werte zu den abgefragten Medien als „sehr“/ „eher vertrauenswürdig“.
Abbildung 16: Vom Portal „Jugenschutz.net“ erhobene und klassifizierte Fälle zum Thema „Rechtsextremismus“ (cf. Ipsen et al. 2021: 31).
Abbildung 17: Anzahl der an die Hass-im-Netz-Beratungsstelle der NGO ZARA gemeldeten Meldungen nach Berichtsjahr (cf. ZARA 2021b: 3).
Abbildung 18: Anzahl der der ADS gemeldeten Hasskommentare laut entsprechender Jahresberichte der Antidiskriminierungsstelle Steiermark (cf. ADS 2020: 18; ADS 2019: 18; ADS 2018: 44; ADS 2017: 39; ADS 2016: 20; ADS 2015: 12).
Abbildung 19: Zustimmung/ Ablehnung zu Aussagen, die sich mit dem Rückzug aus Debatten beschäftigen.
Abbildung 20: Zustimmung oder Ablehnung von Einzelaussagen zu gesellschaftlichen Auswirkungen von Hass im Netz (cf. Geschke et al. 2019: 57).
Abbildung 22: Einzeln dargestellt sind die numerisch größten Blöcke des Deliktbereichs PMK rechtsmotiviert in Prozent für 2020;
Vorbemerkungen
Dieses Buch setzt sich mit einigen vom Mainstream gesetzten Inhalten und Ansichten im Kontext des Internets auseinander. Bereits an der Stelle könnte die Sinnfrage gestellt werden: Warum Energie und Raum darauf verwenden, Themen der tonangebenden Kräfte kritisch zu beleuchten? Wer die Machtposition inne hat, muss ohnehin nicht wirklich argumentieren. Selbst wenn fast schon zu Dogmen erhobene Thesen nicht zuträfen, weil etwa Wissenschaftler sie widerlegt hätten, müssten und würden die Eliten keine Kursänderung vornehmen. Wieso am Ende also widerlegen versuchen (was ob der Volatilität der Thematik ohnehin schwierig ist), wo man damit doch automatisch mitspielt, auf dem Feld des Gegners steht, sein Spiel aufgezwungen bekommt und nur verlieren kann? Nun, das Buch wurde in erster Linie aus Neugier verfasst und beschränkt sich auch nicht auf die Beschäftigung mit Hate Speech und Ähnlichem. Es soll zudem auch einen informativen Charakter haben und kein reines Gegenbuch sein. Nicht selten entsteht der Eindruck, dass in großen Teilen der Rechten zwar moderne Medien hoffnungsvoll-schwärmerisch eingesetzt werden, aber die Reflexionsarbeit etwas vernachlässigt wird. Trotzdem wäre es für die Rechte bedeutend(er), eigene Themen und Ideen aufzubringen, voranzutreiben und nach Macht zu streben.
Das Buch leistet sich aus Gründen der Lesbarkeit, des Platzes und des Anspruchs Ungenauigkeiten, die bei einem gesellschaftspolitischen Buch jedoch als verkraftbar angesehen werden: Es wird keine detaillierte Quellenarbeit abgeführt, gerade dann nicht, wenn es sich um zitiertes Wissen aus Einführungen etc. handelt (d. h. deren zitierte Quellen werden nicht extra angeführt bzw., außer unbedingt nötig, ausgehoben). Zudem ist es so, dass in diesem Buch eine Fülle von Quellen unterschiedlicher Art und, wenn man so will, Qualität herangezogen wird. Es wurde aus denselben Gründen davon Abstand genommen, stets eine Quellenkritik vorzunehmen. Das bedeutet auch, dass neben akademischer Literatur genauso journalistische Quellen, offizielle Statistiken, Umfrageergebnisse, politische Blogs, Telegram-Nachrichten, YouTube-Videos etc. zitiert und verarbeitet werden. Ein Teil der verwendeten Quellen (Videos, Tweets und Ähnliches) ist neben anderen Anmerkungen im Fußnotenapparat, der andere (Berichte, Bücher usw.) in der Bibliographie am Ende des Buches angeführt. Mit einem Wort erhebt das Buch keinen wissenschaftlichen Anspruch, soll aber dennoch Nachvollziehbarkeit gewährleisten.
Womöglich fühlen sich Leser motiviert, die Lektüre zu vertiefen, anders zu interpretieren oder selbst ein besseres Buch zu verfassen. Ansonsten könnte es zum Aufhübschen des Bücherregals oder zum Heizen dienen, selbstredend aber keinesfalls zum „Entglasen von Geschäften“1.
Thorsten Seifter
Dezember 2022
1 So eine Widmung der Rechtsextremismusexpertin Natascha Strobl in einem von ihr mitverfassten Buch über die Identitären. Cf.: Die Presse. 23.5.2014. Identitäre Bewegung: Rechts oder rechtsextrem? Verweis: https://www.diepresse.com/3811210/identitaere-bewegung-rechts-oder-rechtsextrem, zuletzt abgerufen am 1.12.2021.
Einleitung
Mit den sozialen Medien avancierten die Bürger selbst zu Produzenten, ihr Dasein als bloße Empfänger von Informationen gehörte der Vergangenheit an. Kritische, vom hegemonialen Mainstream abweichende Meinungen umgingen die ehemals übermächtigen Torwächter der Informationsbeschränkung in Medien und Politik relativ problemlos. Diese emanzipatorische Entwicklung rief besonders bei den genannten Institutionen Abwehrreaktionen hervor, da sie Autoritätsverluste befürchteten. Dabei ist es nach wie vor zu spüren, dass es sich um eine Angst vor Erosion des etablierten Systems und seinem Wertefundament handelt. In zum Teil hysterischen Beschwörungen werden die sozialen Medien mittlerweile zur Ursache für die vermeintlich oder tatsächlich zunehmende Spaltung der Gesellschaft oder überhaupt zur Gefährdung der Demokratie erklärt. Hass, Hetze, Lügen gegen bzw. über Politiker, Frauen, Ausländer, Homosexuelle, Menschenrechte usw. stünden an der Tagesordnung, begünstigt und verstärkt durch Echokammern und Filterblasen. Die Gegenwehr sei viel zu schwach und die rechten, verschwörungstheoretischen oder sonst wie böswillig veranlagten Profiteure der sozialen Medien zu gewitzt – sie beförderten inzwischen durch ihre Online-Aktivitäten schon Wahlerfolge so genannter Rechtspopulisten. Dräut eine politische Wende? Schwenken autoritäre Rechte bereits die Fahnen, zumindest vor dem Computerbildschirm? Müssen Minderheiten wieder kollektiv um ihr Leben bangen, im Netz und auf der Straße?
Abseits der Aufregung könnte die Frage gestellt werden, ob Inhalte in sozialen Medien nicht auch gesellschaftliche Phänomene offenlegen, die ansonsten unterbelichtet blieben oder von oben einseitige, unwidersprochene Deutungen erführen. Sachgerechter wäre es womöglich, wenn manche Beiträge im Netz als Folge oder Reaktion einer andauernden Heterogenisierung und Individualisierung der Gesellschaft gesehen würden. Vor diesem Hintergrund könnten Moralwächter und Streiter für die aktuell geltende gute Sache (Multikulturalismus, Feminismus, LGBTQ etc.), anstatt sich als Ankläger zu gerieren, über eigene (Mit-)Verantwortungen an bestimmten Entwicklungen nachdenken. Wohlfeiler und lukrativer ist es dagegen, den verbissenen Kampf gegen Rechts auch auf digitaler Ebene zu führen. Publizisten fordern denn auch, dass „Demokraten nicht darauf verzichten [können], die Möglichkeiten eines digitalen Antifaschismus wahrzunehmen.“ (Fielitz & Marcks 2020: 219) Die Drohkulisse muss entsprechend groß sein, was zur Folge hat, dass nicht nur der ach so böse, so genannte politische „Narrensaum“ (Andreas Mölzer) ins Visier gerät, sondern auch Menschen, die schlicht nur als rechts gewertete Kritik an politischen Entwicklungen üben, eigentlich aber keine andere Ordnung anstreben.
Wenn der von Experten wie Natascha Strobl und einigen anderen erhobene Radikalisierungsvorwurf nach rechts (der im Prinzip ein Extremismusvorwurf ist und sein soll; cf. Strobl 2021: 27, 39, 91, 148, passim) bis in die viel zitierte, für die Demokratie als tragend geltende bürgerliche Mitte unserer Tage reicht, wird es absurd. Denn selbst nach einer der diskussionswürdigen „Mitte“-Studien weisen in der BRD nur 4% der Befragten ein „geschlossen rechtsextremes Weltbild“ auf (Decker et al. 2020: 51). In derselben Untersuchung stimmen 93% der „Demokratie als Idee“ zu (Decker et al. 2020: 60). Für wiederum 87% („stimme sehr“ oder „ziemlich“ zu) der Österreicher ist die Demokratie „die beste Staatsform, auch wenn sie Probleme mit sich bringen mag.“ (Zandonella 2020: 10) Wie radikalisiert oder extrem(-istisch) kann die Mitte, aber auch insgesamt dieses Volk dann schon sein? Die Mitte hat sich überdies in den letzten Jahrzehnten nach links geöffnet, kaum nach rechts. Sie ist dementsprechend, zumindest im organisierten Bereich, im Kampf gegen Rechts tatkräftig engagiert, wenn auch der antifaschistische Eifer links von ihr natürlich größer ist. Es mag sich der Furor in der breiten Mitte auf nicht-parteipolitischer Ebene udgl. bisweilen etwas abschwächen2, doch wird den Abweichlern, nicht zuletzt im Internet, mittels rigider kommunikationslenkender Maßnahmen deutlich gemacht, was erwünscht ist und was nicht.
Während (radikale) Rechte als Hauptbetroffene von Ausgrenzung, Verteufelung und Einschnitten in die Meinungsäußerungsfreiheit aus Überzeugung versuchen werden, dem System weiterhin zu trotzen, könnte es in anderen Kreisen zu einer Schere im Kopf führen. Das könnte für die liberale Demokratie mit ihren sonst so betont wichtigen Grundrechten wie eben jenes der Meinungsäußerungsfreiheit schädlich sein und insofern mit Sorge gesehen werden. In einer „Allensbach“-Umfrage in der BRD wurde die Frage gestellt, ob die Befragten „das Gefühl [haben], dass man heute in Deutschland seine politische Meinung frei sagen kann, oder [es besser ist], vorsichtig zu sein?“ 2021 bejahten diese Frage nur mehr 45%, der Wert lag 2003 noch bei 72% und fiel seither stetig (cf. Petersen 2021: Schaubild 1). Ist das das Resultat einer von Rechten u. a. durch das Internet verhetzten Mehrheit, die nun unter Realitätsverlust leidet? Möglicherweise wurden und werden durch diese Argumentation und Handlungen in Sachen Meinungsäußerungsfreiheit, die immer stärker im Netz Thema ist, dem rechten Rand plötzlich selbst von Anschwärzungen, Löschungen oder Sperren betroffene Menschen aus der Mitte zugetrieben.
Solche digitalen Verdrängungsprozesse sind Teil des politischen, aber auch ökonomischen Kampfes unserer Tage und sicherlich keine Lappalie. Wer ist neben Personen, Parteien und Organisationen des Establishments dafür noch verantwortlich? Definitiv auch die sozialen Medien (Big Tech) selbst. Diese sind nicht sakrosankt, kein Geschenk von fleißigen US-Unternehmern bzw. deren Investoren, die die Welt verbessern wollten. Wir leben im Kapitalismus, in erster Linie geht es darum, möglichst viel Profit zu erwirtschaften, dabei alle möglichen sozialen, kulturellen oder fiskalischen Hürden aus dem Weg räumend bzw. umgehend. Gleichzeitig gibt es einen gesellschaftlich wirksamen Zeitgeist, der hier als linksliberal bezeichnet wird. Dieser zeichnet sich dadurch aus, dass er das Kapital nicht attackiert, sondern für favorisierte Gruppen finanziell und sprachlich-kulturell etwas herausschlagen möchte. Man schwingt sich etwa als NGO als Kämpferin für angeblich von Weißen marginalisierte, unterjochte Gruppen auf und trommelt gegen Rassismus usf. Ein kapitalistisches Unternehmen nun will aus pragmatisch-ökonomischen und/ oder geteilten ideologischen Gründen Teil davon sein – das ist das woke capital im Sinne eines sensibilisierten Handelns für soziale Belange. Das ist kommod, denn Großunternehmen können damit sehr gut asoziale (volks- und völkerfeindliche) Handlungen für die Gier Weniger weiterführen und gelten durch z. B. Spenden an Black Lives Matter als moralisch integer und die Zivilgesellschaft ist ruhiggestellt. An den Grundfesten des kapitalistischen Systems wird natürlich dann nicht mehr gerüttelt, ein eklatantes Versagen der Linken, wie Bernd Stegemann schreibt3:
„Die ‚woken‘ Linken sind die Kettenhunde des Kapitals, denn sie halten sein Image sauber, indem sie schmutzige Worte anprangern und diese Reinheit als zivilisatorischen Gewinn verkaufen. Die Ausbeutung der Welt steigert sich, aber wir versehen die Ausgebeuteten heute mit einem Gendersternchen.“
Nicht-linke Akteure müssen sich in Anbetracht der Übermacht digitaler Konzerne aber auch positionieren. Wahrnehmbare Ansichten in dieser Frage reichen von libertären bis hin zu antikapitalistischen Perspektiven und differieren insofern klarerweise. Für die Rechte gilt, wie einige Leser monieren werden, dass diese Weltanschauung nur mit kapitalismuskritischen oder gar antikapitalistischen Standpunkten vereinbar sei, es wird aber auch andere selbstidentifizierte Rechte geben, die wirtschaftsliberaler denken, gesellschaftspolitisch aber deshalb bspw. nicht für die Homoehe eintreten wie etliche Liberalkonservative4.
Während Libertäre (um einen Extrempunkt zu nennen) behaupten könnten, der Staat sei schuld am virulenten Thema der Zensur, ansonsten flottierten die Meinungen frei auf den Plattformen, würden (einige) orthodoxe Rechte die Rolle des Staats bekräftigen und die Unternehmen stärker kontrollieren oder gar zerschlagen wollen. Positionen irgendwo dazwischen würden mal mehr die Unternehmen staatlich regulieren, dann wieder stärker den Markt betonen, etwa in der Hoffnung auf einen reichen, rechten Zampano, der sich mit einem erhabenen, zensurfreien Alternativprodukt im Netz durchsetzen könnte.
Je nach politischer Überzeugung kann auch die Einschätzung über den Umgang der Plattformen oder des Staates mit Verbannungen auseinanderklaffen. Die einen, die eine lebendige Teilhabe des Volkes am politischen Prozess auch durch Aktivitäten in den sozialen Medien ermöglichen wollen – durchaus in Analogie zur direkten Demokratie (dort wie da wird sich davon eine stark reformatorische bis revolutionäre Wirkung versprochen) –, dann andere, die libertär bis anarchistisch gepolt sind und für die ohnehin (fast) nichts (staatlich) bestraft oder reguliert werden soll, und wiederum Elitäre, denen es gar nicht so ungelegen kommt, dass die Masse stärker an die Kandare genommen wird, da sie ein hierarchisch und/ oder ständisches Bild von politischem Wandel, Herrschaft und Sitte verfolgen, aber trotzdem zur Vernetzung, Ideenentwicklung und dergleichen selbst einen möglichst praktikablen Zugang zum Internet benötigen.
Die Digitalisierung, die selbstredend nicht auf die sozialen Medien beschränkt ist, schreitet jedenfalls unaufhaltsam voran und wird im 21. Jahrhundert ein großes Thema bleiben. Der Kampf ums Netz ist bereits voll entbrannt und vollzieht sich vor unseren Augen. Ihn gilt es, zu führen – auch wenn die Erfolgsaussichten der Rechten nicht rosig sind.
2 Die radikale Rechte kritisiert häufig das Bürgertum/ die Mitte und es wäre zu diskutieren, ob eine Ablehnung von CDU, ÖVP und ihren assoziierten Verbänden auch bedeuten soll, den bürgerlichen Menschenschlag pauschal zu verwerfen (aktuell ist er eine verlässliche Systemstütze, könnte/ sollte er das auch von rechts sein?).
3 Freitag. 2020. Wem die Zwietracht nützt. Verweis: https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/wem-die-zwietracht-nuetzt, zuletzt abgerufen am 30.3.2021.
4 Seit einiger Zeit werden in der AfD und in ihrem Vorfeld (zunehmend erbitterte) Kontroversen um die Wirtschaftsfrage geführt, die auch Implikationen für andere Politikfelder hat. Im Kern geht es darum, wer die Schuld am Niedergang der Familie, des Volkes und der Völker, der Kulturen und Traditionen trage. Ist es, holzschnittartig dargestellt, der Marxismus (also die Linken) oder der Kapitalismus (die Liberalen)? In Diskussionen fallen dazu häufig die Begriffe „Kulturmarxismus“ bzw. „kultureller Kapitalismus“, womit auf die gesellschaftspolitischen Manifestationen der jeweiligen ökonomischen Position abgehoben wird.
1Medienbegriff und Medientheorien
1.1Medienbegriff
Das lateinische Adjektiv „medius“ bedeutet (unter anderem) „in der Mitte befindlich“, „dazwischen liegend“; unter dem Substantiv „medium“ wird „Mitte“ oder „Mittelpunkt“ verstanden. Die Anwendungen des Begriffs sind mannigfaltig und mitunter breit gefasst, z. B. wurde die Kontakt zu den Geistern Verstorbener herstellende Mittelsperson im Spiritismus des 18. und 19. Jahrhunderts als Medium bezeichnet, und auch Medientheoretiker im 20. Jahrhundert weiteten den Begriff auf alle möglichen Objekte aus (cf. Hickethier 2010: 18-19). Es gibt also keine einheitliche und eindeutige Bestimmung des Begriffs Medium (cf. z. B. Kloock & Spahr 2012: 9-12; Wersig 2009: 115; Ziemann 2012: 16; Helmes & Köster 2002: 15), es hängt von der eingenommenen Perspektive ab. Frühe Reflexionen über Medien (in dem Fall: das Medium der Schrift) nahmen Aristoteles, Sokrates oder Platon vor, wonach ohne Vermittlung durch ein Medium der Mensch nichts wahrnehmen könne (cf. Ströhl 2014: 16) – versehen mit der Befürchtung „einer Verkümmerung des Gedächtnisses“ durch die Schrift, womit eine bis heute nachwirkende Medienkritik geäußert wurde (cf. Helmes & Köster 2002: 17).
Der Uneinheitlichkeit des Medienbegriffs bzw. der Medien als solche kann mit einem Überblick nach Funktionsarten begegnet werden, bei dem eine Einteilung der Medien in vier Gruppen vorgenommen wird (cf. Hickethier 2010: 21-22):
•Medien der Beobachtung/ Wahrnehmung
Sie dienen der Erweiterung und Steigerung der menschlichen Sinne, z. B. die Brille oder das Megaphon.
•Medien der Speicherung und der Bearbeitung
Sie zeichnen Informationen auf, um diese u. a. für eine weitere Bearbeitung zur Verfügung zu haben, z. B. die Fixierung des durch die Kamera Festgehaltenen auf das Filmband als Voraussetzung für Schnitt und Montage. Grundlegender wäre etwa die Schrift als Speichermedium des Gedächtnisses.
•Medien der Übertragung
Diese transportieren Informationen von einem Ort zu einem anderen, z. B. die Brieftaube, Telegraphensysteme, Kabelnetze oder Satellitenübertragungssysteme. Medien haben die Tendenz, Funktionen anzuhäufen, so war das Telefon zunächst ein Übertragungsmedium und gewann mit dem Anrufbeantworter auch eine Speicherfunktion.
•Medien der Kommunikation
Sie stellen die Kommunikation zwischen mehreren Menschen auf komplexe Weise her, indem sie andere Medien der Wahrnehmungserweiterung, Speicherung und Übertragung verbinden bzw. für sich selbst neu entwickeln, was zur Schaffung neuer Kommunikationsräume führt (demnach wären Computer und Internet die technischen Bedingungen für das eigentliche Medium Homepage usw.; cf. dazu auch Burkart 2019: 41). Hickethier gibt zwar keine Beispiele, aber hier könnten auch die computerbasierten Medien mitgemeint sein.
Diese recht stark an die Technik angelehnte Klassifikation (cf. Sucharowski 2018: 91) ist in der Medienwissenschaft gängig. Auch sonst werden in der Wissenschaft wie im Alltagsverständnis technische Aspekte der Medien hervorgehoben, was auch der Historie geschuldet ist (die technische Herangehensweise Shannon & Weavers 1949 war Anstoß für eine Theorie der Kommunikation).
Eine weitere diesbezüglich bekannte Aufstellung ist jene von Harry Pross aus den 1970er Jahren. Er teilt Medien in „primäre“, „sekundäre“ und „tertiäre“ ein, je nach ihrer Abhängigkeit von der Technik. Während bei menschlicher Sprache, Gestik oder Mimik keine technischen Hilfsmittel nötig seien („primär“), müssten bei sekundären Medien auf der Produktionsseite Technik zum Einsatz kommen (z. B. bei der Schrift, etwa ein Stift oder eine Schreibmaschine). Bei tertiären Medien brauche es bei Produktion und Rezeption Technik, wie bei Telegraphie, Film oder Internet (cf. Sucharowski 2018: 90-91; Böhn & Seidler 2014: 17-18). Zwar wurde Pross‘ Systematik noch um „quartäre“ – computerbasierte, internetbezogene – Medien erweitert (cf. Burkart 2019: 37), jedoch ist dies eher als eine Ergänzung zu den tertiären Medien und weniger als eigenständige Gruppe zu sehen, zumal die Frage der Rolle zwischen Sender und Empfänger (wie bei sozialen Medien etc. gegenüber Presse oder Fernsehen) bei Pross kein Kriterium darstellt.
Ist heute im Alltagsgebrauch von „Medien“ die Rede (selten nur von „Medium“ in der Einzahl), so ist damit zumeist der Sammelbegriff für die technisch apparativen Medien (Film, Fernsehen, Radio, Computer/Internet) gemeint, der sich Ende der 1960er Jahre durchgesetzt hat, als das Fernsehen zum Leitmedium wurde (cf. Hickethier 2010: 20). Diese Medien waren und sind zugleich auch „Massenmedien“ (der Begriff „mass media“ kam in den USA der 1920er Jahre auf, als zu den Massenmedien Presse und Kino noch das Radio hinzutrat; cf. Roesler & Stiegler 2005: 137), d. h. „technisch produzierte und massenhaft verbreitete Kommunikationsmittel, die der Übermittlung von Informationen unterschiedlicher Art an große Gruppen von Menschen dienen.“ (Hickethier 2010: 24) Sucharowski (2018: 91) bestimmt den Begriff sehr ähnlich, aber mit der wichtigen Ergänzung, dass „eine Quelle“ die Verbreitung an viele Empfänger vornimmt, wodurch ein asymmetrisches Verhältnis entsteht. Zudem ist die Kommunikation einseitig, da keine Interaktion zwischen Sender und Empfänger stattfindet. Ferner ist bei Presse, Funk und Fernsehen kein Rollenwechsel von Sender und Empfänger möglich. Dem gegenüber steht die Individualkommunikation, bei der das Medium der Verbindung zweier Personen (d. h. gleichzeitig, dass ein symmetrisches Kommunikationsverhältnis vorliegt) dient. Sender und Empfänger können sich abwechseln und die Kommunikation ist – wie bei Brief oder Telefon – zweiseitig (cf. Böhn & Seidler 2014: 22-23).
Beck (2020: 92) erwähnt im Zusammenhang mit den Massenmedien mit Recht, dass die massenhafte Verbreitung und Nutzung eines Mediums alleine nicht ausschlaggebend sein könne, da ansonsten auch das Telefon ein Massenmedium wäre. Er möchte die Bezeichnung „publizistische Medien“ etablieren, die „weitaus überzeugender und auch weniger negativ besetzt“ sei. Letzteres hängt mit dem Begriff der „Masse“ zusammen, der als „relativ diffus“ und „historisch beladen“ verstanden werde (Hickethier 2010: 24). Diffus deshalb, weil nicht klar sei, ab welcher Größe von Masse zu sprechen wäre und historisch beladen, weil sich in dem Wort „die Ängste der Herrschenden vor den Beherrschten gebündelt“ hätten und Masse dabei etwas Unbeherrschtes, Gewalttätiges oder Automatisches innewohne (Hickethier 2010: 24). Die Masse sei durch Medien leicht zu beeinflussen und zu mobilisieren, wie Hickethier unter Berufung auf Gustave Le Bon festhält. Wegen dieser angeblichen oder tatsächlichen Gefährlichkeit der Massenmedien sei es nach dem Ersten Weltkrieg zu „zahlreichen staatlichen Reglementierungen und Beschränkungen der Medien“ gekommen (Hickethier 2010: 25).
In puncto Massenmedien ist noch der Aspekt hervorzustreichen, dass deren Ende trotz sozialer Medien nicht in Sicht ist, erstere hätten sich sogar behauptet, auch, weil sie selbst ins Digitale übergetreten seien und dort ihre Funktion der aufgefangenen, selegierten und redigierten dezentralisierten Botschaften, die in der Gesellschaft umherschwirrten, zu erfüllen versuchten. Diese Synthese fehle den zersplitterten Gruppen und Personen in den sozialen Medien (cf. Burkart 2019: 130).
Es bietet sich nun für die sozialen Medien eine Zusammenführung verschiedener Ansätze an. Zum einen muss Abstand von weiten Begriffsverständnissen genommen werden, sondern ein enges, semiotisches, womit die übertragene menschliche Kommunikation klar umfasst ist. Zum könnte der technische Medienbegriff von Pross herangezogen werden, allen voran die tertiäre (quartäre) Gruppe. Des Weiteren ist die Unterscheidung nach genutzten Sinneskanälen relevant, nach der sich mit Überschneidungen (Stichwörter: Intermedialität bzw. Medienkonvergenz; cf. Balbi & Magaudda 2018: 154-156; Böhn & Seidler 2014: 159) auditive (Musik), visuelle (Bild) und audiovisuelle (Fernsehen, Film) Medien feststellen lassen (cf. Böhn & Seidler 2014: 21-22). Die sozialen Medien wie Facebook zeichnen sich durch eine Verschmelzung zwischen Individual- und Massenkommunikation aus, da einerseits ein Rollenwechsel zwischen Sender und Empfänger möglich ist und andererseits viele Empfänger durch einen Sender erreicht werden. Noch dazu ist der Sender nicht mehr eine mächtige Institution wie eine Fernsehstation oder eine Zeitung, sondern prinzipiell jeder User. Der Nutzer findet sich in den sozialen Medien auf Plattformen wieder, wo er eigenverantwortlich wie ein Medium agiert.
1.2Medientheorien
Erste explizite Medientheorien sind im frühen 20. Jahrhundert entstanden, ab dann hat sich der Medienbegriff auf das Medium selbst bezogen, ihm wurde dabei ein gewisses Eigenleben zugesprochen (cf. Ströhl 2014: 17; Ziemann 2012: 74). Nach Helmes & Köster (2002: 15) kann von Medientheorie schwerpunktmäßig aber erst seit den 1980er Jahren gesprochen werden, von da an hätten sich Begriff und Theorie immer mehr entfaltet.
Im Folgenden werden ausgewählte medientheoretische Zugänge in gebotener Kürze besprochen, für weitere kann z. B. die im Verlauf angeführte Literatur konsultiert werden5. Nach Leschke (2001) könne u. a. zwischen „generellen Medientheorien“ und „generellen Medienontologien“ unterschieden werden. Werde auf die „Erklärung eines Systems von Medien“ (Leschke 2001: 15) abgezielt, wo unterschiedliche Medien in ihrer sozialen Funktion etc. in Verhältnis gesetzt würden, ist bei ihm von generellen Medientheorien die Rede. Es werde dabei auf Paradigmen anderer Disziplinen zurückgegriffen, weshalb nicht von eigenständigen Medientheorien die Rede sein könne. Generelle Medienontologien wiederum gingen über die generellen Medientheorien hinaus und zeichneten sich dadurch aus, dass sie das Mediensystem insgesamt sowie nicht aus der Perspektive einer Nachbardisziplin erklären wollten (für Einzelheiten cf. Leschke 2001: 16-38).
1.2.1Generelle Medientheorien
1.2.1.1Walter Benjamin und der Verlust der „Aura“
Für Benjamin hängt die Aura ursprünglich mit der Einbettung des Kunstwerkes in ein magisches, später religiöses Ritual zusammen (cf. Benjamin 2017: 21); hierin liege der „einzigartige Wert des ‚echten‘ Kunstwerks“ (Benjamin 2017: 22). Die massenhafte Reproduktion, ermöglicht etwa durch Fotographie, löse das Kunstwerk aus seiner Tradition, die es mit einem Ort und einer Zeit verbinde, heraus. Dabei sei die Verwurzelung für Benjamin gerade das Einmalige eines Kunstwerkes; etwas, das seine „Echtheit“ determiniere (cf. Benjamin 2017: 13). Durch die Ortlosigkeit komme das Kunstwerk dem Betrachter entgegen, wie ein Chorgesang, der – eigentlich in einem prächtigen Saal aufgeführt – durch Übertragungstechniken auch im Zimmer eines Hörers vernommen werden könne (cf. Benjamin 2017: 15). Das führe wiederum dazu, das Reproduzierte zu „aktualisieren“ (Benjamin 2017: 17), sprich, aus seiner historischen Gestalt herauszubrechen.
Für Benjamin ist besonders die Geschichte der Photographie von Interesse, da sie als technisches Medium einerseits in der geschichtlichen Phase der Aura und andererseits in der von der technischen Reproduktion geprägten Erfahrungswelt angesiedelt sei (cf. Roesler & Stiegler 2005: 33). Die frühere Photographie und hier insbesondere die so genannte Daguerreotypie (nach dem Franzosen Louis Daguerre) habe er noch in der Phase der Aura gesehen, ab Mitte des 19. Jahrhunderts habe dann „die Erfahrung des Gleichartigen, Seriellen“ (Roesler & Stiegler 2005: 33) den Ton angegeben und die Aura sei verfallen.
Benjamins These, dass mit der Reproduktion eines Kunstwerks das Original durch Auraverlust seine Einmaligkeit einbüße, wurde insofern widersprochen, als dass gerade durch die Vervielfältigung eines Originals die Erinnerung bzw. der Verweis auf das Original vorhanden bleibe, dessen Unersetzbarkeit dadurch sogar unterstrichen werde (cf. Geimer 2017: 145). Widerspruch wurde auch gegen seine Behauptung, dass durch die Reproduzierbarkeit eines Fotos, bei der viele identische Abzüge möglich seien, „die Frage nach dem echten Abzug keinen Sinn“ mache (Benjamin 2017: 24), eingelegt: Da sich die Fotographie als Kunst etablieren konnte, wurde dem Foto der Status eines Meisterwerkes zugesprochen, was wiederum der Echtheit als Kennzeichen des Originals Auftrieb verlieh und keine Abwertung bedeutete (cf. Geimer 2017: 145).
Was bei Benjamin kulturkonservativ klinge (cf. Michalski 2015: 147), verdecke bis zu einem gewissen Grad dessen emanzipatorischen Blickwinkel (cf. z. B. Danko 2012: 29). Er spreche der „Technik des Films“ ein gesellschaftsveränderndes Potential zu, da jeder zum Darsteller werden könne. Benjamin zieht eine Parallele zur Entwicklung des Schrifttums, wo sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts das Verhältnis von Schreibenden und Lesenden (wenig Schreiber, viele Leser) verschoben habe: „[D]ie Unterscheidung zwischen Autor und Publikum [ist] im Begriff, ihren grundsätzlichen Charakter zu verlieren […] Der Lesende ist jederzeit bereit, ein Schreibender zu werden“ (Benjamin 2017: 47); die „literarische Befugnis“ werde zu „Gemeingut“ (Benjamin 2017: 48). Umgelegt auf den Film bestehe prinzipiell die Möglichkeit, den Massen nicht nur all die Illusionen der Filmindustrie verkörpert durch professionelle Schauspieler vorzusetzen, sondern das Leben von und durch normale Menschen zu zeigen (cf. Benjamin 2017: 50). In Widerspruch zur vorhergehenden Kritik ist es also denkbar, durch diesen abermaligen Autoritätsverlust samt abnehmender Asymmetrie gesellschaftsumwälzende Prozesse in Gang zu setzen, da beispielsweise der triste Alltag in einer sozial und wirtschaftlich prekären Lebenswelt verfilmt werden kann.
Benjamin schreibt, dass die technische Reproduzierbarkeit samt Auraverlust „eine revolutionäre Kritik der überkommenen Vorstellungen von Kunst“ befördere. Zudem begünstige der Film „eine revolutionäre Kritik an den gesellschaftlichen Verhältnissen“ (Benjamin 2017: 45). Durch die technischen Möglichkeiten des Filmes (z. B. die Betonung versteckter Details, Zeitlupe usw.) könne der Film die (unsere) „Kerkerwelt mit dem Dynamit der Zehntelsekunden“ sprengen. Damit könnten „wir nun zwischen ihren weitverstreuten Trümmern gelassen abenteuerliche Reisen unternehmen“ (Benjamin 2017: 60), uns also neue Perspektiven eröffnen. Er sieht im Film die Möglichkeit, dass Kunstwerke in der nach Zerstreuung suchenden Masse „versenkt“ würden, aber mehr durch „beiläufiges Bemerken“ und „Gewöhnung“ (Benjamin 2017: 71, 72) denn als eigenständige Vertiefung. Für Benjamin ist dies jedoch ausreichend, da die durch die Kunst vermittelten „Aufgaben“ von der Masse so aufgenommen und auch gelöst werden könnten (cf. Benjamin 2017: 72). Die Berieselung im Kino ist also für Benjamin durchaus nutzbar wie generell für ihn die Integration der Medien ins Kunstsystem kulturrevolutionäre Züge trage (cf. Leschke 2001: 26-27).
Die Thesen, dass das Kino eine zerstreute Rezeption lanciere, es die kritische Stellungnahme des Zuschauers fördere und die filmischen Wirklichkeitskonstruktionen einer Reihe von optischen Tests unterziehe, sei – so die Kritik – vom Kino selbst widerlegt worden (cf. Kreimeier 2001: 448). Unter den ökonomischen und technischen Bedingungen der Kinematographie hätten sich die von Benjamin attribuierten Qualitäten nicht entfaltet. Der Film ziele nicht auf kritische Begutachtung, sondern auf Suggestion, nicht auf die Haltung des Testens, sondern auf Verzauberung. Trotz der tendenziell unendlichen Reproduzierbarkeit seiner Bildwelten, habe das Kino neue Kultwerte und kultische Unterwerfungsriten hervorgebracht (cf. Kreimeier 2001: 448).
Wäre es vor dem Hintergrund des Besprochenen nachvollziehbar, in unserer Zeit durch Internet und insbesondere soziale Medien im Sinne Benjamins ebenfalls einen gesellschaftspolitischen Wandel zu erwarten? Die sozialen Medien wie Instagram oder Facebook lassen schließlich fast keinen Raum mehr für Echtheit, da alles fotografiert, in Videos aufgenommen, mit Filtern usw. versehen, d. h. technisch reproduziert wird. Die Vertreter der Politik etwa sind ohne (soziale) Medien gar nicht mehr denkbar und auch die Frage der Authentizität oder gar Einmaligkeit wirkt anachronistisch. Welche Erhabenheit soll von einem führenden Staatsmann ausgehen, der in allen möglichen und unmöglichen Situationen drapiert wird wie eine wandelnde Schaufensterpuppe? Für die politische Klasse ist die Nutzung der sozialen Medien nicht mehr wegzudenken, möglicherweise aber schadet sie sich damit selbst.
1.2.1.2Max Horkheimers und Theodor Adornos „Kulturindustrie“
Wird bei Benjamin die Integration der Medien in das Kunstsystem und Letzteres wiederum in die kapitalistische Produktionsweise noch positiv betrachtet, stellt sich dieser Integrationsprozess bei Horkheimer & Adorno – bei ihnen begrifflich als Kulturindustrie gefasst – eher als Verfall dar, von dem insbesondere die Kunst betroffen sei (cf. Leschke 2001: 27). Der Markt bestimmt über Ästhetik, standardisiert mit kalkulierten Unterschieden und heroisiert das Durchschnittliche.
Die Autoren verstehen unter „Kulturindustrie“ ein breit gefasstes Konglomerat von Kunst- und Kulturgütern, die von den Massenmedien (Fernsehen, Radio etc.) hervorgebracht würden. Die Kulturindustrie sei ein vereinheitlichendes Instrument der herrschenden kapitalistischen Ordnung (cf. Horkheimer & Adorno 2017: 128-132, 157). Jedes Erzeugnis von ihr dient nur dem Zweck, die Konsumenten gefügig zu halten. Es handelt sich um ein großes, die Menschen in ihren Wünschen manipulierendes Betrugssystem. Sie werden nur scheinbar durch diverse mediale Produktionen bedient, denn in Wahrheit sei alles „in fachmännischer Auswahl gesteuert und absorbiert“ (Horkheimer & Adorno 2017: 130). Verführt werden die Menschen unter anderem damit, dass z. B. ein Kinobesuch als paradiesisches Erlebnis empfunden wird, im Grunde aber dem Alltag möglichst gleichen soll, da das Ziel die Identifikation des Konsumenten mit seinem Dasein sei:
„Indem er, das Illusionstheater weit überbietend, der Phantasie und dem Gedanken der Zuschauer keine Dimension mehr übriglässt, in der sie im Rahmen des Filmwerks und doch unkontrolliert von dessen exakten Gegebenheiten sich ergehen und abschweifen könnten, ohne den Faden zu verlieren, schult er den ihm Ausgelieferten, ihn unmittelbar mit der Wirklichkeit zu identifizieren.“ (Horkheimer & Adorno 2017: 134)
In unserem Wirtschaftssystem wird stets versucht, jegliche Nachfrage zu erfüllen (und eine neue zu erschaffen); für alles Mögliche existieren Nischen, womit das System stabil bleibe: „Unweigerlich reproduziert jede einzelne Manifestation der Kulturindustrie die Menschen als das, wozu die ganze sie gemacht hat.“ (Horkheimer & Adorno 2017: 135) Der Effekt der Kulturindustrie sei anti-aufklärerisch, weil er Bildung selbständig urteilender Individuen verhindere, was aber Voraussetzung für eine demokratische Gesellschaft sei (cf. Roesler & Stiegler 2005: 134).
Auch die Zerstreuung („Amusement“) resultiere in einer Stabilisierung der Herrschaft, denn wer vergnügt ist, sei einverstanden:
„Vergnügen heißt allemal: nicht daran denken müssen, das Leiden vergessen, noch wo es gezeigt wird. Ohnmacht liegt ihm zu Grunde. Es ist in der Tat Flucht, aber nicht, wie es behauptet, Flucht vor der schlechten Realität, sondern vor dem letzten Gedanken an Widerstand“ (Horkheimer & Adorno 2017: 153).
Selbst die Kunstwerke würden eine „Erniedrigung zu Kulturgütern“ erfahren, da sie wegen niedriger ökonomischer Schranken für die Massen zur Verfügung stünden. Die Masse aber trete mit dem Kunstwerk in keine seriöse „Beziehung“, sie beschäftige sich nicht eingehend damit und erkenne den ästhetischen Wert nicht (Horkheimer & Adorno 2017: 169). Man kann hier von einem Auraverlust sprechen, da sie – die „depravierten Kunstwerke“ – zur „bloßen Zugabe“ im Alltag der Massen degradiert würden. Das führe dazu, dass sie „mit dem Schund zusammen“ von den neuen Betrachtern gleichermaßen verworfen würden, gerade weil „alles zu haben [ist]“ (Horkheimer & Adorno 2017: 170). Diese bildungsbürgerlich-elitären Töne von zwei Vertretern der Frankfurter Schule passen so gar nicht in das Bild, das man von Linken bisweilen hat, zumal deren Nachfahren das Bildungssystem in Kollaboration mit den Wirtschaftsliberalen erodiert haben.
Modernere Medien wie der Radio leisten auch keine Abhilfe. Horkheimer & Adorno schreiben, dass noch das Telefon den jeweiligen Sprecher als „Subjekt“ teilnehmen lasse, der Radio als Medium hingegen mache die Menschen „gleichermaßen zu Hörern, um sie autoritär den unter sich gleichen Programmen der Stationen auszuliefern. Keine Apparatur der Replik hat sich entfaltet“ (Horkheimer & Adorno 2017: 129-130). Horkheimer & Adorno wurden dabei für die Vernachlässigung der Rezipientenseite kritisiert, da die Rezeption von Medien als ein aktiver und nicht als passiver Prozess verstanden werde (cf. Roesler & Stiegler 2005: 134; Ziemann 2012: 49, 101). In Anbetracht des düsteren Bildes kann davon ausgegangen werden, dass Adorno und Horkheimer auch über das Internet bzw. die sozialen Medien nicht anders geurteilt hätten.
In einer generellen Kritik wird ins Treffen geführt, dass Adorno und Horkheimer bildungsbürgerliche Maßstäbe an die US-amerikanische Massenkultur angelegt hätten und dabei von Kinofilmen, Schlagerstars und bunten Werbebannern überfordert gewesen seien. Die Autoren hätten in apokalyptischem Ton gegen Kommerz und Verdummung der Massen gewettert; anderorts heißt es auch, dass die Thesen von Adorno und Horkheimer zur Kulturindustrie empirisch nicht hätten belegt werden können (cf. Niederauer & Schweppenhäuser 2018: 3). Eine „Aktualisierung“ der Kulturindustrie sei die viel beachtete Studie „Strukturwandel der Öffentlichkeit“ von Jürgen Habermas (cf. Kap. 4).
Vor dem Hintergrund der Kulturindustrie bespricht Adorno in zwei weiteren Veröffentlichungen das Fernsehen detaillierter (was natürlich keine generelle Medientheorie mehr darstellt, hier aber zur Ergänzung referiert wird). Es falle
„ins umfassende Schema der Kulturindustrie und treibt dessen Tendenz, das Bewusstsein des Publikums von allen Seiten zu umstellen und einzufangen, als Verbindung von Film und Radio weiter. Dem Ziel, die gesamte sinnliche Welt in einem alle Organe erreichenden Abbild noch einmal zu haben, dem traumlosen Traum, nähert man sich durchs Fernsehen und vermag zugleich ins Duplikat der Welt unauffällig einzuschmuggeln, was immer man für der realen zuträglich hält. Die Lücke, welche der Privatexistenz vor der Kulturindustrie noch geblieben war, solange diese die Dimension des Sichtbaren nicht allgegenwärtig beherrschte, wird verstopft.“ (Adorno 1963: 69)
Die Medien der Kulturindustrie seien „derart ineinander gepasst, dass keine Besinnung mehr zwischen ihnen Atem schöpfen und dessen innewerden kann, dass ihre Welt nicht die Welt ist.“ (Adorno 1963: 69-70) In einem Satz: „Je vollständiger die Welt als Erscheinung, desto undurchdringlicher die Erscheinung als Ideologie“ (Adorno 1963: 71). An anderer Stelle spricht er von der Kulturindustrie im Allgemeinen und dem Fernsehen im Speziellen als „Starre“, die nicht „aufgelöst, sondern verhärtet [wird].“ (Adorno 1963: 78) Es verfestigt sich der Eindruck, dass Adorno im Zeitalter des Internets und der sozialen Medien sein Urteil wohl noch verschärft hätte. Denn, so bekräftigt er, schon das Fernsehen – und man könnte das eben auch auf das Netz umlegen – mache die Menschen
„nochmals zu dem, was sie ohnehin sind, nur noch mehr so, als sie es ohnehin sind. Das entspräche der wirtschaftlich begründeten Gesamttendenz der gegenwärtigen Gesellschaft, in ihren Bewusstseinsformen nicht länger über sich selbst, den status quo hinauszugehen, sondern diesen unablässig zu bekräftigen und, wo er etwa bedroht dünkt, wiederherzustellen.“ (Adorno 1963: 70)
Was sich eher abstrakt gesamtgesellschaftlich zeige, kritisiert Adorno auch im Privaten, wenn er dem Fernsehen eine „fatale Nähe“ attestiert. Er schreibt von einer nur „angeblich gemeinschaftsbildenden Wirkung der Apparate“, vor denen sich Familienangehörige und Freunde, „die sich sonst nichts zu sagen wüssten“, „stumpfsinnig“ versammelten. Es werde „die reale Entfremdung zwischen den Menschen und zwischen Menschen und Dingen“ durch den Konsum vernebelt und zum „Ersatz einer gesellschaftlichen Unmittelbarkeit, die den Menschen versagt ist. Sie verwechseln das ganz und gar Vermittelte, illusionär Geplante mit der Verbundenheit, nach der sie darben.“ (Adorno 1963: 74-75) Der „Konformismus im Zuschauer“ sowie die „Befestigung des status quo“ seien Ziel des Fernsehens und der Kulturindustrie (Adorno 1963: 83).
Adorno sieht aber grundsätzlich Chancen, gegen das „Gefälschte und Schlechte“ vorgehen zu können, sofern sich „ein öffentlicher Widerwille dagegen“ bilde (Adorno 1963: 96), der sich in einer „Impfung des Publikums gegen die vom Fernsehen verbreitete Ideologie“ (Adorno 1963: 97) äußere. Wie aber soll ein öffentlicher Widerwille entstehen, wenn sich dieser seit Adornos Zeiten sukzessive bzw. mittlerweile fast ausschließlich medial manifestieren kann und dementsprechend in einem technischen, ökonomischen und ideologischen Rahmen eingehegt wird?
1.2.1.3Hans Enzensbergers und Bertolt Brechts emanzipatorischer Ansatz
Nach dieser negativen Perspektive auf Medien bietet mit Hans Enzensberger ein weiterer Linker einen anderen, positiven (Aus-)Blick, der sich aber über die Jahre eintrüben wird. Enzensberger glaubt, eine „mobilisierende Kraft“ der elektronischen Medien als deren „offenbares Geheimnis“ zu erkennen; ein „politisches Moment“ sei es, „das bis heute unterdrückt und verstümmelt auf seine Stunde wartet“ (Enzensberger 1970: 160). Es gehe demgemäß um die „Entfesselung der emanzipatorischen Möglichkeiten“ der neuen Medien (Enzensberger 1970: 160).
Diese verheißungsvollen Worte lassen Spannung aufkommen, auf welche Weise denn die neuen Medien derart keimhaft revolutionär sein sollen. Zuvor lohnt es sich, darauf hinzuweisen, dass er auf Brecht Bezug nimmt. Dessen so genannte „Radiotheorie“ ist eine von Dritten stammende Einordnung. Es handelt sich dabei aber nicht um eine sonderlich konsistente, von Brecht selbst in Form einer Monographie oder eines ausführlichen Artikels vorgelegte Theorie, sondern um mehrere über einige Jahre publizierte Texte/ Reden (cf. auch die „Anmerkungen“ in Brecht 1967: 14). Brechts Radiotheorie und Enzensbergers eingangs bereits zitierter „Baukasten“ sind bedeutend und würden zur „Standardlektüre“ der Medientheorien gehören (Kloock & Spahr 2012: 8).
Der Rundfunk, schreibt Brecht, habe
„eine Seite, wo er zwei haben müsste. Er ist ein reiner Distributionsapparat, er teilt lediglich zu. Und um nun positiv zu werden, das heißt, um das Positive am Rundfunk aufzustöbern, ein Vorschlag zur Umfunktionierung des Rundfunks: Der Rundfunk ist aus einem Distributionsapparat in einen Kommunikationsapparat zu verwandeln. Der Rundfunk wäre der denkbar großartigste Kommunikationsapparat des öffentlichen Lebens, ein ungeheures Kanalsystem, das heißt, er wäre es, wenn er es verstünde, nicht nur auszusenden, sondern auch zu empfangen, also den Zuhörer nicht nur hören, sondern auch sprechen zu machen und ihn nicht zu isolieren, sondern ihn in Beziehung zu setzen. Der Rundfunk müsste demnach aus dem Lieferantentum herausgehen und den Hörer als Lieferanten organisieren.“ (Brecht 1967: 129)
Das Publikum „[muss] nicht nur belehrt werden, sondern auch belehren“ (Brecht 1967: 131). Folglich fordert er „eine Art Aufstand des Hörers, seine Aktivierung und seine Wiedereinsetzung als Produzent.“ (Brecht 1967: 126) Hier und auch bei Enzensberger kommen in akzentuierter und zuversichtlicherer Weise Aspekte zum Vorschein, die sich auch bei Benjamin und Adorno bzw. Horkheimer & Adorno finden. Brecht fordert gar eine Umwälzung der Verhältnisse:
„Durch immer fortgesetzte, nie aufhörende Vorschläge zur besseren Verwendung der Apparate im Interesse der Allgemeinheit haben wir die gesellschaftliche Basis dieser Apparate zu erschüttern, ihre Verwendung im Interesse der wenigen zu diskutieren. Undurchführbar in dieser Gesellschaftsordnung, durchführbar in einer anderen, dienen die Vorschläge, welche doch nur eine natürliche Konsequenz der technischen Entwicklung bilden, der Propagierung und Formung dieser anderen Ordnung.“ (Brecht 1967: 133-134)
Enzensberger schreibt sehr ähnlich und erhellt, wie er sich die Emanzipation vorstellt und was dabei hinderlich sei:
„Zum ersten Mal in der Geschichte machen die Medien die massenhafte Teilnahme an einem gesellschaftlichen und vergesellschafteten produktiven Prozess möglich, dessen praktische Mittel sich in der Hand der Massen selbst befinden. Ein solcher Gebrauch brächte die Kommunikationsmedien, die diesen Namen bisher zu Unrecht tragen, zu sich selbst. In ihrer heutigen Gestalt dienen Apparate wie das Fernsehen oder der Film nämlich nicht der Kommunikation, sondern ihrer Verhinderung. Sie lassen keine Wechselwirkung zwischen Sender und Empfänger zu: technisch gesprochen, reduzieren sie den feedback auf das systemtheoretisch mögliche Minimum.“ (Enzensberger 1970: 160)
Der Grund dafür liegt für ihn nicht in der Technik, da diese keinen Gegensatz zwischen Sender und Empfänger kenne und jeder Transistorradio grundsätzlich zugleich auch potentieller Sender sei: „Die Entwicklung vom bloßen Distributions- zum Kommunikationsmedium […] wird bewusst verhindert, aus guten, schlechten politischen Gründen.“ (Enzensberger 1970: 160, 169) Enzensberger sieht die „gesellschaftliche Arbeitsteilung zwischen Produzenten und Konsumenten“ in der „Bewusstseins-Industrie“ widergespiegelt. Sie beruhe auf dem Grundwiderspruch zwischen „herrschenden und beherrschten Klassen“ (Enzensberger 1970: 161). Es lauert also der marxistische Klassenkampf. Verantwortlich für die Misere ist für ihn deshalb konsequenterweise die Bourgeoisie:
„Der Kampf um die Presse- und Meinungsfreiheit ist bisher in der Hauptsache eine Auseinandersetzung innerhalb der bürgerlichen Klasse selbst gewesen; für die Massen war die Freiheit der Meinungsäußerung eine Fiktion, da sie von den Produktionsmitteln, vor allem der Presse, und damit von der liberalen Öffentlichkeit von vornherein ferngehalten wurden. Heute wird die Zensur von den Produktivkräften der Bewusstseins-Industrie selber bedroht, die sich zum Teil bereits gegen die vorherrschenden Produktionsverhältnisse durchsetzen.“ (Enzensberger 1970: 163)
Enzensberger lässt sich sein emanzipatorisches Moment also nicht streitig machen. Er plädiert für ein „gesellschaftlich unmittelbar relevantes Eingreifen“ in Bezug auf Medien. Denn die Frage sei nicht, „ob“, sondern „wer sie [die Medien, Anm.] manipuliert.“ Ein „revolutionärer Entwurf muss nicht die Manipulateure zum Verschwinden bringen; er hat im Gegenteil einen jeden zum Manipulateur zu machen.“ (Enzensberger 1970: 166) Dadurch erhofft sich Enzensberger eine „direkte gesellschaftliche Kontrolle“, die von den „produktiv gewordenen Massen“ ausgehe. Dazu bedürfe es zum einen „die Beseitigung der kapitalistischen Besitzverhältnisse“, zum anderen aber eben die „Interaktion freier Produzenten“ (Enzensberger 1970: 166).
Mediengeräte seien keine „bloßen Konsumtionsmittel“, sondern „im Prinzip immer zugleich Produktionsmittel“, durchaus auch durch die „Masse“ „sozialisiert“. Enzensberger geht es auch nicht um eine individuelle, sondern um eine kollektive Nutzung. Eine individuelle, politisch irrelevante Nutzung entspreche etwa einer Fotoserie der letzten Urlaubsreise. Geräte wie Kameras befänden sich zwar „in der Hand der Massen“, ließen aber den Einzelnen, sofern isoliert handelnd, höchstens zum „Amateur, nicht aber zum Produzenten werden“ (Enzensberger 1970: 168). Der Isolation der Teilnehmer sei ohne „Selbstorganisation“ nicht beizukommen (Enzensberger 1970: 169). Er wolle auch keinem „obskuren Fortschrittsglauben“ das Wort reden, denn man könne sich von keinem Gerät an sich eine „Emanzipation“ erwarten (Enzensberger 1970: 169-170). Senden und Empfangen alleine seien demnach unzureichend, es brauche „netzartige Kommunikationsmodelle“, die auf dem „Prinzip der Wechselwirkung“ aufgebaut seien – wie eine „Massenzeitung, die von ihren Lesern geschrieben und verteilt wird, ein Videonetz politisch arbeitender Gruppen usw.“ (Enzensberger 1970: 170) Er fordert deshalb die „sozialistischen Bewegungen“ auf, den „Kampf um eigene Frequenzen aufzunehmen und in absehbarer Zeit eigene Sender und Relais-Stationen“ aufzubauen (Enzensberger 1970: 168).
Die neuen Medien böten für das Emanzipationsstreben die grundsätzliche Möglichkeit, denn sie seien
„ihrer Struktur nach egalitär. Durch einen einfachen Schaltvorgang kann jeder an ihnen teilnehmen; die Programme selbst sind immateriell und beliebig reproduzierbar. Damit stehen die elektronischen im Gegensatz zu älteren Medien wie dem Buch oder der Tafelmalerei, deren exklusiver Klassencharakter offensichtlich ist. […] Tendenziell heben die neuen Medien alle Bildungsprivilegien, damit auch das kulturelle Monopol der bürgerlichen Intelligenz auf. Hier liegt einer der Gründe für das Ressentiment vermeintlicher Eliten gegen die Bewusstseins-Industrie. Der Geist, den sie gegen ‚Entpersönlichung‘ und ‚Vermassung‘ zu verteidigen trachten – je schneller sie ihn aufgeben, desto besser.“ (Enzensberger 1970: 167)
Enzensberger (1970: 173) unterscheidet zusammenfassend zwischen einem repressiven und einem emanzipatorischen Mediengebrauch:
Repressiver Mediengebrauch
Emanzipatorischer Mediengebrauch
Zentral gesteuertes Programm
Dezentralisiertes Programm
Ein Sender, viele Empfänger
Jeder Empfänger ein potentieller Sender
Immobilisierung isolierter Individuen
Mobilisierung der Massen
Passive Konsumentenhaltung
Interaktion der Teilnehmer, Feedback
Entpolitisierungsprozess
Politischer Lernprozess
Produktion durch Spezialisten
Kollektive Produktion
Kontrolle durch Eigentümer oder Bürokraten
Gesellschaftliche Kontrolle durch Selbstorganisation
Tabelle 1: Übersicht über repressiven und emanzipatorischen Mediengebrauch nach Enzensberger (1970: 173).
Die von Brecht angestoßene und von Enzensberger fortgeführte Diskussion um den „Rückkanal“, also die Zwei-Wege-Kommunikation, bei der es dem Empfänger möglich ist, mit dem Sender zu interagieren, anstatt nur zu empfangen, sei eine „marxistisch dominierte Mediendebatte“ gewesen. Es sei für „eine Befreiung des Fernsehzuschauers aus seiner Passivität und dessen Mobilisierung in revolutionärer Hinsicht“ (Roesler & Stiegler 2005: 218) argumentiert worden. Müssten Enzensberger und Brecht heute nicht ausgerechnet den kapitalistischen Big-Tech-Firmen dankbar sein, die „Entwicklung vom bloßen Distributions- zum Kommunikationsmedium“ mit den sozialen Medien maßgeblich befördert zu haben? Auf den ersten Blick scheinen ja Wünsche in Erfüllung gegangen zu sein: Roesler & Stiegler sehen die wechselseitige Kommunikation heute (im Internet) über Homepages, SMS-Funktion des Mobiltelefons, interaktive Fernsehsendungen usw. realisiert. Insbesondere mit dem Aufkommen des Internets kehrt also die alte Emanzipationsdebatte zurück. Dieses Mal in Form der These, dass „die spezifische Weise der Interaktivität im Internet Demokratie befördern“ würde (Roesler & Stiegler 2005: 218) oder, „dass Elemente der direkten Demokratie ideal umgesetzt werden“. Nicht fehlen darf die Verwirklichung der Habermaschen „Deliberation“ oder die Rede von „zensurfreie[r] Meinungsäußerung“ (Roesler & Stiegler 2005: 219).
Knapp 20 Jahre später hat Enzensberger über das Fernsehen gehandelt, wobei schon die Bezeichnung „Nullmedium“ nahelegt, dass bei ihm u. a. aufgrund der Rezeption von Jean Baudrillard Ernüchterung eingetreten ist (cf. Fahle 2008: 258). Er mokiert sich (was er 2000 nochmals wiederholen sollte) über verschiedene Thesen der Medienwirkung, die allesamt „schwach auf der Brust seien“ (Enzensberger 1988: 91). Die Manipulationsthese etwa sei – und das lässt sich bis in unsere Tage herauf prolongieren – sehr beeindruckend für die Medienmacher (cf. Enzensberger 1988: 92, 98). Es fehle nicht an „Pädagogen und an kritischen Theoretikern, die in den elektronischen Medien nach wie vor Produktivkräfte wittern, die es nur zu entfesseln gelte, um ungeahnte gesellschaftliche Lernprozesse in Gang zu setzen“ (Enzensberger 1988: 98) – die also Enzensbergers frühere Thesen glaubten und glauben.
Der „Fernsehteilnehmer“ stehe in Übereinkunft mit der Industrie, die Satelliten in den Weltraum schieße und das Kabelnetz ausweite, worin er „eine beispiellose Aufrüstung von ‚Kommunikationsmitteln‘“ erkennen will. Es werde aber kein inhaltliches Ziel verfolgt, was mitgeteilt werden solle. Es zeichne sich bei Industrie und Konsument der Status der „Programmlosigkeit“ ab, der Zuseher benutze dafür „virtuos alle verfügbaren Knöpfe seiner Fernbedienung“ (Enzensberger 1988: 93). Man nähere sich deshalb dem „Zustand des Nullmediums“ an (Enzensberger 1988: 95). Von den elektronischen Medien führe in erster Linie der hauptsächlich visuell arbeitende Fernseher diesen Zustand herbei, bei dem „die Last der Sprache“ abgeworfen und kein wirklicher Sinn mehr vermittelt werde (Enzensberger 1988: 96). Die Bilder fesselten den Zuseher wie ein kleines Kind, ganz gleich, was auf dem Bildschirm erscheine; es sei bunt, flackernd, leuchtend und löse Interesse aus (cf. Enzensberger 1988: 96). Der Zuschauer ist aber für Enzensberger (entgegen früherer Aussagen) mächtig. Er lasse sich weder manipulieren, erziehen, informieren, bilden, aufklären oder ermahnen, sondern er selbst manipuliere das Medium, um seine Wünsche durchzusetzen. Wer sich nicht füge, werde „per Tastendruck mit Liebesentzug bestraft, wer sie erfüllt, durch herrliche Quoten belohnt.“ (Enzensberger 1988: 100) Der Zuschauer sei – und auch das kommt von Enzensberger eher unerwartet – unerschütterlich davon überzeugt, „dass er es nicht mit einem Kommunikationsmittel zu tun hat, sondern mit einem Mittel zur Verweigerung von Kommunikation“ (Enzensberger 1988: 100). Er schätze die „Stärke des Fernsehens“, nämlich, dass man das Gerät einschalte, um abzuschalten (Enzensberger 1988: 101). Das Abschalten vor dem Fernseher erfüllt für Enzensberger die notwendige Funktion einer Massensedierung. Eine Abschaffung verlangte Ersatz, der „in erster Linie“ im Drogenkonsum zu finden sei (Enzensberger 1988: 101). Fernsehen sei die bessere Alternative zur „Flucht in den Autowahn, die Gewaltkriminalität, die Psychose, den Amoklauf und den Selbstmord.“ (Enzensberger 1988: 102).
Enzensberger überträgt seine Kritik Jahre später auf die elektronischen Medien. Auch hier ist nichts mehr von Emanzipation oder Umsturz zu lesen, es stellt viel mehr den ernüchterten Endpunkt bei ihm dar. Enzensberger (2000) stößt sich bereits an den medientheoretischen Polen, den digitalen „Evangelisten“ und den „Apokalyptikern“, wie er sie nennt. Den Apologeten des Internets hält er – abermals eigentlich eine Selbstkritik – vor:
„[D]ie Naivsten unter ihnen sehen in der globalen Dorfgemeinschaft die Lösung unserer Probleme. Weltweite Kommunikation und Vernetzung, direkte elektronische Demokratie, gleichberechtigter Zugang zu jeder Art von Information, Abbau von Hierarchien, nachhaltige Nutzung von Ressourcen, kurzum, Homöostase und Harmonie – das sind einige ihrer Verheißungen. […] derartige Experten auch heute das Wohlwollen finanzstarker Konzerne, und ihre Forschungsergebnisse sind von den Botschaften einer Public-Relations-Agentur kaum zu unterscheiden.“ (Enzensberger 2000: 93)
Des Weiteren führt er ins Feld, dass die „Datenströme“ im Netz „an ihrer überwältigenden Banalität“ erstickten (Enzensberger 2000: 96): „99,999 Prozent aller Botschaften sind allenfalls für ihre Empfänger von Interesse, und selbst das ist noch übertrieben.“ Dies habe auch Auswirkungen auf die „Prophezeiung von der emanzipatorischen Kraft der neuen Medien“, da „nicht jeder etwas zu sagen [hat], was seine Mitmenschen interessieren könnte. Die viel beschrieene Interaktivität findet hier ihre Grenze.“ (Enzensberger 2000: 96) Zwar sei – was „die Angst der Macher vor dem Netz in diktatorisch verfassten Gesellschaften wie Iran oder China“ erkläre – die Möglichkeit der Veröffentlichung von einem „Privileg Weniger zum elektronischen Menschenrecht“ geworden, das jeder „Minorität“ im Netz eine Heimat böte, doch habe sich das Internet zugleich als „ein Dorado für Kriminelle, Intriganten, Hochstapler, Terroristen, Triebtäter, Neonazis und Verrückte“ entpuppt (Enzensberger 2000: 96).
Dazu kommt noch – erwartungsgemäß aus linker Feder – der schädliche Einfluss des Kapitals. Während die „Web-Pioniere in ihrem elektronischen Idealismus ein Medium für den herrschaftsfreien und kostenlosen Diskurs im Sinn“ gehabt hätten, habe das Kapital nur „die Verwertungschancen, die das Netz ihm nach beiden Seiten hin bot“, gesehen (Enzensberger 2000: 96).
Enzensberger hegt aber auch für die Gegenseite der Evangelisten, den Apokalyptikern, keine Sympathie:
„Sie [die Fraktion der Apokalypse, Anm.] versichert uns, dass das Ende, ohne dass wir es bemerkt hätten, bereits eingetreten ist. Der Medienphilosoph Paul Virilio teilt uns mit, dass wir längst zu Mutanten geworden sind und im Zustand des ‚rasenden Stillstands‘ leben. Raum und Zeit sind uns abhanden gekommen. Übertroffen werden seine Thesen von Baudrillard, dem zufolge alles, was wir für wirklich halten, in Wirklichkeit längst verschwunden ist. Unsere Medien haben jede Möglichkeit, zwischen Schein und Sein zu unterscheiden, bereits abgeschafft. Die Welt ist nur noch eine Simulation. Damit hat sich die Frage nach dem Sinn erledigt.“ (Enzensberger 2000: 94)
Die Apokalyptiker wollten dabei triumphieren und gäben sich „über alle Illusionen erhaben“, hätten sie doch „die allgemeine Verblendung durchschaut“ und das, obwohl sie „auf Tatsachen keine Rücksicht“ mehr nähmen (Enzensberger 2000: 94). Enzensberger missfällt die Behauptung, dass die neuen Medien die Unterscheidung zwischen Realität und Simulation hinfällig gemacht hätten. Wäre die Simulationsthese wahr, würden sich Fragen wie, ob Gewaltszenen im Fernsehen für die Jugendkriminalität verantwortlich seien, erübrigen, da der „Mord im Krimi oder im Videospiel und der Mord vor der eigenen Haustür ein und dasselbe“ wären (Enzensberger 2000: 101).
Die Lösung schlummert für ihn in einer „Ökologie der Vermeidung […], die schon in der Grundschule trainiert werden sollte.“ (Enzensberger 2000: 97) Ihn damit auf eine Stufe mit Autoren wie Manfred Spitzer („Digitale Demenz“) zu stellen, die einer medialen Abstinenz das Wort reden, wäre überzogen. Enzensberger ist in Anbetracht der Entwicklung seiner medientheoretischen Überlegungen in erster Linie Ernüchterung zu bescheinigen. Angetreten mit einem großen emanzipatorischen Impetus, ist auch er schlussendlich in der Realität gestrandet.





























