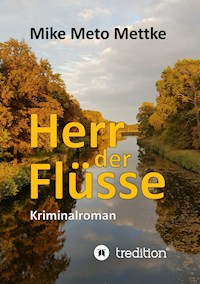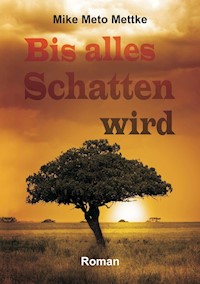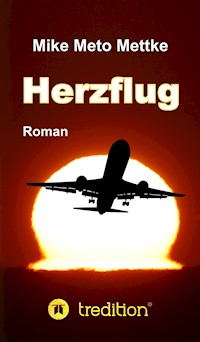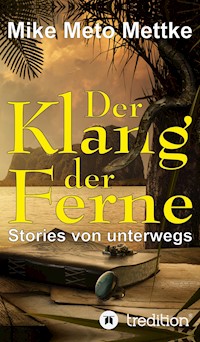
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Mike Meto Mettke ist Abenteurer, Autor und Lehrer. Er bereiste rund 100 Länder auf fünf Kontinenten. In seinem literarischen Reise-Memoir erzählt er unterhaltsam und mit feiner Ironie von Expeditionen und Exkursionen, vor allem aber über Begegnungen mit interessanten Menschen. Er trifft eine Mrs. Rockefeller in Amerika, die ihm ein verheißungsvolles Angebot unterbreitet, schließt lebenslange Freundschaft mit einem Samburu-Krieger aus Kenia, betrinkt sich mit einem Dschungel-Piloten im australischen Outback, der ihn dann für eine Kurz-Robinsonade auf einer Insel im Great Barrier Reef aussetzt, lässt sich von einem katarischen Prinzen zur Falkenjagd in der Wüste einladen, angelt mit einem brasilianischen Literaturprofessor Piranhas am Amazonas, begleitet einen norwegischen Aussteiger im Rentenalter durch Malawi und Sambia, plaudert mit dem lettischen Baron Arvid von Blumenthal alias Crocodile Harry, der in einer unterirdischen Wohnhöhle in einer Opalsucher-Siedlung residiert, leiht sich in Grönland bei einem Restaurantbesitzer aus Thüringen ein Seekajak, um im Licht der Mitternachtssonne zwischen Eisbergen einem zutraulichen Wal zu folgen und sieht den letzten Überlebenden eines Stammes in Feuerland … Zugleich ist Der Klang der Ferne die Geschichte eines kleinen phantasiebegabten Jungen, der felsenfest an eine freie Zukunft glaubt und seine Zuversicht aus den Erzählungen und Berichten der Vergangenheit schöpft. Als Lehrer etabliert der Autor später das in Deutschland einmalige Schulfach Länder, Reisen, Abenteuer. Er lehrt die Kunst des Reisens mit begrenzten Mitteln, die Geschichte der Entdeckungen und Eroberungen und ist mit seinen Schülern auf selbstgebauten Flößen tagelang auf schwedischen Wildflüssen unterwegs. Mit dem Ziel seines eigenen Bildungsromans: eine Weltanschauung nicht durch ideologische Bevormundung, sondern durch Anschauen der Welt zu gewinnen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 496
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Mike Meto Mettke
Der Klang der Ferne
Stories von unterwegs
Copyright: © 2019 Mike Meto Mettke
Umschlag & Satz: Sabine Abels – www.e-book-erstellung.de
Titelbild: © ersler (depositphotos.com)
Verlag und Druck:
tredition GmbH
Halenreie 40-44
22359 Hamburg
978-3-7497-7963-5 (Paperback)
978-3-7497-7964-2 (Hardcover)
978-3-7497-7965-9 (e-Book)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Niemals kann Freiheit in unserem Leben
länger dauern als ein paar Atemzüge lang,
aber für sie leben wir.
Alfred Andersch
Für Kai,
mit dem ich aufbrach, als es endlich möglich wurde.
Inhalt
Prolog
If I can make it there
Go West
Out of Africa
Himalaya
Art & Adventure
Down Under
Mitad del Mundo – Die Mitte der Welt
Nirgendwo ist auch ein Ort
Intermezzo
Amazonien
Trommeln in der Nacht
Von ganz oben nach ganz unten
Kalaallit Nunaat
Samburu
Wondimu Kedru
Der weiße Dampfer
Es wird einmal in Marrakesch
Der Prinz in der Wüste
Auf der Suche nach Macondo
Die Perle Afrikas
Von Boxern, Barbaren und Bürgerkriegen
Die Rote Insel
Epilog
Prolog
Am Anfang ist das Wort. Ist Wortmusik.
Wir gehen hin zu Orten, von denen wir gehört haben.
Lassen uns verzaubern und verführen vom Klang der Namen.
Timbuktu und Marrakesch, Amazonas und Okavango, Sahara und Atacama, Patagonien und Feuerland, Galapagos und Sansibar, Himalaja und Hindukusch, Serengeti und Kalahari …
Sie klingen wie Strophen eines unendlichen Liedes der Ferne.
Den Ureinwohnern Australiens war diese topographische Poesie nicht unbekannt. Ihre Traumpfade, die sich quer durch den ganzen Kontinent schlängelten und die sie auf rituellen Walkabouts mit einer inneren Landkarte aus unfassbar langen Gesängen abwanderten, waren unsichtbare Reisewege in scheinbar markierungslosen Wüsten und Einöden. Man muss sich diese Traumpfade als Spaghetti-Labyrinthe aus Odysseen vorstellen. Ein Lied war Karte und Kompass zugleich. War ein Google Maps für ziemlich nackte homerische Gedächtniskünstler, denen der Jakobsweg wie ein Abendspaziergang vorgekommen wäre …
Als ich ein kleiner Junge war, lebte unsere Familie in einem Plattenbau in Cottbus nahe der Spree, an dessen rechten Ufer mächtige und alte Kastanien standen. Es war eine wunderschöne Allee, in der in Sommernächten die Nachtigallen schmetterten. Und so war sie allen Leuten der Stadt eigentlich nur als „Kastanienallee“ bekannt. Kaum jemand kannte ihren offiziellen Namen. Am Geländer eines alten Wehres, das den Fluss an dieser Stelle ohrenbetäubend über eine Schwelle springen ließ, hing ein rostiges Schild mit rotbraun zerfressenen, ursprünglich erhabenen Lettern.
Eine mickrige Trauerweide verdeckte mit ihren herabhängenden Ruten die Tafel. Niemand las das Schild.
Ich war acht Jahre alt und probierte überall meine noch unsicheren Lesekünste aus. Auf der Jagd nach Bedeutungen fand ich das Schild und: las es.
Ein Name stand darauf: Ludwig Leichhardt.
Und dass er ein großer Australienforscher gewesen sei und in dem brandenburgischen Dorf Trebatsch geboren.
Außerdem kam ein Wort vor, welches ich noch nicht kannte:
VERSCHOLLEN.
Ludwig Leichhardt war auf einer seiner Expeditionen durch Australien verschollen.
Ich rannte zu meiner Mutter, um sie zu fragen, was es mit dem Wort auf sich habe. Sie überlegte kurz und meinte dann, wenn man verschollen sei, wäre man wohl irgendwie verlorengegangen …
Ich besaß auch einen kleinen, apfelgroßen Globus aus dünnem Aluminium, der als Sparbüchse gedacht war. Alle erkennbar großen Länder waren mit einer fetten roten Linie umrandet – das schien wichtig – und jeder Erdteil hatte eine andere Farbe. Das Land, in dem ich aufwuchs, war fast vollständig vom Namen der Hauptstadt zugedeckt.
Ich suchte Australien.
Australien war grün, ja grün, vergleichsweise groß und übersichtlich. Der Südpol war nah, der Nordpol mit dem Schlitz für die Münzen ziemlich weit weg.
Ich schraubte die beiden Erdhalbkugeln auseinander und das Geld fiel heraus. Dann nahm ich einen Schraubenzieher und bohrte eine Direktverbindung von unserem Land – der Name der Hauptstadt verschwand im Eingangsloch – nach Australien.
Ich kam irgendwo in der Simpson-Wüste raus und schnitt mir am Bohrgrat des Austrittslochs in den Finger.
Dann setzte ich die Erdhalbkugeln wieder zusammen, hielt den Globus vors Gesicht und schaute durch die zwei Löcher nach Australien.
Ich sah in das entsetzte Gesicht meiner Mutter.
Mit meinem blutenden Finger verschmierte ich ganz Island und mindestens die Hälfte der Sowjetunion …
20 Jahre später las ich in dem Roman Traumpfade von Bruce Chatwin, dass es nichts Schöneres gebe, als in Australien verlorenzugehen. Es verschaffe einem ein wunderbares Gefühl von Sicherheit. Ich dachte an Ludwig Leichhardt, der in derselben Stadt wie ich sein Abitur gemacht hatte und der auf andere Art, wahrscheinlich in der Simpson-Wüste, verloren gegangen war.
Die Mauer fiel. Und ich machte mich daran, mich in meinen Träumen zu verlieren …
Heute ist der 25. März 2016. Ein klarer, sonnenüberstrahlter Tag auf Spitzbergen. Ich bin auf 78° Grad nördlicher Breite. Arktis. All die großen Polarforscher, deren Berichte ich als kleiner Junge verschlungen habe, sind hier gewesen. Nansen, Amundsen, Nordenskjöld, Nobile … Sie strebten zum Nordpol, einem imaginären Punkt, einer Erfindung der Geographen. Mit Segelschiffen, Luftschiffen, Flugzeugen und Hundeschlitten.
Meine Schlittenhunde heißen Carmen, Jacklin, Luke, Clint, Jan M. und Konjak. In wenigen Minuten geht es los. Nicht zum Pol, aber in meine nächste Geschichte. Ich habe jetzt meine eigenen Geschichten …
-20°C, Atemwolken fallen als Reif zu Boden.
Heftiges Gebell. Und wie von der Sehne geschossen, geht es los …
If I can make it there
(New York, 1990)
Ich kam nach New York und in nur wenigen Stunden
machte New York etwas mit mir: die Stadt erweckt
Möglichkeiten. Hoffnung bricht aus.
Philip Roth
Anflug auf New York City. Eine Stadt ertrinkt in ihrem gleißenden Licht. Long Island, Umrisse von Manhattan. Empire State Building … Alles was ich zu erkennen vermeine, folgt nur angelesenem Wissen oder erinnerten Filmen. Ich weiß nichts.
Ich bin ein tumber Tor, bin ein Parzival auf der Suche nach seinem Heiligen Gral, und da unten leuchtet die Stadt der Städte. Es ist die erste Stadt der freien Welt, die ich mit eigenen Füßen betreten werde …
Jay Jay, der Busfahrer, ein Fats-Domino-Typ mit mindestens 150 Kilogramm Lebendgewicht, kräht auf der Washington Bridge fröhlich mit Reibeisen-Stimme ins Bordmikrophon:
„Anyway, welcome to America!“
Danach gefällt er sich in obszönen Zweideutigkeiten. Alle lachen im Halbdunkel des Busses, der uns nach Manhattan bringt, und niemand sieht die paar Tränen, die ich mir aus den Augen wische …
Dass ich hier sein kann, verdanke ich einem Spot des Radiosenders RIAS 2, der Bewerbungen für Councelor-Jobs in Sommerlagern in den USA publik macht. Camp America.
Ein paar Dutzend Plätze für einige Tausend Bewerber allein in Berlin. Mein Freund Kai und ich probieren es.
Zwei ostdeutsche Jungs ohne harte Währung.
Die aber Englisch können. Weil sie es studiert haben.
Auf einmal beginnen Fähigkeiten, eine Rolle zu spielen.
Auf einmal sind es nicht Parteizugehörigkeit oder Beziehungen, die zählen.
Plötzlich haben wir Eintrittstickets für die „weite Welt“ …
Wir bekommen Freiflüge. Hin und zurück. Und 300 Dollar für neun Wochen Arbeit. Aus den neun Wochen machen wir knapp vier Monate im „Land der Freien“ …
Kai kommt nach Los Angeles. Ein Upper-Class-Camp.
Ich komme in ein Y.M.C.A.-Camp in der Tri-State-Area New York-New Jersey-Pennsylvania. Zwei Autostunden von der City entfernt. Mitten im Wald. Lower Class.
Unterrichte Kids aus der Bronx, Brooklyn und Harlem.
Bringe ihnen Schwimmen, Bogenschießen und einfache Naturerlebnisse bei.
Eines Tages dröhnt der Wald über den Baumspitzen.
Ein Helikopter setzt auf der Lichtung auf.
Mein texanischer Camp-Leiter zerrt mich in Badehose aus dem Schwimmunterricht am See. In breitem Texanisch, als zerbeiße er ein halbes Pfund Hustenbonbons, versucht er mir etwas zu erklären. Ich verstehe nichts.
In der Mitte der Lichtung steht eine alte Lady von um die 75 in einem taubengrauen Kostüm. Sie trägt eine Handtasche, wie sie auch die Queen bei offiziellen Besuchen dabeihat.
Im Halbkreis hinter ihr stehen ihre Bodyguards in zu engen Anzügen. Als sie mich bemerken, verziehen sich ihre Nussknacker-Gesichter zu einem freundlicheren Grinsen.
Ich bin ein Beefcake, das Wort habe ich im Camp gelernt und es bezeichnet einen Mann, der so lange mit schweren Gewichten trainiert hat, dass das Ergebnis unübersehbar ist. An der Uni ist die übliche Reaktion darauf eine nur schlecht kaschierte Annahme meiner intellektuellen Defizite. In Amerika wird das anders wahrgenommen.
Die Bodyguards halten mich für einen der ihren.
Die alte Lady begutachtet mich wie einen Mastochsen auf einer Landwirtschaftsausstellung, aber mit Wohlgefallen.
Der Texaner stupst mich zu der Lady hin und stellt mich als That East German Guy vor. Dann fällt ihr Name.
Mrs. Rockefeller.
Sie reicht mir wahrlich königlich die Hand. Wie im Autopilotmodus murmele ich: Nice to meet you, Ma’am.
Ich bin der Exot. Der Eiserne Vorhang ist gerade gefallen. Und jetzt steht ein ostdeutscher Eingeborener in Badehose in ihrem Königreich der Wohltätigkeit. Ich habe einen Bonus. Das wird schnell klar. Später werde ich diesen anderswo noch weidlich ausnutzen.
Wir kommen ins Gespräch. Ich habe nichts zu verlieren.
Die alte Dame ist hellwach, intelligent und erstaunlich gut informiert. Ihr Interesse nicht gespielt.
Um uns herum hat sich mittlerweile das ganze Lager in respektvollem Abstand versammelt.
Sie fragt nach dem Leben in Ostdeutschland, fragt nach meinen Motiven für Amerika. Bittet um meine Einschätzung der politischen Lage in den beiden Deutschländern.
(Den Tag der Wiedervereinigung werde ich am Grand Canyon verbringen, aber das kann ich noch nicht wissen.)
Interessiert sich für mein Studium.
(Am Tag vor meiner Abreise habe ich meine Diplomarbeit zu einem Thema der Ethnopsycholinguistik abgegeben. Methoden der interkulturellen Kommunikation …)
Wir reden fast eine Stunde lang.
Dann macht sie mir ein Angebot. Es gebe von ihrer Stiftung unterstützte Stipendien für weiterführende Studien in Amerika. Harvard oder Princeton. Ich solle es mir überlegen.
Sie winkt aus dem kleinen Hofstaat eine Assistentin herbei, die sich alles notiert und mir dann die erste Visitenkarte meines Lebens überreicht.
Mrs. Rockefeller quittiert meine Verwirrung mit einem milden Lächeln. Zum Abschluss sagt sie etwas, das sich mir einbrennt. Sie habe schon lange niemanden getroffen, der so glaubwürdig über Freiheit gesprochen habe. Und das heiße ja, sich entscheiden zu können …
Ich habe die Visitenkarte noch geraume Zeit unschlüssig als Lesezeichen benutzt. Ehe ich mich gegen eine akademische Karriere und für die Welt-Erfahrung entschied.
Bereut habe ich es nicht.
In Amerika betrat ich das große Karussell der Möglichkeiten.
Eine Möglichkeit kann man je nach Mentalität auf zweierlei Art auffassen. Als Risiko, das ist die deutsche Art. Oder als Chance. Das ist die amerikanische.
Mein Freund Sylvester („Sly“) Lane, den ich im Camp kennengelernt habe, ein schwarzer Lehrer aus Harlem, wird mein Mentor.
In Amerika, erklärt er mir, müsse man die Fähigkeit entwickeln, Glück zu haben. Das widersprach nicht nur meinen Überzeugungen, es schien mir ein Widerspruch in sich.
Ich bin Schachspieler. Und mag dieses Spiel, weil Glück darin die denkbar geringste Rolle spielt.
Am Washington Square spielte ich mit den dort zahlreich versammelten alten Männern Blitz-Schach um Geld. Ich hatte viel zu wenig und nahm die Gelegenheit wahr, um mir etwas dazu zu verdienen. Es ging um keine großen Summen. Aber bei einem angesetzten Tagesbudget von knapp fünf Dollar – ein Dollar für ein French Bread vom Vortag, 95 Cent für ein Stück Philadelphia Cream Cheese, kostenloses Wasser an den Speiern im Central Park, zwei Token für die U-Bahn zu je einem Dollar und einem Buck für Unvorhergesehenes – bedeuteten zwei oder drei gewonnene Zehner viel für mich.
Die alten Männer waren ausgebuffte und gewiefte Taktiker. Aber ich kannte auch die Theorie, und nachdem ich mich auf ihre Spielweise eingestellt hatte, gewann ich weit öfter, als ich verlor. Es zahlte sich aus, dass mein Freund Kai und ich unsere Uni-Prüfungen mit nächtlichen Blitzschach-Exzessen „vorbereiteten“ …
Sly sieht mir oft zu und lächelt weise, bis ich seine Theorie endlich begreife. Es kommt darauf an, für das Glück bereit zu sein.
Mein Fünf-Dollar-Etat funktioniert nur, weil ich bei Sly in der 92nd Street in Spanish-Harlem wohnen darf. Er schlägt sich selbst nur mehr schlecht als recht durch.
Wenn ich üppiger gewonnen habe, gehen wir ins nahe Bitter End in der 147 Bleecker Street im Greenwich Village.
Tracy Chapman begann dort ihre Karriere. Auftrittsort von Woody Allen, Bill Cosby, Chick Corea, John Denver, Neil Diamond, Bob Dylan, Neil Young, Pete Seeger, Kris Kristofferson, Stevie Wonder und Bette Midler …
Wer auch immer auftritt, Sly und ich halten uns für den Abend an unseren Vier-Dollar-Heineken fest …
An den Sonntagen nimmt er mich zu seiner Familie nach Black Harlem mit. Wir gehen in die Kirche und ich erlebe Gospel-Happenings der unverfälschten Art. Die Predigten des Pastors sind rhetorisch hochmotorisierte Bekehrungsmaschinen; und ich, der überzeugte Atheist, staune und bewundere die Wirkungsmacht dieses Martin Luther King-Doubles aus Slys Neighbourhood. Das ritualisierte, sich gegenseitig verstärkende Frage-Antwort-Spiel. Ehe alles in einen rauschenden Chorus übergeht …
Ecke Lenox Ave/125th Street. Das Herz Harlems.
Und zum ersten Mal in meinem Leben, lange vor den vielen Schwarzafrika-Reisen, werde ich mir meiner Hautfarbe bewusst.
Bin ich der einzige Weiße. Das fühlt sich merkwürdig an.
Wir essen in Sylvia’s Patio Soul Food. Yams-Gemüse und Rippchen. Sly möchte, dass ich Harlem schmecke, rieche, fühle, sehe …
Ich folge seinen Gebrauchsanweisungen.
Dann will er für meinen Geburtstag, es ist der 4. September, bewusstseinserweiternd vorsorgen.
Irgendwie hat er Geld locker gemacht. Wir besuchen verschiedene „Läden“, bei denen ich draußen bleiben muss, weil mich jeder für einen Cop hält.
Wieder in seinem Apartment, wird die Feier mit Joints eröffnet. Wird mit gestrecktem Kokain pharmazeutisch sanft gesteigert. Dann das Level mit Wodka, Südstaaten-Brandy, Winecooler und Budweiser in den thermisch-emotionalen Aufwinden gehalten …
Ich bin zwar breit, aber noch aufnahmefähig.
Und zu einem flashigen Kurz-Fazit meines Drogen-Crash-Kurses in der Lage: Marihuana und Hasch machen mich lethargisch.
Kokain ist gefährlich, weil es die assoziativen Synapsen befeuert und mich direkt in den Größenwahn entlässt. Ich will dann sofort ein kreatives Großprojekt starten. Alkohol bleibt das überschaubare Mittel der Erfahrung …
Gott sei Dank bekomme ich nun das schönste Geburtstagsgeschenk ever.
Sly singt für mich Amazing Grace. Natürlich ist sein Resonanzkörper enorm. Aber er kann auch singen. Er singt so gut, dass Religion für ein paar Augenblicke wie eine Option erscheint …
Mein Geldmangel ist für Sly Ansatz für allerlei Job-Vorschläge. Das Schach-Taschengeld findet er zu mickrig.
Er empfiehlt ein Vorstellungsgespräch bei den Chippendales. Die würden mich sicher nehmen.
Halbnackte Männer tänzeln oder scharwenzeln auf einer Bühne für gutbetuchte Frauen, die einem dann Geld in die Unterwäsche stecken. Ich müsse mich nur komplett rasieren.
400 Dollar pro Abend seien realistisch.
Ich denke kurz über meinen Realismus-Begriff nach.
Wenig später telefoniert er in der schwarzen Community herum, die eng vernetzt ist (auch wenn dieser Begriff damals noch unüblich) und offeriert mir ein Angebot, dass für ihn the big chance, a great challenge ist.
Mike Tyson hat gerade gegen Buster Douglas seinen Boxweltmeistertitel verloren. Er benötige Sparringspartner. Solle mit „Fallobst“ wiederaufgebaut werden. Schwarze Trainingspartner gebe es zuhauf, aber ein East German Max Schmeling Look Alike, den habe man eben nicht. Zudem sei ich auf den Inch genau so groß Iron Mike; und wenn ich rasch noch ein paar Pfund zulegte, auch so schwer …
Ich denke an meine tägliche Zwei-Dollar-Diät und wie jemand damit Gewicht machen kann …
Ich sehe berechtigte Chancen, ihn im Schach zu schlagen.
Wahrscheinlich auch im Bankdrücken. Mein Rekord liegt bei 170 Kilo. Aber: Ich bin definitiv kein Boxer!
Und außerdem kommen mir Sly‘s Vermittlungen plötzlich surreal vor. Drogenwirrungen.
Andererseits war Mrs. Rockefellers Auftritt ein Fakt. Ich bin in Amerika …
Sly hält mir den Hörer hin.
Ich winke ab. Gebe klein bei. Habe wenig Lust, für eine überschaubare Gage mir das Hirn beschädigen zu lassen.
Ich muss weg von dieser für mich irritierenden Körperbezogenheit, die hier als normal gilt. Dass Arnold Schwarzenegger auf diesem Ticket später bis zum Amt des Gouverneurs von Kalifornien reist, kann ich ebenfalls noch nicht ahnen …
Egghead, sagt Sly, aber er grinst wenigstens.
Traveler, antworte ich und habe meine Bestimmung gefunden.
Go West
(Los Angeles und kreuz und quer, 1990)
Ich komme gerne nach L.A., aber ich würde
nicht gerne dort leben.
Robert De Niro
In einem New Yorker Reisebüro, Liberty Agency(!), habe ich ein Flugticket nach Los Angeles für 278 Dollar gebucht, das meinen Camp-Verdienst fast vollständig aufbraucht.
In Deutschland hat derweil die Währungsumstellung stattgefunden, dort könnte ich jetzt über ein stark geschrumpftes Restsparguthaben in D-Mark verfügen.
Aber ein Transfer in die Staaten überfordert alle Beteiligten.
Ich werde improvisieren müssen …
Mein Freund Kai und ich haben uns brieflich auf einen Treffpunkt verständigt. Campus der UCLA. Dort soll es nach unseren vagen Informationen einen großen Bronze-Bär geben.
Unsere Verabredung hat etwas naiv Schwejkhaftes.
Nach dem Krieg um sechs im Kelch, so hatte sich der brave Soldat Schwejk mit seinem Freund Woditschka verabredet.
Stundenlang warte ich geduldig auf das Eintreffen meines Freundes, mit dem ich in der DDR alles geteilt und erlebt habe, was junge Männer teilen und erleben konnten.
Bücher, Klamotten, Wohnungen, Frauen, Partys, Prüfungen, Sportwettbewerbe. Nicht unbedingt in dieser Reihenfolge …
Daraus ergibt sich ein unerschütterliches Grundvertrauen, das uns auch bei späteren Expeditionen und Reisen verbindet.
Irgendwann fallen wir uns in die Arme.
Das nächste Kapitel kann beginnen.
Kai hat Verwandte in Los Angeles. Ein Brückenkopf.
Aber natürlich sind arme Verwandte wie wir nicht das, was man sich für länger wünscht. Ganz ohne Geld bekommt auch DNA ein Haltbarkeitsdatum. Verstehen wir.
Indes: Kais angeheirateter Onkel Garo hat ein Herz für uns.
Er ist Armenier. Und in Afrika geboren. Äthiopien. Hat dort 25 Jahre lang gelebt. War staatenlos, ehe ihm Amerika die Chance auf Einbürgerung bot. Dankbar meldete er sich zum Marine Corps und diente seiner neuen Heimat ein Jahr in Vietnam. Kam verwundet zurück …
Er ist wie ich glühender Hemingway-Fan.
An den Wochenenden fährt er oft hoch nach Utah zum Jagen.
Danach schaut er rituell den Film Jenseits von Afrika und will eines Tages dahin zurück. Sitzt nach der Jagd und langer Fahrt ungeduscht und mit dem Gewehr zwischen den Knien auf dem Sofa, trinkt sein Bier und spricht tonlos Dialoge mit. Seine Frau ist dann nie zu sehen.
Kai und ich wollen irgendwann auch dahin. Afrika.
Vorher trinken wir Garos reich bestückte Bar leer …
Garo betreibt eine gutgehende Werkstatt und überlässt uns einen alten VW-Rabbit. Wichtiger noch: Er verschafft uns eine Kreditkarte. Wir haben erstmals Kredit. Der Kreditrahmen ist nicht üppig, lässt uns aber Spielraum für ein Fortkommen ohne feste Unterkünfte …
Zum Abschied überreicht mir Garo sein MarineMesser, das ich mir an den Oberschenkel binde.
Take care!
New York war die vertikale Entäußerung einer Stadt.
Los Angeles ist ihre horizontale Entsprechung.
Tausend Vorstädte auf der Suche nach einer Stadt …
Der Körperkult in Venice Beach. Santa Monica. Pacific Palisades. Thomas Mann, Bertolt Brecht, Lion Feuchtwanger, Franz Werfel … Hollywood. Sunset Boulevard. Jedes Viertel, jeder Block und jede Straße haben literarische oder cineastische Bezüge. Wir fahren die berühmten Stätten ab, als ginge es darum, touristische Skalpe einzusammeln. Vergleichbar den alten Wanderstöcken, auf die man winzige Abzeichen von den Orten nagelte, die man „besucht“ hatte.
Und zu Hause verkümmert jeder Reisebericht zu einem Namedropping.
Trotz aller Anfangseuphorie – Am Anfang ist das Wort … – wird uns schnell klar, dass wir unsere Reisestrategien ändern müssen, wenn wir die Transformation vom Touristen zum Reisenden schaffen wollen. Das heißt nicht, bekannte Orte oder Sehenswürdigkeiten zu ignorieren, aber sie anders zu erleben. Kai und ich sind uns einig, dass es nicht darum gehen kann, herkömmliche Muster oder Vorgaben zu kopieren. Wir wollen dem Zufall Raum geben, den Neben- und Abwegen, der anderen Perspektive, die sich oft nur ein paar Schritte entfernt bietet. Die Welt ist entdeckt, kartographiert und beschrieben. Neue Einsichten jedoch sind immer möglich.
Weglassen oder Verweilen können. Tiefenbohrung statt Flächenradar. Ein langer Lernprozess.
Heute folge ich nur noch selten den konventionellen Vorschlägen der Reiseführer. Diese Kirche und jenes Museum. Und da ein Schloss und dort ein Denkmal. Das sich merkwürdig fortschreibende Primat von Architektur- oder Religionsgeschichte, die man reisend nachvollziehen müsse.
Ein Markt? Immer. Ein lebendiger Park, wo Einheimische ihr Leben ins Draußen verlagern und picknicken oder spielen? Klar.
Die Schlösser der Loire sind großartig. Wenn man den Fluss mit einem Kajak abfährt und sich ihnen von hinten nähert und das eine oder andere einfach passiert.
Oder wenn man zwei Wochen lang mit einem Mountainbike die Straßen Havannas erkundet und danach 1000 Kilometer Alltag „auf der Uhr“ hat …
Kai und ich sitzen des Nachts vor dem Griffith Observatory und schauen runter auf Los Angeles. Wie Lava in einem riesigen vulkanischen Krater flimmert der Lichter-Ozean bis zum Horizont. Die Highways glühende Seile.
Eine verschwenderische Orgie des Lichts. Dunst und Smog verwandeln das Panorama in eine Fata Morgana.
Wir haben gerade für 6 Dollar eine Lasershow gesehen. Mit einer Ecstacy-Pille wären wir wahrscheinlich besser bedient gewesen. Aber die kostenlose Show vor uns lässt uns verstummen.
Dann sagt Kai etwas, das ich völlig plausibel finde:
„Lass uns nach Mexico fahren!“
Es wird natürlich keine Mexico-Reise. Die hole ich Jahre später nach. Wir stranden in Tijuana. Zu jener Zeit ist Tijuana noch kein Ballermann für US-College-Kids, die sich ins Koma saufen. Aber die anderen Drogen sind schon allgegenwärtig. Die Luft flimmert vor Hitze. Eine gleißende Sonne entfärbt die Sierra.
Alles ist laut. Straßenmusik. Trompeten und Gitarren. Schreien, Feilschen, Kreischen.
Es riecht nach Bohnen, Tacos, Paprika und Staub.
Ständiges Anreden, das in seiner groben Direktheit noch ungewohnt:
Hey Rambo, get the fuck in!
Do you wanna have some pussy?
I’ve got all the shit …
Wir bescheiden uns mit ein paar Tequilas in Diskotheken, deren grotesker Männerüberhang erstaunt.
Auf den Straßen aber werden wir immer wieder offensiv von Chicas angesprochen, die keine Prostituierten sind.
Die gesellschaftlichen Gepflogenheiten unserer alten Heimat haben uns in vielerlei Hinsicht unzureichend in die erweiterte Welt entlassen. Mit einer Ausnahme: Sex.
Um es klar zu benennen: Der Westen war uns in jeder Hinsicht überlegen, aber wir hatten, weil weniger prüde und mit überschaubaren Freizeitmöglichkeiten ausgestattet, deutlich mehr Spaß im Spiel der Geschlechter. Ein Spiel, das gleichberechtigt und umstandslos bei jeder beliebigen Gelegenheit verhandelt werden konnte. Im Prinzip die einzige lustbetonte Freiheit in der „kommoden Diktatur“ …
Wir wissen jetzt: Amerika ist nur der Anfang unseres
Die-Welt-Erfahrens.
Wieder zurück auf US-Territorium, übernachten wir am Strand von San Diego. Das ist verboten, aber wir liegen gut getarnt in einer von Seegras geschützten Mulde, während über uns die Hubschrauber der Küstenwache mit Scheinwerfern das Gelände absuchen. Endlich mal zahlt sich unsere militärische Ausbildung aus. Wir sparen Übernachtungskosten …
Mich erwischt ein plötzlich hohes Fieber. Wahrscheinlich eine Blasenentzündung oder irgendwas im „Abwassertrakt“.
Zitternd sitze ich an einem Strandlagerfeuer mit der Intensität eines Autodafés, als wäre es ein offener Kühlschrank.
Dee Dee und Sandy nehmen sich meiner an.
Zwei Rugby spielende Lesben von großer Einfühlsamkeit.
In ihrem Haus pflegen sie mich gesund. Ihre Katzen lieben mich und meine fieberverschwitzten Klamotten. Und lange vor der allgegenwärtig politisch korrekten Gängelung erlebe ich die reine Akzeptanz unterschiedlicher Lebensentwürfe …
Der Yosemite National Park in der Sierra Nevada ist der erste Nationalpark überhaupt, den wir erleben. Das Konzept von Nationalparks ist uns bis dahin unbekannt. Wir verbinden mit dem Wort „Park“ eine grüne Oase in der Stadt oder am Stadtrand. Etwas Eingehegtes für Picknicker.
In einem Park erfrieren nur betrunkene Obdachlose auf einer Parkbank und in einer sehr kalten Winternacht.
Wir sind in Kalifornien, und da ist es angeblich immer warm bis heiß. It never rains in Southern California … Das wissen wir aus Songs und von San Diego und Los Angeles.
Tagsüber haben wir uns von einer Landschaft begeistern lassen, die sich von Menschen benutzter Sprache entzieht, weil sie auch ohne Beschreibung oder Wahrnehmung einfach nur „unmenschlich“, also in Abwesenheit derselben, vorhanden ist.
Half Dome und El Capitan, „Schreie aus Stein“ in einer Granitwelt der Superlative. Und die belebte Welt besteht aus Bäumen, Mammutbäumen, die älter sind als die westliche Zivilisation. Grizzly Giant, wieder nur ein Name, eine mehr als 2300 Jahre alte Redwood-Säule …
Nach Sonnenuntergang müssen wir nahe des Tioga-Passes auf knapp 3000 Metern in den Wäldern ein Biwak errichten, für das wir nur unzureichend vorbereitet sind. Unser Rabbit hat in der Höhe einen Hustenanfall, wir können ihm die Überwindung des Passes nicht mehr zumuten.
Wir tragen T-Shirts. Und wir haben einen Pullover, den ich aus völlig irrationalen Gründen in der Hitze Tijuanas gekauft habe. Den streifen wir uns im Viertelstunden-Rhythmus abwechselnd über. Dieser Pullover rettet uns jetzt.
Es wird die längste Nacht unseres Reiselebens.
Die Temperatur sinkt auf -7°C. Das ist objektiv nicht bemerkenswert. Wir werden auf Expeditionen im Himalaja und in den Anden und in Grönland extremere Bedingungen vorfinden.
Aber subjektiv erleiden wir die kälteste Nacht unseres Lebens. Wir üben Schattenboxen, um warm zu bleiben.
Schattenboxen in einer sternklaren Nacht in der Sierra Nevada. Das könnte in der ersten halben Stunde witzig sein. Feuer sind nicht erlaubt. Und das erste Mal in meinem Leben wünsche ich mir, eher mit dem Rauchen angefangen zu haben. Denn dann hätten wir wenigstens ein Feuerzeug.
Immerhin haben wir eine Flasche Tequila, die wir auf die Stunden bis zum Sonnenaufgang portionieren.
Wir kämpfen die legendären Kämpfe Muhammad Alis in Echtzeit nach. The Rumble in the Jungle. The Thrilla in Manila.
Aber ohne die Hitze der Originalschauplätze.
Mit Live-Kommentar, der mögliche Bären abhalten soll, vor denen uns Schilder und stählerne Bearproof Food Lockers warnen. (Dass wir nichts zu essen haben, erweist sich mal als Vorteil.) Wir schlagen uns mit gefühllosen Fäusten auf frostige Rippen. In der Eiseskälte der Berge Kaliforniens.
Am Nachmittag des nächsten Tages erreichen wir das glühende Death Valley. Es ist, als stünde man eben noch unter einer kalten Dusche und plötzlich ergießt sich kochendes Wasser über den Körper. Unser VW-Golf-Rabbit verfügt über keine Klimaanlage. Irgendein wütender Gott schmeißt Hochofenschmelze über den Talboden. Kristallines Salz gleißt trügerisch wie Schnee. Die umgebenden Berge – ocker, rotbraun, rostrot – kommen uns wie von innen befeuert vor.
Nirgendwo auf der Welt fällt weniger Regen.
Im verbotenen Westfernsehen habe ich einst den Film Zabriskie Point von Michelangelo Antonioni gesehen, der nach einem Aussichtspunkt im Death Valley benannt ist. Ich erinnere mich an den Soundtrack von Pink Floyd, erkenne die Landschaft, kann jedoch die Handlung nicht mehr nachvollziehen. Mein pubertär-selektives Gedächtnis zaubert ein paar Sex-Szenen hervor; Paare, die sich in Staub und Fels lieben …
Kai und ich verspüren gerade nicht die geringste Lust auf Sex. Ein jeder von uns kämpft eher um das Fortbestehen seiner Schleimhäute.
Und dann kämpfen wir gegen den Sand.
Unsere erste Wüste. Wir biegen nur ein paar Meter vom weichen Asphalt ab, um die Dünen näher zu beschauen. Und bleiben stecken. Der Motor jault wie eine auf den Schwanz getretene Katze. Die Räder mahlen sich fest.
Stille. Kochende Stille. Die Luft ist flimmerndes Sonnenplasma.
Mit bloßen Händen schaufeln wir die Räder frei.
Der Sand kommt mir so heiß vor wie die glühende Asche, mit der in Georgien in kupfernen Bechern Kaffee aufgekocht wird.
An langen Stielen … Das weiß ich von der einzigen Fernreise, die mir im Osten des Kalten Krieges erlaubt wurde.
Ich buddle also im Death Valley Räder frei und denke an georgischen Kaffee. Diese surreale Denkweise wird mich ein Reiseleben hinweg fortan begleiten …
Wir schaffen es kurz vor dem gnädigen Sonnenuntergang auf einen Campingplatz. Saugen aus dem Wasserhahn das lebensnotwendige Nass.
Und legen uns völlig erschöpft auf Holzbänke unter freiem Himmel. Mein Fieber kommt zurück. Ich habe wirre Träume …
Einen Tag später nächtigen wir bei angenehmen Temperaturen in einem Obsthain, den wir für unbewacht halten.
Ich dünge, früh-gedrungen, einen Apfelbaum.
Eine kreischende Frauenstimme verspricht uns, in die nackten Ärsche zu schießen.
Ich sehe eine doppelläufige Flinte.
Selten habe ich meine Hose schneller hochgezogen …
Wir lernen das Stand-your-ground-law kennen und entfliehen rasch.
Bis heute wundere ich mich, warum Las Vegas für so viele Menschen einen Sehnsuchtsort darstellt.
Alles ist billig-künstlich und teuer zugleich.
Mittlerweile war ich öfters dort.
Als Ausgangspunkt für Ausflüge in die unfassbar schöne Umgebung. Lake Mead nur ein Beispiel.
Ich kenne die popkulturellen Bezüge. Casino. Die Shows.
The Rat Pack. Die Boxkämpfe. Die Rentenversicherung für alternde Stars …
Ich habe in Las Vegas gezeltet.
Und fünf Dollar beim Poker verloren. (Aber nur, damit ich diesen Satz schreiben kann.)
Die vielen alten Frauen an den einarmigen Banditen.
Die glitzernde Trostlosigkeit für die weiße Klasse auf dem absteigenden Ast. Klappernde Münzen, springende Jetons, scheppernde Kurbeln. Von seelenlosen und stupiden Automaten begeisterte Gesichter. Zur Animation der Verweis auf einen 500.000 Dollargewinn einer Mrs. Neumann.
Warum sind wir hier?
Weil wir ständig Hunger haben. Echten, realen Hunger.
Und nirgendwo in Amerika kann man so günstig frühstücken …
In San Francisco lernen wir Freunde kennen, die uns fast luxuriös beherbergen. Jenny und Rick. Wir sind im selben Alter und im selben akademischen Zwischenreich.
Fortgeschritten, aber nicht abgeschlossen. Allerdings stellt sich für sie nicht ernsthaft die Frage der Finanzierung des Alltages. Sie können es sich erlauben, Feinheiten auszuleben.
Für sie ist klar, dass wir die Feinheiten des Weingenusses erleben sollten. Da dieser probehalber kostenlos sein soll, stimmen wir zu. Prolls wie wir gehen auf Umdrehung, nicht auf Verfeinerung. Aber wir lernen dazu …
Es werden vier verschiedene Wineries angesteuert. Und je ein Dutzend unterschiedliche Weine verkostet. Die Weißbrothäppchen mit Käse stillen unseren steten Hunger, auch wenn sie nicht dafür gedacht sind.
In Glen Allen, in der Nähe von Jack Londons ehemaligem Wohnhaus, geben wir uns den Rest. Mir ist, als würde ich gekelterte Literatur saufen …
Auf dem Rückweg nach San Francisco liegen wir auf der Ladefläche des offenen Pickups, der über die Golden Gate Bridge schnurrt. Der Nebel kriecht von Nordwesten wie ein großes graues Tier über die Berge in die Bucht. Ich denke an den Horrorfilm The Fog. Aber ich fürchte mich nicht; weiß nur: So sollte es sein. So und nicht anders. Deshalb sind wir hier. Und so muss es weitergehen. Wir haben im Gefängnis des kleinen ostdeutschen Landes gegen eine irrwitzige Ideologie angeträumt. Niemand hat uns wirklich geglaubt. Aber wir fühlen uns als Gewinner einer Geschichte, die wie ein wildes Pferd in die provinzielle Enge unseres Wohnzimmers gestürmt ist. Und jetzt lernen wir, dieses Pferd zu reiten …
Auf der Gefängnisinsel Alcatraz weht mich durch die Ritzen der Fenster von Block D ein kalter Wind an. Das Wasser der Bay hat 8-10 °C. Starke Strömungen erschwerten jegliche Ausbruchsversuche. Ich höre die Schreie der Möwen …
Al Capone war hier, George „Machine Gun“ Kelly, Alvin „Creepy“ Karpis, Robert Stroud, „Birdman of Alcatraz“.
Was haben diese Männer für Träume gehabt, was fühlten sie, wenn Silvester von San Franciscos Yachthafen die Stimmen der Feiernden herübergeweht wurden? Was fühlte der Gefangene, der nach 5 Jahren Abstinenz eines Tages ein Mädchen die Treppen von Alcatraz heraufsteigen sah?
„Machine Gun“ Kelly soll wenigstens gute Geschichten erzählt haben …
Da kann ich wenig entgegensetzen, obwohl ich augenblicklich ein paar Spiegelneuronen zu viel aufbiete.
Mein Sektionschef der Germanistik an der Humboldt-Universität zu Berlin befand einst, dass Bautzen, das „Alcatraz der DDR“, ein für mich geeigneter Ort sei.
(Im Prinzip hatte er Recht.)
Eine spätere Bundestagsabgeordnete der Nachfolge-Partei, die „immer Recht“ hatte, stimmte ihm zu. Sie belehrt heute Menschen über die Grundprinzipien der Demokratie …
Keine Sorge: Dies wird keine politische Abrechnung.
Und letztlich habe ich nur drei Tage in einem Kasernen-Gefängnis verbracht. Gute Tage. Ich las drei gute Bücher …
Es ist der 3. Oktober 1990. Mein Freund Kai und ich verbringen ihn am Grand Canyon. Wir klettern auf rostig-rote Felssäulen. Unter uns die sakrale Morphologie der Erosion: durch Wind, Wasser, Hitze und Kälte aus dem Stein gefräste Kathedralen, Dome und Kirchenschiffe.
Andächtig hockt ein jeder von uns auf seiner privaten Siegessäule und lässt die Gedanken mit den Adlern, Bussarden und Falken fliegen, die zu unseren Füßen in der Schlucht schweben.
Zeitgleich verschwindet der kleine Staat, der uns so lange daran hinderte, an Orten wie diesem zu sein.
Die Gleichzeitigkeit des Unvergleichlichen.
Ein Thema, das mich nicht loslässt.
Nach knapp vier Monaten, es ist Mitte Oktober, landen wir wieder in New York.
Noch einmal dürfen wir uns bei Sly einquartieren.
Er fragt uns nach Places to see. Denkt an die Hamptons am Ostende von Long Island, wo die Reichen und Schönen wohnen und wo hippe Partys abgehen sollen, in die man sich irgendwie einklinken könne. Auch da habe er Connections.
Mittlerweile sehen wir nicht mehr direkt vorzeigbar aus.
Wir haben zwar jedes überflüssige Gramm Fett abgeschmolzen, aber Kleider machen Leute. Und Geld.
Unser Kreditkartenguthaben ist erschöpft …
Wir entscheiden uns für die South Bronx.
Zu diesem Zeitpunkt ist der Stadtteil noch genauso, wie man ihn aus einschlägigen Gangster-Thrillern kennt.
Der gefährlichste Ort der westlichen Hemisphäre. 1990 ist das mörderischste Jahr des modernen New Yorks. Am Jahresende werden 2245 Morde gezählt. Und die Outer Boroughs gelten praktisch als rechtsfreie Räume. Erst vier Jahre später wird mit dem neuen Bürgermeister Rudolph Giuliani die Kriminalitätsrate durch eine strikte Law-and-Order-Politik drastisch gesenkt und die Stadt befriedet.
Sly rät ab und will uns um nichts in der Welt begleiten. Auch seine Familie beschwört uns bei einem Besuch in Harlem einhellig, darauf zu verzichten.
Also fahren wir allein. Nicht als Risiko-Junkies, sondern als Realitätssüchtige, die sich die Welt nicht mehr aus zweiter Hand erklären lassen wollen.
Mit der Subway bis 161st Street, Yankee Stadium. Dann 149th Street, Grand Concourse. Weiter Jackson Avenue, Prospect Ave, Brook Ave, 152nd Street … Alles nur Parameter für den Polizeifunk.
Wir laufen entlang zerbombt wirkender roter Backsteinhäuser, brennender Mülltonnen und wasserspeiender Hydranten. Schmutz, Abfall, Graffitis. Ein Gebiet voller Ruinen wie im Bürgerkrieg.
Ein vorbeihumpelnder Hispanic murmelt drohend:
You’re white. What are you doing in South Bronx? Get away …
Schwarze halten auf Basketballplätzen, die wie geöffnete Raubtierkäfige wirken, plötzlich inne und rufen unverständlich Unmissverständliches.
Eine Auto-Hip-Hop-Party mit aufgedrehten Lautsprechern wird der beiden streunenden Weißen gewahr und entwickelt ein gestisches Interesse, das uns in die Flucht schlägt …
Am letzten Tag unseres ersten Aufenthaltes in Amerika wechseln wir in der 42nd Street, Ecke Fifth Avenue letzte 20 D-Mark in 11 Dollar. Wir haben, hungergeplagt, die Wahl zwischen Pizza und dem Museum of Modern Art.
Wir entscheiden uns heroisch für die Kunst.
Für Picasso, Dali, Miro, Braque, Matisse, van Gogh, Rodin, de Chirico, Grosz, Nolde, Klee, Feininger, Kandinsky, Chagall, Cézanne, Modigliani, Klimt, Dix, Mondrian, Gauguin, Kokoschka … Ja, okay. Wir entscheiden uns gegen das Knurren unserer Mägen für ein unbeachtetes Statement: Für das Beste der alten in der neuen Welt …
Am Kennedy Airport spendet Kai unsere letzten silbernen Quarter einem Sicherheitsbeamten.
Mit buchstäblich leeren Taschen fliegen wir heim.
Voll Vorfreude auf zukünftige Welterkundung …
Out of Africa
(Nairobi, 1992)
Ich liebte dieses Land, und ich fühlte mich hier zu
Hause, und wo ein Mann sich außerhalb seiner Heimat
zu Hause fühlt, dorthin sollte er gehen …
Ernest Hemingway
1987 kommt der Film „Jenseits von Afrika“ mit Meryl Streep und Robert Redford auch in die DDR-Kinos. Er löst in mir augenblicklich eine starke Sehnsucht nach diesem Kontinent aus. Natürlich mythisch aufgeladen. Und natürlich ist es eine Liebe, die auf irrigen Annahmen fußt. Aber beginnt nicht jede Liebe mit affirmativen Irrungen und Wirrungen?
Man kann über diesen Film geteilter Meinung sein. Man kann ihn berechtigt für kitschig halten. Man kann sowieso jede romantische Idee zynisch filetieren. Aber Zyniker sind auch nur enttäuschte Romantiker. Sage ich, als altersmilder Zyniker …
Heute, da ich fast jedes Land südlich der Sahel-Zone bereist und genügend über die Realität erfahren habe, um ein hinreichend klares Bild auch der Historie zu sehen, mag ich den Film noch immer. Weil er jenseits aller faktischen Unrichtigkeit eine poetische Wahrheit vermittelt.
Klar, dass unser erster Ausflug auf dem afrikanischen Kontinent zu eben jener Farm führen soll, die das mythische Epizentrum unserer Ostafrika-Vorstellungen darstellt.
Ich hatte eine Farm in Afrika …
Vom Parkplatz gegenüber dem Bahnhof von Nairobi fahren Matatus – Sammeltaxis – nach Karen, wo sich das Blixen-Farm-Museum befindet.
Wir haben wenig Geduld und mieten den Kleinbus für uns allein. Der Fahrer wirkt nicht vertrauenserweckend, eher wie der einzige Überlebende eines Matatu-Unfalls.
Und so kommt, wenn man sich auf jemanden einlässt, der nicht an Ursache-Wirkung-Beziehungen, sondern an die Jungfrau Maria glaubt, was kommen muss …
Der Fahrer fährt mit irrwitzigem Tempo.
Überholt mit schwachsinnigem Selbstvertrauen.
Und wir erleben, an Rücksitzlehnen geklammert und in Zeitlupe, was nicht psychischer Wahrnehmungsverzögerung geschuldet, sondern dem Ausgeliefertsein an kognitive Minderleistung entspringt, dem … Vermeidlichen.
Dem Zusammenprall.
Vor uns versucht ein Peugeot nach rechts abzubiegen.
Unser Matatu will, im Linksverkehr, trotzdem rechts überholen. Erst auf den letzten zehn Metern tritt er zaghaft auf die Bremse.
Wir krachen in das Heck des Peugeots, driften weiter nach rechts und landen im Straßengraben.
Die Welt scheint durch das Spinnennetz der Frontscheibe um 45 Grad gedreht.
Meine Nackenmuskulatur fühlt sich zementiert an.
Dann höre ich Kais trockene Stimme: „The eagle has landed.“
Wir lachen, weil uns nichts anderes einfällt.
Apollo-11 hat für uns seine Mission beendet. Und wir steigen nach oben aus …
Schnell versammelt sich eine Menschenmenge um die verunfallten Fahrzeuge. Glücklicherweise ist niemand ernsthaft verletzt.
Wir drücken dem Fahrer ein paar Scheine in die Hand und machen uns aus dem Staub.
Kurze Zeit später sitzen wir in einem überfüllten Matatu, das uns in Karen entlässt.
Auf der Farm sind wir die einzigen Besucher und genießen die idyllische Atmosphäre. Alles blüht; die satte, feuchte und rotbraune Erde dampft vor Fruchtbarkeit und in der Ferne sieht man die Kammlinien der Ngong-Berge.
Im Farmhaus entdecken wir die Kuckucksuhr, das Grammophon, Denys Finch Hattons Bibliothek – allerdings nur die originalen Filmrequisiten, fast alles andere ist verbrannt. Die meisten Innenaufnahmen filmte Sydney Pollack zudem in einem Haus in der Nachbarschaft.
Im kleinen Souvenirladen lernen wir Gladys kennen, eine außergewöhnlich kluge afrikanische Schönheit. Ihr Stolz fasziniert uns ungemein. Also flirten und baggern wir gewaltig. Sie hätte kongenial für die Rolle der Lebensgefährtin Berkeley Coles besetzt werden können, die im Film von Iman gespielt wird. Und natürlich weiß sie das auch.
Wir verabreden uns für den Abend vor dem Hilton in Nairobi.
Vorher wollen wir noch das Grab Denys Finch Hattons in den Ngong-Bergen besuchen, um die „Mythen-Begehung“ abzurunden.
Ein Ort von entmutigender Tristesse. Hier möchte man nicht mal sprichwörtlich „tot überm Zaun hängen“. Im konkreten Fall ein Staketenzaun mit Stacheldraht, hinter dem wir einen verwitterten grauen Obelisken inmitten von Maisanpflanzungen erblicken. Blökende Schafe, stumpfsinnig wiederkäuende Rinder und schnüffelnde Hunde beleidigen zwei enttäuschte Romantiker.
Eine gierige Alte knöpft uns für die Besichtigung des Grabes 200 Kenia-Schilling ab …
Gladys lächelt nachsichtig, als wir ihr am Abend in einem Restaurant mit einheimischer Küche von unserer Enttäuschung berichten und empfiehlt, uns künftig auf ein aktuelleres Afrika zu konzentrieren. Dann erzählt sie von ihrem Afrika, während wir Süßkartoffeln mampfen und „Süßholz raspeln“ …
Aber wir sind nicht auf erotische Abenteuer aus, unser Sinn wird von stärkeren Motiven gelenkt. Während wir auf unsere Visa für Tansania warten, lassen wir uns auf die Slums von Nairobi ein.
Naiv laufen wir, buchstäblich einfach der Nase nach, in sie hinein. Folgen dem pestilenzartigen Gestank, der aus der morastigen Niederung des Nairobi River in Miasmen aufsteigt.
Der Fluss ist kein Fluss, sondern eine rinnende Kloake.
Nairobi, River Road ist ein empfehlenswerter Roman von Meja Mwangi. Aber wir laufen in keinen Roman. Wir laufen in ein Pandämonium menschlicher Kreaturen. Überall Krüppel. Leprös Dahinsiechende. Menschen, die nur noch Rumpf sind.
Ruinen und Müllberge.
Tausende Bilder gesehen, aber nichts ersetzt den tatsächlichen Eindruck. Geh und sieh! Blech- und Holzverhaue im Schlamm.
Die abschüssige Straße führt in ein Schlammloch.
Doch plötzlich der Geruch von geröstetem Mais. Und ein erkleckliches Angebot von Früchten.
Stundenlang sehen wir keinen einzigen Weißen. Werden misstrauisch beäugt, aber nicht behelligt. Mittlerweile ist es dunkel. Unter meiner Achsel trage ich ein Bowie-Messer, das eher der eigenen Beruhigung als möglicher Verteidigungsbereitschaft dient.
Neben mir kotzt ein betrunkener Schwarzer in Schwallduschen auf seine nackten Füße.
Nahebei ein Butcher. Große blutige Fleischbrocken hängen im Fenster. Und dann sehe ich doch noch einen Weißen. Hinter der Glasscheibe. Dem gehört die Fleischerei: Ein alter Jude mit Kippa, auf einem Schemel sitzend, am erkalteten Zigarrenstummel kauend, seltsam deplatziert wirkend, der Anweisungen an seine Gehilfen gibt.
Sein Gesicht ist narbig, graue Strähnen hängen ihm schweißnass in die Stirn. Er ist hier zu Hause.
Ein nackter, glänzender, schwarzer Oberkörper beugt sich im Funkenregen über rostiges Metall. Der Mann schweißt ohne Schutzbrille. Ich muss mich selbst aus der Entfernung abwenden, weil ich den schmerzhaft grellen Lichtbogen nicht aushalte.
Mit einem Mini-Bus fährt uns Moses (sic!) sicher und umsichtig von Nairobi nach Arusha in Tansania. Wir lernen unsere Lehrmeister kennen: Jill und Harold.
Ein amerikanisches Pärchen auf zweijähriger Weltreise, schon etwas älter und mit allen Globetrotter-Wassern gewaschen.
Sie haben 12 Jahre im japanischen Kyoto gelebt und sich ihren Lebensunterhalt als Übersetzer verdient. Sie wissen, wie man sich durchschlägt. Wie man verhandelt. Wie man clever reist. Wie man unterwegs ist.
Unsere Lektion wird plötzlich durch ein vorbeiziehendes Landschaftsspektakel unterbrochen. Die Wolkendecke bricht auf. Und wir sehen erstmals die Schneekappe des Kilimandscharo. So weiß und gleißend, und so ungeheuer oben.
Die höchste freistehende Erhebung der Welt.
Nahe am westlichen Gipfel liegt der ausgedorrte und gefrorene Kadaver eines Leoparden. Niemand kann sagen, was der Leopard in dieser Höhe gesucht hat. (Ernest Hemingway in Schnee auf dem Kilimandscharo)
Jill und Harold werden uns später dazu drängen, auf den Gipfel zu steigen. Warum? Weil er da ist …
In Arusha klappern wir die örtlichen Reisebüros ab, meist eher provisorische Verschläge, in denen uns Harold die Kunst des grenzwertigen Feilschens beibringt.
Irgendwann trifft Harold im Niedrigpreissektor auf einen ebenbürtigen Meister, der wie eine Schokoladenausgabe von Nikita Chrustschow mit Schiebermütze aussieht. Es wird versprochen, geflucht, auf einem Taschenrechner herumgehackt, es werden fiktive Rechnungen erstellt, die verworfen, korrigiert und revidiert werden. Am Ende grinsen Harold und „Nikita“, beide gewiss, einander übers Ohr gehauen zu haben.
Wir grinsen auch, aber eher blöde, weil ohne Ahnung.
Dass Harold einen unfassbar günstigen Deal ausgehandelt hat, merken wir erst sehr viel später im Austausch mit anderen Reisenden.
Lake Manyara, Serengeti, Ngorongoro Krater und die Olduvai-Schlucht, die Wiege der Menschheit … The Big Five …
Stopp!
All dies ist für den Reisenden atemberaubend, spektakulär oder einfach nur neu. Ich lese in Hemingways Die grünen Hügel Afrikas. Beschreibungen von beobachteten Tieren und Landschaftsschilderungen. Ziemlich langweilig, wenn man nicht vor Ort ist. Da ein Löwenrudel, dort Nashörner, wenn man Glück hat, ein Leopard, Büffel zuhauf, Elefanten sowieso.
Trophäenjagd. Um zu Hause davon zu erzählen.
Aber um Afrika zu erleben muss man, früher oder später, Abstand nehmen von der Erlebnis-Statistik. In der nur die vermeintlich spektakulären Tiere vorkommen. Oder die Pseudo-Gefahr. Denn dieses Afrika ist weniger gefährlich als, beispielsweise, der Stadtteil von Berlin, Moabit, bei Nacht …
Ein Zelt ist in Afrika immer ein sicherer Ort. Ebenso ein Lagerfeuer. Falls man nicht gerade blutiges Fleisch oder frische Orangen in der stoffbespannten Unterkunft lagert.
Ich beziehe mich auf die Tierwelt. Menschen sind ein anderes Kapitel.
Löwen, beispielsweise, „denken“ anders als wir. Sie sehen nur die Umrisse eines Zeltes. Die dünne Zeltmembran ist ihnen nicht bewusst. Und deshalb „prüfen“ sie die auch nicht. Sie laufen einfach vorbei. Es sei denn, man lässt das Zelt offen und streckt ein Bein raus. Dann fängt wahrscheinlich auch der dämlichste Löwe an, die neuen Optionen zu checken.
Kalt ist es im Zelt am Kraterrand des Ngorongoro. Ein gewaltiger blutroter Mond schiebt sich über die Kammlinien der Berge des Hochlandes. Verschwindet halb in einem Nachthemd aus Wolkenfetzen.
Eine Hyäne klagt in unmittelbarer Nähe.
Unsere Game Drives in der Serengeti haben mein Gesicht zu einer Ledermaske verbrannt, die ich mit einer Aloe Vera-Lotion von Jill zu behandeln versuche.
Der leise Swahili-Singsang unseres Koches und des Fahrers am Lagerfeuer lässt mich einschlummern.
Irgendwann schrecke ich auf. In Höhe meines Kopfes, nur durch die Zeltwand getrennt, schnüffelt ein Tier, das über hinreichend kräftige Atemorgane zu verfügen scheint. Das Mondlicht zeichnet den eindeutigen Schattenriss einer Hyäne. Das abfallende Hinterteil. Der wuchtige Kopf, die rundlichen Ohren.
Plötzlich lässt sich das dumpfe Grollen eines Löwen vernehmen. Die Hyäne trollt sich mit einem kurzen höhnischen Gelächter, das mich in flache Zwerchfellatmung versetzt.
Danach ist an Schlaf nicht mehr zu denken. An die Akustik der afrikanischen Nacht muss ich mich erst noch gewöhnen.
Am nächsten Morgen wollen wir zum Grund des Ngorongoro-Kraters hinabfahren, was für jedes Fahrzeug eine Herausforderung darstellt. Insbesondere für Fahrzeuge ohne voll funktionsfähige Bremsen. Abdul, unser Fahrer, vertraut ganz auf Allah. Ephraim, der Koch, weiß Jesus an seiner Seite. Religiös doppelt gewappnet sollte eigentlich nichts schiefgehen. Jill und Harold sind buddhistische Juden, falls wir das richtig verstanden haben. Kai und ich sind metaphysisch unbegleitet und müssen auf positive Zufälle hoffen, was seit unserem Matatu-Unfall empirisch eher wenig Trost verspricht.
Aber der Ausblick auf die Caldera des Ngorongoro ist so unfassbar, dass theologische Erwägungen in den Hintergrund treten. Eine gewaltige Arche Noah! Oder der Garten Eden! Jeder Superlativ eine Untertreibung. Schönheit mag relativ empfunden werden. Die Schönheit des Ngorongoro ist ein naturästhetisches Absolutum. Mit nichts adäquat zu vergleichen. Es kann nur noch ein völlig Anderes geben, mit neuen Kriterien und anderen Parametern.
Die Stunden, die folgen, sind eine visuelle Meditation.
Schauen und schweigen.
An der Krücke des Faktischen lässt sich allenfalls der Raum ermessen und bevölkern. Etwa 25.000 Großsäuger leben im größten Kraterkessel der Welt am Rand der Serengeti.
Das bedeutet zugleich die größte Raubtierdichte Afrikas. Löwen, Hyänen und Leoparden.
Der Durchmesser des Kraters beträgt zwischen 17 und 21 Kilometer. Hier drängen sich Zebras, Büffel, Gnus und Antilopen in großer Zahl. Es gibt Elefanten, Flusspferde und Spitzmaulnashörner. Nur Giraffen findet man ob der steilen Abhänge nicht. Die sogenannten „Big Five“ erleben wir binnen einer Stunde, aber da sind wir emotional schon längst jenseits jedweder Trophäenjagd, weil einfach überwältigt.
Alle Löwen sind hier vollgefressen. Sie liegen auf dem Rücken, wie trächtig hechelnd, die Geschlechtsteile obszön entblößt, die Hinterpranken gespreizt. In scheinbar akuter Atemnot bewältigen sie ihr Schlaraffenland.
Die Vielfalt der Tierwelt ist das Eine.
Das Andere ist die Landschaft. Die Aufeinanderfolge der Farbbänder. Das Braungelb der Grassavanne, das Grün der Moorflächen, das Schwarzbraun der Bergketten, dazwischen das gleißende Silber der Soda-Seen und schließlich Wolken, wie überdimensionale Baumwollballen auf den Bergen, darüber hellblaues Firmament. Schattensprenkel, wechselnd in Sekundenschnelle. Und tausend rosa Flamingos, die über dem Salz zu explodieren scheinen …
Eine der häufigsten Fragen: Was ist der schönste Ort der Welt? Nun gut, ich will mich nicht drücken, der Ngorongoro-Krater ist keine schlechte Wahl. Jahre später bin ich ihn mit engen Freunden und besserem Fahrzeug noch einmal abgefahren. Die Wertung ließ sich aufrechterhalten. Doch solches Bemessen ist immer emotional geprägt. Heute weiß ich, dass der schönste Ort auch in Brandenburg liegen kann.
Jill und Harold sind der festen Ansicht, dass wir den Kilimandscharo besteigen sollten. Wir werden quasi überredet.
Per physischem Augenschein sind wir nach Expertise einiger gescheiterter Gipfelstürmer, die wir in den Restaurants von Arusha treffen, dafür bestens geeignet. Mehr noch, Jill und Harold, die bereits im Himalaya unterwegs waren, befinden, dass dies nur die Vorstufe für Besteigungen hoher Berge in Nepal sei.
Wir sind diesbezüglich eher vorsichtig bis demütig.
Schließlich haben wir nicht die geringste Ahnung vom Bergsteigen. Der höchste Berg von Ostdeutschland war und ist der Fichtelberg im Erzgebirge. 1214 Meter …
Okay, wir sind subleistungssportlich trainiert.
Kai kann sogar in der Spitze von Triathlon-Wettbewerben mithalten. Ich kann, außer Eisenstemmen, eigentlich nichts.
Na ja, ich kann mich quälen …
Keiner von uns kann klettern.
Aber das ist am Kilimandscharo auch nicht gefordert.
Wir erfahren, dass es die Höhe ist, die zu schaffen macht. Die Akklimatisation. Wir können es lassen oder es probieren. Also probieren wir es.
Unser Plan: Auf den Guide hören und demütig sein.
Eigentlich haben wir nicht das Geld für eine Besteigung.
Aber Harold handelt uns für 250 Dollar pro Person in eine Seilschaft ein. Bleibt nur noch das Problem der Ausrüstung.
Außer dünnen Schlafsäcken haben wir nichts. Auf dem Markt von Arusha finden wir Stöcke, Trinkflaschen, Kopfschützer, Wollsocken und Handschuhe. Für geeignete Bergschuhe reicht das Geld nicht. Unsere Palladium, einst für französische Fremdenlegionäre für den Dschungel im Indochina-Krieg entworfen, müssen reichen. Das sind gute Schuhe, aber es sind Stoff-Schuhe. Minus-Temperaturen oder Eis und Schnee sind als Einsatzzweck nicht vorgesehen. Für den Gipfelaufstieg planen wir ein „Zwiebelprinzip“ aus allen verfügbaren T-Shirts, Hemden und Windjacken übereinander.
Noch Jahre später bringen wir in unseren Diashows das Publikum mit unseren „historischen“ Fotos von unserem bizarren Outfit verlässlich zum Lachen. Zwei abgehalfterte Lumpensammler und Hungerleider, die wie Opfer der „Großen Depression“ aussehen. Aber Hunger werden wir auf unserer ersten Bergexpedition nicht leiden. Das liegt vor allem am organisatorischen Unvermögen von Clemence, der mit überschaubarem kaufmännischem Erfolg Aufstiege zum Kilimandscharo managt. Die anderen Teilnehmer unserer „Seilschaft“ – ein Seil wird nie gebraucht – treten nämlich gar nicht an. Die Lebensmittel jedoch sind schon auf die drei Träger verteilt. Dazu kommt der Guide August Joseph. Der spricht ein grausiges Englisch. Und wiederholt eigentlich immer nur eine Swahili-Ansage: Pole, pole. In dieser Ansage verbirgt sich jedoch das entscheidende Erfolgsrezept für einen Aufstieg. Ruhig, langsam, behutsam. Und das befolgen wir.
Auf der Normalroute wird der 5895 Meter hohe Kilimandscharo üblicherweise in fünf Tagen bestiegen. Den Rückweg eingerechnet. Das ist für eine vernünftige Akklimatisation – das A und O – im Prinzip zu wenig. Wenn man sich vorher länger im Hochland aufgehalten hat, ist man im Vorteil. Denn es droht die Höhenkrankheit. Das ist die eigentliche Gefahr. Sie äußert sich in den Anfangssymptomen Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen und Schwindelgefühlen. Später können Lungenembolien und Hirnödeme auftreten. Dann besteht akute Lebensgefahr. Die individuelle Anpassung geschieht höchst unterschiedlich und ist nur bedingt an physische Leistungsfähigkeit gekoppelt. Die Nierenfunktion spielt eine zentrale Rolle, weshalb sehr viel getrunken werden muss. Aber kein Alkohol …
Ein ehemaliger deutscher Boxweltmeister im Super-Mittelgewicht hat über seinen Aufstieg auf den Kilimandscharo einmal geäußert, dass er sich „wie ein 85-Jähriger“ gefühlt habe. Oben angekommen, zitternd vor Kälte, ist er „pappsatt. So kaputt wie noch nie.“ Kein Vergleich mit einem WM-Kampf …
Sportlicher Ehrgeiz gerät an diesem Berg schnell an Grenzen.
Kai und ich steigen bewusst langsam und am Ende der anderen „Gipfelstürmer“. Die Letzten werden die Ersten sein.
Es geht durch alle Klimazonen der Erde. Wollte man dies horizontal erleben, müsste man von Grönland in den Kongo.
Von den Plantagen am Gate geht es in den Regenwald, dann in Heide und Moorland, anschließend in die Hochwüste und schließlich in die arktische Zone mit ewigem Eis.
Die erste Etappe zur Mandara-Hut auf 2800 Metern führt durch dichten Bergregenurwald auf schlammigen Pfaden. Armdicke Wurzeln kreuzen wie Schlangen den glitschigen Grund. Wilde Begonien, Blut- und Fackellilien, ginsterähnliche Stauden. Bemooste Bäume, von denen Lianen hängen, sattgrünes und feuchtes Dunkel. Affen beobachten uns von überhängenden Zweigen. Unsere Stoffschuhe sind bald hoffnungslos durchnässt.
Wir kommen als Letzte ins Lager und werden belächelt.
Die so stark aussehenden Kerle sind schon jetzt so langsam.
Neidische Blicke nur über die üppigen Mahlzeiten, die wir ob der Fehlkalkulation von Clemence serviert bekommen. Wir haben Appetit und fühlen uns gut.
Am nächsten Tag verlassen wir seltsam abrupt den Regenwald und die rutschigen roten Lehmböden und stapfen sieben Stunden durch eine Heidelandschaft mit Pflanzengigantismus. Heidekraut in Strauchform. Riesige Senecien und Lobelien, überdimensionierte Gladiolen.
An Bächen füllen wir unsere Trinkflaschen.
Stoisch gleichmütig steigen wir im Diesel-Modus. Fitness, Tempo, Rhythmus, Wasser, Essen und Schlaf stimmen.
Wir bekommen ein Gefühl für das richtige Verhalten am Berg.
Auf 3800 Metern erreichen wir, wieder nach allen anderen, Horombo Hut. Sind nun weit über der geschlossenen Wolkendecke. Mittlerweile ist eine nicht unbeträchtliche Zahl der anderen Bergsteiger leicht oder mittelschwer höhenkrank.
Es wird viel und vernehmlich gekotzt und sparsam gegessen.
Kai und ich schlagen uns die Bäuche voll. Unsere Köche und Träger leisten unter den Umständen fabelhafte Arbeit.
August Joseph grinst und sagt nur: Pole, pole.
Schwankende Gestalten in der vegetationslosen Hochwüste. Schutthalden, Staub und Lava-Guss. Vor Stunden eine letzte Quelle: Last Waterpoint.
Für einige Bergsteiger das Ende der Fahnenstange. Bei Höhenkrankheit hilft nur der schnelle Abstieg.
Ich habe nur einmal einen Menschen erlebt, der sich auf gleicher Höhe erholt hat. Meine Frau.
Das war sehr viele Jahre später. Kai und ich erwiesen einem Sponsor einen Freundschaftsdienst, und wir eskortierten den Mann im Rentenalter auf den Berg seiner Jugendträume, weil wir mittlerweile im Höhenbergsteigen erfahren waren und wussten, was wir taten. Wir hatten beide unsere Freundinnen dabei und ich nutzte die temporäre Schwäche der meinen, um ihr auf dem Gillman’s Point in 5685 Metern ein Eheversprechen abzuverlangen. Das war ein bisschen fies, aber ich neige dazu, Chancen zu nutzen. Es gibt aber die nicht völlig unberechtigte Hoffnung, dass sie sich in den letzten 20 Jahren an diesen Gedanken gewöhnen konnte.
Kai und ich sitzen zu Füßen des Kibo-Gipfels, der schneebedeckt so nahe erscheint. Wir schreiben in unseren Tagebüchern und schauen, und über uns schwebt ein Bartgeier, man kann seine suchenden Augen sehen, und der Bartgeier schaut zurück. Wir unterhalten uns über die Südpolexpeditionen von Scott und Amundsen und lachen über unsere selbstironischen Vergleiche. Kai fragt mich, ob mir nicht die Tinte einfriert, denn es wird allmählich bitterkalt. Wir sind auf 4750 Metern und kurz nach Mitternacht wollen wir zum Gipfel aufbrechen.
In der Kibo-Hütte lagert auch eine Gruppe des Deutschen Alpenvereins. Ich werde Zeuge einer letzten Lagebesprechung zwischen den Stockbetten.
Die Professionalität des Leiters verschüchtert mich. Er wirkt wie Rommel auf dem Vormarsch in Ägypten. Eine Karte wird ausgebreitet. Der Zeitplan besprochen. Verstohlen mustere ich die Ausrüstung der Expeditionsteilnehmer. Schalenschuhe. Meine Palladium sind in der Hochwüste Gott sei Dank getrocknet. Steigeisen für den Abschnitt zwischen Gillman’s Point und dem vereisten Weg am Kraterrand zum Uhuru Peak.
Zum ersten Mal sehe ich Steigeisen. Scheinen angemessen. Sollte man vielleicht haben. Habe ich nicht.
Ich ziehe mir den Schlafsack über die Augen.
An echten Schlaf ist nicht zu denken. Es wird gehustet, sich herumgewälzt und geröchelt. Ab und wann verschwindet jemand zur Entleerung von Magen oder Darm.
Um Mitternacht werden wir von unseren Guides geweckt.
Ich stehe auf und ziehe alles an, was ich habe.
Im Schein einer Petroleumlampe beobachten mich die Mitglieder des Deutschen Alpenvereins hohläugig und kreidebleich in ihren Hightech-Schlafsäcken. Keiner von ihnen steht auf. Sie sind alle so höhenkrank, dass ein Aufstieg unmöglich ist. Aber sie ermuntern mich und wünschen mir Glück.
Irritiert stolpere ich in die -15°C kalte und sternklare Nacht, remple Kai an und folge ihm und August Joseph in die Serpentinen der Lava-Sandhänge. Unsere Stirnlampen bohren Lichtkegel in den dunklen Bauch des Berges.
Im selben Tempo wie auf den vorigen Etappen gehen wir den steilen Gipfel an. Unsere Körper haben sich an diesen Rhythmus gewöhnt. Muskeln, Sehnen und Hirn kennen ihn.
Was vorher langsam war, ist jetzt schnell.
Bald schon lassen wir alle anderen Bergsteiger hinter uns.
Die Lichterkette ihrer Stirnlampen reißt ab.
Nach einiger Zeit wird das Tempo unseres Bergführers August Joseph geringer. Verlangsamt sich fast bis zum Stillstand.
Erfahrung oder Schwäche? Wir rätseln. Allerdings haben die Wartepausen zur Folge, dass unsere Füße in den Stoffschuhen kalt werden. Die Zehen spüren wir schon nicht mehr. Ohne Bewegung keine Hoffnung auf Erwärmung. Deshalb steigen Kai und ich weiter. August Joseph ist aufgebracht, bemäntelt seine Schwäche mit Erfahrung, jetzt sind wir dessen sicher.
Zwei Stunden später erreichen wir die Meyer-Höhle und lassen, dort etwas geschützt, August Joseph aufschließen. Sein unverständliches Kauderwelsch bezieht sich auf die Bergsteiger, die als Glühwürmchen weit unten blinken. Die sind nicht unser Maß. So viel Selbstvertrauen haben wir.
Nur 5-8 Prozent aller Aufstiegsversuche endeten bis 1992 auf dem Uhuru-Peak.
Meine rechte Daumenkuppe erfriert. Noch Tage später kann ich eine Nadel in das gefühllose Fleisch stechen, ohne etwas zu merken.
Dann stellen sich Kopfschmerzen ein. Eine neue Erfahrung, weil ich dank irgendeiner individuellen Prädisposition unter normalen Bedingungen nie welche bekomme. Nicht mal bei Alkoholmissbrauch …
Bald sind wir in der Schnee- und Eisregion.
Um 5.30 Uhr erreichen wir Gillman’s Point, den Kraterrand, in 5685 Meter Höhe. Noch ist alles dunkel, nur langsam hellt sich der Horizont auf.
Wir trinken das gefrierende Wasser unserer Feldflaschen und warten auf August Joseph.
Unser Bergführer ist fix und fertig. Er will nicht weiter, weil es für den Uhuru-Peak angeblich zu spät sei.
Das ist natürlich absurd. Entlang des Kraterrandes werden bis dorthin noch etwa zwei Stunden veranschlagt. Wir verhandeln, raten ihm zurückzugehen, er sei zu krank, wir würden den Weg allein finden.
„How you know the top?“, radebrecht August Joseph keuchend.
„When all the ways lead down again“, entgegnet Kai weise, ohne eine Miene zu verziehen.
Wir rappeln uns auf und gehen weiter. August Joseph bleibt sitzen.
Man kann das letzte Teilstück leicht unterschätzen, weil der Weg nun vergleichsweise sanft ansteigt. Dafür werden die Stiege schmaler, und im vereisten Firnschnee sind unsere Gummisohlen ohne festen Tritt.
Die Sonne geht auf. Weit unter uns die dicke Daunen-Wolkendecke, darüber ein gewaltiger roter Feuerball. Rechts von uns der vergletscherte Krater. Ein gleißendes Amphitheater aus Eiswandkaskaden.
In unseren Mägen rumort es. An unseren Schädeln reiben sich, dem Druck nach zu urteilen, Nilpferd-Ärsche wund.
Noch 100 Meter, wir sehen die tansanische Flagge.
Sind endlich, endlich da.
Und trotz der Erschöpfung stellt sich ein nie erlebtes Gefühl ein. Jede Kokain-Line verkommt zum Schmalspurgleis im Vergleich zu dieser körpereigenen Endorphin-Ausschüttung.
Über den Wolken und weit über der Welt …
Rational veranlagt, wie wir sind, haben wir auf eine grandiose Aussicht spekuliert.
Hoher Berg, gute Aussicht.
Sehr hoher Berg, noch bessere Aussicht.
Den „mentalen Gezeitenanstieg“ hatten wir so nicht auf der Rechnung …
Unsere Kameras sind eingefroren. Lethargisch drücken wir auf die Auslöser. Ein Bügel bricht in der Kälte …
Auf dem Weg zurück lesen wir August Joseph auf, der sich auf allen Vieren gerade erbricht. Auch er hat ein Ziel – das üppige Trinkgeld als Bergführer einer erfolgreichen Besteigung. Ein moralisches Dilemma. Wir geben ihm Wasser und päppeln ihn mit Aspirin auf. Und führen ihn zurück zu den Abhängen unterhalb des Gillman’s Point, die er allein bewältigen kann.
Im Highspeed jagen wir nun die weichen Hänge hinab. Slalomfahrer mit Stöcken, doch ohne Skier. Unsere Oberschenkel und Waden brennen. Aber die Euphorie treibt uns voran.
In der Kibo-Hütte bereiten uns unsere Träger Tee und einen kleinen Imbiss. Wir genießen die Anerkennung derer, die vorzeitig umkehren mussten.
You made Uhuru?
Yes, we made it.
Die eitel-naive Freude von zwei Berganfängern. Verzeihlich.
Es folgt ein 35 Kilometer langer Abstieg bis zur Mandara-Hütte, der mutmaßlich nur durch den Erfolg der Bezwingung unseres ersten nennenswerten Berges gelingt. Denn es ist definitiv die kräftezehrendste Wanderung unseres Lebens so far. Gegenseitig spornen wir uns an. Wir albern. Machen Witze. Philosophieren. Fallen hin. Stehen wieder auf. Stützen uns. Taumeln. Werden wortkarg. Verstummen.
Schleppen uns durch den tröpfelnden, schlammigen Regenwald, völlig verdreckt. Erreichen schließlich die Mandara-Hütte.
Das letzte Gefühl, an den Rändern des Bewusstseins, bevor wir in einen komatösen Schlaf versinken: Da geht noch was. Das ist nur der Auftakt. Wir sind jung. Wir sind stark. Diese Welt ist so schön. Und wir haben gerade erst angefangen …
Himalaya
(Nepal, 1993)
Dass die Dinge geschehen, ist nichts:
Dass sie gewusst werden,
ist alles.
Egon Friedell
Unsere Vorbereitungen auf Reisen werden professioneller.
Wir wissen nun, dass wir nicht immer wie vom Flickschuster ausstaffiert antreten können. Wir brauchen gute Ausrüstung und Übung, wie man sie benutzt. Also investieren wir in Hightech-Zelte und Schlafsäcke und Bergsteiger-Equipment. Unsere Giro-Konten tendieren ins Minus.
Im April fliege ich nach Island, um unsere Ausrüstung zu testen. Ich erlebe ein Land, das mich zutiefst fasziniert.
Ein halbherziger Versuch, den Hvannadalshnúkur, Islands höchsten Gipfel, solo zu besteigen, scheitert einschüchternd bereits an der ersten Hürde, einer Kammlinie weit entfernt vom Ziel. Ein plötzlicher Sturm lässt meinen Körper waagerecht wie einen Wimpel am Griff meines Eispickels in den Böen flattern. Diese ungeahnte Naturkraft stutzt mich deprimierend auf ein Zwergenmaß zurecht. Mit Mühe rette ich mich zum Basislager zurück. Ich bekomme eine Vorstellung von den Gewalten, die in den Bergen herrschen. Und werde wieder demütig.
In der Nacht mache ich Bekanntschaft mit Fallwinden vom Gletscher Vatnajökull. Es fühlt sich an, als spränge jemand aufs Zeltdach …
Im Juli entschließen Kai und ich uns ad hoc zu einer Besteigung des Mont Blanc (4810m), des höchsten Berges in Europa. (Je nach Definition der Schlaumeier …)