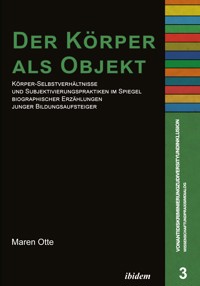
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ibidem
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Von Antidiskriminierung zu Diversity und Inklusion. Wissenschaft und Praxis im Dialog
- Sprache: Deutsch
Welche Rolle spielen biographische Prägung, Geschlechtszuschreibungen und die soziale Herkunft für die Wahrnehmung, das leibliche Empfinden und den Umgang mit dem eigenen Körper? Sind Phänomene wie Burn-out und Erschöpfungsdepression Ausdruck einer gegenwärtig konstatierten entfremdeten Körperkultur? Und wie lassen sich diese Fragen im Rahmen der Biographieforschung überhaupt untersuchen? In Anknüpfung an Bourdieu, Butler und Foucault nimmt Maren Otte das Sprechen über den eigenen Körper als Praxis der Selbstpositionierung in den Blick und weist anhand von biographischen Interviews mit Studierenden aus Nicht-Akademikerfamilien nach, dass die individuelle Objektivierung des Körpers als Erklärung für einen entfremdeten Umgang mit ihm nicht ausreicht. Sie rekonstruiert vielmehr das Sprechen als Ort der Verhandlung geltender Diskurse einerseits und (interaktiver) Prozesse der Anerkennung, Identifikation und Differenzbildung andererseits. Über den fallübergreifenden Vergleich von Erzählmotiven und biographischen Selbstdarstellungen zeigt Otte darüber hinaus, wie sich ein spezifischer Habitus bei Bildungsaufsteigern auch in ihrem Körper-Selbstverhältnis widerspiegelt. Sie macht damit deutlich, dass sich soziale Ungleichheiten sowie Geschlechtszuschreibungen bis heute in die Perspektive auf den Körper und damit auch in die Umgangsweisen mit dem Körper einschreiben. Das Buch richtet sich nicht nur an Studierende der Erziehungswissenschaften, Soziologie und Psychologie, sondern auch allgemein an Interessierte am Thema Sicht auf den eigenen Körper.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 407
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
ibidem-Verlag, Stuttgart
Inhaltsverzeichnis
Vorwort des Reihenherausgebers
Danksagung
1. Einleitung
2. Sprechen über den Körper: Theoretischer Rahmen und Diskussion
2.1. Körperdeutungen und Lebensstile im Anschluss an Bourdieu
2.1.1. Habitus: Das Körper gewordene Soziale
2.1.2. Der Körper als unwiderlegbarste Objektivierung des Klassengeschmacks
2.1.3. Der Körper als Symbol der ,männlichen Herrschaft‘
2.1.4. Gesellschaftlicher Wandel und Transformation von Körperidealen
2.2. Sprechen über den Körper als diskursive und performative Praxis
2.2.1. Macht, Wissen und Subjekt
2.2.2. Performative Sprechakte und Anerkennung
2.2.3. Selbsttechnologien und Selbstsorge
2.2.4. Zwischenfazit
2.3. Praktiken der Positionierung im Sprechen
2.3.1. Diskurs um ein männliches ,Riskieren‘ und eine weibliche ,Sorge‘ um den Körper
2.3.2. Legitime Argumentationsmuster: Natürlichkeit und Souveränität
2.3.3. Herstellung von Geschlechtsidentität und Bildungsaufsteigerhabitus
2.3.4. Offene Fragen
3. Methodische Überlegungen: Biographische Interviews als Selbsttechnologien
3.1. Vorüberlegungen
3.1.1. Warum biographisch-narrative Interviews?
3.1.2. Narrative Interviews als Geständnisse
3.2. Erhebung der Daten
3.2.1. Zur Auswahl und Beschreibung des Samples
3.2.2. Durchführung der Interviews
3.3. Schritte der Auswertung
3.3.1. Transkription
3.3.2. Feinanalyse der Anfangssequenzen und Narrationsanalyse
3.3.3. Analyse von Körper-Selbst-Verhältnissen: Deutungsmuster, Diskurse und Praktiken
4. Fallbeschreibungen: Körper und Biographie
4.1. Auswahl und Strukturierung der Fallbeschreibungen
4.2. Lennart, 28: Der Erfolgs-Körper
4.2.1. Einstieg ins Interview: Der fehlende Ehrgeiz
4.2.2. Argumentationslinien und Implizites: Notwendigkeit und sexuelle Attraktivität
4.2.3. Körper-Selbst-Verhältnis: Den eigenen Ehrgeiz beweisen
4.3. Daniel, 29: Der gefährdete Körper
4.3.1. Einstieg ins Interview: Die starke Triebkraft
4.3.2. Argumentationslinien und Implizites: Gesundheit und Ängste vor Selbstgefährdung
4.3.3. Körper-Selbst-Verhältnis: Orientierungslosigkeit und Suche nach Halt
4.4. Sandra, 34: Der unbeschwerte Körper
4.4.1. Einstieg ins Interview: Die antrainierte Körperwahrnehmung
4.4.2. Argumentationslinien und Implizites: Souveränität und Ablehnung des Körpers
4.4.3. Körper-Selbst-Verhältnis: Den eigenen Wert beweisen
4.5. Hannes, 31: Der ausagierte Körper
4.5.1. Einstieg ins Interview: Der körperliche Verfall und die Freude an der Bewegung
4.5.2. Argumentationslinien und Implizites: Stärkeideal und Erniedrigungserfahrungen
4.5.3. Körper-Selbst-Verhältnis: Kampf um die eigenen Bedürfnisse
4.6. Ulrike, 29: Der angetriebene Körper
4.6.1. Einstieg ins Interview: Das ,Großwerden‘ in der Natur
4.6.2. Argumentationslinien und Implizites: Souveränität und der Körper-für-Andere
4.6.3. Körper-Selbst-Verhältnis: Kampf um Unabhängigkeit
4.7. Sarah, 23: Der fühlende Körper
4.7.1. Einstieg ins Interview: Die Tragik der Pubertät
4.7.2. Argumentationslinien und Implizites: Der Körper ,für sich‘ und ,mit Anderen‘
4.7.3. Körper-Selbst-Verhältnis: Wunsch nach Nähe und Selbstbestimmung
5. Kontrastierende Vergleiche: Lebensgeschichten als Kämpfe um Souveränität und Anerkennung
5.1. Fallspezifische Thematisierungsweisen
5.1.1. Lennart: Der Erfolgs-Körper
5.1.2. Daniel: Der gefährdete Körper
5.1.3. Sandra: Der unbeschwerte Körper
5.1.4. Hannes: Der ausagierte Körper
5.1.5. Ulrike: Der angetriebene Körper
5.1.6. Sarah: Der fühlende Körper
5.1.7. Zwischenbilanz: Der Körper als Objekt
5.2. Darstellung der Lebensgeschichte: Kampf und Befreiung
5.2.1. Die Fotobeschreibung: Präsentation der Persönlichkeit und spontane Gefühle
5.2.2. Die Anfänge in die Narration: Das frühkindliche Selbst und die Prägung durch die Eltern
5.2.3. Pubertät als ,Tiefpunkt‘ der Lebensgeschichte
5.2.4. Biographische Wendepunkte: Auszug als Befreiung und Orientierungslosigkeit
5.2.5. Bildungsgeschichte als Kampf gegen innere und äußere Widerstände
5.3. Körperthematisierungen und Diskurse
5.3.1. Drei Arten, über den Körper zu sprechen: Körper als Leistungsträger, Schönheitsobjekt und leibliches Gegenüber
5.3.2. Performative Männlichkeit: Körper als Symbol der Fähigkeiten und Mittel zum Zweck
5.3.3. Performative Weiblichkeit: Körper als Ausdruck des Selbst und der Unabhängigkeit
5.3.4. Akademische Distinktionslinien: Selbstsorge und Achtsamkeit
5.4. Handlungsstrategien: Erfolg, Anerkennung und Souveränität
5.4.1. Körperdeutungen und Körperumgang
5.4.2. Sprache: Entfremdung von Bedürfnissen und Gefühlen
5.4.3. Biographische Konflikte und Kämpfe
6. Körper-Selbst-Verhältnisse von Bildungsaufsteigern
7. Literaturverzeichnis
Von Antidiskriminierung zu Diversity und Inklusion
Impressum
Vorwort des Reihenherausgebers
Maren Otte lernte ich vor Jahren in einem meiner „Heimlichen Begleiter – Soziale Herkunft und Bildung“-Workshops, den ich zusammen mit Oliver Trisch gestalte, dessen Dissertation zum Anti-Bias-Ansatz die erste Publikation in dieser Reihe war, kennen. Zu dieser Zeit war Maren Otte Stipendiatin der Hans-Böckler-Stiftung, für die wir auch den Workshop durchführten. In der Workshopreihe ging es uns um „Empowerment von sogenannten ‚Arbeiterkindern‘“, die studieren, oder, zeitgemäßer, wie die Soziologie es heute formulieren würde, für Studierende, deren Eltern keinen akademischen Hintergrund haben.
Wir arbeiteten damals auch intensiv mit dem Körper. Denn meine Aufgabe bei diesem Workshop war es, sich dem Thema soziale Herkunft mit den Methoden des „Theaters der Unterdrückten“ anzunähern – und Theaterspiel ist ohne Körpereinsatz nicht möglich. Als Maren beim Abendessen über ihr Dissertationsvorhaben „Körper und soziale Herkunft“ erzählte, wurde ich hellhörig. Im Mittelpunkt sollten Bildungsaufsteiger stehen. Ich habe ihr sofort angeboten, diese wissenschaftliche Arbeit in der Reihe „Von Antidiskriminierung zu Diversity und Inklusion – Wissenschaft und Praxis im Dialog“ zu veröffentlichen, weil ich davon überzeugt bin, dass dieses Thema eine interessierte Öffentlichkeit findet.
Inzwischen ist das Thema soziale Herkunft im akademischen Diskurs wieder präsenter geworden, nicht zuletzt aufgrund des Bestsellers „Rückkehr nach Reims“ von Didier Eribon, der große Wellen geschlagen hat. In Eribons Buch lässt sich einiges über den Habitus in einer Arbeiterfamilie erfahren, aber wie sich dieser auf die Körperlichkeit auswirkt, wird nicht behandelt. Diese Lücke schließt Maren Otte mit ihren biographischen Erzählungen von Bildungsaufsteigern.
Sicherlich wird diese anspruchsvolle Arbeit nicht so viele Leser*innen finden wie Didier Eribon, aber sie wird vielen Menschen eine Bereicherung sein, die sich mit dem Thema Körper und soziale Herkunft intensiver beschäftigen wollen. Ich wünsche allen Leser*innen viel Freude und Erkenntnisgewinn bei der Lektüre.
Harald Hahn
Berlin im August 2018
„also ich hab nur dieses Körper ein Zweites gibts nicht zum Glück naja leider“ (lacht) (Daniel, Zeile 54)
„ICH IN DER NATUR ist ähm . ist wahnsinnig wichtig bis HEUTE“ (Ulrike, Zeile 10)
„das erste Mal womit ich dann so-so ernsthaft mit . Körper auseinandersetzen musste war als die MÄDELS interessanter wurden“ (Lennart, Zeile 32)
„jetzt plötzlich wird der Körper interessant für mich das war halt vorher so (I: hm) ja den gibts halt zwangsläufig“ (Sandra, Zeile 758-759)
„eigentlich hab ich so (...) hab ich glaub ich eigentlich schon immer ganz gut so ZEICHEN oder so also mein Körper schon ganz gut WAHRnehmen können“ (Sarah, Zeile 135-137)
„ich wollte immer der PROFI sein (lacht) der der was KANN und das hat sich für mich vor allem KÖRPERLICH dargestellt und auch irgendwie durch ne körperliche ERSCHEINUNG“ (Hannes, Zeile 82f)
Danksagung
Eine wissenschaftliche Arbeit wie diese braucht die Unterstützung Vieler, um zum Abschluss zu kommen. Ohne die Hilfe der folgenden Personen wäre diese Arbeit nicht möglich gewesen: Aus ganzen Herzen bedanke ich mich bei allen, die sich dazu bereit erklärt haben, ihre persönliche Körpergeschichte zu erzählen. Ohne das Vertrauen, um sich in diesem Kontext öffnen zu können und vielfältige Einblicke in die persönliche Biographie zu geben, hätte ich diese Arbeit nicht schreiben können.
Fachlicher Dank gilt als Erstes Prof. Dr. Sabine Reh, die meine Dissertation betreut und begutachtet hat. Durch ihre Unterstützung, ihre konstruktiven und kritischen Anregungen hat sie mich von Beginn an immer weiter vorangetrieben und mir den Weg in eigenständiges wissenschaftliches Arbeiten gezeigt. Durch ihre Motivation und die vielfältigen Ideen ist die Arbeit erst zu dem geworden, was sie jetzt ist.
Weiterhin danke ich allen, die mir Feedback zu meinen Ergebnissen und Interpretationen gegeben haben und mich dadurch zu einem Perspektivenwechsel und neuen Einsichten inspiriert haben. Hier bedanke ich mich besonders bei: Dr. Tilman Drope, Dr. Kathrin Berdelsmann, Lea Steinert, Katharina Albers, Martin Fries, Almut Röhrbohrn, Josefine Wähler, Stefan Schubert, Benjamin Cers, Claudia Schulz und Linda Massino. Für die technischen Hilfen danke ich Dr. Marvin Schulz sowie Dr. Jannis Uhlendorf. Neben den fachlichen Rückmeldungen gilt mein Dank allen, die mich in den letzten Jahren begleitet, mich durch Gespräche inspiriert und mir geholfen haben, mich abzulenken. Weiterhin danke ich meinen Eltern, Marianne und Dieter Otte, die mich mein Leben lang motiviert haben, meinen Weg zu gehen und an mich zu glauben. Ich danke Claudia Schulz für ihre Inspiration, diese Arbeit mit Leichtigkeit und Spaß zu schreiben. Schließlich möchte ich mich bei Ragnar Karlsson bedanken, der mich die letzten drei Jahre auf vielfältige Weise inspiriert und mir Kraft gegeben hat.
1. Einleitung
„Was immer wir mit unserem Körper tun, wie wir mit ihm umgehen, wie wir ihn einsetzen, welche Einstellung wir zu ihm haben, wie wir ihn bewerten, empfinden und welche Bedeutung wir dem Körper zuschreiben, all das ist geprägt von der Gesellschaft und der Kultur, in der wir leben.“ (Gugutzer 2004, 5)
Das Verhältnis von Menschen zu ihrem Körper besteht in einer Zweiheit: Einerseits nehmen wir den Körper aus einer Außenperspektive wahr und machen ihn zum Objekt unserer Wahrnehmung und unseres Handelns. Andererseits sind wir leiblich an unseren Körper gebunden und erleben uns bei Schmerzen, Müdigkeit, Hunger oder Durst aus einer Innenperspektive.1Trotz dieses „unaufhebbaren Doppelaspekts“ (Plessner 1975, 294) von Körper-Haben und Leib-Sein, scheint es allgegenwärtig, den Körper als Gegenstand zu behandeln. Dies äußert sich bereits in der Alltagssprache: Wir ,sind‘ keine Körper, sondern wir ,haben‘ einen Körper. Indem wir über den Körper sprechen, machen wir ihn somit automatisch zum Objekt unserer Anschauung. Diese distanzierte Konstruktion unserer Alltagssprache ist eigentlich verblüffend, da wir ohne unseren Körper nicht wären. Gleichzeitig stellt sich – vor dem Hintergrund von Volksleiden wie Burn-out bzw. Erschöpfungsdepressionen2, die aktuell als häufigste Ursache von Krankschreibungen konstatiert werden – die Frage, inwieweit sich bereits in den alltäglichen sprachlichen Zugängen zum Körper Tendenzen eines ignorierenden und auch schädigenden Umgangs abzeichnen.
Mit meiner Forschungsfrage knüpfe ich an soziologische Debatten an, nach denen sich neoliberale Dynamiken – z.B. die Flexibilisierung des Arbeitsmarkts, die Entstehung vielfältiger Märkte, Technologien und „Expertenkulturen“ (Alkemeyer u.a. 2003a) – und die Bereitstellung von Wissen zu Gesundheit und Selbstsorge in individuelle Denkformen und Praktiken einschreiben. Villa spricht von einer „Hegemonie eines spezifischen ökonomisch inspirierten Optimierungsgebots als übergeordnete Subjektivierungsweise“ (Villa 2008, 249). Demnach folgt auch der Körperumgang der Logik eines „unternehmerische[n] Selbst“ (Bröckling, 2007) und wird durch eine zunehmende Entfremdung gekennzeichnet, bei der er als „symbolisches Kapital“ (Kreisky 2003, 4) für den beruflichen und privaten Erfolg permanent verbessert und eingesetzt werden soll.3 Laut Abraham steht „die deutliche Zunahme von stressbedingten Erkrankungen, chronischen Erschöpfungszuständen, Angststörungen und Depressionen [...] in engem Zusammenhang mit Arbeitsbedingungen, die den Menschen entweder überfordern oder ihn aber als ‚unrentabel’ aussortieren“ (Abraham 2012, 16). In der Biographie- und der Habitusforschung wird insbesondere der Zugang zum Körper als Arbeitsinstrument als Risikofaktor dafür verstanden, diesen als „auszubeutende Ressource“ (Abraham 2002, 476) zu benutzen. Michael Meuser beschreibt dieses „Riskieren des Körpers“ (Meuser 2005) auch als ,männlichen Habitus‘ und stellt diesen einer ,weiblichen‘ Sorge um den Körper gegenüber.
„Während Frauen eher sagen würden: ‚Ich bin mein Körper‘, läßt sich die männliche Perspektive angemessener in die Aussage übersetzen: ‚Ich habe einen Körper und der muß funktionieren‘ [...] Solange der Körper aus dieser Außensicht funktioniert, verschwenden Männer kaum einen Gedanken an das, was in ihm vorgeht. Sie wissen auch kaum etwas über sein Innenleben, häufig jedenfalls erheblich weniger als über die Funktionsweise und das Innenleben ihres Autos.“ (Brandes 2003, 10)
Die Idee einer ,männlichen‘ Außen- und ,weiblichen‘ Innenperspektive – hier beispielhaft bei Brandes dargestellt – unterstellt nicht nur geschlechtsspezifische Unterschiede im Umgang mit dem Körper aufgrund unterschiedlicher Thematisierungen, sondern baut auf der Prämisse auf, eine gesellschaftliche Objektivierung des Körpers sei die Ursache für ein individuell schädigendes Verhalten.
Mit diesen Annahmen habe ich mich in meiner Arbeit kritisch auseinandergesetzt. Meine These ist erstens, dass die Objektivierung und Ökonomisierung des Körpers nicht nur negativ, sondern ambivalent zu betrachten ist und vielfältige und auch widersprüchliche Handlungsstrategien impliziert. Von den Klassikern der Körpersoziologie4 bis zu aktuellen Bezugnahmen wurden jedoch bisher vor allem die Bereiche in den Blick genommen, in denen der Körper diszipliniert, optimiert und kontrolliert wird. Es gibt zahlreiche Studien zu Schönheitspraktiken und -technologien (Degele 2004, 2008, Villa 2008), Diäten (Stein-Hilbers/Becker 1998, Forster 2002, Gugutzer 2005) sowie zum Leistungs- und Fitnesssport (Gugutzer 2005, Alkemeyer 2003, Gosch 2008, Graf 2013), wobei ein Überhang von Analysen zur weiblichen Geschlechtsidentität auffällt (u.a. Helfferich 1994, Degele, Villa 2008). So bedeutsam die Analyse der Gefahren der Ökonomisierung des Körpers auch ist, jenseits von Kontrolle und Überforderung werden durch die Bereitstellung von Wissen, Techniken und Angeboten zur Gesundheit, Prävention und Entspannung (Wellness, Massagen, Meditation) auch zahlreiche Optionen geboten, sich dem Körper zuzuwenden.
Zum anderen betrachte ich die individuelle Deutung des Körpers als Arbeitsinstrument nicht zwingend als Beleg für einen ,funktionalen Umgang‘, sondern ich sehe das Sprechen über den Körper insgesamt als vielschichtig und nur auf mehreren Ebenen verständlich. Denn wenn Menschen über ihre Körperideale, ihre Wahrnehmung, ihren Umgang und ihr leibliches Spüren sprechen, geben sie nicht nur ihr individuelles Denken und Fühlen preis, sondern dieses Sprechen ist immer auch eingebunden in gesellschaftliche Wissensbestände zu Gesundheit und Selbstsorge sowie Vorstellungen von Geschlecht, zu denen sich positioniert wird. Hier fällt in bisherigen Studien auf, dass der Schwerpunkt der Analyse meist entweder auf die individuellen Biographien und Lebensumstände oder auf die gesellschaftlichen Wissensbestände gelegt und ein spezifischer Habitus in den Blick genommen wurde. Über das Zusammenspiel individueller Lebensgeschichten, kollektiver Faktoren und alltäglicher Körperpraktiken herrscht bislang noch Unklarheit.
„Was im Dunkeln bleibt ist das subtile Verhältnis, welches Menschen im Laufe ihres Lebens zu ihrem Körper aufbauen, das Identitäten generiert, soziales Handeln bedingt und beeinflusst und so auch ein wichtiger Baustein in der Herstellung und Verfestigung sozialer Lagen und Chancen ist.“ (Abraham 2002, 476)
Insbesondere der Einbezug der sozialen Herkunft5 sowie eine grundlegende qualitative Studie zu Körper und Männlichkeit steht bislang noch aus. Um eine Forschungslücke zu schließen, die das Verhältnis von makro- und mikrosoziologischer Ebene als Verhältnis von Alltagsdiskursen und (Sprech-) Praktiken über den Körper untersucht, setze ich mich in der vorliegenden Studie auf mehreren Ebenen mit dem Sprechen über den Körper vor dem Hintergrund der eigenen Lebensgeschichte auseinander. Dabei stellen sich mehrere Fragen: Welche Bedeutung wird dem Körper für die eigene Biographie zugesprochen? Welche Rolle spielt der Körper in und für Prozesse der Subjektivierung?6 Welche Alltagsdiskurse lassen sich entschlüsseln? Lassen sich Rückschlüsse vom Sprechen über den Körper auf den Umgang mit dem Körper treffen, und wie lassen sich die subtilen Körper-Selbst-Verhältnisse fassen? Mit der Kategorie des Körper-Selbst-Verhältnisses sollen die vielschichtigen Ebenen des Sprechens sichtbar gemacht werden, die das reflexive Verhältnis des Einzelnen zu seinem Körper darstellen, welches gleichzeitig auch ein Bezug zu sich selbst darstellt. Darunter fasse ich mehrere – miteinander verwobene – Ebenen: 1) Bedeutung, Ideale und Vorstellungen; 2) Wahrnehmung/Gefühlsebene; 3) Praktiken und Umgang mit dem Körper; 4) leibliches Spüren und Innenperspektive.7 Aus diesen Forschungsfragen ergeben sich sowohl theoretische Anknüpfungspunkte für Theoriedebatten in Anlehnung an Foucault über Regierungstechniken und Verlagerung von Zwängen in die Subjekte als auch praxisorientierte Perspektiven für die Analyse eines schädigenden Umgangs mit dem Körper. So stellt sich vor dem Hintergrund erziehungswissenschaftlicher Diskussionen über eine zunehmende Standardisierung und Qualitätskontrolle im Bildungssystem und eine ,Gouvernementalisierung‘ des Bildungssystems (Caruso 2003) auch die Frage, welche Umgangsformen mit dem Körper aus verinnerlichten Anforderungen von Wettbewerb und Leistung folgen. Meine Fragestellung nach Formen des Umgangs und die Eingebundenheit in eine kollektive Objektivierung ist somit relevant für pädagogische Debatten um eine „körperbewusste Schule“ und bietet Handlungs- und Präventionsmöglichkeiten im Hinblick auf Stress, Depressionen und Burn-out.
Auswahl der Methode und des Samples
Sich empirisch den individuellen Körper-Selbst-Verhältnissen zu nähern, ist eine Herausforderung. Denn der Körper ist „uns vertraut, selbstverständlich und allgegenwärtig, zugleich aber auch fremd, partiell nicht wahrnehmbar, bewusstlos und unbewusst, nicht expliziert und letztlich ,unerreichbar‘“ (Abraham 2002, 24). Gerade die Vertrautheit zum Körper macht es dabei so schwer, über ihn zu sprechen, denn das Alltägliche ist dem Bewusstsein nur schwer zugänglich. Darüber hinaus mangelt es – in westlichen Gesellschaften – grundsätzlich an „sprachlichen Mitteln [...], um in differenzierter Weise über körperliche Erlebnisse, körperlich spürbare Gefühle oder körperliche Bedürfnisse zu sprechen“ (Gugutzer 2004, 10). Dies ist dem „vorherrschenden rationalistischen Menschen- und Weltbild[.]“ (Gugutzer 2004, 11) geschuldet, nach dem die Vernunft einen höheren Stellenwert als Gefühle und die leibliche Wahrnehmung einnehmen und nicht nur körperliche Triebe und Bedürfnisse, sondern auch das Sprechen darüber tabuisiert wurde (Elias 1980). Diese Komplexität von Nähe und Unbewussten und Fremdheit führt laut Abraham zur „Sprachlosigkeit“ (Abraham 2002, 16). Die Vorbereitung und Durchführung der Interviews erforderte nicht zuletzt daher ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen, denn die Herausforderung bestand darin, eine Atmosphäre zu schaffen, in der sich Menschen öffnen und zu ihrem Körper erzählen. Um sowohl vielfältige und freie Assoziationen zum Körper zu ermöglichen, als auch – aufgrund möglicher Unsicherheiten und „Sprachlosigkeit“ (Abraham 2002, 16) – einen Rahmen für die Thematisierungen zu setzen, wurde ein halb-offenes Verfahren gewählt und eine narrativ-fokussierte Interviewstudie zum Thema Körpererinnerungen in der eigenen Lebensgeschichte durchgeführt. Es wurde auf Heterogenität des Samples im Hinblick auf Studienfächer, Beruf und Geschlecht8geachtet. Die Auswahl von Bildungsaufsteigern – Studierende aus nicht akademischen Elternhaus9 – erfolgte vor dem Hintergrund des Einbezugs sozialer Ungleichheiten. So können Körperthematisierungen und Argumentationen von Bildungsaufsteigern – die durch ihren Wechsel in ein akademisches Milieu, durch eine Ambivalenz zwischen „Anpassung und Abgrenzung“ (Schömer 2003, 43) an einen legitimen Habitus gekennzeichnet werden – in besonderem Maße Aufschluss über die gegenwärtige soziale Bedeutung des Körpers geben. Durch die Wahl der Altersgruppe (23-35 Jahre) sollte dieser Lebensabschnitt des Milieuwechsels besonders beleuchtet werden. Zum anderen werden Bildungsaufsteiger durch einen besonders rationalen und entfremdeten Körperzugang gekennzeichnet.
„Körperkultur, generell alle strikt gesundheitsdienlichen Aktivitäten und Praktiken wie Wandern oder ‚jogging‘ […] setzen den rationalen Glauben in die von ihnen für die Zukunft verheißenden und häufig kaum merklichen Gewinne voraus […] Verständlich wird darüber hinaus, daß die Verfolgung solcher Aktivitäten die Dispositionen derer voraussetzt, die als soziale Aufsteiger gleichsam dazu präpariert sind, bereits im Akt der Anstrengung ihre Erfüllung zu finden […] – eine solche Haltung ist gleichsam der Inbegriff ihrer gesamten Existenz.“ (Bourdieu 1982, 341)
Ob Bildungsaufsteiger tatsächlich einen Umgang aufweisen, bei dem sie „im Akt der Anstrengung ihre Erfüllung“ finden, ihren Körper zum Zweck des sozialen Erfolgs disziplinieren und damit eine Risikogruppe für Depressionen oder Burn-out darstellen, lässt sich im Anschluss an meine Forschungsthesen untersuchen und diskutieren.
Um das Sprechen nicht als ,Abbild‘ eines individuellen Körperverhältnisses oder eines nahegelegten Habitus zu verstehen, sondern als performative und diskursive Praxis zu untersuchen, in der sich die Interviewpartner durch ihren reflexiven Bezug auf ihren Körper in ihrem ,biographischen Selbst‘ und ihrem Körperverhältnis hervorbringen, knüpfe ich an Rehs (2003) Überlegungen zur Biographieforschung an. In diesem Sinne verstehe ich das biographische Sprechen über den Körper im Interview in doppelten Sinne als „Technologie des Selbst“ (Foucault 1986, 18), denn hier zeigt sich das Phänomen, dass einerseits Diskurse zu Lebensführung, Gesundheit und Geschlechterdichotomien reproduziert werden, sich jedoch gleichzeitig ein hohes Maß an Reflexion über gesellschaftliche Anforderungen zeigt und sich strikt von der Annahme abgegrenzt wird, selbst diesen Normen zu unterliegen, womit der eigene Anspruch an Selbstbestimmung und körperliche Selbstsorge als implizites Thema immer mitschwingt (Villa 2008). Auch die spezifische Interview-Interaktion und wer sich hier gegenüber sitzt, spielen eine zentrale Rolle für die Selbstpräsentation im Interview und damit die Erzählung über den eigenen Körper sowie die Reproduktion und Verhandlung von Vorstellung von ,Männlichkeit‘, ,Weiblichkeit‘ sowie der sozialen Positionierung (Reh 2003; Butler 2001, 2003a). Um sich dem Umgang zum Körper zu nähern, soll im Folgenden eine Perspektive auf das Sprechen im Interview eingenommen werden, bei der es nicht nur wichtig ist, was gesagt wird, sondern vor allem, wie die Befragten im Rahmen ihrer biographischen Erzählung über den Körper und über sich selbst sprechen.
Aufbau der Arbeit und Relevanz
Um mich dem Zusammenspiel von individuellen Körper-Selbst-Verhältnissen und kollektiven Wissen zum Körper zu nähern, gehe ich in mehreren Schritten vor. Anhand einer Diskussion vorliegender Studien zu Körperthematisierungen, Deutungen und Praktiken wird im Theorieteil (Kapitel 2) das dieser Arbeit zugrunde liegende Verständnis von Sprechen über den Körper dargelegt und Anknüpfungspunkte für meine Studie geschaffen. Die Auseinandersetzung mit Bourdieus Habituskonzept sowie seiner Klassenstudie der 1970er Jahre (Bourdieu 1979, 1982) stellt dabei den Ausgangspunkt dar, an der die zentralen Erkenntnisse klassen- und auch geschlechtsspezifischer Deutungen des Körpers festgehalten und danach auf ihre Anschlussfähigkeit diskutiert werden. Anhand von Foucaults spätem Subjektbegriff (Foucault 1986) und Butlers Begriff der Performativität (Butler 2001, 2003a) wird im Anschluss eine Perspektive auf Subjekte entworfen, bei der sich diese durch performative Sprechakte in ihrer Identität hervorbringen, sozial positionieren und sich als selbstführende autonome Subjekte konstituieren (Reh 2010). Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen werden gegenwärtige Studienergebnisse zu Körperverhältnissen diskutiert, zentrale Diskurse und Argumentationsmuster im Hinblick auf die Herstellung von Geschlecht und sozialer Position erörtert und offene Fragen und Widersprüche aufgezeigt.
Im Anschluss (Kapitel 3) wird diskutiert, wie sich Ansätze der Biographieforschung (Schütze 1983, 1984) mit dem Verständnis einer biographischen Selbst-Konstruktion vereinen lassen. In Anlehnung an Koller (1999) und Reh (2003) steht die formale Analyse von Erzählstruktur und sprachlicher Mittel im Fokus, nach der am Einzelfall und fallübergreifend Schemata im Alltagswissen rekonstruiert werden, die Rückschlüsse auf die soziale Bedeutung des Körpers und Subjektivierungsprozesse im Interview ermöglichen. Erst im zweiten Schritt wird – über die gemeinsame Betrachtung von Sprechpraxis, der Darstellung der Lebensgeschichte und Körperdeutungen – gefragt, ob und inwieweit sich kollektive Ursachen und Risiken für den Umgang aus den biographischen Erzählungen ableiten lassen.
Anhand der Darstellung von sechs Fallbeschreibungen (Kapitel 4) werden zunächst die individuellen Zugänge zum Körper sequenzanalytisch ausgewertet. In einer fallübergreifenden Kontrastierung (Kapitel 5) werden anschließend die biographischen Schwerpunktthemen des Samples herausgearbeitet und dargestellt, welche Bedeutung dem Körper in welchen Lebensabschnitten zugesprochen wird. Anhand der Darstellung von drei zentralen Schwerpunktdeutungen werden Erzähllogiken und Diskurse zu ,Männlichkeit‘, und ,Weiblichkeit‘ dargestellt und die Herstellung einer spezifischen ,Bildungsaufsteigerbiographie‘ nachvollzogen. Um die Körper-Selbst-Verhältnisse im Kontext des Bildungsaufstiegs deuten zu können, wird das Verhältnis von Deutungen, Diskursen und sprachlichen Umgang mit dem Körper herausgearbeitet sowie biographische Konflikte einbezogen werden. Die Ergebnisse (Kapitel 6) werden schließlich vor dem Hintergrund der theoretischen Fragestellung diskutiert. Mein Ziel ist es, einen Beitrag zur methodischen Herangehensweise an Körper-Selbst-Verhältnisse durch qualitative Interviews zu leisten, die das Sprechen als Praxis in den Blick nimmt und zudem geschlechtsspezifische und kollektive Muster herausarbeitet. Insgesamt wird ein erweiterter Blick auf die Folgen einer kollektiven Objektivierung des Körpers geworfen, der einen Befund zu Risiken und Chancen gegenwärtiger Körperverhältnisse und sozialer Ungleichheiten ermöglicht.
1Anthropologisch-phänomenologisch wird dabei zwischen Körper – als Materie und Gegenstand – und Leib als Innenwelt des Menschen (Sein-im-Körper) unterschieden. Da ,der Leib‘ jedoch nur im Sinne subjektiver Erfahrung spürbar ist (Gugutzer 2002, 53), wird in der vorliegenden Arbeit das Substantiv ,Leib‘ vermieden und stattdessen vom ,leiblichen‘ Empfinden oder Spüren gesprochen.
2Auch wenn in den letzten Jahren ein Rückgang von Burn-out propagiert wurde, belegen Krankenkassenberichte 2011, dass jeder zehnte Berufsanfänger an körperlichen Problemen, Schmerzen und Depressionen leidet (DAK 2011). Da die Diagnose Burn-out medizinisch nicht anerkannt ist, werden den Arbeitnehmern stattdessen Depressionen attestiert (DAK 2016).
3Zur Logik dieser ,unternehmerischen Körperverhältnisse‘ siehe u.a. Lemke 2000, Schmidt-Semisch 2000, Alkemeyer 2003, Villa 2008, Degele 2008, Maasen 2008.
4Der Körper als Gegenstand gesellschaftlicher Konditionierung wird beispielsweise von Elias (1980) beschrieben, der vor dem Hintergrund eines Prozesses der Zivilisation die zunehmende Kontrolle und Selbstbeherrschung des Körpers analysiert. Foucault (1976) untersucht, wie sich die Disziplinarmacht durch verschiedene Techniken in Schule, Militär und Gefängnis in die Körper einschreibt, und Bourdieu (1982) entwirft mit seinem Habitusbegriff eine Perspektive auf den Körper als Objekt der Einschreibung sozialer Strukturen.
5Soziale Ungleichheiten sind lediglich im Zusammenhang mit Gesundheitsverhalten oder Krankheitsrisiken quantitativ erforscht (Bittlingmayer 2008, Richter/Hurrelmann 2007, Barlösius/Feichtinger/Köhler 1995).
6Unter Subjektivierung wird in diesem Arbeits- und Forschungskontext eine gegenüber gängigen Vorstellungen veränderte Perspektive auf Sozialisationsprozesse verstanden, in der das Subjekt nicht als Vorgängiges vorausgesetzt, sondern als in diesem Prozess selbst unter immer spezifischen historisch-sozialen Bedingungen – z. B. eines diesem nahegelegten Körper-Verhältnisses – produziert gesehen wird.
7Der Begriff der Körper-Selbst-Verhältnisse wird in Kapitel 3. Methodische Überlegungen näher ausgeführt.
8Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser Studie auf die Verwendung gegenderter Formen verzichtet und bei Gruppen durchgehend die männliche Form verwendet.
9Unter Bildungsaufsteiger wurden hier Personen gefasst, deren Eltern nicht studiert haben und die in klassischen Ausbildungsberufen arbeiten.
2. Sprechen über den Körper: Theoretischer Rahmen und Diskussion
Es soll nun dargelegt werden, auf welcher theoretischen Grundlage meine empirische Studie basiert. Hier werden zwei Themenstränge parallel verfolgt: Da in meiner empirischen Studie Bildungsaufsteiger untersucht werden, soll zum einen an vorhandene Erkenntnisse gegenwärtiger Studien zu klassen- und geschlechtsspezifischen Körperverhältnissen angeknüpft werden. Zum anderen soll eine kritische Perspektive auf diese Ergebnisse geworfen werden und die Frage beantwortet werden, auf welche Weise das Sprechen über den Körper Aufschluss über diese individuellen und kollektiven Haltungen zum Körper sowie körperbezogene Umgangsweisen geben kann.
(2.1.) Den Ausgangspunkt meiner Diskussion bildet Bourdieus Habituskonzept sowie seine Klassenstudie „Die feinen Unterschiede“, in der er beschreibt, wie sich soziale Klassen in die Körperpraktiken und Lebensstile und eine geschlechtsspezifische Arbeitsteilung in die Körperhaltungen einschreibt. Die zentralen Erkenntnisse dieser Studien sollen danach reflektiert und vor dem Hintergrund gesellschaftlichen Wandels auf ihre Anschlussfähigkeit überprüft werden. Im Hinblick auf mein Sample der Bildungsaufsteiger soll dargestellt werden, ob und an welche Lebensstile und Körperverhältnisse hier angeknüpft werden kann.
(2.2.) Bourdieus Konzept soll im Anschluss um den Gedanken erweitert werden, dass sich die Akteure bereits im Sprechen in ihrem Habitus formieren. Diese Überlegung ist für das weitere Verständnis von Interviews relevant und soll mit Foucaults spätem Subjekt- und Diskursbegriff und Butlers Theorie der Performativität theoretisch gerahmt werden. Mit Foucaults Konzept der Technologien des Selbst wird schließlich ein spezifischer Selbstsorgediskurs als Logik gegenwärtigen Sprechens über den Körper herausgearbeitet.
(2.3.) Die Konsequenzen, die sich aus dieser Perspektive für die anschließende biographische Interview-Studie ergeben, sollen danach erarbeitet werden. Am Beispiel gegenwärtiger Studien zu Gesundheitsverhalten und Schönheitspraxis soll dargestellt werden, wie Weise die Vorgehensweise, bei der vom Sprechen auf die Praxis geschlossen wird, sowohl zur Reproduktion von Geschlechterdichotomien als auch stereotyper Vorstellungen von milieuspezifischen Körperverhältnissen führen kann. Demgegenüber sollen zentrale Muster im Sprechen über den Körper dargestellt werden, durch die sich auf legitime Körperideale bezogen, sich sozial positioniert und das eigene Körperverhältnis als ,männlich‘ und als ,weiblich‘ hergestellt wird. Aus dieser Diskussion werden schließlich Anknüpfungspunkte für offene Fragen, Widersprüche sowie methodische Vorgehensweisen für meine biographische Studie von Bildungsaufsteigern dargelegt.
2.1. Körperdeutungen und Lebensstile im Anschluss an Bourdieu
2.1.1. Habitus: Das Körper gewordene Soziale
„Bis in die kleinsten Gesten verrät der Körper die Herkunft seines Trägers“
(Schroer 2005, 37)
Wie wir unseren Körper wahrnehmen, wie wir über ihn sprechen, was wir über ihn denken und wie wir mit ihm umgehen, ist laut Bourdieu Teil unseres klassen- oder auch geschlechtsspezifischen Habitus. Bourdieu beschreibt mit dem Begriff des Habitus, wie sich die Lebensbedingungen auf die Haltung eines Individuums zu seiner Welt auswirken und in der Gesamtheit der individuellen Praktiken wie Lebensstil, Vorlieben, Gewohnheiten, Gestik, Mimik, Sprache, Kleidung widerspiegeln. Mithilfe der Unterteilung in Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsschemata macht er auf die verschiedenen Ebenen aufmerksam, auf denen der Habitus wirkt und die darüber hinaus miteinander verknüpft sind. Bourdieu zufolge wird der Habitus erlernt, wobei dieser jedoch nicht explizit als theoretisches Wissen vermittelt, sondern vielmehr unbewusst durch die Praxis angeeignet und weitergegeben werde. Durch dieses implizite Lernen, indem zum Beispiel Spiele, Regeln oder Rituale beobachtet, nachgeahmt und eingeübt werden (Bourdieu 1979, 190), schreibe sich der Habitus in körperliche Gewohnheiten als auch in das Denken und die Art und Weise, wie die Welt wahrgenommen wird, ein. Der Habitus ist demnach „der wirklich gewordene, zur permanenten Disposition gewordene einverleibte Mythos, die dauerhafte Art sich zu geben, zu sprechen, zu gehen, und darin auch: zu fühlen und zu denken“ (Bourdieu 1979, 195).
„Er [der Habitus, Anm. M.O.] produziert „individuelle und kollektive Praktiken, […] er gewährleistet die aktive Präsenz früherer Erfahrungen, die sich in jedem Organismus in Gestalt von Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsschemata niederschlagen und die Übereinstimmung und Konstantheit der Praktiken im Zeitverlauf viel sicherer als alle formalen Regeln und expliziten Normen zu gewährleisten suchen“ (Bourdieu 1987, 101).
Durch die implizite Einschreibung, nach der die Akteure unbewusst wissen, wahrnehmen und spüren, wie sie sich in bestimmten Situationen zu verhalten haben, wird der Habitus auch als das „Körper gewordene Soziale [verstanden]“ (Bourdieu/Wacquant 1996, 161, zitiert nach Alkemeyer/Schmidt 2003, 77). Bourdieu hebt die Doppelfunktion des Habitus hervor, der sowohl als Produzent als auch Produkt der sozialen Struktur wirkt. Als „strukturierende, die Praxis wie deren Wahrnehmung organisierende Struktur“ (Bourdieu 1982, 279) oder auch „modus operandi“ (Bourdieu 1982, 281) ist er das „Erzeugungsprinzip objektiv klassifizierbarer Formen von Praxis“. Als modus operandi weist der Habitus Bourdieu zufolge auf die verinnerlichten Urteile und Bewertungsmuster hin, nach denen die Akteure ihre Praktiken, beispielsweise eine Sportart, auswählen. Dabei bewirke der Habitus, „daß die Gesamtheit der Praxisformen eines Akteurs (oder einer Gruppe von aus ähnlichen Soziallagen hervorgegangenen Akteuren) als Produkt der Anwendung identischer (…) Schemata zugleich systematischen Charakter tragen und systematisch unterschieden sind von den konstitutiven Praxisformen eines anderen Lebensstils“ (Bourdieu 1982, 278). Indem der Habitus auf diese Weise Lebensstile und Geschmäcker hervorbringe, sei er nicht nur Erzeugungsprinzip, sondern biete darüber hinaus auch das „Klassifikationssystem“ (Bourdieu 1982, 277) an, nach dem diese Praxisformen einer sozialen Klasse oder einem Geschlecht zugeordnet werden. Wenn also beispielsweise nur männliche Arbeiter Sportarten wie Boxen oder Fitness betreiben, werden diese Sportarten als ,Arbeitersport‘ wahrgenommen.
Neben dem Bezug auf die Art und Weise, wie gehandelt wird, verweist der Habitus auch auf das Vergangene. Als „strukturierte Struktur“ (Bourdieu 1982) oder „opus operatum“ (Bourdieu 1982, 281) ist er das Produkt der sozialen Lage. Damit bezieht sich Bourdieu neben den unterschiedlichen ökonomischen Ressourcen als Bedingungen für die Herausbildung der Vorlieben auch grundsätzlich auf „das Prinzip der Teilung in logische Klassen, das der Wahrnehmung der sozialen Welt zugrundeliegt, [das] seinerseits Produkt der Teilung in soziale Klassen [ist]“ (Bourdieu 1982, 279). Beide Wirkweisen des Habitus – als Produkt und Produzent – sieht Bourdieu dialektisch durch die Praxis verknüpft. Aufgrund des inkorporierten Bewertungssystems, welches Folge der Einteilung von Geschmäckern und Gewohnheiten in soziale Klassen sei, wählen laut Bourdieu Menschen eine Sportart, die ihnen als passend oder stimmig erscheint, weil sie dem entspricht, was bereits in der frühen Kindheit gelernt wurde und seitdem bekannt ist. Wenn beispielsweise Fußball als stimmig wahrgenommen wird, werden demgegenüber unbewusst Praktiken vermieden, die diesen frühkindlichen Erfahrungen und Mustern entgegengesetzt sind:
„Als generelle Regel kann formuliert werden, daß ein Sport mit umso größerer Wahrscheinlichkeit von Angehörigen einer bestimmten Gesellschaftsklasse übernommen wird, je weniger er deren Verhältnis zum eigenen Körper in dessen tiefsten Regionen des Unterbewußten widerspricht“ (Bourdieu 1982, 347).
Indem die Angehörigen einer sozialen Klasse oder Herkunft kollektiv eine spezifische Sportart ausüben, schreibt sich diese wiederum in die Körperhaltung, den Habitus und die äußere Erscheinung dieser Personen ein. Damit manifestieren sich wiederum bestimmte Vorstellungen darüber, was für eine bestimmte soziale Klasse oder das Geschlecht als typisch erscheint, beispielsweise die Vorstellung über einen ,männlichen Arbeiterkörper’. Durch diese Doppelfunktion des Habitus konstituiert sich die „repräsentierte soziale Welt, mit anderen Worten der Raum der Lebensstile“ (Bourdieu 1982, 278).
„Der Habitus bewirkt, daß die Gesamtheit der Praxisformen eines Akteurs (oder einer Gruppe von aus ähnlichen Soziallagen hervorgegangenen Akteuren) als Produkt der Anwendung identischer (oder wechselseitig austauschbarer) Schemata zugleich systematischen Charakter tragen und systematisch unterschieden sind von den konstitutiven Praxisformen eines anderen Lebensstils“ (Bourdieu 1982, 278).
Da das „Prinzip der Teilung in logische Klassen, das der Wahrnehmung der sozialen Welt zugrundeliegt […] seinerseits Produkt der Verinnerlichung der Teilung in soziale Klassen [ist]“ (Bourdieu 1982, 279), erscheinen diese als naturgegeben. Sowohl der kollektive Lebensstil als auch die eigene Vorliebe für eine bestimmte Sportart wird von den Angehörigen einer bestimmten Klasse als individueller Geschmack erlebt und wahrgenommen.
2.1.2. Der Körper als unwiderlegbarste Objektivierung des Klassengeschmacks
„Der Geschmack: als Natur gewordene, d. h. inkorporierte Kultur, Körper gewordene Klasse, trägt er bei zur Erstellung des ,Klassenkörpers‘ […], woraus folgt, daß der Körper die unwiderlegbarste Objektivierung des Klassengeschmacks darstellt, diesen vielfältig zum Ausdruck bringt, in seinen scheinbar natürlichsten Momenten – seinen Dimensionen (Umfang, Größe, Gewicht, etc.) und Formen (rundlich, vierschrötig, steif oder geschmeidig, aufrecht oder gebeugt, etc.) seinem sichtbaren Muskelbau […] mit anderen Worten, eine ganz bestimmte, die tiefsitzenden Dispositionen und Einstellungen des Habitus offenbarende Weise, mit dem Körper umzugehen, ihn zu pflegen und zu ernähren“ (Bourdieu 1982, 307)
Auf welche Weise sich diese Vorlieben in Geschmäckern, Gewohnheiten und Lebensstilen manifestieren, untersucht Bourdieu in seiner Klassenstudie der siebziger Jahre „Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft“ (Bourdieu 1982) und analysiert dabei den Körper als die „unwiderlegbarste Objektivierung des Klassengeschmacks“ (Bourdieu 1982, 307). Für die Einteilung der drei Klassen geht er von einem konstruierten dreidimensionalen Raum aus, den er durch drei Achsen kennzeichnet: Kapitalvolumen, Kapitalstruktur und soziale Laufbahn.
„Das Prinzip der primären, die Hauptklassen der Lebensbedingungen konstituierenden Unterschiede liegt im Gesamtvolumen des Kapitals als Summe aller effektiv aufwendbaren Ressourcen und Machtpotential, also ökonomisches, kulturelles und soziales Kapital“ (Bourdieu 1982, 196).
Nach dieser Unterscheidung der Kapitalsorten stellen Geld und materielle Ressourcen wie Grundstücke, Unternehmen und Bankguthaben das ökonomische Kapital dar. Unter kulturellem Kapital versteht Bourdieu sowohl Bildungsgüter und Kulturgegenstände wie Bücher und Gemälde als auch inkorporierte und institutionalisierte Wissensformen wie den Zugang zu Kunst und Kultur, beispielsweise das Interesse für Museums- und Opernbesuche. Darüber hinaus gelten erworbene Bildungstitel als kulturelles Kapital.
Als soziales Kapital werden sowohl soziale Beziehungen und Netzwerke als auch soziale Fähigkeiten und Kompetenzen bezeichnet, diese Netzwerke zu bilden. Weiterhin definiert Bourdieu an anderer Stelle das symbolische Kapital als übergeordnete Ressource, welches durch Anerkennungsakte erworben wird und als Machtmittel, zur Prestigeerweiterung, einsetzbar ist. Zentral bei diesem Kapitalbegriff ist die Möglichkeit der Transformation einer Kapitalart in eine andere, beispielsweise könne ökonomisches Kapital durch den Erwerb von Kulturgütern oder eines Doktortitels in kulturelles Kapital umgesetzt werden oder umgekehrt (Bourdieu 1983, 183-198 und Bourdieu 1982, 196f). Ausgehend von Kapitalvolumen und Struktur teilt Bourdieu drei Klassen ein: Demnach verfüge die herrschende Oberklasse oder das Großbürgertum, in das er freie Berufe, leitende Angestellte und Beamte einschließt, über das meiste Kapital. Als Mittelklasse oder Kleinbürgertum kennzeichnet er Büroangestellte oder Handwerker, während die untere Klasse/Arbeiterklasse Arbeiter, Hilfsarbeiter, Landarbeiter darstellen und über den geringsten Umfang an Kapital (aller drei Formen) verfügen (Bourdieu 1982, 196). Innerhalb einer Klasse unterscheidet er teilweise zwischen verschiedenen Fraktionen, abhängig von der Verteilung von ökonomischem und kulturellen Kapital.
Herrschende Oberklasse: Sinn für Distinktion
Bourdieu kennzeichnet den Lebensstil der herrschenden Oberklasse durch hohe Kompetenzen, Kenntnisse und Wissen und Selbstsicherheit; ihren „Sinn für Distinktion“ (Bourdieu 1982, 405). Aufgrund des hohen kulturellen Kapitals „besitzt [man] die entsprechenden distinktiven Merkmale; Statur, Haltung, angenehmes Äußeres, Auftreten, Diktion und Aussprache, Umgangsform und Lebensart, ohne die alles Schulwissen zumindest auf diesen Märkten wenig oder gar nichts gilt“ (Bourdieu 1982, 159). Durch die Vorliebe für das Kostspielige und Seltene grenzt sich Bourdieu zufolge die obere Klasse vom Geschmack der niedrigeren Bildungs- und Einkommensschichten ab. Es würden seltene, vornehme und teure Speisen, qualitativ hochwertige und extravagante Kleidung sowie Kleidungsstücke, die den anderen Klassen fremd sind, wie der Morgenrock, ausgewählt (Bourdieu 1982, 301, 324). Bourdieu unterscheidet innerhalb der oberen Klasse in zwei Fraktionen. Er charakterisiert die Lehrer und Hochschullehrer, die über weniger ökonomisches und mehr kulturelles Kapital verfügen, durch ihren „asketischen Aristokratismus“ (Bourdieu 1982, 447). Demgegenüber kennzeichnet er die freiberuflichen Manager, die über mehr ökonomisches und weniger kulturelles Kapital verfügen, durch ihren „Sinn für Luxus“ (Bourdieu 1982, 447). Insgesamt hebt er das hohe Maß an Selbstbeherrschung im Umgang mit dem Körper der oberen Klassen hervor. Da die ,Form‘ im Zentrum der Praxis stehe, werde das Essen zur „gesellschaftlichen Zeremonie“ (Bourdieu 1982, 316) stilisiert, und bei den Tischsitten wird auf Zurückhaltung und Diskretion geachtet. Die bevorzugten Prestigesportarten wie Tennis, Golf, Reiten, Segeln oder Fechten seien nicht nur exklusiv, sie erforderten neben der teuren Ausrüstung auch ein hohes Maß an Geschicklichkeit und Körperbeherrschung. Bourdieu zufolge hat der Körper für die oberen Klassen darüber hinaus einen sehr hohen symbolischen Stellenwert. Als „Körper-Kapital“ (Bourdieu 1982, 345) sei er Status- oder Prestigeobjekt, Schönheit werde als „Naturgabe und Verdienst“ (Bourdieu 1982, 329) gesehen, und auch Übergewicht trete seltener auf (Bourdieu 1982, 326f). Bourdieu kommt zu dem Ergebnis, dass bei den oberen Klassen der Glaube an Machbarkeit und Selbstverantwortung mit dem erreichten Schlankheitsideal korreliert.
Mittelklasse und Bildungsaufsteiger: Sein-für-den-Anderen
Der Lebensstil und Geschmack der Angehörigen der Mittelklasse, die über ein geringeres ökonomisches und kulturelles Kapital verfügen, ist laut Bourdieu durch Orientierung am sozialen Aufstieg geprägt und äußert sich in einer Wertschätzung für Bildung, Bildungstitel und einem anerzogenen Leistungsbewusstsein. Im Gegensatz zu den Angehörigen der Oberschicht, die ihren legitimen Lebensstil von Geburt an automatisch angeeignet haben und diesen häufig mit einer Lässigkeit und dem Privileg der Gleichgültigkeit begleiten, verfügten die Angehörigen der Mittelklasse über weniger Selbstsicherheit:
„[So] erweist sich die typisch kleinbürgerliche Erfahrung der Sozialwelt zunächst als Schüchternheit, als Gehemmtheit dessen, dem in seinem Leib und seiner Sprache nicht wohl ist, […] der sich fortwährend überwacht, sich kontrolliert und korrigiert, der sich tadelt und züchtigt und gerade durch seine verzweifelten Versuche zur Wiederaneignung eines entfremdeten ,Seins-für-den-Anderen‘ sich dem Zugriff der anderen preisgibt, der in seiner Überkorrektheit so gut sich verrät wie in seiner Ungeschicklichkeit […]“ (Bourdieu 1982, 331).
Aufgrund ihres niedrigen Selbstbewusstseins kennzeichnet Bourdieu ihren Lebensstil durch den Versuch der Anpassung an den Lebensstil der oberen Klassen und das „Sein-für-den-Anderen“ (Bourdieu 1982, 331). Eine Alternative zu dieser Art der Anpassung sieht Bourdieu lediglich durch „eine Protesthaltung, die schon im Aufbegehren ihr Scheitern anerkennt“ (Bourdieu 1982, 166).
In den körperbezogenen Haltungen äußerten sich dementsprechend Perfektionsansprüche sowie ein hohes Maß an Selbstkontrolle. Der schlanke Körper werde als Kapital betrachtet, insbesondere bei den Frauen, die in Präsentations- und Repräsentationsberufen wie im Verkauf, im Büro oder am Empfang arbeiten, „wo Schönheit und Benehmen am nachdrücklichsten zum beruflichen Wert beitragen“ (Bourdieu 1982, 328). Bourdieu analysiert, dass die Angehörigen der Mittelklasse die geringeren finanziellen Mittel mit einem höheren Aufwand an Zeit, Mühen, Entbehrungen ausgleichen (Bourdieu 1982, 330). Die Angehörigen der Mittelschicht bevorzugten infolgedessen Sportarten wie Jogging, Walking, Gymnastik sowie Sportarten mit ganzheitlichen Aspekt wie Yoga oder asiatische Körper- und Bewegungsformen (Bourdieu 1982, 341). Bourdieu sieht den „Gesundheitskult in Verbindung nicht selten mit einem übersteigerten Asketismus der Nüchternheit und der Diätstrenge“ (Bourdieu 1982, 340) als typisch für die Mittelklasse. Besonders in der Gymnastik als der „Übung um der Übung willen“ (Bourdieu 1982, 340) sieht er das Nach-oben-Streben und die permanente Selbstdisziplinierung verkörpert. Diese Eigenschaften und das Sein-für-Andere sieht Bourdieu bei sozialen Aufsteigern besonders ausgeprägt.
„Körperkultur, generell alle strikt gesundheitsdienlichen Aktivitäten und Praktiken wie Wandern oder ,jogging‘ […] setzen den rationalen Glauben in die von ihnen für die Zukunft verheißenden und häufig kaum merklichen Gewinne voraus […] Verständlich wird darüber hinaus, daß die Verfolgung solcher Aktivitäten die Dispositionen derer voraussetzt, die als soziale Aufsteiger gleichsam dazu präpariert sind, bereits im Akt der Anstrengung ihre Erfüllung zu finden […] – eine solche Haltung ist gleichsam der Inbegriff ihrer gesamten Existenz.“ (Bourdieu 1982, 341)
Das Körperverhältnis von sozialen Aufsteigern beschreibt Bourdieu im Sinne einer Objektivierung, bei dem der „Akt der Anstrengung“ der wesentliche Aspekt des Habitus ist. Dies erklärt er durch ihre Biographie. Da sich soziale Aufsteiger durch die Haltung, permanent Anstrengungen in Kauf zu nehmen, auch den Aufstieg in eine höhere Klasse erfolgreich erarbeitet haben, sei dies zu einer permanenten Disposition, zum „Inbegriff der gesamten Existenz“ geworden.
Arbeiterklasse: Geschmack der Notwendigkeit
Die Angehörigenderunteren Klasse/Arbeiterklasse,die über geringes ökonomisches und kulturelles Kapital verfügen, kennzeichnet Bourdieu durch ihre Abgrenzung vom legitimen Geschmack der oberen Klasse. Ihr sogenannter „Geschmack der Notwendigkeit“ (Bourdieu 1982, 585f) ist laut Bourdieu zwar einerseits den geringeren finanziellen Mitteln geschuldet, andererseits wird sich mit der Bevorzugung des Praktischen, Vernünftigen und Einfachen auch vom Luxus und dem gesellschaftlichen Schein der oberen Klasse abgegrenzt (Bourdieu 1982, 313). Hier gilt „Sein gegen Schein, die Natur […] und das Natürliche, Einfache und Schlichte gegen das Gedruckse und Geziere, gegen das Förmliche und Manierte“ (Bourdieu 1982, 321). Das Körperideal der Arbeiterklasse kennzeichnet Bourdieu durch „die hohe Bewertung physischer Kraft als Grundlage der Männlichkeit“ (Bourdieu 1982, 600). Der Körperbau solle in erster Linie an die belastenden Arbeitsbedingungen angepasst sein. Nach diesem Körperschema werden Bourdieu zufolge Sportarten bevorzugt, in denen hoher Einsatz und Körperkontakt gefordert ist, es um eine geringe Schmerzempfindlichkeit sowie um eine Kräftigung des Körpers geht (beispielsweise Fußball, Rugby, Boxen, Bodybuilding) (Bourdieu 1982, 339; 600). Des Weiteren stellt er fest, dass die oberen und mittleren Klassen den Sport – aufgrund seiner gesundheitsfördernden Funktion – oft lebenslang betreiben, die Angehörigen der Arbeiterklasse jedoch die sportliche Betätigung bereits sehr früh, mit dem Eintritt ins Berufsleben oder der Heirat, aufgeben (Bourdieu 1982, 342). Für die Frauen der Arbeiterklasse kommt er zu dem Ergebnis, dass diese an die naturgegebene – und nicht die machbare – Schönheit glauben, am wenigsten Schönheitspraktiken ausüben und am unzufriedensten von allen Klassen sind (Bourdieu 1982, 596). Auch Übergewicht komme unter ihnen dreimal häufiger vor (Bourdieu 1982, 326). Dies erklärt Bourdieu damit, dass sie sich des Marktwertes der Schönheit weniger bewusst sind, da sie seltener in Repräsentationsberufen arbeiten oder nicht berufstätig sind.1 Als weitere Erklärungsmöglichkeit in diesem Zusammenhang, die von Bourdieu nicht angeführt wird, ließe sich auch die Auswahl reichhaltiger und kräftiger Speisen heranziehen, die vor allem auf die Kräftigung des männlichen Körpers ausgerichtet ist (Bourdieu 1982, 307ff; 600). Insgesamt wird nicht klar, inwieweit das dargestellte Kraft- und Stärkeideal auch von den Frauen vertreten wird. Gerade die angeführten Sportarten (Kampf- und Kraftsportarten) werfen die Frage auf, ob sich diese nur auf die Männer der Arbeiterklasse beziehen, oder ob auch die Frauen der Arbeiterklasse Sportarten ausüben, bei denen die Kräftigung des Körpers im Fokus steht. Ähnlich verhält es sich mit der Frage der Körperzufriedenheit, dem Verhältnis zum Aussehen und der Körperpflege, denn dazu wurden von Bourdieu klassenübergreifend die Frauen untersucht (Bourdieu 1982, 326).
2.1.3. Der Körper als Symbol der ,männlichen Herrschaft‘
In „Die männliche Herrschaft“ (1997b) definiert Bourdieu auch das Geschlecht als „eine fundamentale Dimension des Habitus“ (Bourdieu 1997a, 222) und geht näher darauf ein, wie der Habitus als Erzeugungsprinzip und Klassifikationssystem der vergeschlechtlichen Ordnung wirkt. Dabei bezieht er sich jedoch weniger auf Körperideale und Praktiken, sondern analysiert eine „Somatisierung der Herrschaftsverhältnisse“ (1997b, 166), die „in Form von zwei entgegengesetzten und komplementären Klassen von Körperhaltungen, Gangarten, Weisen des Auftretens, Gesten usf. und in die Köpfe eingelassen [ist]“ (Bourdieu 1997b, 162). Diese Einteilung und Aufteilung in zwei entgegengesetzte Systeme von ,männlich‘ und ,weiblich‘ sieht er als Ursache für eine geschlechtsspezifische Arbeitsteilung. Nach dieser Einteilung gilt der Mann als „allgemeines Wesen (homo) […], das faktisch und rechtlich das Monopol auf das Menschliche, d. h. das Allgemeine hat“ (Bourdieu 1997b, 160). Die Männer stehen demzufolge auf der Seite „des Draußen, des Offiziellen, des Öffentlichen, des Aufrechten, […] des Diskontinuierlichen“ und beanspruchen die „kurz dauernden, gefährlichen und spektakulären Tätigkeiten für sich“ (Bourdieu 1997b, 161). Demgegenüber wird die Frau durch ihr Sein für andere definiert und ihr werden die privaten, häuslichen und kontinuierlichen Arbeiten zugeteilt. Durch die Inkorporierung der Vorstellung von ,weiblich‘ und ,männlich‘ in den Habitus „als ein universelles Prinzip des Sehens und Einteilens als ein System von Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungskategorien“ (Bourdieu 1997b, 159) wird die Einteilung von dem, was als männlich und als weiblich gilt, zum Klassifikationssystem, gleichzeitig bringt auch die Ausübung der unterschiedlichen Tätigkeiten den Habitus hervor.
Der weibliche Habitus wird von Bourdieu durch sein Sein als Erscheinen gekennzeichnet: „Die männliche Herrschaft, die die Frau als symbolisches Objekt konstituiert, dessen Sein (esse) ein Wahrgenommen-Sein (percipi) ist, hat den Effekt, dass Frauen in einen Zustand ständiger körperlicher Unsicherheit oder besser symbolischer Entfremdung versetzt sind“ (Bourdieu 1997a, 229). Diese Wahrnehmung des Körpers-für-Andere sei dabei so ins Bewusstsein und die körperliche Haltung übergegangen, dass sie nicht mehr wahrgenommen werde. Besonders die Möglichkeit zur Teilhabe am öffentlichen Raum repräsentiert Bourdieu zufolge die hierarchische Ordnung, nach der Frauen – unabhängig von der Klassenzugehörigkeit – jeweils weiter unten in der Hierarchie stehen und dies sich in die Körper einschreibe. Bourdieu beschreibt, wie Frauen aufgrund der starken Zensur und Beobachtung an öffentlichen Plätzen in der Kabylei durch körperliche Haltungen wie Zurückhaltung oder Scham reagieren und schließlich sogar fernbleiben, um sich diese unangenehme Erfahrung zu ersparen (Bourdieu 1997b, 171).
„Dieses vom Körper vermittelte Wissen bringt die Beherrschten dazu, an ihrer eigenen Unterdrückung mitzuwirken, indem sie, jenseits jeder bewußten Entscheidung und jedes willentlichen Beschlusses, die ihnen auferlegten Gesetze stillschweigend akzeptieren […]“ (Bourdieu 1997b, 170).
Die unmerkliche Diskriminierung der männlichen Herrschaft zeigt sich laut Bourdieu in der Unterwerfungsbereitschaft der Frauen, die sich die körperlichen Gewohnheiten und die Deutungsmuster eingeschrieben haben (Bourdieu 1997a, 228). Der männliche Habitus und das männliche Körperverhältnis wird von Bourdieu nicht konkret beschrieben, wird jedoch durch die Teilhabe am öffentlichen Raum als Herrschaftsverhältnis gekennzeichnet. Dementsprechend kann davon ausgehend ein Verhalten abgeleitet werden, bei dem in der Öffentlichkeit selbstverständlich mehr Raum eingenommen wird und die Bereitschaft gezeigt wird, um diesen Raum zu kämpfen.
2.1.4. Gesellschaftlicher Wandel und Transformation von Körperidealen
„In der sozialen Praxis bilden die Menschen nicht nur körperliche Gewohnheiten aus, sondern sie verinnerlichen auch Denkschemata und Werthaltungen, die sich ebenfalls nach sozialer Lage zu habituellen Mustern verfestigen“ (Penz 2010, 43).
Inwieweit sich Bourdieus Thesen auf gegenwärtige Körperverhältnisse übertragen lassen und inwieweit seine Erkenntnisse relevant sind für mein Sample der Bildungsaufsteiger soll vor dem Hintergrund gesellschaftlichen Wandels diskutiert werden. Dazu möchte ich auf zwei Aspekte eingehen. Erstens sind Körperideale und ein spezifischer Habitus nicht statisch zu denken, sondern Bourdieu selbst macht darauf aufmerksam, dass sich dynamische Wandlungsprozesse des Habitus im Zuge gesellschaftlicher Veränderungen vollziehen. Diese Modifikationen und Transformationen vollziehen sich laut Bourdieu von oben nach unten als auch umgekehrt. Er beschreibt beispielsweise einen historischen Bedeutungswandel der von ihm gekennzeichneten Arbeitersportarten „Fußball und Rugby, Ringen und Boxen, [die] in ihren Anfängen zu den Vergnügen der französischen Aristokratie“ (Bourdieu 1982, 342) gehörten. Solche Wandlungsprozesse von Körperidealen und Symbolen zeigen sich in vielfacher Weise auch gegenwärtig. Beispiele dafür sind der Wandel von Fitness vom Arbeiter- zum ,Managersport‘ (Graf, 2013) oder des Tattoos vom ,Symbol unterer Bildungsschichten‘ zur ,Kunst‘. Um an bestimmte Körperdeutungen und Distinktionslinien anknüpfen zu können, muss daher diese Dynamik der Körperideale im Zuge sozialen Wandels mitgedacht werden.
Die zentrale Problematik für die Übertragbarkeit von Bourdieus Erkenntnissen ist jedoch der Wandel von Arbeitsverhältnissen und in diesem Kontext die von ihm vorgenommene Einteilung der sozialen Positionen. Denn wenn Bourdieus Darstellung eines ,Geschmacks der Notwendigkeit‘ der Arbeiterklasse nicht mehr aktuell erscheint, ist dies als Erstes darauf zurückzuführen, dass die im heutigen Verständnis bezeichneten Milieus oder Bildungsschichten anders angelegt sind als Bourdieus soziale Klassen. Ohne hier die Konzepte (Klassen-, Schicht- oder Milieubegriff) diskutieren zu müssen – denn dies ist nicht notwendig und würde zudem die Arbeit überfrachten – soll jedoch auf die Unterschiede dieser Einteilungen eingegangen werden, denn diese haben eine wesentliche Auswirkung auf die jeweils zugeschriebene Bedeutung des Körpers. Während die von Bourdieu angelegte Oberklasse sowohl freie Berufe, leitende Angestellte, Beamte als auch Akademiker und Lehrer umfasst, werden in aktuellen Studien zu Körperidealen die oberen sozialen Positionen (,akademische Milieus‘) meist von Studierenden (mit wenig ökonomischen Kapital) repräsentiert (u.a. Maier 2000). Demgegenüber wird Bourdieus ,Arbeiterklasse‘ von Bauern und Arbeitern abgebildet, gegenwärtige Studien fassen jedoch nicht nur reine Arbeiter-, sondern auch Angestelltenberufe (die in Bourdieus Klassenstudiezur Mittelklasse zugeordnet werden) zu den unteren sozialen Positionen. Diese unterschiedliche Einteilung macht die Widersprüche zwischen Bourdieus klassenspezifischen Körperdeutungen und dem, was aktuell mit Körper und Klasse oder sozialem Milieu verknüpft wird, erklärbarer. So kann beispielsweise ein ,Geschmack der Notwendigkeit‘ möglicherweise gegenwärtig noch für (ältere) Land- oder Bauarbeiter gelten, nicht jedoch für junge, urbane Mechatroniker oder Verkäufer, für die berufsbedingt die Repräsentation des Körpers eine größere Rolle spielt und die zudem Modeerscheinungen wie Piercings oder Tattoos als Mittel der Distinktion einsetzen.2 Des Weiteren zeichnet sich eine Verschiebung sozialer Positionen nach unten ab, beispielsweise durch die Entwicklung eines akademischen ,Prekariats‘ sowie eines niedrigbezahlten Dienstleistungssektors. Diese Aspekte sollen für meine Studie und das Sample von Studierenden aus Nichtakademikerfamilien mitgedacht werden. Da gerade bei Studierenden viel kulturelles und nur wenig ökonomisches Kapital vorliegt, bieten sich Anknüpfungspunkte an den von Bourdieu beschriebenen Lebensstil eines „asketischen Aristokratismus“ (Bourdieu 1982, 447) der Lehrer und an den gesundheitsbewussten, disziplinierten Lebensstil der Mittelklasse.
Des Weiteren soll die Bedeutung der körperlichen Arbeit in der Herkunftsfamilie mit bedacht werden. Auch Kategorien und Vorstellungen von ,Männlichkeit‘ und ,Weiblichkeit‘ unterliegen gesellschaftlichem Wandel, und es lassen sich Verschiebungen zwischen Kategorien von ,Männlichkeit‘ und ,Weiblichkeit‘ beobachten. Bevor ich konkret darauf eingehe und diskutiere, ob und inwieweit sich die von Bourdieu beschriebene Habitus – einer ,männlichen Herrschaft‘ und dem ,Körper-für-Andere‘ als auch der Habitus ,sozialer Aufsteiger‘ – auf gegenwärtige Körper-Selbst-Verhältnisse übertragen lassen, soll zunächst jedoch grundsätzlich diskutiert werden, ob und inwieweit das Sprechen – beispielsweise durch Interviews – Aufschluss über die Inkorporierung sozialer Strukturen, geschlechtsspezifischer Machtverhältnisse und Körperpraktiken geben kann.
1Bourdieu bezieht sich hier vor allem auf Hausfrauen, zumindest ist ihr Beruf nicht genau gekennzeichnet, denn ihr sozialer Status ist vom Beruf des Mannes abgeleitet.
2 Vergleiche Kapitel 2.3.2. Legitime Argumentationsmuster: Natürlichkeit und Souveränität.
2.2. Sprechen über den Körper als diskursive und performative Praxis
Trotz der weiten Verbreitung, die der Habitusbegriff in der Soziologie gefunden hat, hat Bourdieus Herangehensweise auch zu Kritik geführt. Der zentrale Kritikpunkt ist dabei, dass die von ihm gedachten Akteure als determiniert erscheinen (Wigger 2006, 106). Tatsächlich liegt der Schwerpunkt von Bourdieus Studien nicht in der Analyse von Handlungsmöglichkeiten, sondern in der Inkorporierung der sozialen Strukturen und der Frage, wie Lebensstile, Machtverhältnisse und soziale Ungleichheiten beständig weitergegeben werden. Durch diesen Fokus wirken die von ihm gedachten Akteure und ihre Körperverhältnisse eher statisch, auch wenn dies von Bourdieu nicht so gemeint ist. So kennzeichnet er nicht nur die Strukturen als von Veränderung begriffen, wie er im Hinblick auf einen historisch und kulturellen Bedeutungswandel der Körperideale und Sportarten belegt, sondern er versteht den Habitus selbst als „bedingte Freiheit“ (Bourdieu 1987, 103). Durch eine „‚geregelte […] Improvisation‘“ (Bourdieu 1979, 179) haben die einzelnen Akteure das Potenzial, ihren eigenen Habitus mit zu erzeugen (Schwingel 2005, 69, Wigger 2006, 107).
„Da der Habitus eine unbegrenzte Fähigkeit ist, in völliger (kontrollierter) Freiheit Hervorbringungen – Gedanken, Wahrnehmungen, Äußerungen, Handlungen – zu erzeugen, die stets in den historischen und sozialen Grenzen seiner eigenen Erzeugung liegen, steht die konditionierte und bedingte Freiheit, die er bietet, der unvorhergesehenen Neuschöpfung ebenso fern wie der simplen mechanischen Reproduktion ursprünglicher Konditionierungen“ (Bourdieu 1987, 103).
Seinem Habituskonzept liegt also ein Subjektbegriff zugrunde (oder man könnte einen Subjektbegriff ableiten)1





























