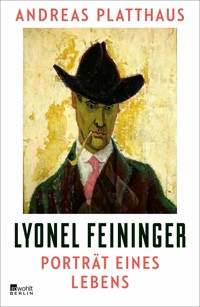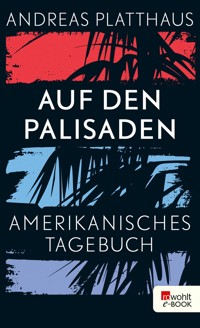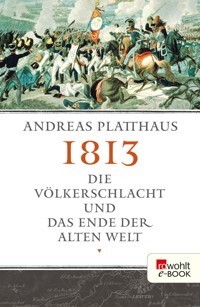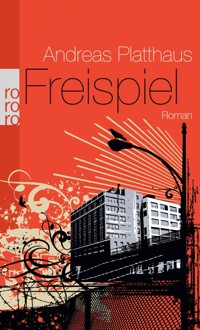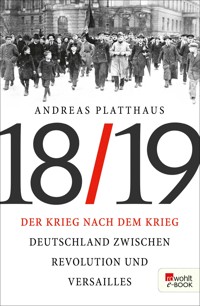
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Als Europa den Atem anhielt: das Schicksalsjahr zwischen der deutschen Niederlage und dem Vertrag von Versailles Der September 1918 sollte endlich den Sieg bringen. Mit der letzten großen Offensive des deutschen Heeres setzt Andreas Platthaus' packende Darstellung ein, in der er die Zeit vom Herbst 1918 bis zum Sommer 1919 als einen einzigen großen Gewaltzusammenhang erzählt. Denn mit dem Waffenstillstand war der Krieg keineswegs beendet. Die Zeitgenossen erlebten, wie eine Welt umgestürzt wurde, und sie stritten mit allen Mitteln um die Frage, was nun kommen sollte: eine kommunistische Volksherrschaft? Eine gemäßigte Republik? Und wie sollte die Nachkriegsordnung aussehen? Die Hoffnungen auf einen Großen Frieden nach dem Großen Krieg zerschlugen sich, am Ende stand der diktierte Frieden von Versailles. 2018 jährt sich der eigentliche Beginn des «kurzen» 20. Jahrhunderts zum hundertsten Mal. Mit den Jahrestagen von Waffenstillstand, Novemberrevolution, Republikgründung, Münchner Räterepublik und Versailles schildert Andreas Platthaus den Krieg nach dem Krieg und den Anfang einer schrecklichen Moderne. Die packende Analyse jenes historischen Moments, in dem für einen Augenblick alles möglich schien – bevor auf verhängnisvolle Weise die Weichen für die Zukunft gestellt wurden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 476
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Andreas Platthaus
Der Krieg nach dem Krieg
Deutschland zwischen Revolution und Versailles 1918/19
Über dieses Buch
Als Europa den Atem anhielt: das Schicksalsjahr zwischen der deutschen Niederlage und dem Vertrag von Versailles
Der September 1918 sollte endlich den Sieg bringen. Mit der letzten großen Offensive des deutschen Heeres setzt Andreas Platthaus’ packende Darstellung ein, in der er die Zeit vom Herbst 1918 bis zum Sommer 1919 als einen einzigen großen Gewaltzusammenhang erzählt. Denn mit dem Waffenstillstand war der Krieg keineswegs beendet. Die Zeitgenossen erlebten, wie eine Welt umgestürzt wurde, und sie stritten mit allen Mitteln um die Frage, was nun kommen sollte: eine kommunistische Volksherrschaft? Eine gemäßigte Republik? Und wie sollte die Nachkriegsordnung aussehen? Die Hoffnungen auf einen Großen Frieden nach dem Großen Krieg zerschlugen sich, am Ende stand der diktierte Frieden von Versailles.
2018 jährt sich der eigentliche Beginn des «kurzen» 20. Jahrhunderts zum hundertsten Mal. Mit den Jahrestagen von Waffenstillstand, Novemberrevolution, Republikgründung, Münchner Räterepublik und Versailles schildert Andreas Platthaus den Krieg nach dem Krieg und den Anfang einer schrecklichen Moderne. Die packende Analyse jenes historischen Moments, in dem für einen Augenblick alles möglich schien – bevor auf verhängnisvolle Weise die Weichen für die Zukunft gestellt wurden.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, März 2018
Copyright © 2018 by Rowohlt · Berlin Verlag GmbH, Berlin
Umschlaggestaltung Frank Ortmann
Umschlagabbildung akg-images
Karten Copyright © Peter Palm, Berlin
ISBN 978-3-644-11811-9
Hinweis: Die Seitenverweise beziehen sich auf die Printausgabe.
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
V wie Verpflichtung:
Für Alan Moore, der uns alles lehrt, was Erzählen heißt.
Vorwort: Die Illusion vom Ende
Dieser Krieg hatte begonnen, um alle Kriege zu beenden. So zumindest verkündete es H.G. Wells, und der musste es wissen. Kein anderer Schriftsteller war mit Kriegsbüchern so bekannt geworden wie der Brite. Sein Roman «Der Krieg der Welten» war 1898 erschienen und ein Welterfolg. Allerdings war das Buch auch Science-Fiction, noch bevor das Wort geprägt war: Heldenhafte Engländer wehren einen Angriff von Außerirdischen ab, deren Heimat der nach dem Kriegsgott Mars benannte Planet ist. Zehn Jahre später wählte Wells ein ähnliches Thema für einen neuen Erfolgsroman, «Der Luftkrieg», doch diesmal waren sich die Gegner näher: Die Deutschen führen Krieg gegen die Vereinigten Staaten, und als sich eine Allianz von asiatischen Mächten einmischt, ist der Weltkrieg ausgebrochen. Wells siedelte die Handlung in einer nahen Zukunft an, am Ende des folgenden Jahrzehnts. Zu jenem Zeitpunkt also, als in der Wirklichkeit der Erste Weltkrieg enden sollte.
Mit der Parole «The War That Will End War» hatte Wells jedoch keinen Roman, sondern eine Broschüre betitelt, in der er im Oktober 1914 seine seit Kriegsbeginn geschriebenen politischen Artikel versammelte.[1] Elf Aufsätze waren in nur knapp mehr als einem Monat zusammengekommen, und gleich der erste hob mit dem Satz an: «Der Anlass eines Krieges und sein Ziel stimmen nicht notwendig überein.» Da nicht Deutschland seinem Heimatland den Krieg erklärt hatte, sondern Großbritannien am 3. September an die Seite Frankreichs und Russlands getreten war, fühlte sich Wells bemüßigt, den Kriegseintritt zusätzlich zu dem ohnehin guten Grund – dem deutschen Einmarsch in die neutralen Staaten Belgien und Luxemburg – durch ein weiteres moralisches Kriegsziel zu legitimieren: «For this is now a war for peace.»
Ewigen Frieden sah Wells am Horizont, wenn es denn gelingen werde, den «preußischen Imperialismus zu zerschmettern». Weil man nur das anstrebe – nicht etwa, die «Freiheit oder Einheit der Deutschen zu zerstören» –, richte sich der Krieg unmittelbar auf eine allgemeine Entwaffnung, denn sobald die preußische Weltbedrohung beseitigt sei, müsse die bisherige Hochrüstung nicht länger fortgeführt werden. Der reißerische Titel «Krieg zur Beendigung aller Kriege» findet sich gar nicht explizit in den Texten der Broschüre, doch zu reizvoll war diese Formulierung im Zusammenhang mit einem Autor, der auf dem Titelblatt als «Author of ‹The War of the Worlds›, ‹The War in the Air› etc.» ausgewiesen wurde, also als der literarische Kriegsexperte schlechthin. Und so zitierte denn auch der amerikanische Präsident Woodrow Wilson just jenen Buchtitel, als er am 2. April 1917 vor beiden Häusern des Kongresses den bevorstehenden Eintritt der Vereinigten Staaten in den Krieg gegen Deutschland begründete: «Ich verspreche Ihnen, dass das der letzte Krieg sein wird – der Krieg, der alle Kriege beendet.»[2] Dass Wilson tatsächlich Wells gelesen hatte, das sollte sich an dem Werk zeigen, das die präsidiale Ankündigung zwei Jahre später einlöste: dem Versailler Vertrag.
Der Text des bis dahin umfangreichsten Friedensschlusses der Geschichte liest sich selbst wie ein Roman – leider nicht stilistisch, aber allemal vom Umfang her: Er umfasst achtzigtausend Worte, das ergibt in der deutschen Druckausgabe[3] rund zweihundertfünfzig Seiten. Als in der amerikanischen Debatte um die Ratifizierung des Abkommens im Herbst 1919 der komplette Vertragstext im zuständigen Senatsausschuss verlesen wurde – eine Schikane der Abkommensgegner, die Zeit gewinnen wollten, um weitere Senatoren auf ihre Seite zu ziehen –, dauerte das zwei Wochen.[4] Wilson hatte nicht Science-, sondern Politics-Fiction schreiben lassen. Die Ablehnung vom 19. November 1919 durch den Senat war dann das erste Eingeständnis, dass dieser Vertrag scheitern würde. So umfangreich war er deshalb geraten, weil er sich einerseits vorgenommen hatte, tatsächlich ewigen Frieden zu schaffen, und andererseits, einen Krieg zu beenden, in dem es militärisch noch keinen eindeutigen Sieg gegeben hatte – die Deutschen hielten sich, mit einem späteren Propagandaslogan der politischen Rechten, für «im Felde unbesiegt».
Man könnte den Eindruck gewinnen, beide Zielsetzungen würden sich perfekt ergänzen, aber faktisch hatte es eben doch Sieger gegeben, als im November 1918 der Waffenstillstand geschlossen worden war: die Alliierten. Und die wollten diesen Sieg nun nicht nur anerkannt sehen, sondern auch seine Früchte ernten. Der Versailler Vertrag wurde von beiden Seiten unterschrieben, jedoch allein von den Siegern verfasst. Die Debatte über das Abkommen hält bis heute an, unter Historikern, aber auch in der breiten Öffentlichkeit. Umstritten ist weniger die Frage, ob es zum Scheitern verurteilt war – dass dafür schon die Form des Vertrags gesorgt hat, darüber ist man sich mittlerweile weitgehend einig –, sondern wie es geschehen konnte, dass man dem Abkommen überhaupt diese Form gab. Die Diskrepanz zwischen den beiden Hauptabsichten ist eine Erklärung, aber es spielen noch viele andere Faktoren eine Rolle. Sie sollen in diesem Buch Berücksichtigung finden.
In Deutschland ist man nach wie vor geneigt, sich auf die Folgen des Vertrags zu konzentrieren; das berühmte Schlag- und Schimpfwort von der «Erfüllungspolitik» ist dafür bezeichnend. In den anderen am Versailler Vertrag beteiligten Ländern – und das war die halbe Welt – richtet sich das heutige Augenmerk dagegen mehr auf dessen Voraussetzungen. In diesen unterschiedlichen Betrachtungsweisen artikuliert sich die jeweilige Beteiligung: Die Deutschen saßen in den Verhandlungen um den Vertragstext nicht mit am Tisch, sie wurden erst mit dem fertigen Dokument konfrontiert. Zudem hatten sie im ersten Halbjahr des Jahres 1919, als die Pariser Friedenskonferenz tagte, auf der die Sieger den Versailler Vertrag aushandelten, noch ganz andere Sorgen. Die junge Republik musste sich nicht nur mit den Beharrungskräften des alten Kaiserreichs auseinandersetzen, sondern auch mit der Enttäuschung jener, die sich eine sozialistische Revolution erhofft hatten. Das Jahr 1919 hatte in der Reichshauptstadt Berlin mit bürgerkriegsähnlichen Zuständen begonnen, und bis zur Unterzeichnung des Versailler Vertrags am 28. Juni war auch in Bayern, Sachsen und dem Ruhrgebiet der Bürgerkrieg mehrfach offen ausgebrochen.
Die deutschen historischen Darstellungen legen ihren Schwerpunkt deshalb auf die inneren Verhältnisse dieser Zeit, während in den anderen Ländern zwar Besorgnis über die revolutionären und reaktionären Ereignisse im Reich herrschte, aber das Augenmerk der Pariser Konferenz galt – und bis heute gilt. Zumal die Konferenz eine historisch einmalige Funktion zu erfüllen hatte: Ihr Ergebnis, der Friedensvertrag mit Deutschland, sollte erklärtermaßen als Muster für die dann noch anstehenden Friedensschlüsse mit den deutschen Kriegsverbündeten dienen, also mit Österreich-Ungarn, Bulgarien und der Türkei. Der Historiker Jörn Leonhard schreibt dazu: «Da die anderen Konferenzen nach dem Vorbild der Pariser Konferenz organisiert sowie die anderen Verträge nach dem Vorbild des Versailler Vertrags verfasst wurden und da viele ihrer Klauseln sich auf diesen Vertrag bezogen, lag der Fokus der Aufmerksamkeit von Zeitgenossen und Historikern vor allem auf der Konferenz von Paris und dem daraus hervorgehenden Versailler Vertrag. Ebendiese Konferenz warf die drängendsten Fragen auf, an sie wurden die meisten Erwartungen gestellt, und sie rief die schärfste Kritik hervor.»[5] Danach gab es nur noch für Deutschland ein Problem. Zumindest hofften das die Sieger.
Da sich im Versailler Vertrag aber die unterschiedlichen Interessen der Alliierten artikulierten, hörten die Probleme auch für sie nicht auf. Die nachträgliche Ablehnung des Abkommens ausgerechnet durch jene Macht, die den größten Einfluss auf seine Entstehung hatte, die Vereinigten Staaten, machte das bald klar. Es hatte etwas von diplomatischer Ironie, dass der amerikanische Präsident im Vertrag mit einer traditionellen Titulierung genannt wurde, die sich von der aller anderen Signatare unterschied: «der ehrenwerte Woodrow Wilson, Präsident der Vereinigten Staaten in seinem eigenen Namen und aus eigener Machtbefugnis». Diese Machtbefugnis war nicht groß genug, der Senat diskreditierte durch seine Ablehnung den eigenen Staatschef, der als Spiritus Rector des Vertragstextes galt. Tatsächlich war Wilson aber vor allem an einem Teil interessiert: dem ersten, der Völkerbundsakte, die lediglich sechsundzwanzig von insgesamt vierhundertvierzig Artikeln und zehn von zweihundertfünfzig Seiten umfasste. Der Rest war für ihn Klein-Klein, auch wenn es ihn und seine Berater während der Pariser Konferenz oft genug hatte verzweifeln lassen. Als überseeische Macht, die zudem erst spät in den Krieg eingetreten war, fehlte den Vereinigten Staaten das existenzielle Bedürfnis, Fragen zu regeln wie jene nach den Grenzziehungen und den wirtschaftlichen Verflechtungen in Europa, die den größten Teil des Versailler Vertrags ausmachen.
Gegliedert ist der Vertrag in vierzehn Teile ganz unterschiedlicher Länge. Die beiden umfangreichsten (mit jeweils etwas mehr als einem Fünftel des Gesamttextes) sind der dritte Teil über «Politische Bestimmungen für Europa», in dem die Bedingungen der deutschen Gebietsabtretungen geregelt wurden, und der zehnte über «Wirtschaftliche Bestimmungen». An Letzteren hatte vor allem Großbritannien als führende Handelsmacht Interesse, während die französischen Bemühungen sich vorrangig darauf richteten, Deutschland dauerhaft politisch und militärisch zu schwächen. Das besondere Augenmerk der Franzosen galt den deutschen Territorialverlusten und der damit verbundenen Bevölkerungsreduzierung.
In Übereinstimmung zu bringen waren aber die Interessen von insgesamt dreiunddreißig Vertragspartnern, die in Versailles schließlich unterzeichneten, inklusive Deutschland. Auf den Verlierer musste keine große Rücksicht genommen werden, umso mehr jedoch auf die fünf sogenannten Hauptmächte: die Vereinigten Staaten, das Britische Empire, Frankreich, Italien und Japan. Da das Empire neben Großbritannien die Dominions Kanada, Südafrika, Australien und Neuseeland sowie das Kaiserreich Indien umfasste, prallten unter den Hauptmächten sogar insgesamt zehn Positionen aufeinander. Und weil der Versailler Vertrag Vorbildcharakter für die anderen sogenannten Pariser Vorortverträge haben sollte – also in der Reihenfolge ihrer Abschlüsse für den von Saint-Germain-en-Laye mit Österreich, den von Neuilly-sur-Seine mit Bulgarien, den von Trianon mit Ungarn und den von Sèvres mit der Türkei –, waren auch Mächte, die wie Italien oder Japan gar nicht intensiv in die Kriegsführung mit den Deutschen verwickelt gewesen waren, im höchsten Maße an einzelnen Bestimmungen interessiert. Italien hatte zwar keine gemeinsame Grenze mit Deutschland, weshalb sein künftiges Territorium in den «Politischen Bestimmungen für Europa» des Versailler Vertrags gar nicht erwähnt wird, aber die deutschen Gebietsabtretungen und ihre jeweiligen Regelungen sollten die Basis legen für die Bedingungen der italienischen Gebietszuwächse auf Kosten des früheren Habsburger-Reichs. Japan wiederum spekulierte auf deutsche Kolonien im Pazifik und Einflusssphären in China, weshalb für die Regierung in Tokio der vierte Teil des Vertrags, «Deutsche Rechte und Interessen außerhalb Deutschlands», zentral war – wie auch für Australien und Neuseeland, die in der Frage der Verteilung des deutschen Kolonialbesitzes im Pazifik als Rivalen Japans auftraten. Schließlich gab es neben diesen Mächten eine Reihe «normaler» Alliierter, unter denen zum Beispiel China und Siam waren, die den japanischen Einfluss eindämmen wollten. Oder die süd- und mittelamerikanischen Staaten Bolivien, Ecuador, Brasilien, Kuba, Guatemala, Haiti, Honduras, Nicaragua und Panama, die größtes Interesse an den Formulierungen der Völkerbundsakte hatten, auch deshalb, weil darin die Rolle der Vereinigten Staaten als amerikanische Ordnungsmacht fortgeschrieben werden sollte – sehr zum Missfallen der lateinamerikanischen Länder.
Das alles sind Fragen, die mit dem Vertrag selbst zusammenhängen und von denen jede ein eigenes Buch verdienen würde. Das vorliegende wird sie und viele mehr ansprechen, aber nur insofern, als sie charakteristisch sind für eine Konstellation, die die letzten fünfzig Tage des Jahres 1918 und das erste Halbjahr 1919 ausmachte. Es war offiziell ja noch Krieg und doch auch nicht mehr Krieg. Zwar hatten die aktiven Kampfhandlungen am 11. November 1918 aufgehört, bis der Friedensvertrag mit Deutschland aber in Kraft trat, galt noch der Kriegszustand zwischen dem Reich und den Alliierten. Die Welt lebte ungeachtet der Erleichterung über das Ende des Abschlachtens an der Front weiterhin unter der Drohung, dass die Kämpfe wiederaufgenommen werden könnten. Es war der Krieg, den keiner so nennt. Wie er geführt wurde, diplomatisch und innenpolitisch, das ist der Gegenstand dieses Buchs.
Es herrschte also immer noch Krieg, die ganze Zeit lang, die dieses Buch beschreibt, bis zum Vertragsschluss von Versailles. In einem Fall sogar noch weit darüber hinaus, und das war nun wirklich nicht die Schuld der Deutschen: Der Krieg zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten war erst 1921 mit dem Berliner Frieden offiziell vorbei, nachdem der bereits von Wilson unterzeichnete Versailler Vertrag nicht die Zustimmung des amerikanischen Senats gefunden hatte. Zwischen dem Reich und allen anderen an dem Abkommen beteiligten Staaten herrschte der Kriegszustand bis zum 28. Juni 1919, dem Tag von Versailles. Der besiegelte dann einen Kampf mit Worten, der genauso erbittert geführt worden war wie der mit Waffen.
In der Forschungsliteratur aber lesen wir über den Waffenstillstand, der ein halbes Jahr zuvor geschlossen wurde, solche Sätze: «Sechs Stunden nach der Unterzeichnung dieses Abkommens, am 11. November um 12 Uhr mittags, wurden die Feindseligkeiten eingestellt. Der Krieg war zu Ende.»[6] An diesen zwei Sätzen eines erstmals 1968 erschienenen deutschen Standardwerks zum Ersten Weltkrieg ist alles falsch. Weder war am 11. November 1918 der Krieg zu Ende, noch waren die Feindseligkeiten eingestellt. Im Gegenteil hatte nie größere Feindschaft zwischen den beteiligten Nationen geherrscht als in den siebeneinhalb Monaten danach, denn nun standen sich nicht mehr nur die verbündeten Mittelmächte, also das Deutsche Reich, Österreich-Ungarn, Bulgarien sowie die Türkei, und die Alliierten mit den Hauptmächten Frankreich, Großbritannien, den Vereinigten Staaten, Italien und Japan gegenüber, sondern auch zwischen den Siegern brach Streit aus: um den endgültigen Friedensschluss mit den Besiegten. Er fand sein Schlachtfeld in Paris, vom Januar bis zum Mai 1919, als von den Alliierten jene Bedingungen ausgehandelt wurden, unter denen sie bereit waren, ihren Gegnern Frieden zu gewähren.
Die Rede von «den Alliierten» ist dabei nicht ganz richtig. Die Vereinigten Staaten, die sich in den Folgemonaten als wichtigste Macht erwiesen – und diesen Status bis heute nicht eingebüßt haben –, weigerten sich, als Alliierter bezeichnet zu werden. Sie waren erst spät in den Krieg eingetreten, im April 1917, und in Washington war man sorgsam darauf bedacht, sich nicht vollständig mit den bereits lange kämpfenden Verbündeten gemeinzumachen. Den sichtbarsten Ausdruck fand das am 8. Januar 1918 in der Verkündigung der «Vierzehn Punkte», die Woodrow Wilson zur Bedingung für einen Friedensschluss machte. Sie waren mit den anderen Ländern, die gegen die Mittelmächte kämpften, nicht abgesprochen. Und als die Deutschen unter Anerkennung dieser Vierzehn Punkte am 3. Oktober um einen Waffenstillstand baten, firmierten die Amerikaner in den folgenden Verhandlungen bis zum Abschluss des Versailler Vertrags immer nur als mit den Alliierten «assoziierte Macht», weshalb im Abkommen vom 11. November stets von «den alliierten und assoziierten Mächten» die Rede ist. Unumstößliche Einigkeit wurde damit nicht signalisiert. Sofern in diesem Buch trotzdem meist nur von «den Alliierten» oder bisweilen auch «der Entente» die Rede ist, wenn es um die Siegermächte geht, entspricht das lediglich dem gängigen Sprachgebrauch.
Das mehr als vier Jahre währende Gemetzel an der Front war mit diesem Abkommen vorbei, aber das Sterben nicht. In den siebeneinhalb Monaten des Waffenstillstands verloren weit mehr Menschen ihr Leben durch die Spanische Grippe, als von 1914 bis 1918 in den Schützengräben gestorben waren, im Falle der Vereinigten Staaten sogar mehr Soldaten als infolge von Kampfhandlungen. Die Zahl der weltweiten Pandemietoten ist nie exakt ermittelt worden, die Schätzungen schwanken zwischen zwanzig und siebzig Millionen, während im Krieg rund fünfzehn Millionen Soldaten starben. Auffällig ist, dass von der Spanischen Grippe am stärksten jene Länder betroffen waren, die am Ersten Weltkrieg teilgenommen hatten. Durch die Truppenbewegungen und zynischerweise auch durch die nach dem 11. November in den alliierten Staaten abgehaltenen Siegesfeiern konnte sich der Erreger, der zum Jahresanfang 1918 erstmals nachgewiesen worden war, rasant verbreiten. Am schlimmsten sollte er dann im Jahr 1919 in Indien wüten, kurz nachdem die Soldaten des damals der englischen Krone untertanen Landes nach dem Waffenstillstand nach Hause zurückgekehrt waren.
In Deutschland traf die Grippewelle auf eine ausgehungerte und entsprechend wenig widerstandsfähige Zivilbevölkerung. Zuletzt war bevorzugt die Front mit Lebensmitteln versorgt worden, außerdem hatte jahrelang die alliierte Handelsblockade gewirkt. Die Blockade bestand auch nach dem offiziellen Ende der Kampfhandlungen fort, sie wurde eigens ins Waffenstillstandsabkommen aufgenommen. Artikel XXVI lautete: «Die Blockade der alliierten und assoziierten Mächte bleibt im gegenwärtigen Umfange bestehen. Deutsche Handelsschiffe, die auf hoher See gefunden werden, unterliegen der Beschlagnahme.» Zwar wurde im selben Artikel eine mögliche Versorgung Deutschlands mit Lebensmitteln «in dem als notwendig anerkannten Maße» angesprochen, aber das Gremium, das diese Anerkennung zu leisten hatte, war die im Schlussartikel des Abkommens etablierte Internationale Waffenstillstandskommission, der trotz ihrer «Internationalität» kein Vertreter der Deutschen angehören sollte. Auch waren die Lebensmittellieferungen nicht garantiert, sondern lediglich «in Aussicht genommen». Im hungernden Deutschland empfand man das eher als Fortführung der Feindseligkeiten.
Es wurde also weiterhin in Massen gestorben, wenn auch nicht mehr direkt durch fremde Hand. Und es wurde weiterhin gekämpft, zum Beispiel im Osten, wo es galt, der vom bolschewistischen Russland ausgehenden revolutionären Bedrohung Westeuropas Einhalt zu gebieten. Diese Aufgabe kam den Deutschen zu, die seit dem am 3. März 1918 mit Russland geschlossenen Separatfrieden von Brest-Litowsk weite Gebiete im Westen des früheren Zarenreichs kontrollierten. Der zwölfte Artikel des Waffenstillstandsabkommens vom 11. November mit den Alliierten verlangte vom Deutschen Reich zwar den Rückzug aller Soldaten von der Ostfront hinter die Grenzen von 1914, aber das galt nicht für ehemals russische Gebiete, die erst geräumt werden sollten, «sobald die Alliierten, unter Berücksichtigung der inneren Lage dieser Gebiete, den Augenblick für gekommen» erachteten. Von einer «Einstellung der Feindlichkeiten zu Lande und in der Luft», wie es das Abkommen in Artikel I für die Westfront vorsah, war im Osten daher keine Rede, konnte es auch gar nicht sein, weil Russland am Abschluss nicht beteiligt war. Zugleich zwang Artikel XIII dem Deutschen Reich den Verzicht auf den Frieden von Brest-Litowsk ab. Damit befand sich das Land formell wieder im Krieg mit Russland. Das war praktisch für die Alliierten, denn würden die Bolschewisten nach Westen vorstoßen, hätten es nur die Deutschen mit ihnen zu tun. Das Waffenstillstandsabkommen regelte also die Fortdauer des Kriegs mit anderen Mitteln.
Dass der 11. November 1918 als Schlusstag des Ersten Weltkriegs wahrgenommen wurde, ist verständlich aus der Sicht der Soldaten und ihrer Angehörigen, da nicht länger der Tod an der Front drohte. Auf alliierter Seite feierte man den Sieg, weil die Bedingungen des Waffenstillstands dokumentierten, wer den Krieg gewonnen hatte. Bis heute ist der 11. November Nationalfeiertag in Frankreich und Belgien, in den Ländern des Commonwealth begeht man an diesem Datum den Remembrance Day, in den Vereinigten Staaten den Veterans Day. In Deutschland dagegen gedenkt man dieses Tages nicht, als zu vernichtend wurde er empfunden. Für die Regierungen aller beteiligten Staaten aber begann nach dem Waffenstillstand erst der schwierigste Teil des Krieges, weil plötzlich nicht mehr nur der Feind zu bekämpfen war. Bei den Alliierten wurden Verbündete zu Gegenspielern, bei den Deutschen wütete der Kampf nun auch im Inneren.
Im städtischen Kunstmuseum von Stuttgart hängt ein Triptychon von Otto Dix. Er hat das Bild 1927 gemalt, und es trägt den Titel «Großstadt». Im Mittelpunkt steht eine ausgelassene Tanzveranstaltung, die durch die Eleganz der Stoffe, in die die aufreizenden Damen gehüllt sind, die blitzenden Blasinstrumente einer Jazzcombo und das glänzende Parkett des Tanzbodens wie eine farbgetreue Illustration der Rede von den «Goldenen Zwanzigern» wirkt. Doch Dix rahmte diese Mitteltafel durch zwei Flügel mit Straßenszenen, auf denen die so reich geschmückten Damen zu nicht minder farbenprächtig, aber vulgär gekleideten Dirnen werden, die sich an zwei Bettlern vorbei zu den Clubs und Salons begeben, wo sie ihre Dienste anbieten. Die beiden Bettler sind Veteranen des Ersten Weltkriegs: auf der linken Tafel ein doppelt Beinamputierter in zerlumpter Uniform auf zwei Krücken, auf der rechten ein Soldat, der ebenfalls beide Beine verloren hat und in Zivilkleidung, die aber feldgrau ist wie eine Uniform, auf dem Boden sitzt, den umgedrehten Hut vor sich. Der Kopf des Bettlers auf der rechten Seite ist kahl, und zwischen Augen und Mund fehlt ihm die Nase: Eine brutale Lücke verunstaltet sein Gesicht wie ein tiefer Einschnitt. Er gehört jener Gruppe von Verwundeten an, die man in Frankreich unter dem drastischen Namen «Gueules cassées» kannte, zerschlagene Fressen.
Eingerahmt vom Elend der Kriegskrüppel, malt Otto Dix 1927/28 seine Darstellung der luxuriösen und realitätsvergessenen «Großstadt». Er war selbst Kriegsteilnehmer und hatte seine Eindrücke der Versehrten schon an der Front in Skizzen festgehalten. Das Triptychon befindet sich heute im Kunstmuseum Stuttgart.
Das waren Gesichter, die nach dem Ersten Weltkrieg jeder kannte, weil sie zum Straßenbild gehörten. Die Zahl der während des Kriegs auf beiden Seiten verwundeten Soldaten wird heute auf mehr als sieben Millionen geschätzt, elf bis vierzehn Prozent davon erlitten Gesichtsverletzungen.[7] Die Fortschritte in der Militärtechnik hatten zum Resultat, dass es schlimmere Versehrungen gab als jemals zuvor, während die Fortschritte der Medizintechnik dafür sorgten, dass viele der derart schwer Verletzten überlebten. Vor allem die plastische Chirurgie und die Entwicklung und Herstellung von Prothesen wurden in den Feld- und Heimatlazaretten der am Krieg beteiligten Staaten revolutioniert, doch auch die besten neuen Behandlungsmethoden konnten die Verheerungen der Körper nicht unsichtbar machen, und am unmittelbarsten zeigten sie sich in verwundeten Gesichtern. Wobei man in vielen Fällen eher von Zerfleischungen sprechen sollte, denn der Granaten- und der Gaseinsatz hinterließen bislang unbekannte Zerstörungen – unbekannt nicht deshalb, weil es sie vorher nicht gegeben hätte, sondern weil die Opfer nun medizinisch gerettet werden konnten. Niemand vermochte es, sie und die Menschen, die ihnen begegneten, vor dem Schock ihres Anblicks zu bewahren.
Diese zerstörten Gesichter prägten die Ikonographie des Nachkriegs, vor allem nachdem 1924 das Buch «Krieg dem Kriege!» des deutschen Pazifisten Ernst Friedrich erschienen war. Friedrich hatte sich 1914 als damals Zwanzigjähriger der Einberufung zum deutschen Heer verweigert und war erst als geisteskrank eingestuft und 1917 schließlich zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden. Sein Buch machte Furore: Den einen galt es als unübertreffliche Anklage gegen die Schrecken der modernen Kriegsführung, den anderen als geschmacklose Instrumentalisierung des Leidens heroischer Soldaten. Der Bildband verzichtete weitgehend auf Text – eine Ausnahme war das kurze Vorwort unter dem Titel «Menschen aller Länder» – und reihte auf zweihundert Seiten Fotos und einzelne Zeichnungen aneinander. Sie zeigten Schlachtszenen und auch fünfundzwanzig aufeinanderfolgende Porträtaufnahmen schrecklich verstümmelter Gesichter.
Friedrich verwendete die Methode von Goyas ein Jahrhundert zuvor entstandenem Radierungszyklus «Desastres de la guerra» (Schrecken des Krieges) und fügte jeder Abbildung einen lapidar formulierten Untertitel hinzu, manchmal nur ein Wort, dann wieder einen ganzen Satz und bisweilen auch die Namen der abgebildeten Kriegsopfer. Unter dem berühmten Foto, das einen aus dem Schützengraben heranstürmenden gasmaskenbewehrten Soldaten zeigt, hieß es: «Das ‹Ebenbild Gottes› mit Gasmaske». Friedrichs Werk bezog wie Goyas Radierungen Stellung durch Augenzeugenschaft, wobei im Falle der fotografischen Bilddokumentation «Krieg dem Kriege!» die Kamera an die Stelle des Autors trat, der als erst psychiatrisierter und dann inhaftierter Kriegsdienstverweigerer nicht mehr vom Krieg hatte sehen können als die Folgen des Schlachtens, wie sie sich im Alltag darboten. Damit ging es ihm wie der Mehrheit der Menschen in den kriegführenden Staaten, und deshalb war die Wirkung der zerstörten Gesichter so stark: Sie stellten nun den Erfahrungshintergrund aller dar.
«Krieg dem Kriege!» bot seine knappen Texte in vier Sprachen dar – Deutsch, Französisch, Englisch und Niederländisch –, wurde in den Folgejahren aber noch in fünfzig weitere übersetzt und fand so weltweit Verbreitung. 1926 erschien ein zweiter Band der gleichen Machart mit neuen Aufnahmen, der allerdings im Schatten der Originalausgabe blieb. Das Buch trug dazu bei, dass auch in Staaten, die nicht selbst am Kampfgeschehen beteiligt gewesen waren, die verheerenden Auswirkungen bekannt wurden. Neben den Fotos von zerstörten Gesichtern fanden sich auch solche von Überlebenden in ersichtlich zerrüttetem Geisteszustand, zu denen Friedrich bisweilen berühmte Sätze deutscher Militärs als Begleittexte setzte, etwa Hindenburgs Ausspruch «Der Krieg bekommt mir wie eine Badekur». Auf der gegenüberliegenden Seite stand dann unter einem weiteren zerstörten Gesicht: «Die Badekur des Proleten».[8] Auch die Behauptung des früheren preußischen Generalstabschefs Helmuth von Moltke «Die edelsten Tugenden des Menschen entfalten sich im Krieg» griff Friedrich auf.[9] Vor allem deutsche Veteranenverbände warfen dem Buch deshalb Zynismus vor.
Ernst Friedrichs Bildband war aber nur das bekannteste Beispiel der öffentlichen Instrumentalisierung von Kriegsversehrten. Es gab durchaus auch nationalistische und militaristische Beispiele, die weitaus früher erschienen, nämlich noch während des Kriegs. Die ersten acht Fotos von schwer am Gesicht verwundeten Soldaten druckte die deutsche Zeitschrift «Die Umschau» bereits im Februar 1916. «Zu medizinischen Zwecken wurden (…) Fotografien von Gesichtsverletzten veröffentlicht, die die hervorragenden Methoden moderner Gesichts- und Kieferchirurgie demonstrieren sollten. Der Kontext jedoch maß den Bildern jeweils den Rang des Singulären zu, gepaart mit einem Versprechen: Mit den Möglichkeiten des wissenschaftlich voll auf der Höhe befindlichen Kaiserreichs – ergo mit plastischer Chirurgie, sozialer Wiedereingliederung, Orthotechnik – ist die Situation für die Betroffenen gut zu meistern.»[10] Als nach dem Waffenstillstand die Pressezensur aufgehoben wurde, ergab sich aber auch die Möglichkeit, solche Motive für antimilitärische Zwecke einzusetzen. Und durch die Verbreitung der Amateurfotografie verfügten die Kriegsteilnehmer über reiches Bildmaterial. Viele führten auch Skizzenbücher, in denen sie ihre Beobachtungen festhielten.
Gerade Otto Dix, der im Gegensatz zu Friedrich vier Jahre lang selbst im Feld gestanden hatte und dort traumatisiert worden war, wählte immer wieder die Schreckensmotive, die er während der Wartezeiten im Schützengraben in zahlreichen Kreidezeichnungen und Gouachen festgehalten hatte, als Material für seine späteren Bilder. Ebenfalls 1924 – kein Zufall, denn die internationale pazifistische Bewegung hatte anlässlich der zehnten Wiederkehr des Kriegsausbruchs ein «Anti-Kriegs-Jahr» ausgerufen – brachte er seine fünfzigteilige Graphikfolge «Der Krieg» heraus, in der das Krepieren an der Front genauso Thema war wie die Langzeitfolgen der Verwundungen. Auch Dix bezog sich in den Titeln der einzelnen Motive auf Goyas Vorbild, wenn er etwa eine Radierung mit grässlich zugerichteten Soldaten einfach mit «Gesehen am Steilhang von Cléry-sur-Somme» unterschrieb. Aus diesem Zyklus wanderten vor allem die versehrten Gesichter als besonders verstörende Motive in die großen Tafelbilder, die Dix in den zwanziger Jahren malte: in den seit 1940 verschollenen «Schützengraben», ins Dresdner Triptychon «Der Krieg» und eben auch in dessen Stuttgarter Äquivalent, das die Auswirkungen des Gemetzels auf das spätere Alltagsleben in den Städten zeigte.
Vorbereitet worden war diese Faszination für deformierte Menschen schon vorher: durch die Freakshows, die sich während der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in den Vereinigten Staaten und Großbritannien zu Jahrmarktsattraktionen entwickelt und damit das zuvor feudale Privileg der schaudernden Ergötzung an Missbildungen, wie es etwa am Beispiel der sogenannten Hofzwerge belegt ist, demokratisiert hatten. Dass der Krieg dann aber auch die Verunstaltung selbst demokratisieren würde, war nicht absehbar gewesen. Die propagandistische Wirkung der Abbildungen war umso größer, als es sich in der öffentlichen Wahrnehmung bislang um ein Minderheitenphänomen bedauernswerter Kreaturen gehandelt hatte, eine Laune der Natur; nun hatte man es mit einem Massenphänomen zu tun, einer Folge bewussten Handelns. Durch die Präsenz der Kriegsversehrten auf der Straße und im neuen Zeitalter medialer Massenreproduktion wurden die Verunstaltungen überdies zu einem sichtbar objektiven Tatbestand, während sich ihre Vorstellung zuvor nur durch mündliche Berichte von Freakshow-Besuchern verbreitet hatte. Trotzdem blieb etwas von der älteren bildlosen Kommunikation der Deformation erhalten, weil die damit einhergehende Betonung des Unvorstellbaren so leicht instrumentalisiert werden konnte – sogar noch nach 1918, nicht nur durch die Gegner des Kriegs, sondern auch durch seine Befürworter. Die drastische französische Selbstbezeichnung der schwer im Gesicht Verwundeten als «Gueules cassées» etwa war nicht pazifistisch motiviert, sondern nationalistisch und somit kriegsbejahend.
Die Entstehung dieses Ausdrucks wird anekdotisch erklärt. Im Januar 1917 war der damals vierunddreißigjährige Oberleutnant Yves Picot als Kommandant eines Infanterieregiments an der Westfront schwer im Gesicht verwundet worden; er hatte dabei ein Auge verloren. Zu Operation und langwieriger Rekonvaleszenz kam er in das Hospital von Val-de-Grâce, das mitten in Paris gelegene Zentralkrankenhaus der französischen Armee. Mit verbundenem Gesicht soll sich der mittlerweile zum Oberst beförderte Picot noch während der Kriegszeit eines Abends zur nahen Sorbonne-Universität aufgemacht haben, wo eine patriotische Feier veranstaltet wurde. Doch ohne Einladung wollte man ihn nicht hineinlassen, obwohl sich Picot als Offizier ausweisen konnte und seine Verwundung offensichtlich war. Ein Neuankömmling drängte ihn schließlich beiseite, zog eine Visitenkarte hervor und rief dem Kontrolleur lediglich das Wort «député» zu, wies sich also als Abgeordneter der ebenfalls nicht weit entfernt gelegenen Nationalversammlung aus. Daraufhin soll Picot seinerseits eine Visitenkarte gezückt und sich selbst als «gueule cassée» vorgestellt haben – silbengleich und ähnlich klingend wie «député». Niemand traute sich jetzt noch, ihn aufzuhalten, und die despektierliche Bezeichnung etablierte sich als Ehrentitel. Als 1921 in Frankreich die «Union des Blessés de la Face et de la Tête», also die Interessenvertretung der an Gesicht und Kopf Verletzten, gegründet wurde, trug man Picot die Präsidentschaft an, die er auch übernahm. Fortan trat die Vereinigung in der Öffentlichkeit vor allem als «Union des Gueules Cassées» auf.
Richtig populär wurde der Ausdruck mit der Unterzeichnung des Versailler Vertrags. Was der Historiker Gerd Krumeich dem Buch «Krieg dem Kriege!» pauschal zuschreibt, nämlich den «Vorhang weggerissen zu haben vor dem bestgehüteten Unsagbaren des Ersten Weltkrieges»[11], geschah zumindest in Frankreich schon fünf Jahre früher, und zwar auf denkbar affirmative Weise. Am 28. Juni 1919 sollten im Spiegelsaal von Versailles fünf Schwerverwundete eine wichtige symbolische Rolle spielen und ins Bildgedächtnis der Nation eingehen: «Bevor man die deutsche Delegation in den Saal führte», schreibt Jörn Leonhard, «wurden fünf an ihren Gesichtern schwer verletzte französische Soldaten in der Nähe des Tisches platziert, an dem die deutschen Politiker ohne jede Aussprache die Dokumente zu unterzeichnen hatten. Der französische Ministerpräsident Clemenceau unterstrich diese Geste noch, indem er den cinq gueules cassées vor Beginn der eigentlichen Vertragsunterzeichnung (…) die Hände schüttelte. Auf Hunderttausenden von Bildpostkarten sollten die fünf Soldaten nach dem Friedensschluss zum Symbol der französischen Opfer werden.»[12]
So sahen Sieger aus: eine der Propagandapostkarten, die nach dem Friedensschluss von Versailles in ganz Frankreich in Umlauf kamen. Das Foto zeigt die fünf im Spiegelsaal anwesenden «Gueules cassées»: André Cavalier, Pierre Richard, Eugène Hébert, Henri Agogué und Albert Jugon (v.l.n.r.).
Die fünf Soldaten hatte Clemenceau persönlich für die Zeremonie angefordert. Es war ihm ein besonderes Anliegen, die deutsche Schuld hervorzuheben, indem er nicht nur auf die Toten des Weltkriegs hinwies, sondern auch auf die noch zahlreicheren Verwundeten. Bereits sieben Wochen zuvor, bei der Übergabe der alliierten Friedensbedingungen an die deutsche Delegation, hatte Clemenceau als Vorsitzender auch dieser Zeremonie ausgeführt: «Das Verhalten Deutschlands ist in der Geschichte der Menschheit fast beispiellos. Die schreckliche Verantwortung, die auf ihm lastet, lässt sich in der Tatsache zusammenfassen, dass wenigstens sieben Millionen Tote in Europa begraben liegen, während mehr als zwanzig Millionen Lebender durch ihre Wunden und ihre Leiden von der Tatsache Zeugnis ablegen, dass Deutschland durch den Krieg seine Leidenschaft für die Tyrannei hat befriedigen wollen.»[13] An diese Worte sollte nun beim Abschluss des Friedens durch die Anwesenheit der fünf Versehrten protokollarisch erinnert werden. Sie kamen zusammen mit fünfundzwanzig weiteren französischen Kriegsteilnehmern, die ebenfalls kurzfristig auf Clemenceaus Geheiß teilnehmen durften – niemand sonst in Frankreich hatte zuvor daran gedacht, auch gewöhnliche Soldaten zur feierlichen Vertragsunterzeichnung einzuladen,[14] während England und Amerika jeweils fünfzehn ihrer im Krieg aktiv gewesenen Kämpfer hinzubaten. Das waren die einzigen «normalen» Bürger im Saal unter all den Delegierten, Offizieren, Berichterstattern und Vertretern der feinen Pariser Gesellschaft. Dass es sich auch bei den französischen Versehrten nicht um hohe Offiziere handelte, hatte Clemenceau sichergestellt, indem er sich ausdrücklich Träger der Médaille militaire gewünscht hatte, einer hohen Auszeichnung, die nur an Unteroffiziere oder gemeine Soldaten verliehen werden konnte.[15] Der Militärgouverneur von Paris hatte sich deshalb am Vortag auf Geheiß des Ministerpräsidenten an das Hospital Val-de-Grâce gewandt, wo schon Picot operiert worden war. Zweihundert Männer waren dort sieben Monate nach Ende der Kämpfe immer noch in Behandlung wegen ihrer Gesichtsverletzungen, und aus ihren Reihen stammten jene fünf, die am nächsten Tag nach Versailles gebracht wurden: Albert Jugon, Eugène Hébert, Henri Agogué, Pierre Richard und André Cavalier.
Jugon war schon seit fast fünf Jahren in Val-de-Grâce und mittlerweile nicht mehr nur Patient, sondern auch in der Verwaltung tätig; er war gleich zu Beginn des Kriegs im September 1914 als Angehöriger eines Infanterieregiments bei einem Granateneinschlag verwundet worden, seitdem fehlte ihm ein Großteil des Gesichts und der Kehle. Da er sich so lange im Krankenhaus aufhielt, wurde er zum Vertrauten sämtlicher ähnlich schlimm zugerichteten Patienten, und so überließ ihm das Hospital die Auswahl der anderen vier Gueules cassées. Hébert war ein Jugendfreund von Jugon; die beiden hatten sich im Krankenhaus wiedergetroffen, nachdem Hébert ebenfalls als Soldat eines Infanterieregiments verwundet worden war. Agogué und Richard hatten jeweils Jägerbataillonen angehört, und Cavalier war als Mitglied des Eliteregiments der Zouaven verwundet worden – auch schon vor vier Jahren. Sie alle waren in Val-de-Grâce von dem berühmten Mediziner Hippolyte Morestin behandelt worden, der sich während des Kriegs auf plastische Gesichtschirurgie spezialisiert hatte, aber im Februar 1919 gestorben war. Jugon war der Primus inter Pares unter den fünf Verwundeten; seine Teilnahme an der Unterzeichnung des Vertrags machte ihn so bekannt, dass er zwei Jahre später mit einem Leidensgenossen die Union des Gueules Cassées gründen konnte.
Das Quintett nahm im Spiegelsaal einen herausgehobenen Platz ein: Die fünf Männer besetzten die mittlere Fensternische gleich hinter dem Schreibtisch, an dem die Delegierten der beteiligten Staaten das Vertragswerk nacheinander unterzeichnen sollten. Gegenüber, vor der Spiegelfront des Saals, saßen die Vertreter der fünf alliierten Hauptmächte, die zusammen mit den jeweils Unterzeichnenden und den fünf Gueules cassées die zentrale Achse des gesamten Geschehens bildeten. Clemenceau wollte mit den Schwerverwundeten, die eigens angewiesen worden waren, ihre Orden anzulegen, das Ausmaß der Opfer Frankreichs sichtbar machen, das nun endlich Kompensation erfahren sollte. Zugleich sollte die Platzierung genau gegenüber den Hauptmächtevertretern auch die eigenen Verbündeten daran erinnern, welches Land den höchsten Preis für den gemeinsamen Sieg gezahlt hatte. Der Versailler Vertrag entsprach in seinen Konsequenzen keineswegs den Erwartungen Frankreichs, und so sollten die entstellten Menschen gar nicht einmal vorrangig bei den Deutschen, sondern auch bei den aus Clemenceaus Sicht uneinsichtigen Alliierten für ein schlechtes Gewissen sorgen.
Auf Anweisung des Ministerpräsidenten hatten die Gueules cassées bereits mehr als eine Stunde vor dem Eintritt der deutschen Delegation ihre Plätze eingenommen, sodass Clemenceau selbst, als er den Saal betrat, auf sie zugehen und ihnen für ihre Teilnahme danken konnte. Nach den Erinnerungen der Versehrten sagte er dabei: «Man sieht zweifellos, dass ihr in einer schlimmen Gegend wart. Frankreich, das ich heute repräsentiere, grüßt in euch die Männer, die mit ihrem Blut für den Sieg bezahlt haben. Die heutige Zeremonie ist der Beginn einer Entschädigung. Das ist nicht alles, es wird noch mehr geben, das versichere ich euch.»[16] Damit machte der Vorsitzende im Spiegelsaal schon vor dem eigentlichen Beginn der Zeremonie ihren Zweck deutlich: Kompensation seitens der Deutschen für die Schrecken und auch die Kosten des Krieges.
Andererseits hatte Clemenceau diese Worte nicht so laut gesprochen, dass sie außer den Angeredeten noch sonst jemand aus der unruhig wartenden Gesellschaft gehört hätte. Tatsächlich war im riesigen und vollbesetzten Spiegelsaal jeder sichtbare Akt besser dazu geeignet, von den Teilnehmern wahrgenommen zu werden, als eine mündliche Äußerung. Lautsprecherverstärkung gab es noch nicht, abseits des zentralen Bereichs rund um den Unterzeichnungstisch war für die Anwesenden kaum mehr etwas zu verstehen. Deshalb brachte Albert Jugon als Sprecher der Versehrtengruppe die Sache auf den Punkt, als er nach der Zeremonie gegenüber einem Reporter feststellte: «Indem die französische Regierung uns ausgewählt hat, demonstrierte sie ihren Willen, den deutschen Delegierten die schmerzhaften Konsequenzen des Krieges zu demonstrieren, den sie verschuldet haben. Zugleich demonstrierte sie, dass der Friede, den wir feiern, teuer bezahlt wurde. Als wir die deutschen Delegierten sahen, wie sie sich in diesem grandiosen Saal, wo so viele ruhmreiche Seiten unserer Geschichte geschrieben wurden, herunterbeugten, um die Niederlage ihres Landes zu besiegeln, vergaßen wir alles Elend der Vergangenheit, und unser Herz schwoll an von einer Freude, die kaum zu bewältigen war und an der wir in Gedanken all unsere Brüder teilnehmen ließen, die auf dem Feld der Ehre gefallen waren.»[17] Die Präsenz der fünf Gueules cassées war ein hochsymbolischer Akt, mit dem im wörtlichen Sinne ersichtlich der Beweis dafür erbracht wurde, dass die den Deutschen abverlangten materiellen Opfer legitimiert waren durch die physischen Verluste der Franzosen.
Aber haben das die Deutschen genauso gesehen? Oder präziser: Haben sie im großen Gesamtspektakel der Vertragsunterzeichnung überhaupt etwas von dieser symbolischen Teilinszenierung mitbekommen? Interessanterweise existiert keine einzige zeitgenössische deutsche Quelle, die zur Anwesenheit der fünf Versehrten Auskunft gibt, und in den Erinnerungen der – wenigen – Deutschen, die im Spiegelsaal dabei waren, gibt es keinen Hinweis darauf, dass die Veteranen von jenen bemerkt worden wären, denen sie doch Schuldgefühle bereiten sollten. Schon Jugon hatte ja nach der Zeremonie nur vom eigenen Blick auf die Deutschen gesprochen, nicht von einer Erwiderung dieses Blicks. Es mag sein, dass Clemenceau auf die Überraschung durch den erschreckenden Anblick spekuliert hatte, doch wenn dem so gewesen sein sollte, hatte er sich getäuscht. Als die beiden Minister Hermann Müller und Johannes Bell als bevollmächtigte Vertreter des Reichs durch den Saal zu ihren Sitzplätzen schritten, wird ihre Aufmerksamkeit auf die wartenden Vertreter der Hauptsiegermächte gerichtet gewesen sein, die vor dem mittleren Spiegel der Galerie saßen: auf Clemenceau, Woodrow Wilson, David Lloyd George und Sidney Sonnino.
Die Versehrten in ihrer Fensternische standen also metaphorisch gesprochen im Schatten der vertretenen Prominenz. Zugleich standen sie aber ganz konkret im Licht, nämlich vor der in den sich nach Nordwesten öffnenden Saal einfallenden Nachmittagssonne, sodass es doppelt schwierig war, die Verwundeten zu sehen, zumal für zwei Diplomaten, die gleich die schwerste Pflicht ihrer Laufbahn zu absolvieren haben würden. Auch als die beiden Deutschen als Erste von ihren Plätzen zum Unterzeichnungstisch schritten, werden sie die fünf versehrten Soldaten im Gegenlicht nicht als solche erkannt haben. Beim Unterschreiben des Vertrags selbst wendeten sie ihnen ohnehin gezwungenermaßen den Rücken zu, weil der Stuhl für den jeweils Unterzeichnenden so aufgestellt war, dass dieser den alliierten Regierungsvertretern gegenübersaß. So schrecklich die zerstörten Gesichter waren, so wenig Wirkung konnten sie auf die Deutschen machen.
Dabei waren vielleicht sogar mehr Schwerverwundete als nur die fünf namentlich bekannten Gueules cassées im Saal, denn einige französische Quellen sprechen von bis zu dreizehn anwesenden Versehrten.[18] Im Gedächtnis der Nation aber bleiben diese fünf mit ihren Gesichtsverletzungen; nur sie wurden fotografisch festgehalten – abseits der Zeremonie, unter deren Aufnahmen durch die zugelassenen Fotografen und auch Kameramänner sich die fünf Veteranen nicht finden –, und es war dieses außerhalb des Spiegelsaals entstandene Lichtbild von fünf entsetzlich entstellten Menschen, das in den Folgejahren immer wieder zu Propagandazwecken in Frankreich reproduziert und verteilt wurde. Lange bevor Ernst Friedrichs «Krieg dem Kriege!» erschien oder Otto Dix seine Kriegsbilder malte, waren die Franzosen also mit diesem Antlitz des Kampfgeschehens vertraut. Sie sahen darin ein vaterländisches Opfer für den Sieg, dem man Dank schuldete.
In Deutschland dagegen erinnerte jedes zerstörte Gesicht an die Demütigung des verlorenen Kriegs. Niemand empfand dabei Dankbarkeit, und diese Gefühllosigkeit war das große Thema von Otto Dix. Er sah den Krieg als das grundlegend Böse, den Soldaten darin aber durchaus als Helden. «Der Krieg», so sagte er noch mehr als vierzig Jahre später, 1961, in einem Interview anlässlich seines siebzigsten Geburtstags, «ist eben etwas so Viehmäßiges: Hunger, Läuse, Schlamm, diese wahnsinnigen Geräusche. Ist eben alles anders. Sehen Sie, ich habe von den früheren Bildern das Gefühl gehabt, eine Seite der Wirklichkeit sei noch gar nicht dargestellt: das Hässliche. Der Krieg war eine scheußliche Sache, aber trotzdem etwas Gewaltiges. Das durfte ich auf keinen Fall versäumen! Man muß den Menschen in diesem entfesselten Zustand gesehen haben, um etwas über den Menschen zu wissen.»[19] Was der Maschinengewehrschütze Dix, der im September 1914 als Zweiundzwanzigjähriger in den Krieg gezogen und bis zu dessen letztem Tag, dann als Vizefeldwebel, an West-, Ost- und schließlich wieder Westfront im Einsatz gewesen war, dabei über den Menschen gelernt hatte, das war das Thema seiner Versehrtenbilder.
Eines der ersten dieser Werke war 1920 das noch cartoonartige, im Stil von George Grosz gehaltene großformatige Gemälde «Kriegskrüppel», das vier grässlich amputierte und anderweitig entstellte verwundete Heimkehrer in einer deutschen Einkaufsstraße zeigte. Dix stellte es im selben Jahr auf der «Ersten Internationalen Dada-Messe» in Berlin aus, anschließend setzte er seine thematische Beschäftigung mit weiteren Bildern fort, in denen er die elende Situation von Schwerverwundeten nach ihrer Rückkehr in die besiegte Heimat darstellte. Noch 1920 begann er mit dem monumentalen «Schützengraben», das erst 1923 beendet werden sollte, sein erstes Gemälde in einem drastischen Realismus, der nun die Fronterlebnisse selbst zum Gegenstand machte. Darin gab es nichts Groteskes mehr, nur noch nackten Horror: In seiner apokalyptischen Szenerie kehrte Dix das Innerste der Körper nach außen, ließ Köpfe aufplatzen und verrenkte Glieder aus Leichenhaufen ragen. Dafür skizzierte er anatomisch genau menschliche Gehirne, und er besuchte deutsche Gueules cassées, die noch immer in Hospitälern behandelt wurden, um Porträts von ihnen anzufertigen.
Drastik à la Dix: Sein monumentales Gemälde «Schützengraben» machte den Maler 1923 berühmt und bei der politischen Rechten berüchtigt. Von den Nationalsozialisten wurde es als Musterbeispiel «entarteter Kunst» denunziert und aus der Dresdner Gemäldegalerie entfernt. Seit 1940 ist es verschollen.
Doch schon zu Kriegszeiten hatte Dix in den Lazaretten Verwundete gesehen und mutmaßlich ebenso skizziert wie die Leichen von Gefallenen an der Front. In seinem Radierungszyklus «Der Krieg» gibt es konkrete Bezeichnungen der dargestellten Toten und Verletzten, die auf Selbsterlebtes verweisen. Aber es findet sich in der Graphikfolge auch ein Blatt wie «Transplantation», für das Dix eines jener Fotos von Schwerverwundeten zum Vorbild nahm, wie sie im selben Jahr auch Friedrich für sein Buch «Krieg dem Kriege!» verwendet hatte. Das «Großstadt»-Triptychon von 1927 führte dann das Schreckenspanoptikum wieder mit dem Satirisch-Grotesken der ersten Versehrtenbilder zusammen – als bitterer Kommentar auf die Selbstzufriedenheit einer Republik, die doch auf dem Blutzoll der Soldaten begründet worden war.
Sinnvoll hätte dieser Blutzoll in Dix’ Augen nur dann genannt werden können, wenn man der Opfer gedacht hätte. Doch während in jeder deutschen Gemeinde Kriegerdenkmäler für die Toten errichtet wurden, die den Opfertod heroisierten, fanden sich die entstellten Überlebenden unbeachtet am Rande der Gesellschaft wieder. Das nahmen Dix und mit ihm andere Künstler wie Grosz oder Max Beckmann auf. In Frankreich dagegen machte allein der Illustrator Gus Bofa, der wie Otto Dix lange im Krieg gekämpft hatte, in den zwanziger Jahren das Elend der Versehrten zum Gegenstand. Doch im Vergleich zu den verkrüppelten deutschen Soldaten genossen die französischen hohes Ansehen, denn sie waren zumindest alle Sieger. Die von Livius überlieferte klassische Floskel «Vae victis» (Wehe den Besiegten) fand im Land der Besiegten selbst ihre unbarmherzigste Bestätigung.
Erster TeilDie deutsche Verzweiflung
1. Vorgeschmack auf Versailles:Der Weg zum Waffenstillstand
Kein Frieden ohne Waffenstillstand. Aber an den dachten im Sommer 1918 im Deutschen Reich nur wenige. Der Frieden schien wieder erkämpfbar: Seit man im Osten den Krieg siegreich beendet hatte, war ein Kollaps im Westen anscheinend nicht mehr zu befürchten, denn nun konnte man doch alle Kraft hier konzentrieren; man richtete sich also auf eine lange Fortdauer der Kämpfe ein. In den besetzten Gebieten hinter der Westfront wurden sogar Katheder an den Universitäten provisorisch mit treudeutschen Wissenschaftlern besetzt, so im belgischen Gent der romanistische Lehrstuhl mit Victor Klemperer; es war der erste Ruf für den späteren Star seiner Zunft, wenn man von einer kurzfristigen Lektorenstelle in Neapel absieht, die Klemperer aber 1915 durch den italienischen Kriegseintritt auf Seiten der Alliierten wieder eingebüßt hatte. Den Genter Posten sollte er allerdings gar nicht erst antreten können.
Klemperer, sechsunddreißig Jahre alt, war Unteroffizier, wenn auch nur im Einsatz beim Buchprüfungsamt Ober-Ost, also als Zensor in der Etappe, und das noch nicht einmal an der seit dem russischen Ersuchen um Waffenstillstand friedlichen Ostfront, sondern in der Deutschen Bücherei in Leipzig. Trotzdem wollte er weg und endlich akademische Karriere machen. Die ausgeschriebene Position in Gent war «auf Kriegsdauer» befristet. Doch das reichte Klemperer im Frühjahr 1918, zumal er von einem Kollegen gehört hatte, «diese flämische Universität sei ein Lieblingskind der deutschen Regierung, ich dürfte mich dort als Ordinarius betrachten, ich würde, falls ich nach Friedensschluss nicht dableiben könnte, fraglos durch ein deutsches Katheder entschädigt».[1] So rasch aber, da war sich Klemperer damals ebenso sicher wie die Mehrzahl seiner Landsleute, würde der Krieg nicht enden, die Aufnahme der Vorlesungen wurde ihm für Mitte November 1918 in Aussicht gestellt. Als ein Freund ihm vorhielt, er werde sich damit zum Werkzeug der deutschen Unterdrückung Belgiens machen, hielt Klemperer dem entgegen: «Ich werde in französischer Sprache über französische Literatur lesen, nennst du das Unterdrückung? Glaubst du, die Franzosen, wenn sie heute die Hand auf Heidelberg legten, würden dort mitten im Kriege deutsche Vorträge über deutsche Literatur halten lassen?»[2]
Dennoch sah Klemperer seine Felle davonschwimmen, als er am 29. September in München, wohin er nach Genehmigung eines Sonderurlaubs aus Leipzig gereist war, um sich die Berufung bestätigen zu lassen – Klemperer war Angehöriger der bayerischen Armee, und die akademische Germanisierung der Genter Universität galt als Lieblingsprojekt des bayerischen Kronprinzen –, einen Leitartikel der «Münchner Neuesten Nachrichten» las. Darin wurde nicht nur erwähnt, dass Bulgarien um Waffenstillstand gebeten hatte und bereits aus dem Krieg ausgeschieden war, sondern auch, dass die angeblich unerschütterliche deutsche «Siegfriedstellung», auf die man sich an der Westfront erst kürzlich zurückgezogen hatte, von den Alliierten durchbrochen worden war. Wenn solche Fakten die deutsche Zensur passieren konnten, das wusste der deutsche Zensor Klemperer besser als jeder andere, war das gewollt: Die Reichsbevölkerung sollte offenbar auf eine Niederlage vorbereitet werden.
Anfang November wurde Klemperer dann ins ehemals russische Wilna abgeordnet, wo die deutsche Besatzungsmacht sich in der prekären Lage befand, zwischen gleich zwei Unabhängigkeitsbewegungen agieren zu müssen, der litauischen und der polnischen. Am 16. November, sechs Tage nachdem die Nachricht von den Waffenstillstandsverhandlungen in Compiègne dort eingetroffen war, bekam Klemperer einen Bescheid des königlich-bayerischen Kriegsministeriums, dass er aus kriegswichtigem Grunde nicht für Gent freigegeben werde. Das war im doppelten Sinne ein Schildbürgerstreich der militärischen Bürokratie, denn zum einen war der Krieg mittlerweile faktisch verloren und Klemperer also durchaus abkömmlich, zum anderen suggerierte die Mitteilung, dass man über Gent noch verfügen könnte, obwohl die deutsche Armee bereits dabei war, Belgien zu räumen. Bayern war zudem schon Freistaat, das königliche Kriegsministerium bestand also überhaupt nicht mehr. Klemperer begab sich zurück nach München, um dort trotz nicht erfolgter Berufung auf die erhoffte «Entschädigung durch ein deutsches Katheder» hinzuarbeiten. In der bayerischen Hauptstadt wurde er dann im Winter 1918/19 zum Beobachter der revolutionären Nachwehen bis zur Ausrufung der Räterepublik. Aber das ist eine andere Geschichte, die erst später erzählt werden soll.
Typisch an Klemperers Einzelschicksal ist die Fassungslosigkeit angesichts des Umschlags von Siegesgewissheit in Fatalismus binnen jener gerade einmal sechs Wochen von Ende September bis Anfang November. Und sie herrschte eben nicht nur in der durch die zensierte Presseberichterstattung auf Siegeszuversicht eingestimmten deutschen Zivilbevölkerung, sondern auch auf den höchsten Ebenen des Militärs. Eine Ausnahme bildete nur die Oberste Heeresleitung (OHL) selbst, die am 29. September die Reichsregierung aufgefordert hatte, unverzüglich Friedensverhandlungen mit den alliierten Gegnern aufzunehmen, weil der Zusammenbruch der Westfront drohe: Binnen vierundzwanzig Stunden müssten die Waffen schweigen, um das Schlimmste zu verhüten. Das widersprach allen bis dahin verkündeten Durchhalte-, ja Siegesparolen, mit denen man seit dem Friedensschluss von Brest-Litowsk auch die vordem Skeptischen im Reich wieder zuversichtlich gestimmt hatte. Arg verspätet schien der Schlieffen-Plan ja doch noch aufzugehen, wenn auch seitenverkehrt: Sieg im Osten, um nun alle Kräfte an die Front im Westen werfen zu können. Aber «alle Kräfte» bedeutete 1918 nicht mehr viel, denn nach vier Jahren Kriegsführung waren die deutschen Ressourcen erschöpft – industriell, finanziell und vor allem personell. Die Gegenseite hatte sich dagegen seit dem amerikanischen Kriegseintritt im Vorjahr in allen diesen Bereichen erholt. Dadurch war das Ausscheiden des noch stärker als Deutschland ausgelaugten Russland aus dem feindlichen Entente-Bündnis mehr als überkompensiert worden. Wenn überhaupt deutsche Soldaten im Osten – wo es jetzt ein riesiges besetztes Gebiet zu kontrollieren galt – frei geworden waren, dann trafen sie im Westen auf einen frisch verstärkten, neu motivierten und vor allem neu munitionierten Gegner.
Die letzte große deutsche Offensive scheiterte im Spätsommer 1918, das nicht mit Berlin abgestimmte österreichische Friedensersuchen vom 13. September signalisierte den baldigen Ausfall des wichtigsten Verbündeten. Zwei Tage später brach die von Bulgarien gehaltene Balkanfront unter dem Ansturm alliierter Soldaten zusammen, und angesichts des militärischen Fiaskos bat auch dieser Verbündete am 27. September die Entente um Frieden. Im Westen verteidigten sich die Deutschen zu Tode, während im Süden und Südosten neue Fronten zu entstehen drohten – der freie Durchmarsch alliierter Truppen nach Deutschland war eine der Friedensbedingungen an Österreich –, wenn man die Kriegsführung alleine weiter aufrechterhalten wollte. Die Oberste Heeresleitung wusste, dass das nunmehr unmöglich sein würde.
Zwei Jahre zuvor, im August 1916, als sich das Konzept des vom bisherigen deutschen Generalstabschef Erich von Falkenhayn entwickelten Abnutzungskriegs mit der bereits monatelang erfolglos geführten Schlacht um Verdun als gescheitert erwiesen hatte, war mit Paul von Hindenburg ein Veteran an die Spitze der deutschen Truppen gestellt worden. Der 1847 geborene Offizier hatte als Kommandierender der 8. Armee im Spätsommer 1914 den russischen Vormarsch nach Ostpreußen stoppen können und war deshalb nicht nur zum Generalfeldmarschall ernannt, sondern in der Bevölkerung zum Mythos erhoben worden: als einziger eindeutiger deutscher Sieger im Weltkrieg. Bereits damals hatte ihm als Generalmajor der fast zwanzig Jahre jüngere bürgerliche Offizier Erich Ludendorff zur Seite gestanden, der für die strategischen Entscheidungen verantwortlich war. Als Hindenburg 1916 den Posten des Generalstabschefs von Falkenhayn übernehmen sollte, machte er zur Bedingung, dass Ludendorff zu seinem Stellvertreter und zum «Ersten Generalquartiermeister» ernannt würde. Diese Position war neu und deshalb unbestimmt; faktisch machte sie Ludendorff zum Oberkommandierenden. De jure kam diese Aufgabe im Deutschen Reich zwar dem Kaiser zu, aber weder traute die Heeresspitze Wilhelm II. ihre Erfüllung zu, noch hatte der Monarch selbst in den ersten beiden Kriegsjahren Willen zur ernsthaften Einflussnahme bewiesen, trotz markiger Randbemerkungen in den ihm vorgelegten Akten. Da auch Hindenburg mehr symbolischer als praktischer Generalstabschef war, lagen Planung und Führung des Kriegs auf deutscher Seite nun in den Händen von Erich Ludendorff. Der Kaiser pochte zwar in Privatgesprächen auf seine verfassungsmäßige Rolle als Oberbefehlshaber – so etwa am 8. Januar 1918 gegenüber dem Chef des Marinekabinetts, Georg Alexander von Müller: «Als ob ich nicht die Oberste Heeresleitung wäre! Ich werde aber versuchen, diesen unglücklichen Begriff ‹Oberste Heeresleitung› wieder zu beseitigen!»[3] –, angesichts der beiden auch ihm gegenüber dreist auftretenden Offiziere hatte er jedoch nichts zu bestellen.
Die erhofften Architekten des deutschen Sieges in den Ruinen der Schlacht bei Tannenberg vom Spätsommer 1914: Dritter von rechts ist der damalige Generaloberst Paul von Hindenburg, links von ihm steht sein Stabschef Erich Ludendorff. Ihr Ruhm aus der frühen Kriegszeit brachte den beiden Offizieren 1916 die Oberste Heeresleitung ein, die sie diktatorisch ausübten.
Die Oberste Heeresleitung hieß zwar schon früher so, doch erst jetzt, mit der dritten ihrer Art im Weltkrieg, setzte sich der Begriff auch in der Bevölkerung durch. Das war das Resultat der nach außen hin behaupteten kooperativen Verantwortlichkeit von Hindenburg und Ludendorff, während sich zuvor alle öffentliche Aufmerksamkeit auf die jeweiligen Generalstabschefs, zunächst Helmuth von Moltke der Jüngere und dann Erich von Falkenhayn, konzentriert hatte. Es war paradox: Hindenburg wurde als messianischer Retter angesehen, und trotzdem kam immer stärker die verwaltungstechnische Bezeichnung für die Heeresspitze in Gebrauch. Sicher trug dazu die bewusste Abkopplung vom Kaiser bei, durch die Deutschland für zwei Jahre de facto zu einer Militärdiktatur geworden war, in der alle wichtigen Entscheidungen unter dem Primat der Weiterführung des Kriegs getroffen und somit als der Obersten Heeresleitung zugehörig betrachtet wurden. Mit der Betonung dieser Bezeichnung anstelle der konkreten Personen in den entsprechenden amtlichen Verlautbarungen sollte die neue Verantwortlichkeit verschleiert werden. Zugleich hatte die Beschwörung der obersten Instanz als Kollektiv etwas Mystisches: Eine untrennbare Zweieinigkeit schien nun für den Fortgang der deutschen Sache einzustehen. Psychologische Betäubungsmittel wie die sogenannten Kriegsnagelungen, bei denen hölzerne Hindenburg-Statuen auf öffentlichen Plätzen im Deutschen Reich aufgestellt worden waren, in die jeder Bürger gegen eine Spende einen Nagel einschlagen durfte, hatten schon seit 1915 einen quasireligiösen Kult um die Person des vergötterten Feldmarschalls geschaffen. Und Ludendorff war sein Stellvertreter auf Erden.
Vernagelt wird hier Paul von Hindenburg gezeigt, als satirische Reaktion aus Frankreich auf eine Idee der deutschen Kriegspropaganda. Im ganzen Reich wurden hölzerne Hindenburg-Figuren aufgestellt, in die man gegen eine Spende Nägel schlagen konnte – als Zeichen der Widerstandskraft des Landes.
Im September 1918 war aber auch er mit seinem Latein am Ende. Schon im August hatte Ludendorff gegenüber Wilhelm II. eingeräumt, dass der Krieg nicht mehr zu gewinnen sei,[4] aber von einer Niederlage war noch keine Rede. Das änderte sich binnen kürzester Zeit: Am 29. September war Ludendorff so weit, dass er einen Zusammenbruch der Front für unvermeidlich hielt. Das teilte er der Reichsregierung in Berlin mit und forderte zugleich die sofortige Aufnahme von Friedensverhandlungen. «Der 29. September 1918», schreibt Sebastian Haffner, «ist eines der wichtigsten Daten der deutschen Geschichte, aber er ist nicht, wie andere vergleichbare Daten – der 30. Januar 1933, der 8. Mai 1945 –, ein fester Bestandteil des deutschen Geschichtsbewusstseins geworden. (…) Er brachte zugleich Kapitulation und Staatsumbau. Und beides war das Werk eines Mannes – und zwar eines Mannes, dessen verfassungsmäßige Stellung ihm nicht die geringste Befugnis zu so ungeheuren Aktionen gab: des Ersten Generalquartiermeisters Erich Ludendorff.»[5]
Dem ging es im Angesicht der jetzt als sicher angesehenen Niederlage nicht um den Schutz des Reichs oder des Kaisers, sondern um die Bewahrung jenes Instruments, das sein Lebensinhalt war: der deutschen Armee. Ihren Fortbestand und ihre Ehre galt es zu sichern, und dazu musste die eigene Verantwortlichkeit wieder beseitigt werden, denn ein vom Militär ausgehender Waffenstillstand hätte in den Augen der Öffentlichkeit ein Eingeständnis des Scheiterns von Ludendorffs Strategie bedeutet, mit anderen Worten: ein militärisches Desaster. Und seit Januar 1918 gab es ja die Vierzehn Punkte des amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson, die in den Folgemonaten präzisiert und um mehrere Punkte erweitert worden waren. In Wilsons Rede zum Unabhängigkeitstag am 4. Juli war etwa die Bedingung hinzugekommen, dass «jede willkürliche Macht allerorts», die geeignet sei, den Weltfrieden zu stören, vernichtet oder wenigstens neutralisiert werden müsse. Dieser Punkt bedrohte den Fortbestand der Armee nach preußischer Tradition, die in der Weltöffentlichkeit als Inbegriff aller fehlgeleiteten deutschen Ambitionen angesehen wurde. Zugleich aber eröffnete er einen Ausweg, denn in der internationalen Kommentierung von Wilsons Programm war dieser Passus vor allem als Absage an das deutsche Kaisertum, als Forderung nach einer Parlamentarisierung des Deutschen Reichs gedeutet worden. Eine von der Regierung in Berlin ausgehende Waffenstillstandsinitiative versprach der Obersten Heeresleitung somit doppelten Nutzen: ein notwendiges Zugeständnis an Wilson und die Ablenkung von der eigenen Verantwortlichkeit.
Wobei verfassungsgemäß ohnehin kein Weg an der Regierung vorbeiführte, und so war denn auch im Dezember 1916 ein erster deutscher Appell zur Aufnahme von Friedensverhandlungen vom damaligen Reichskanzler Theobald von Bethmann Hollweg ausgegangen – natürlich mit Billigung der Obersten Heeresleitung, also Hindenburgs und Ludendorffs, wie auch des Kaisers. Der seinerzeitige Vorstoß war allerdings lediglich taktischer Natur gewesen; niemand auf deutscher Seite nahm an, dass die Alliierten darauf eingehen würden, zumal sich der Reichskanzler über konkrete Ziele, die sein Land bei diesen Verhandlungen anstreben könnte, ausgeschwiegen hatte. Mit der absehbaren Ablehnung der Initiative durch die Alliierten sollte die Wiederaufnahme des uneingeschränkten U-Boot-Kriegs gerechtfertigt werden, die für den Beginn des Jahres 1917 geplant war.[6] Im Frühherbst 1918 aber gab es aus Sicht Ludendorffs für Deutschland keine militärische Option mehr, also musste eine diplomatische Initiative her, die nun nicht mehr aus einer Position militärischer Stärke wie noch 1916 erfolgen konnte. Um den dadurch zu erwartenden Autoritätsverlust der Armee in der Öffentlichkeit zu vermeiden, sollte der Eindruck erweckt werden, dass die Oberste Heeresleitung gar nichts mit dem Waffenstillstandsgesuch zu tun hatte – was man wiederum der Regierung gegenüber leicht damit begründen konnte, dass auch der Feind nichts über den drohenden Kollaps der deutschen militärischen Position erfahren dürfe, wenn man maßlose Forderungen oder gar die Ablehnung der Initiative ausschließen wollte. Es schien alles ganz logisch.
Ludendorff ließ am 28. September, ohne dass er Hindenburg informiert hatte, den seit elf Monaten amtierenden Reichskanzler Georg von Hertling in die belgische Stadt Spa bitten, wo die Oberste Heeresleitung im Hotel Britannique seit März 1918 ihr «Großes Hauptquartier» hatte und sich derzeit auch der Kaiser aufhielt. Der bereits fünfundsiebzigjährige und todkranke Reichskanzler – er sollte wenige Monate später sterben – erfuhr über den Zweck des bevorstehenden Treffens nur eines: Die Armeeführung war angeblich zu der Überzeugung gekommen, «dass eine Umbildung der Regierung oder ein Ausbau derselben auf breiterer Basis notwendig geworden sei».[7]