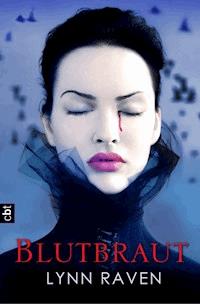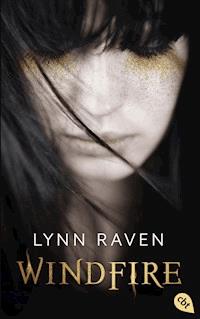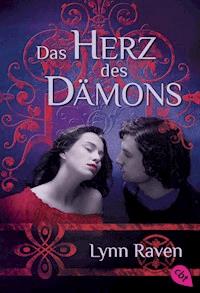7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbt
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die "Dämon"-Reihe
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Vampire und andere bluttrinkende Schönheiten - der Auftakt der Bestsellertrilogie
Es ist Liebe auf den zweiten Blick – doch nie im Leben hätte Dawn für möglich gehalten, dass ihre Gefühle ausgerechnet von einem Geschöpf der Nacht erwidert werden: von Julien, dem unnahbar Coolen, aber auch unheimlich schönen Neuen an der Highsschool. Er hat einen blutigen Auftrag, in den Dawn tiefer verwickelt ist, als sie ahnt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 482
Ähnliche
DIE AUTORIN
Foto: © Katja Theiß
Lynn Raven lebte in Neuengland, USA, ehe es sie trotz ihrer Liebe zur wildromantischen Felsenküste Maines nach Deutschland verschlug. Nachdem sie zwischenzeitlich in die USA zurückgekehrt war, springt sie derzeit nicht nur zwischen der High- und der Dark-Fantasy hin und her, sondern auch zwischen den Kontinenten und ist unter den Namen Lynn Raven und Alex Morrin erfolgreich.
Weitere lieferbare Titel bei cbt:
Der Spiegel von Feuer und Eis (unter dem Namen Alex Morrin)
Lynn Raven
Der Kuss des Dämons
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
© 2008 Verlag Carl Ueberreuter, Wien
Alle Rechte dieser Ausgabe bei cbt/cbj Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Covergestaltung: Carolin Liepins
Covermotiv: Shutterstock.com (Tusumaru, Relight Motion, Olga Nikonova, Amanda Carden, AS Inc, YuriyZhuravov, Olena 1)
Herstellung: AnG
ISBN: 978-3-641-24108-7V005
www.cbt-jugendbuch.de
Für Katja
– die mir mehr als einmal den Wald zwischen all den Bäumen gezeigt hat. Danke!
Ein Oberlicht auf einem Flachdach über Nacht offen zu lassen war, als bettele man um einen Regenguss und die darauf folgenden nassen Fußböden – oder um einen Einbruch. Vor allem wenn das Sicherheitssystem so prähistorisch war wie das der Montgomery-High und nur ein einsamer Wachmann auf dem kleinen Campus seine Runden drehte. Und der befand sich gerade auf der anderen Seite, bei den Turnhallen.
Geschmeidig glitt er durch das Oberlicht und landete lautlos auf dem Linoleumfußboden. Der Anbau lag ebenerdig. Es wäre für ihn auch ein Leichtes gewesen, durch eines der Fenster hineinzugelangen, aber wenn jemand so freundlich war, ihm eine Hintertür offen zu lassen, warum sollte er diese dann nicht nutzen. Ohne zu zögern, bewegte er sich durch den dunklen Korridor, vorbei an metallenen Spinden, mehreren gläsernen Schaukästen, in denen Fotografien der Schulmannschaften und deren Trophäen standen, und an einem Schwarzen Brett, das mit Zetteln und Plakaten bedeckt war, zur Tür des Sekretariats. Er drückte die Klinke und grinste, als sich nichts bewegte. Offenbar gab es in dieser Schule zumindest einen verantwortungsbewussten Menschen. Nach nicht ganz einer Minute war das Schloss geöffnet und die Tür schwang mit einem leisen Schaben auf.
Der Raum dahinter hätte als Prototyp eines Highschool-Sekretariats durchgehen können. Ein Tresen trennte den Schreibtisch der Sekretärin mit Computer, Drucker, Telefon und was man sonst noch brauchte von der vorderen Hälfte des Raumes, an dessen Längswand ein paar Plastikstühle standen. Hinter dem Schreibtischsessel erhob sich ein metallener Hängeregisterschrank, auf dem sich mehrere Ordner den Platz mit Postein- und -ausgangskorb, zwei Stapeln Schulbüchern und einem Prachtexemplar von Ficus teilten. Eine zweite Tür, auf deren oberen Hälfte aus Milchglas der Name A. J. Arrons prangte, führte in das Zimmer des Direktors. Was sich dahinter befand, interessierte ihn nicht.
Ohne Licht zu machen, glitt er am Tresen vorbei, zog die erste Schublade des Hängeregisterschrankes auf und orientierte sich kurz im Ablagesystem der Sekretärin. Dann ging er rasch die Akten des für ihn wichtigen Schülerjahrgangs durch. Sorgfältig prägte er sich die infrage kommenden Gesichter ein. Viele waren es nicht. Das bedeutete, er musste nicht die Stecknadel im Heuhaufen suchen.
Hund und Katz
Bis gestern war ich der Meinung gewesen, es gäbe nichts Schlimmeres als eine Matheklausur. Seit heute wusste ich, dass es tatsächlich etwas Schlimmeres gab: eine Matheklausur nach einer Nacht, in der man immer wieder aus Albträumen aufschreckte, an die man sich nicht erinnern konnte, und aus der man schließlich mit hämmernden Kopf- und Zahnschmerzen aufwachte, mit dem Gefühl, keine Sekunde geschlafen zu haben. Um obendrein festzustellen, dass man verschlafen hatte. Und das nicht zu knapp.
Im Bad brach ich jeden meiner bisherigen Rekorde, obwohl ich mir noch die Haare föhnte. Vor dem Kleiderschrank ließ ich bedauernd den Blick über meine Halbarmshirts und Sommerblusen gleiten und entschied mich dann für ein T-Shirt mit aufgedrucktem Löwenkopf zu meinen Jeans. Nachdem es versprach, ein trotz aller Sonne kühler Herbsttag zu werden, würde ich ohnehin eine Jacke überziehen müssen. Rasch fuhr ich noch mal mit beiden Händen durch mein dunkelblondes, schulterlanges Haar, dann hetzte ich die Treppe hinunter. In der Küche rannte ich Ella, die Haushälterin meines Onkels, fast über den Haufen, stürzte meinen Tee in vier großen Schlucken hinunter, gönnte ihren herrlichen selbst gebackenen Schokomuffins – für die ich früher getötet hätte – nur einen flüchtigen Blick und war schon aus der Haustür, ehe sie noch »Aber Dawn …« zu Ende protestiert hatte. Ich nahm die Treppe mit zu viel Schwung, da ich vorgehabt hatte, einen kleinen Sprint zur Garage hinzulegen, sodass ich an ihrem Fuß beinah bäuchlings auf der Motorhaube meines silberblauen Audi gelandet wäre. Auf der Fahrerseite stand Simon und grinste mich an.
»Morgen, Dawn. Na, verschlafen? Soll ich dich mit dem Rolls bringen?«
Simon war der letzte in einer Kette von Quälgeistern, die mein Onkel für mich angestellt hatte. Der muskulöse Hüne mit dem stoppelkurz geschnittenen Haar war Hausmeister, Chauffeur und Leibwächter in Personalunion. Zumindest hatte er mehr Humor als die Männer, die vor ihm auf mich aufgepasst hatten. Und er nahm es glücklicherweise ziemlich gelassen, dass er mir nicht mehr Tag und Nacht folgen oder mich mit dem schwarz- und chromblitzenden Ungetüm von einem Rolls Royce – das unübersehbar hinter meinem Audi parkte – zur Schule fahren durfte.
Vor ein paar Monaten hatte ich einen heftigen Streit mit meinem Onkel zu diesem Thema gehabt. Seit meine Eltern bei einem Raubüberfall ermordet worden waren, kümmerte er sich um mich. Meine Mutter war seine jüngere Stiefschwester gewesen, die er abgöttisch geliebt haben musste. So sehr, dass er es ihr sogar verzieh, mit »einem dahergelaufenen Ausländer«, wie er meinen Vater immer nannte, durchgebrannt zu sein. Nach ihrem Tod hatte er mich bei sich aufgenommen. In dem Bestreben, mich vor jedem Übel der Welt zu beschützen, heuerte er jede Menge Kindermädchen und Leibwächter an. Bis ich es nicht mehr ertragen konnte. Gewöhnlich widersetzte man sich Samuel Gabbron nur, wenn man unter akuten Suizidabsichten litt. Aber an jenem Tag vor etwa einem Jahr war alles in mir hochgekocht. Er war schließlich nicht derjenige, der von seinen Mitschülern schräg angeschaut wurde, der ihre ewigen Sticheleien ertragen musste, der keine Freunde hatte. Er war ja nie hier, sondern immer nur unterwegs, um sich um seine millionenschweren Geschäfte zu kümmern. Ich hatte ihm durchs Telefon hindurch vorgeworfen, er würde mich wie eine Gefangene behandeln, hatte geschrien, dass ich ihn hasste und die erste sich bietende Gelegenheit nutzen würde, um davonzulaufen. Dann hatte ich aufgelegt und mich geweigert noch mal ranzugehen. In der gleichen Nacht stand er plötzlich neben meinem Bett. Wir sprachen ziemlich lange miteinander. Ich verstand seine Angst, mir könnte das Gleiche zustoßen wie meiner Mutter, aber letztendlich konnte ich ihn überzeugen. Es lenkte viel mehr Aufmerksamkeit auf mich, wenn stets irgendwelche durchtrainierten Kerle so auffällig unauffällig in meiner Nähe herumstanden. Vor allem, da ich noch nicht einmal seinen Nachnamen trug, sondern den meiner Mutter. Wer also sollte Dawn Warden mit ihm, dem steinreichen Industriellen, in Verbindung bringen? Ich war siebzehn. Ich wollte Freunde. Vielleicht sogareinen Freund. Ich wollte endlich leben! Es war kurz vor Sonnenaufgang, als er wieder in den Helikopter stieg, der hinter dem Haus auf ihn gewartet hatte. Am nächsten Morgen stand der Audi vor der Tür, damit ich von nun an alleine zur Schule fahren konnte. Außer Simon waren meine anderen Leibwächter noch in derselben Nacht abgereist. Und damit begann sich mein Leben endlich zu normalisieren. Seitdem hatte ich meinen Onkel nur zwei- oder dreimal gesehen. Im letzten Monat war er zu meiner Überraschung sogar volle zwei Wochen geblieben. Allerdings bekam ich ihn auch in dieser Zeit nicht wirklich häufig zu Gesicht. Er vergrub sich den ganzen Tag in seinem Arbeitszimmer und ließ sich sogar seine Mahlzeiten in sein Heiligtum bringen.
»Danke, aber ich fahr selbst.«
Simon hatte mir die Tür geöffnet und wartete, bis ich um den Audi herum war. Ich warf meine Tasche auf den Beifahrersitz – die Hälfte meiner Bücher rutschte heraus und landete im Fußraum, na prima! – und brauste davon.
Dass ich der lebende Beweis für Murphys Gesetz war, zeigte sich einmal mehr. Sämtliche Ampeln schalteten auf Rot, wenn ich auf sie zufuhr. Schülerlotsen führten ganze Herden von Grundschülern über die Straße und zu allem Überfluss hätte ich um ein Haar einem Typen auf einer dieser Rennmaschinen die Vorfahrt genommen. Zum Glück raste er in mörderischem Tempo weiter, ohne mich zu beachten. Mein Adrenalinspiegel war jedoch jenseits der Höchstmarke angelangt.
Ich fand – wie sollte es anders sein – einen Parkplatz am anderen Ende des Campus, stopfte meine Bücher in die Tasche zurück und rannte quer über den Rasen zu dem flachen Anbau des Schulgebäudes, in dem ich Mathe hatte. Vollkommen außer Atem schaffte ich es gerade noch, vor Mrs Jekens in den Raum zu schlüpfen und mich auf meinen Platz fallen zu lassen. Elizabeth Ellers, mit der ich in der Stunde zusammen an einem Tisch saß und die eine der wenigen war, die ich inzwischen zu meinen Freunden zählte, lächelte mir aufmunternd zu. Sie kannte meine Matheprobleme besser als jeder andere. Doch ehe sie etwas sagen konnte, verbannte Mrs Jekens mich an einen anderen Tisch, verbat sich weitere Gespräche und teilte die Arbeiten aus. Die nächste Stunde kämpfte ich mit den Aufgaben. Als das Schrillen der Schulglocke endlich das Ende der Stunde – und damit das Ende meiner Qual – verkündete, war ich erleichtert, dass es vorbei war. Ich stopfte Taschenrechner und Stifte zurück in meine Tasche und verließ fluchtartig den Raum. Draußen sank ich neben der Tür auf eine der metallenen Bänke, die im Korridor entlang der Wände verteilt standen, und zog die Beine an.
»So schlecht kann es doch gar nicht gelaufen sein. Du bist zumindest fertig geworden. Dass wir gestern noch zusammen gelernt haben, hat demnach geholfen.« Elizabeth setzte sich neben mich und strich ihren Rock glatt. Wie immer war jeder Zentimeter von Beths Kleidung schwarz – inklusive Lippenstift und Kajal.
Anstelle einer Antwort verdrehte ich nur die Augen, ohne mich aus meiner trüben Stimmung reißen zu lassen. Wenn ich in dieser Matheklausur nicht mindestens eine Drei hatte, drohte mir in den Ferien ein zusätzlicher Kurs. Grausiger Gedanke.
Ein helles Lachen ließ mich aufschauen. Neben mir beugte Beth sich vor, um besser sehen zu können, was bei den Spinden ein Stück den Flur hinunter vor sich ging. »Oje. Cynthia hat ihn. Was meinst du? Wie lange wird es dauern, bis sie ihn mit Haut und Haaren gefressen hat?« Beth legte den Kopf schräg. »Ob man ihn aus ihren Klauen retten sollte?«, sinnierte sie scheinbar unschuldig weiter. Auch wenn die meisten es ihr, dem zierlichen Mädchen mit dem blassen Puppengesicht und den großen, unschuldig blickenden, dunklen Augen, nicht zutrauten, konnte Beth ein richtiges Biest sein, wenn es um Cynthia Brewer ging. Dabei waren sie und die rothaarige Schulschönheit entfernte Cousinen. Doch während Elizabeth Jungs gegenüber eher zurückhaltend war, hatte Cynthia den Verschleiß einer Gottesanbeterin, was ihre Freunde betraf. Ihr jüngstes Opfer hieß Julien DuCraine und war erst seit knapp drei Wochen an der Montgomery. Er war groß, schlank und bewegte sich mit einer irgendwie gefährlichen Eleganz. Sein Haar war dunkel, fast schwarz, im Nacken ein bisschen zu lang und stand in einem scharfen Kontrast zu seiner überraschend hellen Haut. Er trug stets eine getönte Brille, die er selbst im Unterricht nicht abnahm. Aber auch sie konnte nicht ganz verbergen, dass seine Züge von einer Perfektion waren, die man auf einer Kinoleinwand zu sehen erwartete, aber nicht in einem Klassenzimmer. Julien DuCraine war auf eine klassische und zugleich beunruhigende Art schön. Er wirkte zwei oder drei Jahre älter als der Rest unseres Jahrgangs. Wenn man den Gerüchten über ihn glaubte, war er bereits von diversen Schulen geflogen und mehrmals hängen geblieben. Ein paar Leute wollten sogar erfahren haben, dass er einige Zeit im Jugendgefängnis gesessen hatte und deshalb jetzt mehrere Schuljahre hinterherhinkte. Weder Beth noch ich hatten mit ihm zusammen einen Kurs, doch laut Neal, einem Jungen aus unserer Clique, der mit ihm den gleichen Physik-, Geschichts- und Sportkurs besuchte, war Julien DuCraine ein Einzelgänger, abweisend und arrogant. Die meisten behandelten ihn mit vorsichtigem Respekt, nachdem er in der ersten Sportstunde Mike Jamis beim Volleyball das Handgelenk gebrochen hatte. Dabei war alles – nach Mikes eigener Aussage – nur ein Unfall gewesen. Er hatte versucht DuCraines Aufschlag anzunehmen. Die Wucht, mit der der Ball auf seinen Arm geprallt war, hatte Mikes Handgelenk gebrochen. Seitdem ging die gesamte gegnerische Mannschaft in Deckung, wenn DuCraine den Aufschlag hatte. Nach dem, was man sich weiter erzählte, war Julien ein begnadeter Fechter, dem selbst der Coach nicht gewachsen war. Doch bislang hatte er alle Angebote, der Schulmannschaft beizutreten, ausgeschlagen. Sehr zu Neals Erleichterung, der bis zu Juliens Erscheinen der unangefochtene Champion gewesen war. Ich selbst war DuCraine bisher nur ein paarmal auf den Fluren begegnet, ohne auch nur ein Wort mit ihm zu wechseln. Beim Mittagessen in der Cafeteria hatte ich ihn noch nie getroffen. Offenbar wollte er so wenig wie möglich mit uns allen zu tun haben.
Wenn er sich mit seiner abweisenden Art auch jeden anderen an der Montgomery vom Hals halten konnte, so versagte seine Taktik bei Cynthia Brewer vollständig. Cyn hatte ihn gesehen und sofort stand er auf der Liste der Dinge, die sie unbedingt haben wollte. Ganz oben. Noch am selben Tag hatte sie die Jagd eröffnet. Und ihn jetzt endlich gestellt. Zumindest lehnte er gerade mit dem Rücken an seinem Spind am anderen Ende des Flures, während Cynthia so dicht vor ihm stand, dass ihre über ihren Büchern verschränkten Arme nur noch Zentimeter von seiner Brust entfernt waren. Ihr Lachen drang bis zu Beth und mir, während sie sich ihre dunkle Mähne zurückstrich.
Im Gegensatz zu Beth wäre ich niemals auf die Idee gekommen, DuCraine vor Cynthia retten zu wollen. Die beiden hatten einander verdient. In den drei Wochen, die er gerade mal an der Schule war, hatte er bereits mit zwei Mädchen aus unserer Stufe etwas angefangen, jede von ihnen aber schon nach ein paar Tagen wieder mit gebrochenem Herzen in die Wüste geschickt.
Zwei Jungen blieben vor der Bank stehen, auf der Beth und ich saßen, und vertraten uns dabei die Sicht.
»Und? Wie ist Mathe gelaufen?« Neal, der größere der beiden, zog den Riemen seines Rucksacks über der Schulter zurecht und grinste mich an. Neben ihm spielte Mike mit der Schlinge, in der sein eingegipstes Handgelenk lag. Obwohl er ungefähr zehn Zentimeter kleiner war als sein Freund Neal, war er in den Schultern ein gutes Stück breiter. Er begrüßte uns mit einem Nicken und einem »Hi!« und hob dann die Hand, als ein Junge aus seiner Volleyballmannschaft vorbeiging.
»Wie soll Mathe schon gelaufen sein. Schlecht natürlich.« Ich streckte die Arme über den Knien und sah unangenehm berührt zur Seite.
Neal – das Mathe- und Computergenie – schnalzte mit der Zunge. Alles, was nur ansatzweise mit Zahlen und Logik zu tun hatte, war für ihn ein Kinderspiel, während es mir nicht in den Kopf wollte, wozu ich berechnen können sollte, welcher Punkt einer Kurve sich wo in einem Koordinatensystem befand. Und das auch noch aus der x2en Ableitung heraus. Etwas, was Neal absolut nicht nachvollziehen konnte.
»Ich dachte, Beth hätte mit dir gelernt«, stellte er mit unüberhörbarer Missbilligung in der Stimme fest. Schon im letzten Schuljahr hatten wir herausgefunden, dass seine Geduld nicht ausreichte, um mir Nachhilfe zu geben. Unsere Versuche damals hatten in Wutausbrüchen sowohl auf seiner als auch auf meiner Seite geendet und waren gnadenlos schiefgegangen.
Ehe ich etwas zu meiner Verteidigung sagen konnte, tat Beth es für mich.
»Das habe ich auch. Und sie übertreibt. Sie hat nämlich dieses Mal alle Aufgaben geschafft. – Du stehst mir im Weg, Neal. Geh mal einen Schritt nach links.«
Ein wenig verwirrt gehorchte er und blickte flüchtig in die gleiche Richtung wie Beth. Nur um einen Sekundenbruchteil später die Augen aufzureißen und zu den Spinden hinzustarren. Mike schnappte neben ihm hörbar nach Luft. Auch ich schaute wieder den Gang hinunter. Und glaubte nicht richtig zu sehen. Hatte zuvor DuCraine mit dem Rücken zu den Spinden gestanden, so drückte sich jetzt Cynthia dagegen. Sie war zwischen seinen langen Beinen gefangen. Ihre Bücher hielt sie umklammert, als hinge ihr Leben davon ab. DuCraine hatte einen Ellbogen gegen die Metalltüren gestemmt, den Kopf auf die Hand gestützt und sich so dicht zu ihr gelehnt, dass sein Gesicht nur noch ein paar Zentimeter von ihrem entfernt war. Seine andere Hand tat irgendetwas oberhalb ihrer Bücher an ihrem Hals und dem Ausschnitt ihrer Bluse. Was genau, war nicht zu erkennen. Offenbar sagte er etwas zu ihr, denn seine Lippen bewegten sich und Cynthia starrte gebannt zu ihm auf. Sie schien mehrmals krampfhaft zu schlucken. Dann schloss sie die Augen und lehnte den Kopf gegen den Spind, als DuCraine sich noch weiter vorbeugte und sein Gesicht ganz nah an ihres brachte. Doch anstatt sie zu küssen, wie sie es wohl erwartet hatte, stieß er sich von der Spindtür ab und trat zurück. Den Mund zu einem halben verächtlichen Lächeln verzogen beobachtete er, wie Cynthia verwirrt den Kopf wieder hob und ihn anblinzelte, ehe er sich mit einer kleinen, spöttischen Verbeugung von ihr abwandte und den Gang entlang davonging. Genau auf uns zu. Er gönnte uns keinen Blick, als er an uns vorbeischritt. Der höhnische Ausdruck in seinem Gesicht war verschwunden. Ich glaubte jetzt eine Mischung aus Bitterkeit und Frustration darin zu sehen. Und Wut. Selbst die Art, wie er den Flur hinuntermarschierte, wirkte zornig.
Ein Klatschen bei den Spinden lenkte meine Aufmerksamkeit zurück zu Cynthia. Ihre Bücher lagen über den Boden verteilt. Sie mussten ihr aus den Händen gerutscht sein. Keuchend starrte sie DuCraine nach, so als hätte sie bis eben vergessen, wie man atmete. Dann blickte sie hastig den Gang entlang, bückte sich betont lässig nach ihren Büchern und ging in die entgegengesetzte Richtung davon. Seit ich an dieser Schule war, hatte noch kein Junge Cyn so behandelt.
»Verdammt«, entfuhr es Mike. »Das sah aus, als würde er sie gleich hier auf dem Flur …« Er wurde rot und schluckte den Rest des Satzes runter. Beth nickte. Sie wirkte fast ein bisschen benommen.
»Was sah aus, als würde es wer hier gleich auf dem Flur?« Mikes Halbschwester Susan war gerade aus dem Gang, der zur Bibliothek führte, in den Hauptkorridor gebogen und stellte sich zu uns. Mike drehte sich zu ihr um. Obwohl sie unterschiedliche Väter hatten, sahen sie sich ähnlich wie Zwillinge. Beide hatten glattes, dunkles Haar und hellbraune Augen. Gewöhnlich trug Susan ihre Locken zu einem Pferdeschwanz gebunden, was ihr schmales Gesicht noch besser zur Geltung brachte. Einige Zeit war sie eine von Cynthias engsten Freundinnen gewesen, doch dann hatte die sich im vergangenen Jahr Neal zum Opfer auserkoren, nachdem er seine Pubertäts-Akne-Phase hinter sich gelassen hatte. Die Art, wie sie mit ihm umgegangen war und ihn schließlich hatte fallen lassen, hatte zum Bruch zwischen ihr und Susan geführt.
»DuCraine hätte Cynthia beinah bei den Spinden …«, Mike zögerte, »… du weißt schon.«
Verständnislos sah sie ihn an. »Nein, ich weiß nicht. Was denn?«
Ihr Halbbruder wand sich. »Na ja, es sah aus, als würde er sie gleich …«, er räusperte sich und blickte Hilfe suchend zu Neal.
»Er hat sie gegen den Spind gedrängt und es sah aus, als hätte er mehr im Sinn, als sie nur vor allen hier zu küssen«, sprang der ein.
Susans Augen wurden groß. »Oh«, machte sie. »Ooohh.« Ihr Blick schweifte kurz den Gang entlang, kehrte dann aber zu Neal und Mike zurück, als sie weder DuCraine noch Cynthia dort sah. »Und was ist passiert?«, bohrte sie weiter.
»Nichts«, mit scheinbarer Gleichgültigkeit zuckte Neal die Schultern. »Er hat sie angefixt und stehen lassen.«
Ihre Augen wurden noch ein Stück größer. Für einen Moment stand ihr Mund offen, ehe sich ein Grinsen auf ihrem Gesicht ausbreitete. »Und alle haben es gesehen? Arme Cynthia. – Ich glaube, ich mag diesen Typen.« Ihre Schadenfreude war nicht zu überhören. Sie räusperte sich ein bisschen übertrieben. »Zurück zum Geschäft, Leute. Es gibt ein kleines Problem.« Sie sah ihren Halbbruder an. »Mom hat mir gerade eine SMS geschickt. Sie hat Migräne und fragt, ob wir uns heute Abend zum DVD-Schauen bei jemand anderem treffen können.« Mike fluchte leise, während Susan jetzt uns andere ansah. Schon vor über einer Woche hatten wir diesen Termin ausgemacht. Ihn nun einfach sausen zu lassen widerstrebte jedem von uns.
Beth lehnte sich ein Stück vor. »Meine Granny hat bestimmt nichts dagegen, wenn wir uns bei mir treffen! Sie ist heute Abend ohnehin bei ihren Freundinnen. – Aber wir haben nur den kleinen Fernseher.« Seit ihre Eltern sich getrennt hatten, lebte sie bei ihrer Großmutter, einer manchmal äußerst direkten alten Dame, die ihre Enkelin über alles liebte. Ihr kleines Häuschen lag am Stadtrand inmitten eines leicht verwildert wirkenden Gartens. Beth kellnerte dreimal die Woche im Ruthvens, einem Klub, der vor einigen Monaten neu eröffnet hatte, um ein bisschen Geld zu der mageren Rente ihrer Großmutter beizusteuern. »Wenn der reicht …«
»Wir können es auch bei mir machen. Meine Eltern sind im Augenblick mal wieder beide auf Geschäftsreise«, bot Neal an. »Und der Beamer von meinem Vater ist inzwischen repariert.«
Mike ließ ein begeistertes »Jau!« hören und stieß Neal in die Seite. »Ich würde sagen, das ist damit beschlossen. Was wollen wir uns ansehen?«
Wir tauschten Blicke. Neal hob die Schultern.
»Wie wär’s mit einer Horror-Nacht? Wir haben bald Halloween«, meinte Susan nachdenklich.
»Coole Idee. Ich besorg die DVDs.« Mikes Grinsen wurde ein Stück breiter, als er mich ansah. »Wie wär’s mit ›From Dusk Till Dawn‹?«
Ich nahm den Fuß vom Sitz und versuchte nach ihm zu treten. Lachend wich er zurück und ich seufzte genervt.
»Hat dein Bruder irgendwo einen Aus-Knopf, Susan?« Manchmal fragte ich mich wirklich, was meine Eltern dazu veranlasst hatte, mich ausgerechnet Dawn zu nennen.
Sue schüttelte mit Leidensmiene den Kopf. »Glaub mir, den such ich auch noch, Süße.«
Mikes Grinsen nahm Honigkuchenpferd-Qualitäten an.
»Ist es okay, wenn Ron und Tyler auch kommen?«, erkundigte sich Neal. Ron war Cynthias um ein Jahr älterer Bruder. Er und Neal verbrachten unzählige Stunden ihrer Freizeit damit, an Computern herumzubasteln, und waren eng befreundet. Während seine Schwester eine arrogante Ziege war, war Ron zurückhaltend und umgänglich. Er hatte ein Lächeln, das einem die Knie weich werden ließ. Cynthias Versuchen, ihn mit einer ihrer Freundinnen zu verkuppeln, hatte er bisher erfolgreich getrotzt.
Tyler war nach Neal der zweite Kapitän der Fechtmannschaft. Ein nur mittelgroßer, schlaksiger Junge mit einem leicht morbiden Humor. Er war Cynthias erwähltes Opfer gewesen, bevor Julien DuCraine an die Schule gekommen war.
Ein schrilles Klingeln verkündete das Ende der Pause und der Gang leerte sich ziemlich schnell. Hastig beendeten wir unsere Planung für den Abend. Natürlich hatte niemand etwas dagegen, dass Ron und Tyler kamen. Es wurde beschlossen, dass wir uns um sieben bei Neal treffen würden. Beth, Susan und ich übernahmen es, Muffins zu backen und Salate zu machen. Mike, Neal und die beiden anderen Jungs hatten für die DVDs, Getränke und Knabberzeug zu sorgen.
Ich musste mich beeilen, um noch rechtzeitig in meinen Physikkurs zu kommen, und erntete einen tadelnden Blick von Mr Horn, weil ich noch an meinen Platz hastete, während er schon seine Tasche auf das Pult legte.
Als ich nach der letzten Stunde im strahlenden Nachmittagssonnenschein zu meinem Auto zurückging, rief mir ein unangenehmes Jucken an meinen bloßen Armen ins Gedächtnis, dass ich heute Morgen meine Jacke auf dem Beifahrersitz vergessen hatte. Wenn ich nicht vorsichtig war, würde meine Haut bis zum Abend aussehen, als hätte ich einen leichten Sonnenbrand. Eine schwache Form einer Sonnenallergie, war die Diagnose des Arztes gewesen, zu dem Ella mich gebracht hatte. Wassergefüllte Bläschen würden mir erspart bleiben, wenn sich die Allergie nicht verschlimmerte. Mit dem Gefühl der Hitze und der Empfindlichkeit bei Berührungen hätte ich mich noch abfinden können. Aber nicht mit diesem Jucken. Vielleicht sollte ich dankbar sein, dass uns mein Onkel damals hierher nach Ashland Falls verfrachtet hatte und nicht nach Florida oder einen anderen sonnenverwöhnten Ort.
Ashland Falls mochte anscheinend am Rand der zivilisierten Welt liegen, doch es bot mir – abgesehen von einer kleinen Mall, in der man entspannt bummeln gehen konnte, ein paar Klubs, in denen sie gute Musik spielten, und einem Kino, das nicht zu sehr hinter dem Programm der großen Städte hinterherhinkte – genau das, was ich liebte: endlose Wälder, die wie geschaffen waren für ausgedehnte Trekkingtouren. Unser Haus befand sich am Stadtrand und damit unmittelbar an diesen Wäldern. Nur das alte, verlassene Hale-Anwesen lag noch weiter außerhalb. Auf dem riesigen Grundstück, das direkt an unseres grenzte, standen jahrhundertealte Ahornbäume am Rand eines Sees, in dessen Wasser man die Wolken beobachten konnte. Im Sommer ging ich dort regelmäßig schwimmen. Das Haus selbst mochte mehr als hundert Jahre alt sein und war seit etwa zwei Jahrzehnten unbewohnt. Elizabeth, die all das von ihrer Großmutter wusste, hatte mir davon erzählt. Es schien keinen Besitzer zu haben, und wenn es ihn doch gab, kümmerte er sich nicht darum, sodass es allmählich verfiel. Etwas, was mir in der Seele wehtat, denn ich mochte die zeitlose Eleganz, die das Haus mit seinen hohen Fenstern in den beiden Stockwerken, der großzügigen Veranda, die es vollständig umgab und deren Dach von gedrechselten Säulen getragen wurde, ausstrahlte.
Auf dem Heimweg von der Schule machte ich einen kurzen Umweg zu dem Gemüsehändler, bei dem Ella immer einkaufte, und besorgte noch einige Zutaten für meinen Salat. Dann fuhr ich nach Hause. In der Auffahrt stand das Monstrum von einem Rolls Royce vor der Garage, das mein Onkel stets benutzte, wenn er ein paar Tage hier verbrachte. Durch das offene Tor dahinter konnte ich die dunkelblaue Schnauze des Mercedes glänzen sehen, den Simon und Ella gewöhnlich fuhren. Simon war dabei, den Rolls wie jede Woche zu waschen und zu polieren. Er winkte mir über das schwarze Dach hinweg zu und deutete auf den Audi. »Lass ihn da stehen. Wenn ich mit dem hier fertig bin, mach ich mit deinem weiter.«
»Ich brauche ihn aber heute Abend.«
»Kein Problem, Kleine. Bis heute Abend ist das Baby frisch gewickelt und ausgehbereit. Was steht denn an?«
»Filmabend bei Neal. Es könnte spät werden.«
Der Hüne zog die blonden Brauen zusammen. »Soll ich dich fahren?«
»Danke, aber danke nein«, lehnte ich entschieden ab, schlang mir den Riemen meiner Tasche über die Schulter und holte meine Einkaufstüte vom Rücksitz.
»Wie du meinst.«
In der absoluten Gewissheit, dass Simon heute Abend in der Nähe von Neals Haus sein würde, schloss ich die Tür auf und betrat die Eingangshalle der kleinen Villa – anders konnte man dieses Gebäude nicht nennen. Die eine Hälfte des Erdgeschosses beherbergte eine modern eingerichtete Küche, in der es vor Chrom und Edelstahl nur so blitzte und die groß genug war, um zusätzlich einem Esszimmertisch und einem halben Dutzend Stühlen Platz zu bieten. Dann gab es ein Speisezimmer – das allerdings nie benutzt wurde, da ich es vorzog, zusammen mit Simon und Ella in der Küche zu essen –, ein mit dicken orientalischen Teppichen ausgelegtes Wohnzimmer, in dem ein schwarzes Monstrum von einem Flügel stand – auf dem niemand spielen konnte – sowie Ellas Zimmer und ihr Bad. Simon hatte seine eigene kleine Wohnung über der an das Haus angebauten Garage. Von der Halle führte eine Tür in die rechte Hälfte des Gebäudes, in der sich der Salon und das Arbeitszimmer meines Onkels befanden. Eine Wendeltreppe verband sein Schlafzimmer und Bad im ersten Stock mit diesen Räumen. Die andere Hälfte des ersten Stocks war über die geschwungene Treppe in der Eingangshalle zu erreichen. Hier befand sich mein kleines Reich – zusammen mit meinem eigenen Badezimmer und zwei Gästezimmern, die noch nie benutzt worden waren. Onkel Samuel duldete keine Fremden in seinem Haus. Auch die Geschäftspartner, die ihn bei seinen seltenen Stippvisiten manchmal besuchten, blieben nie länger als drei oder vier Stunden. Sein Beschützertick ging so weit, dass er es ausdrücklich ablehnte, dass ich Freunde mit nach Hause brachte. Der Himmel wusste weshalb.
Ich ließ meine Tasche auf die unterste Treppenstufe fallen und ging mit meinen Einkäufen in die Küche. Ella stand am Herd und lächelte mir zur Begrüßung zu. Der Geruch von frischem selbst gebackenen Brot wehte mir entgegen. Auf der Anrichte wartete bereits eine Tasse meines Lieblingstees auf mich. Onkel Samuel hatte ihn für mich besorgt. Woher, war sein Geheimnis. Außer mir mochte niemand dieses Gebräu, aber ich war geradezu süchtig nach seinem Geschmack, der sich mit einem dunklen, vollen Aroma zu etwas unbeschreiblich Köstlichem verband. Und er war das Einzige, was bei meinen morgendlichen Zahnschmerzen – die sich anfühlten, als würde jemand eine Wurzelbehandlung ohne Betäubung an meinen oberen Eckzähnen vornehmen – wirkte.
Ella half mir beim Schnippeln der Paprika und Gurken, die ich für meinen Salat brauchte. Ich war ihr dankbar, dass sie die Zwiebeln allein übernahm, denn seit einiger Zeit weckte ihr Geruch eine dumpfe Übelkeit in meinem Magen, die mich manchmal sogar zum Würgen brachte.
Anschließend ging ich in mein Zimmer hinauf und widmete mich meinen Hausaufgaben. Der Biologieaufsatz kostete mich besonders viel Zeit.
Es war kurz nach halb sieben, als ich zu Neal fuhr, den Salat sicher vor dem Beifahrersitz verstaut.
Mike und Susan waren schon da, als ich ankam. Ein Stapel DVDs lag vor der beeindruckenden Heimkinoanlage, dem ganzen Stolz von Neals Vater. Ein Sideboard aus poliertem Kirschbaumholz, über das jemand in weiser Voraussicht eine beigefarbene Tischdecke gelegt hatte, wurde zur Anrichte zweckentfremdet, auf der wir Teller und Gläser bereitstellten. Ich war gerade mit einem Tablett, auf dem ich eine Pyramide aus Susans Apfelmuffins gebaut hatte, unterwegs von der Küche ins Wohnzimmer, als Ron in der offenen Haustür auftauchte. Um ein Haar wäre mir das Tablett aus den Händen gerutscht, als ich Cynthia hinter ihm entdeckte. Rons Gesicht war eine Maske des Elends. Neal, der mit den Armen voller Getränke hinter mir war, stieß den Atem aus, als Cyn sich an ihrem Bruder vorbeidrängte.
»Ron sagte, es würde euch nichts ausmachen, wenn ich ihn begleite«, grinste sie, während sie Richtung Wohnzimmer schwebte. Im Vorbeigehen nahm sie einen Muffin von meinem Tablett.
Neal und ich sahen gleichzeitig zu Ron. Der krümmte sich unter unserem Blick.
»Nichts ausmachen?«, fauchte Neal ihn an. »Bist du bescheuert, Mann?«
Abwehrend hob Ron die Hände. »Ich konnte nichts tun, ehrlich. Sie hat mich …«, er schluckte und schaute zur Wohnzimmertür, wo Cynthia gerade verschwunden war – und aus der jetzt eine äußerst wütende Susan gestürmt kam.
»Bitte, Leute«, flehte er, ehe auch sie über ihn herfallen konnte, »ich wollte sie nicht mitnehmen, aber sie hat mich erpresst.«
»Erpresst?« Susan war stehen geblieben und musterte ihn mit zusammengekniffenen Augen. Mike lehnte schweigend hinter seiner Schwester an der Treppe zum ersten Stock.
»Ja«, unglücklich nickte Ron, ehe er Neal ansah. »Erinnerst du dich an die Sache mit dem Virus, den wir zusammengebastelt haben? Sie hat gedroht, dass sie es Mom erzählt. Und Mr Arrons.«
Susan und ich schauten zuerst einander und dann Neal und Ron an. Vor einigen Wochen hatte ein unbekannter Virus sämtliche Schul-PCs zum Absturz gebracht. Daten waren zwar keine verloren gegangen, aber das ganze System war fast drei Tage lahmgelegt, ehe ein Techniker den Fehler – beziehungsweise den Virus – gefunden und den Schaden behoben hatte. Der oder die Schuldigen waren nicht ausfindig zu machen gewesen. Unser Schulleiter, Mr Arrons, hatte getobt, gelinde gesagt, und dem oder den Übeltätern mit ernsten Konsequenzen gedroht. Noch einmal sah ich von Ron zu Neal. Ich hatte gewusst, dass die beiden gut waren, aber so gut …
»Woher zum Teufel …«, Neal atmete übertrieben tief durch und verlagerte die Flaschen in seinem Arm, die allmählich ins Rutschen kamen. »Okay. – Und was will sie hier?«
»Ich weiß es nicht«, schüttelte Ron den Kopf. »Aber ich glaube, es hat irgendetwas mit DuCraine zu tun. Cyn ist total durchgeknallt, was den Typen angeht. Ich musste mich sogar in den Schulcomputer einhacken, um ihr seine Adresse zu beschaffen.« Er grinste etwas unsicher und hob die Schultern. »Offensichtlich ist die gute Mrs Nienhaus allerdings noch nicht dazu gekommen, seine Daten einzugeben. Zumindest konnte ich nichts finden.« Das Grinsen wich Ärger. »Sogar im Netz musste ich nach ihm suchen. Ihr hättet sie mal hören sollen, als ich nur zwei oder drei Artikel über ein Paar Hochseilartisten mit diesem Namen, irgendwann um neunzehnhundert, gefunden habe.«
»Hast du ihr denn nicht gesagt, dass DuCraine nicht kommen wird?« Neal runzelte verständnislos die Stirn.
»Ich glaube, das wusste sie schon vorher.« Unbehaglich räusperte Ron sich. »Ich fürchte vielmehr, sie ist hinter Tyler her. Zumindest fing sie erst damit an, dass sie mich begleiten wollte, nachdem Mom gefragt hatte, wer heute Abend alles kommen würde und ich Tylers Namen genannt hatte.«
»Tyler?« Neals Miene war ein einziges Fragezeichen. »Ich dachte, sie will DuCraine?«
Susan schnalzte mit der Zunge und nahm Neal ein paar Flaschen ab, ehe sie noch weiter ins Rutschen geraten konnten. »Klar. Aber sie denkt wahrscheinlich, sie kann DuCraine mit Tyler eifersüchtig machen. Das wäre typisch für Cynthia.«
Für eine geschlagene Sekunde sahen wir einander an, dann stahl sich ein Grinsen auf Rons Gesicht. »Warum hab ich nur das Gefühl, dass DuCraine nicht auf diesen Zug aufspringen wird?«, erkundigte er sich. Anstelle einer Antwort klopfte Neal ihm auf die Schulter. Gemeinsam gingen wir ins Wohnzimmer, wo Cynthia es sich grazil auf der Couch gemütlich gemacht hatte. Als hätten wir ein stillschweigendes Abkommen getroffen, waren wir alle äußerst höflich zu ihr – immerhin ging es um Neals und Rons Kopf – und schafften es doch irgendwie gleichzeitig, sie weitestgehend zu ignorieren.
Tyler, der etwa zehn Minuten später kam, wurde von Neal an der Haustür abgefangen und auf Cynthias Anwesenheit vorbereitet. Damit fehlte nur noch Beth. Als es Viertel nach sieben war, begann ich mir Sorgen zu machen. Es sah ihr nicht ähnlich, sich zu verspäten. Nur Cyn schien nicht beunruhigt. Es war kurz vor halb acht, als Neal versuchte bei Beth zu Hause anzurufen. Erfolglos. Auf ihrem Handy ging nur ihre Mailbox ran. Allmählich wurde es draußen dunkel. Ich postierte mich an einem der beiden Fenster zur Straße und beobachtete angespannt jedes Scheinwerferpaar, das sich dem Haus näherte. Alle glitten sie vorbei. Susan schlug vor, dass wir schon einmal eine DVD auswählen sollten, damit wir gleich anfangen könnten, wenn Beth endlich da wäre. Wir entschieden uns einstimmig für die Dracula-Verfilmung von Francis Ford Coppola.
Es war fast acht, als Neal hinauf in sein Zimmer ging, um seine Autoschlüssel zu holen. Er war schon wieder halb die Treppe herunter, als ein einzelner Scheinwerfer die Auffahrt erhellte. Susan und ich waren noch vor ihm an der Haustür. Neal, Mike, Ron und Tyler rannten in uns hinein, weil wir auf der obersten Stufe abrupt stehen geblieben waren. Vermutlich sahen wir aus wie eine Herde mondsüchtiger Hammel, während wir fassungslos beobachteten, wie Beths zierliche Gestalt von dem Sozius einer schwarzen Rennmaschine kletterte und die Schüssel mit ihrem Salat von dem Fahrer entgegennahm, die dieser vor sich balanciert hatte. Er deutete zu seinem Kopf hin, worauf sie etwas von ihrem Ohr herunterfingerte und ihm gab. Als sie sich dann zu uns umdrehte, wirkte sie ein bisschen blass und irgendwie verträumt, aber sie bedachte uns mit ihrem üblichen Lächeln, während sie ein wenig unsicher auf den Beinen auf uns zukam.
»Mein Käfer ist nicht angesprungen«, erklärte sie entschuldigend. Sie gestikulierte zu dem dunkel gekleideten Typen auf dem Motorrad, der jetzt endlich den Helm abnahm. Wir gafften nur, als wir ihn erkannten. Beth schien es gar nicht zu bemerken. Sie plapperte einfach weiter. »Julien hat mich vor einem endlosen Marsch bewahrt. Er kam vorbei, als ich zu Fuß loswollte, und hat mich mitgenommen.« Eine halbe Sekunde runzelte sie die Stirn, als versuche sie sich an etwas zu erinnern, doch dann schüttelte sie den Kopf. Was auch immer es war, sie hatte es für nicht wichtig befunden. »Ich habe ihm gesagt, dass er gerne bleiben kann.«
Beinahe gleichzeitig schauten wir zu ihm hin. Selbst jetzt trug er seine getönte Brille. Die Arme locker über den schwarz glänzenden Helm gelegt, schien er unsere Blicke mit einer Art wissendem Spott zu erwidern, so als sei er sicher, dass wir Beths Worte nicht beachten und ihn mit einem »Danke und auf Wiedersehen« abspeisen würden.
Neal war der Erste, der aus seiner Erstarrung erwachte.
»Logisch kann er bleiben, wenn er sich bei ein paar alten Vampirfilmen nicht langweilt«, meinte er erstaunlich leutselig. Überrascht sah ich ihn an, doch dann begriff ich: Mit ein bisschen Glück war DuCraine unsere Chance, Cynthia vorzeitig loszuwerden. Zugegeben, der Plan war nicht besonders fair DuCraine gegenüber, aber ich hoffte trotzdem, er würde funktionieren.
Unter der Brille hob sich einer der Mundwinkel DuCraines zu einem zynischen, halben Lächeln und er stellte den Motor ab.
»Was für einen wollt ihr euch denn ansehen?«, fragte er. Seine Stimme klang dunkel und weich. Sie passte zu seinem Äußeren. Plötzlich war meine Kehle rau und mir wurde schlagartig klar, dass ich sie noch nie zuvor gehört hatte. Sprich weiter!, flehte ein Teil von mir, der von der Idee, ihn an Cynthia zu verfüttern, gar nicht mehr so überzeugt war.
»Den Coppola-Dracula.« Neal verschränkte die Arme vor der Brust.
»Guter Film.« DuCraine nickte leicht. »Vor allem dieses ›Gib mir Frieden‹ am Schluss.« Er verstellte seine Stimme zu einem heiseren Krächzen, sodass er fast genauso klang wie Gary Oldman in dieser Szene. Sein Lächeln wurde zu einem leisen Lachen, als gäbe es da irgendeinen Witz, den nur er verstand.
»Mann, gehört das Baby tatsächlich dir? Ich hab mich schon gefragt, wer bei uns an der Schule eine echte Fireblade fährt. Ich dachte, es wäre einer der Lehrer.« Tyler schob sich an Neal vorbei und stieg voller Bewunderung die Eingangsstufen hinunter. Es dauerte ein paar Sekunden, bis ich begriff, dass er von dem Motorrad sprach. Auch DuCraine schien für einen Moment verblüfft.
»Ja, die Blade gehört mir«, bestätigte er dann und strich mit der Hand über den Tank.
Ich beobachtete diese fast schon zärtliche Geste mit gerunzelter Stirn. Anscheinend hatte seine Familie genug Geld, um ihm ein solches Spielzeug zu finanzieren. – Und störte sich nicht daran, dass er das eine oder andere krumme Ding gedreht hatte.
»Wie viel macht sie Spitze?« Auch Mike drängte sich zwischen Susan und mir hindurch und folgte Tyler zusammen mit Ron die Stufen hinunter. Neal schloss sich ihnen nach einem Zögern an.
»Laut Hersteller macht sie 287. Aber was sie tatsächlich bringt, kann ich dir nicht genau sagen. Der Tacho zählt leider nur bis 299.«
Tyler, Mike, Ron und Neal schnappten gleichzeitig nach Luft.
DuCraine kickte den Ständer herunter, bockte das Motorrad auf und richtete sich auf dem Sitz weiter auf.
»Du hast ganz schön an ihr gebastelt, oder?« Tylers Blick wanderte anerkennend über die mattschwarz schimmernde Karbonverkleidung.
»Ja«, nickte DuCraine langsam, setzte sich bequemer zurecht und streckte die langen Beine zu beiden Seiten der Maschine aus.
Mike fuhr über den dunkel getönten Windschild des Motorrades. »Eine Racingscheibe. Cool. – Aus dem wievielten kannst du mit ihr aus dem Stand anfahren?«
»Aus dem zweiten. Ein paarmal hab ich sie auch schon aus dem dritten vorne hochgebracht.«
Wieder sogen Mike, Tyler, Neal und Ron gleichzeitig die Luft ein. Für eine ganze Weile drehte sich alles nur noch um Übersetzung, Beschleunigung, Sportauspuffe, Stahlflex-Bremsleitungen, Reifen und zerschrammte Fußrasten – mochte der Himmel wissen, was daran so besonders war. Die Jungs fachsimpelten, als seien sie schon jahrelang die dicksten Freunde. Selbst Neal beteiligte sich daran. Dass wir für diesen Abend eigentlich andere Pläne gehabt hatten, schienen sie vollkommen vergessen zu haben. Als die Worte Laptop und Tuning im gleichen Satz genannt wurden und Ron sich weit vorbeugte, um das Cockpit genauer zu untersuchen, verschwanden Susan und Beth kopfschüttelnd im Haus. Nachdenklich starrte ich auf die schwarze Maschine. Heute Morgen hatte ich einem Typen auf einem solchen Ding die Vorfahrt genommen. War das am Ende er gewesen?
Erst als DuCraine abrupt den Kopf hob und an mir vorbeisah und auch das Gemurmel der Jungs verstummte, wurde mir klar, dass jemand hinter mir stand. Ein Blick in Neals und Tylers Gesichter verriet mir, dass es weder Beth noch Susan waren.
»Hallo, Julien.« Mit der Grazie einer Königin schritt Cynthia an mir vorbei. Schweigend beobachtete DuCraine sie, während sie auf ihn zukam. Das maliziöse Lächeln, das für den Bruchteil einer Sekunde um seine Lippen zuckte, erinnerte mich irgendwie an eine Katze, die eine Maus gefangen hatte und im Begriff stand, mit ihr zu spielen. Cynthia schien es nicht bemerkt zu haben. Tyler, Mike und Neal machten ihr Platz, als sie an die Maschine herantrat und eine Hand auf den rechten Griff legte.
»Hi«, erwiderte DuCraine mit einiger Verspätung und pflückte ihre Hand wieder von dem Griff herunter. Für einen Moment zog Cyn einen Schmollmund, dann fuhr sie mit den Fingern über das Blinklicht.
»Bleibst du, um mit uns ein paar Filme zu schauen?«, erkundigte sie sich lächelnd. Ihre Stimme klang wie das Schnurren einer Katze. Sie trat ein Stück näher an ihn heran.
»Willst du denn, dass ich bleibe?«, schnurrte er zurück und verschränkte erneut die Unterarme über dem Helm.
»Natürlich.« Cynthia strich sich eine Strähne hinters Ohr. »Allerdings …«
»Allerdings?« Seine Stimme wurde um mindestens eine Quint dunkler und hatte plötzlich etwas von schwarzem Samt.
»Ich durfte noch nie auf einer solchen Maschine mitfahren.«
»Ach? Tatsächlich? – Wie ist es, willst du eine Runde drehen?« Erst als Cynthia sich umwandte und erbost zu mir herstarrte, wurde mir bewusst, dass DuCraines Frage nicht ihr gegolten hatte.
»Meinst du mich?«, quietschte ich vollkommen verblüfft. Hatte ich eben tatsächlich vergessen zu atmen? Himmel, ich benahm mich wie ein blödes Schaf.
»Nein, die Dunkelblonde mit den graubraunen Augen, die direkt hinter dir steht«, entgegnete er so todernst, dass ich mich tatsächlich umdrehte. Ich war ein Schaf. Wütend blickte ich ihn wieder an. Wann war er mir so nahe gekommen, dass er gesehen hatte, welche Farbe meine Augen hatten? Er hob eine Braue und neigte den Kopf. Cyn sah aus, als würde sie mir jedem Moment an die Gurgel gehen.
»Klar. Warum nicht?«, nickte ich und ging so gelassen wie möglich die Treppe hinab.
DuCraine strich mit der Hand über seinen Helm. »Wenn du eine Jacke hast, solltest du sie vielleicht anziehen. Du weißt schon: Fahrtwind und so. Könnte ein wenig kühl werden.«
Ich machte kehrt, stolperte die Treppe wieder hinauf und ins Haus – Schaf! Schaf! Schaf! –, riss meine Jacke von der Garderobe und versuchte die Stufen hinunter nicht zu überhastet zu nehmen.
Neal bedachte mich mit einem Blick totalen Unglaubens. DuCraine grinste nur – er hatte vollkommen ebenmäßige weiße Zähne – und hielt mir das kleine Ding entgegen, das Beth zuvor getragen hatte. Verwirrt starrte ich einen Moment darauf, bis ich erkannte, dass es ein Headset war. Ich klemmte mir den Bügel hinters Ohr und justierte das Mikrofon. Dann kletterte ich hinter ihn auf den Sozius, während er selbst seinen Helm aufsetzte. Eigentlich hatte ich vorgehabt mich nur an seinem Gürtel festzuhalten, doch DuCraine packte meine Hände, zog sie um seine Taille nach vorne und legte sie dort gegen seine Mitte, dass ich eng an ihn gelehnt saß. So wie Cynthia mich mit ihren dunklen Augen durchbohrte, hätte ich in diesem Moment eigentlich tot umfallen müssen.
Mit einem Röhren erwachte die Maschine unter uns zum Leben. DuCraine wendete gekonnt auf der Auffahrt und brauste los. Erschrocken klammerte ich mich fester an ihn. Er raste wie ein Wahnsinniger, aber ich hätte mir lieber die Zunge abgebissen, als ihn zu bitten langsamer zu fahren. Der Wind riss an meinen Haaren und trieb mir die Tränen in die Augen. Auf der Hauptstraße gab er noch mehr Gas. Ich machte mich hinter ihm so klein wie möglich, lehnte den Kopf gegen seine Schulter, presste die Lider zusammen und bereitete mich auf den Tod vor.
»Entspann dich!«, hörte ich seine Stimme ein paar Sekunden später über das Headset. Er tätschelte meine Hand. Bei dieser Geschwindigkeit ließ er den Lenker los. Dieser Irre! Irgendwie schaffte ich es, den Kopf zu heben und über seine Schulter zu schauen. Der Wind traf mich wie ein Schlag und ich duckte mich hastig wieder. Im Scheinwerferlicht huschten die Bäume an uns vorbei. Wir waren tatsächlich schon aus der Stadt raus.
»Wohin?«, erkundigte er sich nach einem weiteren Moment.
»Was, ›wohin‹?«, fragte ich zurück.
»Wohin sollen wir fahren?«
Einen Augenblick zögerte ich. »Warst du schon mal auf dem Peak?«
»Wo ist das?«
Ich erklärte ihm den Weg und die Maschine heulte ein wenig mehr auf. Er verringerte das Tempo erst, als er schließlich in den nur schlecht befestigten Wirtschaftsweg abbog, der sich zum Peak hinaufwand, und das wahrscheinlich nur, weil ihn der Untergrund dazu zwang, doch ich dankte dem Himmel dafür. Dennoch war unsere Geschwindigkeit weiterhin halsbrecherisch genug, dass in den scharfen Kehren Schotter unter den Reifen wegspritzte. Einmal rutschte sogar das Hinterrad weg und DuCraine musste die Maschine mit einem Fuß auf dem Boden abfangen. Wahrscheinlich hatte ich vor Schreck geschrien, denn ich hörte ihn lachen. Der Typ war absolut lebensmüde.
Auf dem Plateau hielt er an. Der Motor tuckerte noch im Leerlauf, da glitt ich schon mit weichen Knien vom Sozius und stolperte ein paar Schritte zur Seite. Jetzt konnte ich nur zu gut verstehen, weshalb Beth so blass und irgendwie unsicher auf den Beinen gewesen war.
»Du bist komplett übergeschnappt«, herrschte ich ihn an, kaum dass er die Maschine ausgemacht und den Helm abgenommen hatte.
Halb belustigt, halb in geheuchelter Verständnislosigkeit schüttelte er den Kopf, während er den Ständer des Motorrades herunterkickte und es vorsichtig auf dem mit Blättern und Tannennadeln bedeckten Splittboden abstellte. »Hab dich nicht so. Oder ist dir irgendwas passiert?« Er fluchte ein paarmal und es dauerte einen Augenblick, bis er mit dem Stand der Maschine so weit zufrieden war, dass er vom Sitz stieg und den Helm darauf legte.
Ein paar Sekunden brachte ich keinen Ton heraus. Stattdessen folgte ich seinem Wink und gab ihm das Headset. Es verschwand in der Tasche seiner Motorradjacke, während er sich umsah.
»Hat was«, nickte er schließlich und trat an den Rand des Plateaus, das an drei Seiten von dichten Bäumen umgeben war. Von der vierten Seite aus, dort, wo DuCraine jetzt stand, hatte man einen herrlichen Blick auf Ashland Falls. Wie ein See aus goldenen Lichtern lag es am Fuß des Peaks. Langsam trat ich neben ihn und blickte wie er auf die Stadt hinab. Aus reiner Gewohnheit suchte ich den leuchtenden Punkt, der mein Zuhause war, während ich tief die nach Wald und Erde duftende Luft einatmete. Es half mir mich zu beruhigen. Eine ganze Zeit standen wir schweigend nebeneinander.
»Fährst du immer so?«, fragte ich irgendwann und setzte mich ein paar Meter vom Rand entfernt auf einen vom Regen glatt gewaschenen Felsen. Raschelnd fuhr der Wind durch die Blätter der Bäume und wirbelte einige von denen auf, die schon zu Boden gefallen waren.
Er sah mich an und mir fiel auf, dass er seine Brille abgenommen hatte. Doch es war zu dunkel, um mehr zu erkennen als seine schattenhafte Silhouette.
»Keine Angst. Ich habe gute Reflexe.« Seine Stimme klang, als würde er grinsen. »Was ist das hier?« Er deutete mit einer Bewegung auf das ganze Plateau. »Eine Art Aussichtspunkt für Verliebte?«
Jetzt war ich dankbar für die Dunkelheit. So sah er wenigstens nicht, wie ich rot wurde. »Im Sommer manchmal, ja«, gestand ich. »Aber ich finde es hier oben einfach nur schön. Es ist so ruhig und friedlich. Und man hat einen herrlichen Blick.«
»Aha. Und aus welchem dieser Gründe wolltest du mir das hier nun zeigen?« Er kam auf mich zu, bis er einen guten Meter von mir entfernt stehen blieb. Sein Gesicht hob sich gespenstisch bleich vor der Dunkelheit ab.
»Du warst es, der gefragt hat, ob ich eine Runde mit dir drehen will«, hielt ich dagegen. »Aus welchem Grund auch immer.«
»Und was dachtest du, warum ich gefragt habe?«
Wenn ich ehrlich war, hatte ich in diesem Augenblick gar nicht gedacht. Ich hatte nur … ja, was eigentlich?
Als ich nicht sofort antwortete, lachte er. Dunkel und hart. »Nur damit es keine Missverständnisse gibt, Warden: Ich habe dich gefragt, um Cynthia eins auszuwischen. Das war alles. Sie geht mir auf die Nerven.« Die Häme in seiner Stimme versetzte mir ebenso einen Stich wie der Umstand, dass er mich so verächtlich mit meinem Nachnamen ansprach – woher kannte er den überhaupt? –, und ließ mich wütend werden.
»Heißt das, du hast mich nur benutzt?«
»Natürlich. Oder hast du dir am Ende eingebildet, ich hätte dich aus einem anderen Grund gefragt?« Er überwand die Distanz zwischen uns schneller, als ich Atem holen konnte, und beugte sich zu mir herunter. Hastig rutschte ich ein Stück zurück.
»Angst, Warden?« In der Dunkelheit blitzten seine weißen Zähne.
»Vor dir bestimmt nicht. Bleib mir vom Leib, du Mistkerl.« Mit beiden Händen stieß ich ihn zurück. Zumindest versuchte ich es. Ebenso gut hätte ich mich gegen einen Felsblock stemmen können. Seine Brust war hart und unnachgiebig wie Marmor.
»Nein?« Erneut lachte er. Der Ton verursachte mir eine Gänsehaut und zugleich ein Kribbeln in der Magengrube. »Gib es zu, Warden. Du hast dir dieselben Hoffnungen gemacht wie jede andere an der Schule. Deshalb hast du auch nicht Nein gesagt, als ich dich gefragt habe, ob du mit mir fahren willst.« Seine Stimme troff vor Hohn. »Ihr seid alle gleich. So erbärmlich berechenbar. Ein Junge sieht gut aus und ihr verwandelt euch in Hyänen, die nur noch an das eine denken.«
»Das sagt genau der Richtige!«, hielt ich gereizt dagegen. »Wer hatte denn drei Freundinnen in drei Wochen?«
»Zwei. Es waren zwei«, korrigierte er ungerührt und erklärte mir dann mit spöttischer Nachsicht: »Und schon in der Bibel steht: Wer bittet, dem wird gegeben.«
Sein Grinsen weckte in mir das Verlangen, ihm eine zu scheuern. Erneut stieß ich ihm die Hände vor die Brust. »Du arroganter Idiot!« Kühl fuhr mir der Wind in den Nacken und blies mir das Haar ins Gesicht. DuCraine versteinerte. In dem Bruchteil einer Sekunde wechselten sich Überraschung und Schrecken auf seinen Zügen ab, ehe Wut beides ersetzte. Er wich mit etwas, was wie ein Fluch klang, so jäh vor mir zurück, als hätte ich ihn tatsächlich geschlagen. Für einen Moment starrten wir uns durch die Dunkelheit an, dann fuhr er sich in einer abgehackten Bewegung mit der Hand durch seine schwarz schimmernde Mähne.
»Weißt du was, Warden: Sieh allein zu, wie du nach Hause kommst!« Abrupt wandte er sich um und ging mit langen Schritten zu seiner Maschine zurück. Er setzte den Helm auf, schwang sich dabei auf den Sitz und kickte den Ständer in die Höhe. Als der Motor aufröhrte, wurde mir klar, dass er tatsächlich ohne mich zurückfahren wollte. Ich sprang auf und wollte ihn aufhalten. Doch ich musste zurückweichen, da Erde und Steine unter seinem durchdrehenden Hinterrad aufspritzen, als er die Maschine wendete. Eine Sekunde später verschwand das rote Auge seines Rücklichts zwischen den Bäumen und ich fluchte ihm hilflos hinterher.
Schließlich zwang ich mich zur Ruhe. Er war wahrscheinlich nur ein paar Hundert Meter den Weg hinuntergefahren und wartete außer Sicht, dass ich ihm nachlief. So etwas traute ich DuCraine zu, ja. Aber nicht, mich mitten in der Nacht hier zurückzulassen. Er mochte durchgeknallt sein, aber so durchgeknallt auch wieder nicht. Und überhaupt: Was zum Teufel war eigentlich plötzlich in ihn gefahren?
Ich zog meine Jacke enger zusammen und ging auf und ab, um mich warm zu halten. Wenn ich nicht kam, würde DuCraine schon wieder auftauchen, sobald er sich abgeregt hatte. Der Splitt knirschte unter meinen Schritten. Zuweilen raschelte es in der Dunkelheit zwischen den Bäumen. Mehrfach erklang gar nicht so weit entfernt ein lang gezogenes Heulen. Jedes Mal erstarrte ich und lauschte auf Schritte oder andere Geräusche, die mich davor gewarnt hätten, dass DuCraine mir irgendeinen Streich spielen wollte. Doch stets blieb es still und nichts geschah, sodass ich meine Wanderung wieder aufnahm.
Warum nur war er plötzlich so wütend geworden? Sein: Ihr seid alle gleich hatte geklungen, als habe er es gründlich satt, dass Mädchen bei seinem Anblick ins Schmachten verfielen. Aber zu denen, die ihn »anschmachteten« zählte ich wohl kaum – und selbst wenn, hätte er das in der Dunkelheit überhaupt nicht bemerken können.
Immer wieder blickte ich auf die Uhr. Die Minuten verrannen zäh und von DuCraine keine Spur. Allmählich hatte ich genug von diesem Spielchen. Ärgerlich rammte ich die Hände in die Jackentaschen und machte mich auf den Weg zur Straße zurück. Wenn er dachte, ich würde hier die ganze Nacht auf ihn warten, dann täuschte er sich gewaltig!
In der Dunkelheit war der Boden des Weges nur schwer zu erkennen. Mehrmals stolperte ich über Löcher und Steine. Einmal knickte ich sogar äußerst schmerzhaft um. Mit jedem Schritt wurde ich gereizter – und zugleich unruhiger. Je weiter ich mich der Straße näherte, umso angespannter lauschte ich, ob ich nicht den Motor seiner Maschine grollen hörte, doch außer dem leisen Rascheln von Blättern im Wind und dem gelegentlichen Ruf eines Käuzchens war es still.
Es war noch immer still, als ich endlich die Straße erreicht hatte. Ich blieb stehen, wartete, horchte, rechnete damit ihn dunkel und spöttisch lachen oder seine Maschine aufheulen zu hören. Nichts geschah. Kein Knirschen von Reifen, kein Aufflammen eines Scheinwerfers. Nichts! Dieser durchgeknallte Idiot hatte mich tatsächlich einfach hier zurückgelassen. Ich wühlte in meiner Jackentasche nach meinem Handy, zögerte dann aber, da ich schwankte, wen ich bitten sollte mich aufzusammeln. Simon? Wenn ich Pech hatte, würde Onkel Samuel es erfahren und ich durfte keinen Schritt mehr alleine tun. Also Neal. Ich hatte seine Nummer schon eingetippt, als mir einfiel, dass Cynthia noch dort sein würde. Wenn sie mitbekam, dass DuCraine mich einfach im Nirgendwo hatte sitzen lassen, würde sie sich auf meine Kosten königlich amüsieren und obendrein dafür sorgen, dass es morgen bis spätestens zur zweiten Stunde die ganze Schule wusste.
Nein! Nicht, wenn ich es irgendwie vermeiden konnte. Ich löschte Neals Nummer und wählte notgedrungen Simons. Irgendwie würde ich ihn schon überzeugen können, Onkel Samuel nichts davon zu erzählen.
Simon ging schon beim zweiten Klingeln ran. Warum nur wunderte es mich nicht, im Hintergrund den Motor eines Autos schnurren zu hören? Knapp erzählte ich, was geschehen war, und sagte ihm, wo er mich abholen sollte. Als ich auflegte, konnte ich mir das Grinsen in seinem Gesicht gut vorstellen. Ich schob die Hände wieder in die Taschen meiner Jacke und marschierte am Straßenrand entlang Richtung Stadt. Mir stand nicht der Sinn danach, hier frierend herumzuwarten. Als mein Handy klingelte und ich Neals Nummer auf dem Display sah, drückte ich ihn weg. Selbst wenn Cynthia nicht mitbekam, was geschehen war, hatte ich im Moment keine Lust, seine Fragen zu beantworten. Ich hatte vergessen, wie hartnäckig Neal sein konnte. Schließlich schaltete ich das Handy einfach aus.
Erstaunlich schnell tauchten die Scheinwerfer des Mercedes vor mir auf. Simon musste in der Nähe gewesen sein. Vermutlich hatte er gesehen, wie DuCraine und ich losgefahren waren, und war uns gefolgt, hatte uns dann jedoch verloren. Kein Wunder bei dem Tempo, das dieser Irre draufgehabt hatte. Ich ließ mich auf den Beifahrersitz fallen und schnallte mich an. Wortlos drehte Simon die Heizung der Klimaanlage ein Stück höher. Er nickte nur, als ich ihn bat, meinem Onkel nichts zu erzählen, sah mich aber während der Fahrt immer wieder von der Seite an. Ich verkroch mich in meinen Sitz und gab vor, es nicht zu bemerken. Warum nur verletzte mich das alles so sehr? Was hatte ich bisher mit diesem Mistkerl zu tun gehabt? Nichts! Wütend auf mich selbst blickte ich aus dem Fenster. Der Himmel mochte mich zukünftig vor diesem Idioten Julien DuCraine bewahren.
Der blonde junge Mann in der dunklen Lederkluft wand sich unter den Augen des Jägers. »Die gleichen Fragen hast du mir schon vor vier Wochen gestellt, Mann«, beschwerte er sich, nachdem er offenbar all seinen Mut zusammengenommen hatte.
»Dann sollte es dir ja nicht zu schwerfallen, sie mir einfach noch einmal zu beantworten. Vielleicht ist dir inzwischen etwas Neues eingefallen, das interessant sein könnte.« Er verschränkte die Arme und musterte ihn schärfer. Der Blonde wich seinem Blick aus und sah sich in der Gasse um, als suche er einen Fluchtweg.
Seine Augen wurden schmal. Der Abend hatte nicht besonders gut angefangen. Er war müde und frustriert und nach wochenlangem erfolglosem Suchen mit seiner Geduld am Ende – vor allem wenn es um solchen Abschaum wie diesen Burschen ging. Ohne Vorwarnung drang er in den Geist des Typen ein, schlug zu und zog sich sofort wieder zurück.
Der Blonde zuckte mit einem winselnden Schrei zusammen und griff sich an den Kopf. »Mann! Was soll das?«
»Das war nur eine Warnung. Das nächste Mal wird es richtig schmerzhaft. Also?«
»Immer noch die gleichen Gerüchte, Mann. Ein ziemlich mächtiger Geschaffener, der sich seine eigene Brut schafft. Und der drauf pfeift, was die Fürsten sagen.«
»Wie alt?«
»Keine Ahnung. Ziemlich alt, würde ich meinen.«
»Hat er hier in der Stadt irgendwo ein bevorzugtes Revier?« Er kräuselte die Oberlippe in einem angedeuteten Zähnefletschen, als der Blonde das Gesicht verzog. »Lass mich raten: Du hast keine Ahnung.«