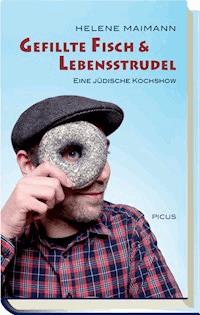Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Paul Zsolnay Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ihre Eltern wollten nach dem Zweiten Weltkrieg eine andere Welt – Helene Maimann über die Kinder der Überlebenden Ein extremes Leben hatten alle ihre Eltern bereits hinter sich: als Kämpfer bei den Internationalen Brigaden in Spanien, in der Résistance und in den Armeen der Alliierten, als Überlebende in einem KZ oder in Sibirien. Andere standen auf Schindlers Liste. Sie waren jüdisch oder kommunistisch oder beides. Nach dem Zweiten Weltkrieg wird die Welt eine andere, das stand für sie fest, als sie in Wien neu anfingen. Ihre Kinder gingen vom Rand der Gesellschaft in ihre Mitte. Viele zählen heute zur kulturellen und politischen Avantgarde. Die Historikerin Helene Maimann ist eine von ihnen. Sie erzählt von ihrer Prägung, aber auch von den Konfrontationen mit der Welt der Eltern, sie erzählt von Hoffnungen und vom Scheitern und von den Freunden Elizabeth T. Spira, Robert Schindel, André Glucksmann u.a.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 469
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch
Ihre Eltern wollten nach dem Zweiten Weltkrieg eine andere Welt — Helene Maimann über die Kinder der ÜberlebendenEin extremes Leben hatten alle ihre Eltern bereits hinter sich: als Kämpfer bei den Internationalen Brigaden in Spanien, in der Résistance und in den Armeen der Alliierten, als Überlebende in einem KZ oder in Sibirien. Andere standen auf Schindlers Liste. Sie waren jüdisch oder kommunistisch oder beides. Nach dem Zweiten Weltkrieg wird die Welt eine andere, das stand für sie fest, als sie in Wien neu anfingen. Ihre Kinder gingen vom Rand der Gesellschaft in ihre Mitte. Viele zählen heute zur kulturellen und politischen Avantgarde. Die Historikerin Helene Maimann ist eine von ihnen. Sie erzählt von ihrer Prägung, aber auch von den Konfrontationen mit der Welt der Eltern, sie erzählt von Hoffnungen und vom Scheitern und von den Freunden Elizabeth T. Spira, Robert Schindel, André Glucksmann u.a.
Helene Maimann
Der leuchtende Stern
Wir Kinder der Überlebenden
Paul Zsolnay Verlag
Übersicht
Cover
Über das Buch
Titel
Über Helene Maimann
Impressum
Inhalt
1
Dapontegasse 3
2
Amarcord
3
Stiege Sieben
4
Die Sirenen
5
Die Kinderjause
6
Picassos Taube
7
Transit. Tumult
8
Der Archipel der Kinder
9
Das rote Plakat
10
Der Müllhaufen der Geschichte
11
Die Spinne
12
Der Schnitter
13
König Oskars Tafelrunde
14
Der goldene Pfau
15
Heldisch leben
16
Herkunftsnachweis
17
The Real Thing
18
Im Reich des Nebels
19
Oper, überall und immer
20
Die Menschenfischerin
21
Café Gagarin
22
Bigger than Life
23
StörenFried
24
Der Singerl
25
An den Wassern der Lethe
Dank
Glossar
Ausgewählte Literatur
Protagonistinnen und Protagonisten
Personenregister
Abbildungsverzeichnis
1
Dapontegasse 3
After midnight, you’re gonna let it all hang out.
J. J. Cale
In der Weihnachtsnacht 2007, in der sich wie jedes Jahr der Freundeskreis von Alexander David traf, um zu essen, zu trinken, zu rauchen, zu reden und die Nacht vorbeiziehen zu lassen, fing das Gespräch über unsere Kindheit an. Im Nebenzimmer thronte der mächtige, bis an die Decke reichende Weihnachtsbaum, frisch geschlagen, traditionell aufgeputzt, zart nach feuchter Tanne duftend. Entlang der Wand war das Buffet angerichtet, faschierter Braten, Erdäpfelsalat, Aufstriche, eine exquisite Käseplatte, Baguette, Schwarzbrot. Daneben Panettone und eine Sachertorte, Gläser, Teller, Fruchtsaft, Wein und Wasser.
Um den langen Holztisch saßen an die zwanzig Gäste, die im Lauf des Abends kamen, um sich für ein oder zwei Stunden oder die ganze Nacht niederzulassen. Die Unterhaltung floss mühelos dahin, wie immer unter Leuten, die sich seit vielen Jahren kennen. Intimeres Zweier- oder Dreiergemurmel, das wieder in ein Tischgespräch mündet, wenn einer anfängt, etwas zu erzählen, ein Zweiter und Dritter es aufnimmt und weiterspinnt, unterbrochen von pointierten Zwischenrufen und Lachen. Es ging um möglichst ausgefallene Geschichten, neue und alte, die, mit dem einen oder anderen Schnörkel versehen, vorgetragen werden wollten.
Robert Horn hatte den größten Heiterkeitserfolg mit einer Geschichte, die alle kannten, einige waren dabei gewesen. Wie kleine Kinder, die sie nicht oft genug hören können, verlangten sie mit »Robert, erzähl uns vom Besuch deiner Mama in der Paulana« eine Reprise.
Er schildert also, wie die komplette Belegschaft der WG Paulanergasse im vierten Wiener Bezirk mit einem gewissen Bangen diesem Besuch entgegensieht und sich, nachdem das schmutzige Geschirr in der Küche abgewaschen, verdächtiges Rauchzeug weggeräumt und die Wohnung ausgiebig gelüftet ist, auf den Matratzen im Gemeinschaftszimmer versammelt. Robert findet es zu kühl, draußen herrschen Minusgrade. Nervös schusselt er beim Einheizen des Ölofens und sprüht eine Zündhilfe hinein, die ihn einnebelt.
Als er das Zündholz anreißt, verwandelt er sich für einen Moment in den biblischen Dornbusch. In diesem Augenblick kommt Mutter Horn bei der Tür herein und starrt auf ihren Sohn, der in eine Feuersäule gehüllt vor ihr steht, beruhigend mit den Händen wachelt und ruft: »Servus Mama, alles in Ordnung, komm nur herein, herzlich willkommen!«
Es ist lang nach Mitternacht, und die meisten Gäste sind weg, als das Gespräch über den Topf anfängt, in dem wir gekocht wurden.
Plakat von Patricio Handl, 1985.
Wir fragen uns, woraus der Kitt besteht, der unsere Freundeskreise zusammenhält. Alle vier, Alexander, seit seiner Kindheit Guki gerufen, Robert, Heinz und ich, wurden nach dem Krieg in Wien geboren. Unsere Eltern waren zuvor anderswo: Roberts Vater im KZ Płaszów und in Oskar Schindlers Emailfabrik, seine Mutter in Auschwitz, Bergen-Belsen und Mauthausen. Gukis Eltern in Moskau, die von Heinz in New York, meine in London. Das reicht für ein komplexes Verhältnis zu dem, was man Heimat und Zugehörigkeit nennt.
Wir sind Kinder von Displaced Persons, Flüchtlingen, KZ-Häftlingen, Widerstandskämpfern, Soldaten in alliierten Armeen. Unsere Familiengeschichte gehört nicht zur Großen Erzählung des Landes, in dem wir aufgewachsen sind. Manche sind noch vor dem Krieg zur Welt gekommen, in Frankreich versteckt in einem Schweinestall wie Jean Margulies oder in einem katholischen Waisenhaus wie André Glucksmann. Andere wurden in der Illegalität geboren, wie François Naëtar in Paris oder Robert Schindel in Bad Hall. Oder in Kasachstan wie Edek Bartz. Ihre Eltern haben Auschwitz überlebt oder sind in Ungarn untergetaucht, wie die von Berta Pixner und Anita Pollak. Schwemmsand mit ungewisser Zukunft.
Was machte das mit unserem Leben? Wir versuchten eine erste Inventur, legten unsere Kindheit wie Dominosteine aneinander und kamen zum Schluss, dass wir schon früh ein herausforderndes Dasein geführt haben. Wir wuchsen auf mit einem leuchtenden Stern über uns, dem roten kommunistischen oder dem blauen jüdischen oder beiden. Sind vom Rand der Gesellschaft in ihre Mitte gegangen und haben an ihren Schrauben gedreht. Das Land, in dem wir aufgewachsen sind, hat uns weder Beachtung geschenkt noch Fesseln angelegt. Wir kamen überallhin, wo es uns hingezogen hat — in die Wissenschaften, in die Medizin, die Kultur, die Wirtschaft, in die Schulen und Medien. Niemand hielt uns auf. Wir hatten einen Pass, mit dem wir überallhin reisen konnten. Es gibt nichts zu bedauern. Wir hätten, wenn überhaupt, auch anderswo zur Welt kommen und es vielleicht besser, aber auch viel schlechter treffen können.
Die bestimmenden Figuren des zwanzigsten Jahrhunderts griffen tief in unser Leben ein. Wenn wir diese Herrschaften an Gukis Tisch luden, dann saßen hier, nur zwei oder drei Handschläge entfernt, Josef Stalin, Georgi Dimitroff, Mao Tse-tung, Charles de Gaulle und Franklin D. Roosevelt. Und Winston Churchill, ohne den wir nicht auf der Welt wären. Und auch nicht ohne die vielen Schindlers, die im entscheidenden Moment ein Leben retteten.
2
Amarcord
Tatsächlich werde ich jedes Mal, wenn ich in Rimini bin,von Gespenstern angefallen, die eigentlich schon archiviert, eingeordnet sind.
Federico Fellini, Mein Rimini
Der Kindergarten am Lainzer Platz in Wien-Hietzing sieht heute noch aus wie damals, nur die graue Fassade ist inzwischen abgeblättert. Die Tante hat für das Faschingsfest einen Kopfschmuck aus Kreppapier gebastelt. Noch spüre ich ihre sanfte Hand, die sich über meine Augen legt, wenn die Kinder sich auf den kleinen geflochtenen Betten niederlegen, die am Nachmittag aufgestellt werden. Sofort schlafe ich ein. Ein Zaubertrick.
Ich kehre nur zögernd in das Lainz der frühen Kindheit zurück. Es hat sich wenig geändert. Der Dorfplatz, die Straßenbahn, die Gemeindebauten, die Villen, die Kastanienalleen und der Rote Berg, die Kirchenglocken, die Verbindungsbahn, die den Westen Wiens mit dem Süden und Osten verknüpft, das Läuten der Schranken, bevor sie sich ächzend senken, das Rattern der Güterzüge. Federico Fellini sagt, die Rückkehr in die frühen Jahre sei wie ein selbstgefälliges Wiederkäuen von Erinnerung, ein theatralisches Unternehmen von trüber Faszination. Eine Dimension von Erinnerung, nicht die Erinnerung selbst. Was habe ich erlebt, gehört, überschrieben, geträumt, gelesen in den papierenen Überbleibseln? Zwanzig Jahre lagen sie im Souterrain, ohne dass ich einen Blick hinein gemacht habe. Jetzt kommt Lainz wie ein Ufo auf mich zu und landet mit sanftem Fauchen im Garten. Heraus steigen meine jungen Eltern, die Familie, ihre Freunde. Ich bin ihnen lange aus dem Weg gegangen. Dabei wohne ich mein halbes Leben nur einen Steinwurf entfernt von der Lockerwiesensiedlung, der letzten Großtat des Roten Wien.
Die Lockerwiese ist eine richtige Kleinstadt, mit Parks, Stiegen, Plätzen, Bäumen, Wiesen, Geschäften. Dazwischen schmale Fußwege, die sich durch die Reihenhäuser winden, jedes mit Küche, zwei Zimmern unten, drei oben, Badezimmer. Das Kind sitzt auf einer Decke im winzigen Hof neben seiner Badewanne, ein mattsilbriges Blechschaff mit Henkeln. Die Mutter plaudert mit dem Ehepaar Swoboda, dazwischen wachsen große Birnen am Spalier. Gehen die Eltern ins Kino, ist die Oma Swoboda da oder Frau Parisek, ein altes Weiblein im dunklen Kleid, in deren Küche es nach Zichorienkaffee und Äpfeln riecht.
Einmal nimmt eine Nachbarin das Kind an der Hand, »komm, ich zeig dir was Schönes«, führt es durch den Torbogen hinaus in die Versorgungsheimstraße. Herunter schaukelt langsam ein Zug von fein angezogenen Leuten. Feierliche, blecherne Musik. Vorne Mädchen, von Kopf bis Fuß weiß gekleidet, mit Kränzen und Schleiern und Blumenkörben. Buben mit weißen langen Hemden und schwarzen Röcken, dahinter ernste Männer in schwarzen Anzügen und Fahnen mit Borten. Zwei Herren mit weißen Kleidern. Sie haben vorne einen Umhang mit einem großen Kreuz und schwenken Kessel, aus denen Rauch dringt. Ein Herr in einem langen, prächtigen Kleid unter einem großen Stoffdach hat ein großes goldenes Gerät in den Händen, das wie eine Sonne aussieht. Um ihn herum Männer, die das Dach mit Stangen tragen. Niemand spricht oder lacht. Viele Leute auf dem Gehsteig, die Männer ziehen den Hut, als das Dach vorbeikommt, die Frauen schlagen ein Kreuz. Das Kind zieht mit einem Ruck seine Hand heraus, dreht sich um und läuft zurück. Es gehört nicht hierher.
Hinter dem Torbogen beginnt das sichere Terrain, im Geviert mit den Gärten, dem Hof und der Rückseite des Kinos. Das Kind hat eine Negerpuppe unterm Arm, das war damals modern, mit roten Lippen und Klapplidern über den starren Augen. Sie ist namenlos, schwer und ungeliebt. Irgendwann wird die Schwarze an der Kinowand deponiert und erfolgreich vergessen. Wenn der Vorführer im Sommer die Lüftungsklappen aufmacht, hören die angrenzenden Häuser den Film mit. An einem Nachmittag sitzt das Kind darunter und hört wunderbare Musik, schläft ein, wacht auf, schläft wieder ein, das Gesicht heiß von der Sonne. Niemand stört es. Jahre später sehe ich »Fantasia« von Walt Disney und erinnere mich, wo ich diese Musik gehört habe, an die warme Kinomauer, die Hitze des Nachmittags. Das Kino hat einem Supermarkt weichen müssen, sonst ist alles wie einst.
Im Wohnzimmer steht die gusseiserne Singer-Nähmaschine mit goldfarbenen Verzierungen auf dem Näharm und einem Tretantrieb. Darauf fertigt die Mutter Korsagen und Badekostüme, mit einer raffinierten inneren Konstruktion für stärkere Damen, und Kleider aus weißem Musselin für das Kind, mit Flügelärmeln und einer großen Masche am Rücken. Das Rattern der Singerin durchzieht das Häuschen wie ein feiner Geruch. Am Nachmittag kommen die Kundinnen zur Anprobe. Neben dem Nähtisch steht ein hoher Schemel, darauf ein Tablett mit der Teekanne, dem Krug für heißes Wasser, dem Milchkrüglein mit der Aufschrift Take a little Cream, alles aus rahmfarbenem Steingut. Daneben Zuckerdose und Teeschalen. Der Kessel meldet sich. Die Mutter nimmt Kanne und Krug, geht in die Küche und zelebriert ihre Teezeremonie: Den Pot mit kochendem Wasser ausspülen. Zwei Fingerspitzen Tee hineingeben. Aufgießen. Drei Minuten ziehen lassen, umrühren, warten, bis sich die Teeblätter gesenkt haben. Etwas Milch in die Schalen, ein Sieb auflegen, den Tee langsam eingießen. Ein Löffel Zucker. Umrühren, auf den Tee blasen.
Zu Hause ist England, vor der Tür ist Wien. Lainz ist weit weg von Krieg und Zerstörung. Niemand verliert ein Wort darüber. In den Gärten wachsen Obst und Blumen, regelmäßig donnert ein Zug vorbei, mit lautem Pfeifen, wenn er sich den Bahnschranken nähert. Rund um die Kirche kleine Läden, der Pfarrhof, das Restaurant Eder.
Ich bin gut in dieser Welt gelandet, umgeben von Onkeln und Tanten, die mich wie ein Schutzmantel von der Düsternis fernhalten. Die feuchte Enge des Nachkriegs, die eisigen Nächte in den Häusern neben den Schutthalden, die Krüppel, die verhärmten Frauen, die abgerissenen Kinder sind anderswo, nicht hier. Dass ich weder Oma noch Opa habe und die Onkel und Tanten keine Verwandten sind, fällt mir nicht auf. Immer sind Leute um mich herum, junge Leute, mein Vater ist dreiundzwanzig, als ich geboren werde.
In der Kindheit scheint sommers und winters die Sonne, ein Gnadenakt der Erinnerung. Mir fällt dazu die Rodelbahn am Roten Berg ein und der Himmel über dem tiefblauen Millstätter See. Mein fünfter Geburtstag, der dort gefeiert wird. Das Käppchen mit dem Kärntner Wappen, das ich geschenkt bekomme. Der Geruch des frischen Striezels zum Frühstück, die saure Milch mit Erdbeeren und Zucker am Abend, dazu ein Butterbrot. Der holzgefütterte Herd in der Küche, auf dem die Haustochter die Töpfe herumschiebt. Die Wolken von auf und ab schwirrenden blauen Schmetterlingen über den Wiesen, und dass ich damals mein Herz an Berge und Almen und Wälder und Seen verloren habe.
Dann müssen meine Eltern das Paradies verlassen. Etwas ist vorbei und kommt nicht wieder. Der Vater löst mit einem Schraubenzieher vorsichtig das gläserne Schild von der Haustür ab und wickelt es in Zeitungspapier.
»Was steht da drauf?«
»Da steht, dass die Mama hier einen Miedersalon hat. Gehabt hat. Geh hinein und hol dir eine Weste. Wir fahren in die neue Wohnung.«
Meine Eltern und ich, Frühling 1952.
Im Wohnzimmer stapeln sich Bündel und Koffer. Die Mutter schlichtet ihr Werkzeug und Nähzubehör in eine große Schachtel: Maßbänder, eines für Yard und eines für Zentimeter, Zwirne, Nähseiden, Garnrollen, Fischbeine, Fingerhüte, das Nähkissen, Stecknadeln, die große Schneiderschere, die flache fettige rosa Kreide zum Anzeichnen der Änderungen, dünner Schaumgummi, Ösen und Schließen und zwei Rollen Köperband. Darauf legt sie Gaze, Schnittmuster aus Packpapier und zusammengelegte Atlasstoffe in Schwarz, Weiß und Rosa.
»Die Singerin kommt auch mit?«
»Es ist wenig Platz, aber es wird sich schon ausgehen.«
Sie richtet sich auf und stemmt die Hände ins Kreuz. Sie hat einen dicken Bauch, bald kriege ich einen Bruder oder eine Schwester.
»Wirst du weiter für die Damen nähen?«
Sie schüttelt den Kopf.
Nie wären wir von dort weggegangen, sagte sie noch viele Jahre später. Diese Vertreibung kam sie hart an, härter als die erste, große. In der Lockerwiese waren Freunde aus der Emigration und Genossen. Der endgültige Abschied von England, das ihr Leben gerettet hat.
Franziska Feigl Reiss wird Frieda und später Friedl gerufen, weil es in der Lassallestraße 6 eine zweite Franziska gibt. In jedem Stock summen die Nähmaschinen, ein Schneiderinnenhaus. Ihre Mutter, Sura Gitel, geborene Hochman in Bukaczowce, nahe Iwano-Frankiwsk, damals Galizien, heute Westukraine, flüchtet im Ersten Weltkrieg mit ihrem Mann Israel Reiss, einem Hebräischlehrer, nach Wien, lange, bevor sich die große Finsternis über Europa ausbreitet. Sie arbeitet für die kleinen Theater in der Wiener Leopoldstadt, der Mazzesinsel. Ein Drittel der Wiener Juden lebt hier, zwischen Donaukanal und Donau. Wenn wieder einmal in letzter Minute ein Kostüm geändert werden muss, läuft sie atemlos die Stiegen hinunter, um es abzuliefern. Ihr Mann Israel ist früh gestorben. Friedl ist ihr Tochterschatz, ihr Ein und Alles. Ein braves Kind, hilft in der Küche und in der Schneiderei, lernt, wie man Maß nimmt, ist mit Stoffen, Heftzwirn, Schere und zwei Probierpuppen aufgewachsen, ein wohlgeratenes, ein gutes Kind, aber so dünn, so dünn!
Sura führt eine koschere Küche, doch am Freitagnachmittag setzt sie sich über die Essensgebote hinweg und geht mit ihrem Friedale über den Donaukanal in die elegante City, zu Schinken Sauer in der Wipplingerstraße. Friedl genießt das Schauspiel, das der Ladengeselle veranstaltet, wenn er zeremoniös mit dem langen schmalen Messer die Scheiben vom hausgemachten Beinschinken herunterschneidet, mit extrabreitem Speckrand, der ist das Wichtigste, sie in zwei frische Semmeln legt und herüberreicht. Iss, mein Kind, sagt Sura, der Doktor hat gesagt, du darfst, du sollst. Sie kommen rechtzeitig nach Hause, um den Tisch für Schabbes zu decken und die Kerzen anzuzünden.
Friedl ist neunzehn, als endlich ihr Dienstmädchen-Visum aus England eintrifft, eine andere Möglichkeit zur Flucht gibt es nicht. Sie hat einen Gesellenbrief als Miedermacherin, die Zeugnisse einer Kochschule und von englischen Sprachkursen. Aber das wäre alles nutzlos gewesen, hätte nicht ihre Freundin Erna Apisdorf ihr Foto nach Epsom mitgenommen, ein Studiofoto, sehr teuer, aber die Zeit drängt. Erna legt es oben auf einen Stapel anderer Fotos und fragt herum, wer ein Hausmädchen braucht. »Diese hier nehme ich«, sagte Mrs. Lyon. Friedl steigt im Mai 1939 in den Zug. In Epsom bittet sie Erna, ihren Dienstherrn, einen Dr. Scott, zu beknien, eine weitere Garantie zu stellen, für Sura, als Köchin. Was immer ihm Erna über Suras Küche erzählt hat, er fackelt nicht lange und unterschreibt. Friedl ist glücklich. Das nötige Englisch wird Sura schon lernen.
Aber meine Großmutter will ohne ihren zweiten Mann nicht gehen. Du musst auch den Vater herausholen, schreibt sie, ich kann ihn doch nicht zurücklassen! Aussichtslos. Erna weiß Bescheid. Sie vermittelt viele Domestic Permits, um Frauen aus Wien herauszuhelfen. Nur wenige Ehepaare erhalten ein Visum. Moses Leib Lewenkron ist Ende fünfzig, für ihn gibt es keine Arbeit und keine Einreise. Friedl versucht, ihre Mutter umzustimmen. Sura lässt nicht locker. Vielleicht findet sich eine Hilfsorganisation, die für ihn ein Altersheim findet? Sie verfasst einen flehenden Brief an Mrs. Lyon, ihn als Hausmeister aufzunehmen, näht für sie ein Dirndl, als ob in England irgendeine Frau ein Dirndl tragen würde, und schickt es mit einem Tiegel Marillenmarmelade nach Epsom, läuft auf das Konsulat, erledigt die langwierige Ausreiseprozedur, spart jeden Pfennig. Alles ist gepackt, die Pässe liegen bereit — und dann lässt sie die Frist für die Ausreise verstreichen. Für den alten Herrn Löwenkron gibt es kein Permit, also bleibt Sura. Dann überfällt die Wehrmacht Polen, es ist Krieg, die Tür fällt zu. Dreißig Jahre später sagte meine Mutter, damals konnte ich die Mama nicht verstehen, heute schon.
Sura schreibt ihr einen Brief nach dem anderen, auf dünnem, federleichtem Papier, über Mailand, wo Erna Verwandte hat, und nach New York, wohin Friedls Stiefbruder Adolf 1940 geflüchtet ist. Besorgte, unruhige, fahrige, schließlich verzweifelte Briefe. Ihre Schrift wird unleserlich, gebrochene Sätze, unzusammenhängende Worte, in höchster Not hingekritzelt. »Feigale, mein Goldenes, mein einziger Sonnenschein auf der Welt, mein süßes Pupperl, schreib mir, schon wochenlang keine Nachricht von Dir, wieso schreibst Du nicht? Hast Du von Joschi Post? Ich nicht, drei Wochen schon. Du wirst doch auf ihn warten? Du weißt ja, was einem bestimmt ist, bleibt einem nicht aus. Er wird bald ein Schiff besteigen nach Palästina. Bitte antworte, lass uns nicht so lange zappeln auf ein Schreiben, das ist unser einziger Trost.«
Im Sommer 1941 steht Friedl hinter der Schank des Woodman in Ashtead, unweit von Epsom, zapft Bier, mild oder bitter oder gemischt, und lässt die Gläser sanft zu den Gästen rutschen. Sie hat den Job gewechselt. Es gefällt ihr hier. Der Pub ist nach Feierabend voll und laut. Die Leute reden übers Wetter, das wieder einmal scheußlich ist, über die Familie und die Nachbarn, am liebsten aber über ihre ehemaligen Favoriten bei den Pferderennen. Den Krieg ignorieren sie, so gut es geht. Während der Bombenangriffe rücken sie keinen Inch von ihrem gewohnten sozialen Leben ab. Kracht es, schauen sie kurz hoch, ob die Decke Risse bekommt, und rühren sich nicht vom Fleck. Zu Friedl halten sie freundliche Distanz. Nie fällt ein böses Wort, auch wenn diese junge Frau aus dem Hunnenland kommt, gegen das England im letzten Krieg seine besten jungen Männer verloren hat. Unter den Gästen Kriegsversehrte, die stumpf in ihr lauwarmes Ale starren, manche mit tiefen Narben quer über den Kopf, die sie im Grabenkampf von einem deutschen Spatenhieb kassiert haben.
Friedl hat immer wieder Veteranen durch die Straßen von Epsom schwanken gesehen. »Poor souls«, sagte Mrs. Lyon. »God knows, how many shellshocked we have.« Sie haben Verdun und Flandern überlebt, zwischen Gasangriffen und einschlagenden Granaten. Keine sichtbaren Verletzungen, kein Schrapnell hat ihnen das Gesicht zerfetzt. Sie sind wie vom Schlag gerührt. Manche erwischen eine Pistole und schießen sich das Hirn weg. Ausgebrannt, sprachlos, gehörlos, mit zuckendem Gesicht, von Schütteln und Panikanfällen gequält, tasten sie sich die Hauswände entlang. Friedl schreckt sich vor ihnen. Um Epsom liegt ein Cluster von Spitälern, Long Grove, Horton, Manor, St. Ebba’s, Ewell, in denen diese armen Seelen Aufnahme gefunden haben. Die Ärzte bemühen sich, aber es gibt keine Heilung. Sich vorzustellen, wie es ihnen jetzt ergeht! Epsom liegt direkt in der Einflugschneise der deutschen Luftwaffe. Sie bombardiert den Bahnhof, die Häuser, die Spitäler und greift mit Tieffliegern alles an, was sich bewegt. Tag und Nacht heulen die Sirenen. Einmal taucht eine Messerschmitt hinter der Kirche auf, geht nieder und rast über die Stadt hinweg, verfolgt von einer Spitfire. Die Leute auf der Straße spritzen auseinander. Dann ein Knall. Der Deutsche wurde abgeschossen. Quer über die Wiesen liegen Panzersperren aus Beton. Neben der Kirche sind riesige Suchscheinwerfer aufgebaut, die berühmte Pferderennbahn ist von tiefen Gräben durchzogen, um Landeversuche zu verhindern.
Friedl musste aus Epsom weg. Als Flüchtling, sagte der zuständige Polizeiofficer, ist sie hier nicht mehr sicher. Wer weiß, ob die Deutschen nicht doch irgendwann landen. Sie hat großes Glück mit dem Woodman und Mr. Henry Samme und seiner Familie, die den Pub betreiben. Alle mögen our Frieda. Sie gehört dazu. Aber Suras Briefe zerren an ihren Nerven. Die Wohnung mit der Werkstatt ist futsch, die Lewenkrons sind bei fremden Leuten einquartiert, Novaragasse 20.
Aus New York kommen schlechte Nachrichten. Moses Lewenkron soll nach Polen abgeschoben werden. Suras letzter Brief erreicht sie im August 1941. »Friedale, mein teures geliebtes Herzenskind, mein Liebstes auf der Welt, mach Dir keine Sorgen.«
Zugleich erreicht sie ein schrecklicher Brief aus Mauritius. Ihr Joschi, die erste große Liebe, ist nicht mehr. Ich hatte einen Freund in Wien, sagte sie einmal. Er war auf Mauritius und ist gestorben. An Malaria. Mehr erzählte sie nicht, sie erwähnte auch nie seinen Namen. Aber es war nicht Malaria.
Joseph Marode geht am 3. September 1940 mit kleinem Gepäck zur Donau und besteigt an der Reichsbrücke die Schönbrunn, zusammen mit neunhundert Wiener Juden. Sie gehört zu einem Konvoi von vier Schiffen, die zum Schwarzen Meer hinunterfahren. 3600 Juden aus Österreich, Deutschland und der Tschechoslowakei, die alle nach Palästina wollen. Männer, Frauen, Kinder. Die Zentralstelle für jüdische Auswanderung in Wien unter Adolf Eichmann orchestriert dieses Projekt. Je mehr Juden aus dem Deutschen Reich verschwinden, desto besser. Außerdem bringt es die Briten in Schwierigkeiten, ein nützlicher Nebeneffekt.
Es ist das größte illegale Fluchtunternehmen aus Europa während des Krieges. Joseph hat lange auf diese Gelegenheit gewartet. »Meiner zukünftigen Palästinenserin im Jänner 1939. Zum Andenken. Von Joschi Marode«, schrieb er auf die Rückseite des Fotos, das er Friedl verehrte. Dann strich er das »Meiner« durch und verbesserte es auf »Der«, als ahnte er, dass er seine Liebste jetzt nicht fest an sich binden konnte. Ein gutaussehender Bursche mit dichtem Haarschopf, oben angezogen wie ein Kibbuznik mit Ausschlaghemd und Umhängetasche, unten mit Kniebundhosen, weißen Strümpfen und Haferlschuhen, um sich auf der Straße die SA vom Leib zu halten. Er will in einem Kibbuz die Wüste zum Grünen bringen. Für ein Zertifikat der Jugendalijah war er mit neunzehn schon zu alt, als die Deutschen in Österreich einmarschierten, also wird er es illegal versuchen. Die Reise ist riskant, er hat gehört, dass die Briten eine Blockade verhängt haben und die Flüchtlingsschiffe abfangen. Aber er muss weg, vielleicht ist es die letzte Chance.
In Tulcea, Rumänien, warten bereits drei Schiffe, die Atlantic, die Pacific und die Milos. Joseph wird mit zweitausend anderen Flüchtlingen in die Atlantic gepfercht, ein uralter Kahn, der unter der Flagge von Panama fährt. Die Reise entwickelt sich zu einem Alptraum. Nur acht Toiletten, nach einer Woche bricht Typhus aus. Jeden Tag sterben Kinder. Die kleinen Leichname müssen von ihren Eltern ins Meer geworfen werden. Zweieinhalb Monate dauert die Irrfahrt. Jede Anlandung kostet hohe Bestechungssummen, und nirgendwo dürfen die Passagiere an Land gehen. Endlich, am 25. November, sehen sie den Berg Karmel. Haifa! Großer Jubel, dann der Schock. Das britische Militär verweigert die Ausschiffung. Im Hafen warten bereits die resignierenden Flüchtlinge der zwei anderen Schiffe. Die Briten haben sie auf einen alten Liner, die MS Patria, verfrachtet, um alle Passagiere des Konvois zu deportieren. Plötzlich eine Explosion. Die Hagana, die zionistische Untergrundorganisation, hat im Bauch der Patria eine Bombe gezündet, um ihre Ausschiffung zu verhindern, eine verpfuschte Aktion. Anstatt manövrierunfähig zu werden, geht die Patria unter wie ein Stein, und mit ihr dreihundert Menschen. Rettungsboote fischen die Überlebenden aus dem Wasser.
Von Palästina sieht Joseph nur Baracken und Stacheldraht, während sich ein wochenlanges Hin und Her zwischen London und Jerusalem entspinnt. Sura schreibt ihrer Tochter Ende November, dass der liebe Joschi schon in Erez gelandet ist. »Leider haben wir keine Post von ihm, nun, mein Liebstes, kränk dich nicht deswegen, der liebe Gott wird dir und uns allen helfen, Hauptsache, er ist schon dort.«
Doch das Colonial Office fährt eine harte Linie. Es schlägt vor, die Illegalen zurück nach Europa zu schicken und die Schiffe unterwegs zu versenken. Winston Churchill schaltet sich ein, verhindert das und handelt einen Kompromiss aus. Nur die Überlebenden der Patria dürfen in Palästina bleiben. Joseph wird mit 1580 Überlebenden des Konvois in die britische Kronkolonie Mauritius deportiert und in eine Festung gesperrt, die einst Napoleon gebaut hat. Mit ihnen reist der Typhus. Kaum angekommen, bricht er neuerlich aus. Drei Wochen später ist Joseph tot.
Der jüdische Friedhof Saint Martin südlich von Port Louis, hoch über dem Indischen Ozean, zählt 126 Gräber. Die ersten dreißig wurden im Jänner 1941 angelegt, darunter das von Joseph Marode. Sein Grab ist mit einer schlichten Steinplatte belegt, darüber der traditionelle halbrunde Grabstein, darauf sein Name. Es ist das einzige Grab von den vielen Verlorenen meiner Eltern, von dem ich weiß, wo es liegt.
Martin Maimann, Bubi gerufen, ist gerade fünfzehn, als er von seiner Mutter Adele, geborene Lewin, mit dem ersten Kindertransport nach England geschickt wird. Sein Bruder Max ist einundzwanzig und während des Novemberpogroms mitten in seinem Heimatbezirk Brigittenau von der SA gekidnappt und nach Dachau deportiert worden. Seine Schwester Miriam, Mädi genannt, hat ein Zertifikat für Palästina in der Tasche. Im nächsten Februar wird sie siebzehn, sie muss bald weg, sonst verfällt das kostbare Papier. Auch Martin hat ein Zertifikat.
Aber Adele wartet nicht ab. Sie setzt alles in Bewegung, um ihren Jüngsten in Sicherheit zu bringen. Ich stelle mir vor, wie sie ihn in der Nacht zum 10. Dezember 1938 zum Westbahnhof bringt, den Koffer abgibt, Martin in der Abfahrtshalle an sich drückt und nicht loslassen kann, ihn noch einmal küsst und zusieht, wie er von einer großen Kinderschar verschluckt und langsam von ihr weggetrieben wird, ein schmaler Bub mit weit aufgerissenen Augen. Zum Bahnsteig darf sie ihn nicht begleiten. Um Mitternacht verlässt der Zug Wien.
Großmutter Sura Gitel
Großmutter Adele
Am 18. Dezember landet Martin im Kitchener Camp, einem Transitlager in Kent, und wird dort von einem walisischen Automechaniker abgeholt. Der gute Mann inspiziert zunächst seine Habseligkeiten, ein Fotoalbum, die Geburtsurkunde, seine Schulzeugnisse, einige Kleidungsstücke und eine gewebte Decke, und kauft ihm lange Hosen, die ersten seines Lebens. Dann lässt er sich von seinem Schützling bewegen, für seinen Bruder Max eine Garantie auszustellen. Noch ist das Zeitfenster offen. Die Behörden hindern niemanden, das Deutsche Reich zu verlassen, ohne Eigentum, Geld und Wertsachen selbstverständlich und wenn ein polizeiliches Führungszeugnis, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung und ein Pass vorliegen. Die britischen Quoten sind knapp, aber Max als KZ-Häftling erhält das Permit. Als er im März 1939 aus Dachau zurückkommt, hat Miriam gerade noch Zeit, ihn zu umarmen, bevor sie den Zug nach Triest nimmt und ein Schiff nach Haifa besteigt. Sie wollte nicht weg ohne Abschied vom geliebten Bruder. Max verlässt Wien drei Monate später.
Adele atmet auf. Sie weiß allerdings nicht, wie sie ohne Max durchkommen wird. Er war ihre große Stütze. Ihr Ehemann, mein Großvater Israel Maimann, baute in den zwanziger Jahren einen blühenden Handel mit Stoffabschnitten und Schneiderzubehör auf. Ein unruhiger Geist, ein Herumtreiber, ein Spieler, der mit anderen Frauen anbandelte. Mitte der zwanziger Jahre ließ er seine Familie im Stich. Adele verlor nie wieder ein Wort über ihn. Sie verließ ihre Anstellung in einer Schiffsagentur, übernahm einen Teil seines Geschäfts und brachte die drei Kinder und ihren alten Vater Lewin damit durch, bis es nach dem Börsensturz 1929 zusammenbrach. Was davon übrigblieb, klaubte der fünfzehnjährige Max auf und erwies sich als unerwartet tüchtig. Er holte mit einem Pferdegespann ganze Säcke mit Tuchresten von den großen Konfektionären ab und verkaufte sie an kleine Schneidereien weiter. Ein Fetzenhandel, enorm wichtig für arme Leute, wenn sie einen Anzug, einen Mantel oder ein Kleid brauchten.
»Wir waren genauso arm wie sie«, erzählte meine Tante Miriam. »Aber gehungert haben wir nicht. Maxi war ein Raufbold, der nicht wusste, wohin mit seinen Energien. Mama hatte schon Angst, dass er so ein Hallodri wird wie ihr Geschiedener. Aber dann stellte sich heraus, dass er ein geborener Unternehmer war.«
Adele schreibt jeden Tag. Ihre Post reist von einem zum anderen, nach New York und Mailand, wird gelesen, beantwortet und nach Wales und Palästina weitergeschickt. Sie berichtet, wer auf gepackten Koffern sitzt oder gerade weggefahren ist. Sie hofft und wartet auf das Visum nach England. Die Briefe gehen in diesem Sommer 1939 zwischen ihren Kindern, drei Schwestern, zwei Brüdern und drei Nichten hin und her, die schon heraus sind aus dieser Hölle des Wartens. Das Bubeli, schreibt sie an Miriam, wohnt jetzt bei Herrn Atkin in Swansea, der sich väterlich um ihn kümmert, und legt einen Shilling auf den anderen. »Er hat mir 45 Reichsmark geschickt, unser großer Schwerverdiener, und einen Rabbiner aufgetrieben, der sich um mein Permit bemüht, was sagst Du dazu, Mädi? Ob das klappt?« Sie lernt fleißig Englisch, denn es muss klappen. »Ich korrespondiere mit dem Kind only in English language, lernst du auch Englisch, Mädika?« Sie legt eine Kochprüfung ab, mit Vorzüglich, und träumt, bei einem Lord zu arbeiten, lässt ihre Zähne richten, kauft sich einen neuen Mantel, ist rastlos, will alles stehen- und liegenlassen.
Max treibt einen Posten auf, als Cook General, Mädchen für alles, schickt den verheißungsvollen Fragebogen und setzt in London alle Hebel in Bewegung, um ihr Visum zu beschleunigen. Am 27. August ist ihr Akt im Home Office. In drei Wochen ist es so weit, schreibt sie an Miriam, so Gott will. Aber Gott entscheidet anders. Am 3. September 1939 verkündet Premierminister Neville Chamberlain über die BBC, »that this country is at war with Germany«.
Was jetzt? Adele schränkt sich ein, wo es geht. Um sie herum wird es leer. Der Krieg vernichtet ihre Hoffnungen. Sie arbeitet als Schreibkraft in einer Druckerei, versucht, ihre Angst zu verbergen, überlegt, eine Schiffskarte nach Palästina zu erwerben, ohne Zertifikat, aber das kostet achthundert Reichsmark, woher soll sie die nehmen? Sie hat nicht die Mittel und den Mut, allein aufzubrechen. Wohin soll sie auch gehen? Uruguay, Shanghai? Sie macht sich keine Illusionen. Unbezahlbar. Nichts hält sie in Wien. Ihr Vater, der alte Moses Lewin, ein frommer Gottesfürchtiger, der entweder in der Synagoge oder über seinen heiligen Büchern saß, ist im Jänner 1939 gestorben. Er war während des Ersten Weltkriegs mit sieben Kindern aus Czernowitz geflüchtet. Zuerst hatte er seine Frau Klara verloren, dann seine Heimat. Die Deportation von Max nach Dachau brach ihm das Herz.
Adele mit den großen blauen Augen, den dunklen Brauen und den vollen, energischen Lippen, die sie ihren drei Kindern und einigen Enkeln und Urenkeln vererbt hat, auch meinem Sohn Philipp, resigniert. Sie muss ihre Wohnung verlassen und wird mit einem Koffer zu einer Frau Kaufmann in die Rotenlöwengasse eingewiesen. Eine Sammelwohnung. Sie wartet nicht mehr auf ein Wunder, nur mehr auf die Briefe ihrer Kinder. Ihre Nichte Sofie muss zunächst ihre Mutter Mina herausholen. Dann wird sie versuchen, der Tante zu helfen. Daran glaubt Adele nicht mehr. »Mein geliebtes, teures Bubeli«, schreibt sie Ende Juli 1941 an Martin, »wie bin ich glücklich, dass Du Deine Prüfung schon so gut bestanden hast mit dem Führerschein. Ich wünsche Dir recht viel Glück dazu, der liebe Gott sei immer mit Dir und behüte Dich. Mein Goldkind, ich bitte Dich, gib gut acht, fahre vorsichtig und aufmerksam.« Nachher kommt kein Brief mehr.
Im Herbst 1945 ersucht Martin sein schottisches Regiment, nach Wien versetzt zu werden, um nach meinen Großmüttern zu suchen. Ein halbes Jahr später trifft er ein, findet sie nicht und hofft, dass sie irgendwo überlebt haben. Schließlich erfährt er, dass Adele im Mai 1942 nach Izbica deportiert wurde und Sura drei Monate zuvor nach Riga. Keine Nachricht, unbekannter Aufenthaltsort. Wien ist eine wüste, leere Stadt. Zweihunderttausend Juden scheinen niemandem abzugehen. Ihr Hab und Gut ist aufgeteilt, in ihren Wohnungen und Häusern leben andere Leute, tempi passati, so ist das eben.
Der zwanzigste Wiener Bezirk, die Brigittenau, ist nicht wiederzuerkennen. Martin läuft durch ein Ruinenfeld. Die Straßen mit den ärmlichen Arbeiterquartieren sind menschenleer, die Fenster der noch halbwegs intakten Häuser mit Brettern verbarrikadiert. Die Friedensbrücke, über die er und Miriam so oft gelaufen sind, um auf der anderen Seite in den Donaukanal zu springen, ist inzwischen von Pionieren der Roten Armee geflickt worden. Er geht hinüber zur Pappenheimgasse, sucht das Bethaus des Großvaters, findet es nicht, dann in die Kluckygasse, wo die prächtige Synagoge mit den zwei Zwiebeltürmen stand, in der er seine Bar Mizwa gefeiert hat. Nichts mehr davon ist zu sehen außer ein leeres, von Schutthaufen übersätes Grundstück. Das Zinshaus in der Burghardtgasse 4, in dem er aufgewachsen ist, liegt in Trümmern. Im Bezirksamt weiß keiner der verhungert aussehenden Beamten, ob es hier noch Juden gibt. Und auch sonst ist niemand mehr da, den er kennt.
Viele Jahre später, im Festsaal meiner Schule, als ich in einem Weihnachtsspiel den unfreundlichen Herbergswirt gebe, begegnet ihm im Publikum sein früherer Mathematiklehrer. Ein großer, hagerer Herr, der mir nach der Vorstellung gerührt die Hand reicht. Ich wende den Blick ab. Jeder Kontakt zur Kindheit meines Vaters ist mir versperrt.
Kaum ist Martin in der Fasangarten-Kaserne, dem Headquarter der Britischen Armee, stationiert, holt er meine Mutter nach Wien. Sie haben sich im Sommer 1943 kennengelernt und im Frühjahr darauf geheiratet, bevor sein Regiment, die Royal Scots, 1944 oversea ging. Er hat den ganzen Feldzug mitgemacht, durch Belgien, Holland und Deutschland, ist verschüttet worden, hat die Rheinüberquerung überlebt und als Übersetzer gearbeitet. Er hat seinen Krieg gegen das Naziregime gewonnen. In diesen Jahren der Bewährung, wie er sie nannte, ist mein Vater Kommunist geworden, zum Missvergnügen von Max, der inzwischen sein Unternehmen neu gegründet hat, mit nichts in der Hand als derselben Geschäftsidee wie in Wien. Max versucht, den Bruder in London zu halten und mit ihm die Firma aufzubauen. Aber Martin hat eine andere Vision von Zukunft.
Friedl kehrt als Soldatenfrau im April 1946 zurück, im Gepäck die Aussteuer, die ihr Sura nach England mitgegeben hat, Bettwäsche und Tischtücher, und englisches Geschirr. Lainz mit seinen Hügeln, Wiesen und Wäldern, dörflich und elegant zugleich, ist ein wahr gewordener Traum. Wie Martin ist sie in einer räudigen Mietskaserne groß geworden und überglücklich, in die Lockerwiese einzuziehen. Sie erhalten von der britischen Militärverwaltung in der Egon-Schiele-Gasse eines der vierzig arisierten Häuser, dessen Mieter, Herr Moriz, nach dem »Anschluss« hinausgeworfen wurde und in Südafrika überlebte.
Friedl und Martin Maimann in Venedig, 1946.
Jahrelang fuhr die Mutter mit mir nach Lainz zu unserem Hausarzt Franz Graf, Obersanitätsrat, wirklicher Hofrat und zuständig für die Häfenbrüder im Polizeigefangenenhaus, zu denen er eine gewisse amikale Beziehung pflegte (das hieß, er duzte sie, nahm sich Zeit und hörte sich ihre Geschichten an, bevor er sie untersuchte), und zu unserem Zahnarzt Moritz, ein Doktor Eisenbart mit einem riesigen Tretbohrer hinter sich. Er schaute in den Mund, kratzte mit einem Haken herum, eine Schrecksekunde, dann klopfte er mir auf die Wange und sagte: »Zumachen.« Zu meiner Mutter: »Geben S’ dem Kind nur schwarzes Brot zu essen. Hartes schwarzes Brot! Das ist das Beste. Keine Zuckerln!« Dann drehte er sich zu mir und deutete auf den Bohrer. »Brav Zähne putzen, ja? Zweimal am Tag mindestens! Besser dreimal. Und immer Hände waschen nach dem Klogehen.« Ich schlug verschämt die Augen nieder, er lachte dröhnend.
In die Nachbarschaft von früher ging die Mutter nie mehr, auch nicht, als sie ihre letzten Jahre bei mir verbrachte, einen Katzensprung von der Egon-Schiele-Gasse entfernt. Dort war wieder der nach dem Krieg delogierte und dann entnazifizierte Nazi eingezogen. Er hatte das Haus von der Gemeinde Wien zurückgefordert und bekommen. Es war nicht unbekannt, dass mein Vater Kommunist war und sein Abschied von der britischen Armee Jahre zurücklag. Da war eine Rückstellung schnell erledigt.
Ein grauer Nachmittag im Spätwinter, ich stehe mit meinem Vater in einem dichten Gedränge am Praterstern. Rundherum Häuser mit dunklen Fensterhöhlen, dahinter wie hohle Zahnstümpfe die Ruinen des Nordbahnhofs. Es ist kalt und neblig. Eine Stimme kommt aus einem Lautsprecher. Die Menschen schweigen, viele weinen. Der Vater beugt sich herunter. Ein großer Mann ist gestorben, sagt er leise. Wer? Er nimmt mich fester an der Hand. Josef Stalin. Zum ersten Mal höre ich den Namen.
3
Stiege Sieben
Jeder erfindet sich früher oder später eine Geschichte, die er für sein Leben hält.
Max Frisch
Elf Jahre wohnten wir im Gemeindebau. Die Wohnung lag im dritten Stock und war für damalige Verhältnisse geräumig und komfortabel. 56 Quadratmeter, Küche, ein grün gefliestes Bad mit Wanne (Sonderanfertigung), Klo, Vorzimmer und drei Zimmer mit Bretterboden, Terrazzo in den Nassräumen und in der Küche. Im Wohnzimmer stand ein hoher Ofen aus Gusseisen, daneben der Kokskübel und eine Schachtel mit Briketts, Unterzündholz und ein Stapel alter Zeitungen. Die Mama wickelte ein Brikett und etwas Holz in Zeitungsblätter ein, drehte lange Papierröhren zusammen und knickte sie, befüllte damit den Ofen durch die obere Klappe und warf brennende Streichhölzer hinterher. Knacken und leises Flackern. Dann schüttete sie den Koks dazu und rüttelte vorsichtig mit einem Haken den Feuerrost über der Aschentür. Ab und zu öffnete sie die obere Tür, um Luft zuzuführen. Auf der Ofenplatte stand ein Topf mit Wasser, das sich im Lauf des Tages erwärmte und eine schwache Dampffahne ausatmete.
Später ersetzte ihn ein Gasofen, der mit einem Schalter bedient wurde. Das herausströmende Gas und das kurze Fauchen, wenn die Flammen hinter dem Gitter aufwallten, gehören in das Archiv der verschwundenen Geräusche. Im Kinderzimmer stand ein kleiner Koksofen mit einer schmiedeeisernen Abdeckung, auf die ich, wenn nicht gerade eingeheizt war, gerne stieg, um vor einem imaginären Publikum laut aus meiner jeweiligen Lektüre vorzulesen. Ohne »Ist der Ofen fest zu?« und »Ist das Gas abgedreht?« fiel die Wohnungstür nicht ins Schloss. Das Schlafzimmer der Eltern war ungeheizt und vollgeräumt. Gebrauchte Möbel aus den dreißiger Jahren, zwei Kästen, vor dem Fenster die Singerin, neben der Tür Mutters Psyche, ihr Frisiertisch mit Spiegel und einem Hocker davor und kaum Platz, sich umzudrehen. Das Doppelbett mit den dicken Tuchenten im Winter, wie kleine Schneehaufen. Abends wurde die Tür etwas geöffnet, um diese Eishöhle zu temperieren.
Vor den Fenstern weitete sich der Himmel, viel Grün, keine grauen Fassaden. Das war dem Vater das Wichtigste. Das Fenster im Kinderzimmer ließ er vergittern, weil er Angst hatte, wir könnten hinausfallen. Das schaute von unten arg aus, wie der Affenkäfig im Tiergarten Schönbrunn. Wenn ich es mir am offenen Fenster bequem machte, die Beine angezogen, ein Buch auf dem Schoß, vergaß ich den Anblick. Manchmal höre ich, dass wieder ein Kind aus dem Fenster gefallen und gestorben ist. Dann denke ich an Papa und sein Risikomanagement.
Die Eltern hatten weder das Geld noch die Möglichkeit, lange zu überlegen. In Wien herrschte große Wohnungsnot. So verschlug es sie nach Altmannsdorf wie auf eine Insel, an den südlichen Stadtrand, weit weg von ihren Freunden und deren Kindern. Die Wohnung, die ihnen als Ersatz für die Lockerwiese angeboten wurde, war eindeutig ein Abstieg nach der Lainzer Idylle. Aber sie war nagelneu, und nur das zählte.
Der Gemeindebau bestand aus sieben Stiegen um zwei Höfe mit der obligaten Sandkiste und zwei Klopfstangen neben den Mistkübeln. Drei Blöcke wie Kasernen hintereinandergestellt. Im Keller Abteile für Kohle und Koks und eine Waschküche mit großem Kessel. Daneben Bottiche zum Einweichen und Ausschwemmen, eine Rumpel und eine Wringe. Mama und ich schleppten den Waschkorb auf den Dachboden. Im Sommer drückte ich das Gesicht in die steif getrockneten Leintücher, die durch die offenen Dachluken nach Wind, Sonne und Holzfirnis rochen, und zog tief ihren Duft ein. Das Wohnzimmer ging auf eine große Gärtnerei hinaus, die mich magnetisch anzog. Ich trieb mich schon früh in den Glashäusern herum, durfte Blumentöpfe mit einer Kreppmanschette umwickeln, die fette schwarze Erde umgraben und die Hühner füttern. Der freundliche Gärtner ließ mich machen, daraus wurde eine lebenslange Passion. Manchmal kam ich mit ein paar Eiern nach Hause, mein erstes Honorar.
Die Küche blickte auf eine ausladende Genossenschaftssiedlung, von dem bedeutenden Architekten Josef Frank entworfen und ihren Bewohnern vor dem Krieg selbst erbaut. Wir kicherten, wenn uns das erzählt wurde, denn bedeutend kam sie uns nicht vor. Hinter den kleinen Häusern lagen lange schmale Gärten mit Obstbäumen, dazwischen verliefen Wirtschaftswege, auf denen die Kinder herumstrawanzten. Waren die Herzkirschen reif, machten die Buben eine Räuberleiter, einer sprang über den Zaun und fladerte ein paar Handvoll, packte sie in ein verrotztes Taschentuch, verknotete es und warf es hinüber. Dann wurde die zweite Räuberleiter gemacht, um den kühnen Helden zurückzuholen. In der Siedlung wohnte auch mein Schulfreund Wolferl Matschnig. Im Sommer öffnete er sein Kasino, gut bestückt mit Roulette, Canastakarten und DKT — Das kaufmännische Talent —, die heimische Version von Monopoly. Viele Nachmittage wurden dem Spielfieber geopfert. Wir hätten mit echtem Geld nicht leidenschaftlicher zocken können. Hauen und Stechen, Täuschen und Abwarten. Wenn es zu laut wurde, kam Frau Matschnig herein und beruhigte die Gemüter mit Mannerschnitten.
Auf einer großen Wiese unweit meiner Volksschule standen ausrangierte Eisenbahnwaggons, in denen Obdachlose wohnten, Zigeuner, sagte man. Sie stehlen kleine Kinder, bleibt ja weg von dort! Daneben ein Ringelspiel, von zwei Ponys gezogen, und eine Schießbude, aber wir trauten uns nicht hin. Zu groß war die Angst vor den Kinderverzahrern. Ab und zu kamen zwei Musikanten in unseren Hof, ein Geiger und ein Sänger. Die Mutter wickelte dann zwanzig oder dreißig Groschen in ein Stück Zeitungspapier und warf sie vom Fenster hinunter. Der Sänger, ein Mann mit schwarzem Schnauzbart und einem dunklen Gesicht, zog den Hut und hob das Geld auf. Er hatte eine hohe, schneidende Stimme, und es klang unheimlich, wenn er sang: »Schön ist so ein Ringelspiel.« Er sang natürlich »Schee is so aa Ringlschpüüü«, denn der Wiener Dialekt besteht vor allem aus langgezogenen Vokalen. Auch der Messerschleifer kam regelmäßig vorbei, und ein Herr István, der Kleinmöbel anbot, das Stück um fünf Schilling. Zwei Schemel, in Wien Stockerl genannt, habe ich noch. Sie werden mich überleben.
Altmannsdorf mit seinen geduckten Häuserzeilen entlang der Breitenfurter Straße, die ihre Schäbigkeit bis heute bewahrt hat, den Hinterhöfen, Gärten, Wiesen und Feldern mit Hasen hatte durchaus seine Meriten. In der Hoffingergasse lag das Grabeland, ein überwuchertes Gemüsefeld aus der Kriegszeit, mit hohem Gebüsch und Kratern, Spielplatz für die Kinder am Tag und die jungen Liebespaare bei Nacht. Daneben erstreckte sich ein Dschungel, umgeben von einer hohen Mauer, mit See und Urwald und Lianen, wie wir hörten, und wildem Getier, wie wir mutmaßten. Ein Schloss gehörte auch dazu. Darin wohnte wie ein alt gewordenes Dornröschen die sagenhafte Baronin, die keiner je zu Gesicht bekam. Daneben der Khleslplatz mit Kirche, Pfarrhof, Wirtshaus und dem Tierschutzhaus. Wenn wir ein Stück altes Brot für die Pferde mitbrachten, durften wir hinein und uns die Hunde und Kätzchen ansehen. Nach der anderen Seite erstreckte sich Brachland, gesäumt von Straßen, die noch immer An der Froschlacken und An den Eisteichen heißen. Hier begann sich das Schöpfwerk auszubreiten, ein riesiger Sozialbau. Er hatte nicht den besten Ruf, wegen der wilden Buben, die dort wohnten.
Wir stromerten im Viertel umher, um zu schauen, was sich abspielt. Wenige Autos, dafür noch Pferdefuhrwerke. In der Hetzendorfer Straße betrieb ein Hufschmied sein Gewerbe. Das Tor stand offen, im Hof loderte die Esse, wenn er die Rösser frisch beschlug. In der Auslage des Motorradgeschäfts Ecke Elsniggasse standen Tritonroller mit Weißwandreifen, unerreichbar für die Buben, die sich davor drängten. Es gehörte dem mürrischen Herrn Gfrerer, immer ein schwarzes Netz über dem schütteren Haar. Ohne eine Miene zu verziehen, reparierte er kaputte Dreiradler und rüstete Roller mit Sitz, Pedalen und Kette auf. Gegenüber stand ein Bauernhof, aus dem das Muhen von Kühen und unruhiges Gegacker drang und im Sommer ein penetranter Schweinestallgeruch. Keuchte ein Fuhrwerk, hochbeladen mit Heu, die Breitenfurter Straße herauf, warteten wir, bis das Tor aufging. Allein wie der Kutscher unter vielen Flüchen den Gaul wendete und im Rückwärtsgang in den Hof dirigierte, war das Warten wert.
Wie überhaupt immer und überall gewartet wurde. In erster Linie auf die Straßenbahn, deren Fahrplan ein Mirakel war. Sie ging, hieß es, wie die Uhr der Simmeringer Wasserleitung. Simmering war noch viel mehr Vorstadt als Altmannsdorf, gerüchteweise gab es keine funktionierende Wasserleitung. Zuerst tröpfelte sie und stieß irgendwann mit einem Knall das Wasser aus. Dieses ungewisse Zeitmaß galt auch vor den Strandbädern an der Alten Donau, wenn der Ansturm losging. Das umständliche Prozedere an den sechs Kassen des Gänsehäufels, von denen grundsätzlich nur zwei geöffnet waren und vor denen sich ein Tausendfüßler aus mit Decken, Handtüchern, Taschen mit der Fourage und Luftmatratzen bepackten Vatis, Muttis, Tanten, Onkeln und Omas sowie Knäuel von quengelnden Kindern zentimeterweise vorwärtsbewegte, um den nach Alter, Tageszeit und vorgelegtem Ausweis unterschiedlich bemessenen Eintrittspreis vorgerechnet zu bekommen, ging fließend in das Anstellen bei der Schlüsselausgabe über. In geringeren Dimensionen dehnte und krümmte sich der Wurm, bereits in Badekleidung und Schlapfen, vor den Zapfstellen mit Milch, Bier, Wurstsemmeln und Eis. Kleinere Würmer standen vor der Trafik und den Toiletten. Für einen Amtsweg musste man ohnehin einen halben Tag einrechnen, und auch auf der Post dauerte es entsprechend, wenn der Beamte sich gerade einen Kaffee auf dem Gasrechaud wärmte oder ächzend aufstand, um nach einem Paket zu suchen. Warten auf den Briefträger, der, wenn er am Monatsanfang die Pensionen auszahlte, ziemlich lange brauchte, um die sieben Stiegen zu absolvieren, weil er häufig auf einen Schnaps und ein Tratscherl eingeladen wurde. Warten auf das Knacken in der Leitung, bis das Vierteltelefon endlich frei war.
Das ewige Warten darauf, dass etwas passierte, was das Einerlei unterbrach und dem Tag Sinn und Inhalt geben könnte, führte gelegentlich zu Spontanbekundungen von Herzensgüte und Empörung. Einmal wurde ich auf dem Heimweg von einem Hund angesprungen, der mir mit der Pfote einen tiefen Kratzer im Gesicht verpasste. Ich fiel hin und blieb halb besinnungslos liegen. Sofort versammelten sich mitfühlende Passanten, halfen mir wieder auf und hielten Hund und Herrl fest. Der Hund bekam eins auf die Nase und heulte, auf das Herrl prasselte der Volkszorn nieder. Einer lief zur Frau Vykoukal, die in ihrer Drogerie ein Telefon hatte und meine Mutter anrief, ohne sie zu erreichen, ein anderer holte die Frau Schediwy, unsere Hausmeisterin, und zwei Herren gingen auf die Polizei, die den hässlichen Köter samt seinem Besitzer verhaftete und uns unter großer Anteilnahme des Publikums auf die nächste Wachstube eskortierte. Dort ließ ich die erste Amtshandlung meines Lebens über mich ergehen, die aus der Aufnahme der Personalien durch den Herrn Inspektor und einer Bestätigung meiner Identität durch die Hausmeisterin bestand, schließlich war ich ein Kind und meinen Angaben nicht zu trauen. Dann warteten wir auf den Polizeiarzt.
Draußen vor der Tür passten die Leute auf den Hund auf, der, angebunden an eine Laterne, wütend auf und ab sprang und einen Höllenlärm veranstaltete. Drinnen lamentierte das Herrl, dass sein Wotan sonst immer brav bei Fuß gehe. Endlich traf der Polizeiarzt ein, ließ Wotan in den Kotter sperren und verständigte einen Veterinär, um ihn auf Tollwut untersuchen zu lassen. Dann versorgte er meinen Kratzer mit Jod, gab mir eine Tetanusspritze und ließ aus dem Gasthaus nebenan ein Himbeerkracherl mit einem Strohhalm bringen. Ich saß auf der Armensünderbank im Vorraum, trank in kleinen Schlucken und genoss mit wachsendem Interesse die Aufregung um mich herum. Inzwischen hatte die Hausmeisterin meine Mutter erreicht. Als die Mama etwas atemlos ankam, wurde sie von der wartenden Menge mit tröstenden und aufmunternden Zurufen empfangen.
Endlich war es so weit. Der Herr Inspektor spannte ein Formular mit drei Durchschlägen in die Schreibmaschine und nahm meine einsilbige Schilderung des Anschlags samt weitschweifigen Ergänzungen der anwesenden Zeugen auf. Mama unterfertigte das Protokoll, dann warteten wir auf den Tierarzt, der den Hund samt seinem geknickten Herrl in die Quarantäne des Tierschutzhauses verbringen ließ. Uns schickte er zum Amtsarzt, um mir vorsorglich eine Tollwutimpfung verabreichen zu lassen. Und jetzt kam das Beste: Ein funkelnagelneuer Streifenwagen fuhr uns hin, und um mir und sich selbst eine Freude zu machen, schalteten die Beamten das Signalhorn ein. Als wir am späten Nachmittag heimkamen, hatte die gute Frau Schediwy die Wäsche aufgehängt und ein Stück Guglhupf, säuberlich in Papier eingeschlagen, vor unserer Wohnungstür deponiert.
Überhaupt, das Hausmeisterpaar Schediwy! Ohne sie wäre Anarchie ausgebrochen. Die Kinderhorden trafen sich im oberen Hof, der untere gehörte den Pensionisten. Zu den Mutproben zählte ekstatisches Schielen (verboten, weil dabei die Augen steckenbleiben würden), Turnen auf der Klopfstange (verboten, dazu war sie nicht da), heimliches Herumdrücken im Keller, wo die Buben sich gegenseitig und manchmal auch uns Mädeln ihr Zumpferl zeigten (schwer verboten). Keine zugekackten Wiesen, weil Hunde nicht erlaubt waren. Der Abfalleimer wurde im Coloniakübel ausgeleert, außer am Sonntag, weil am Tag des Herrn nicht gestattet. Die Pest der Graffiti-Schmierereien lag in ferner Zukunft. Geschrei war nur bis zu einer gewissen Lautstärke erlaubt, und ins Gras steigen überhaupt nicht. Wenn der grantige, von Branntwein umwehte Herr Schediwy herausstürzte, machten wir uns aus dem Staub. Seine kleine, vergrämte Frau mit den knotigen Beinen war eine herzensgute Seele. Ihr wurden die Schlüssel gebracht, um nach uns zu schauen, wenn die Mutter unterwegs war.
Ich bin in wilden Zeiten auf die Welt gekommen. Wien war übersät von Ruinen und schwer beschädigten Häusern, dennoch überschaubar im Vergleich zu den vielen völlig zerschmetterten Städten Europas. Die Menschen hatten zu essen, Verwaltung und Versorgung funktionierten halbwegs, das Land stabilisierte sich. Aber der Krieg hatte nicht einfach aufgehört. Es herrschte Nachkrieg. Endlose Flüchtlingsströme mäanderten quer über den Kontinent, auf der Suche nach einem sicheren Ort, Essen, einem Dach über dem Kopf. Weite Gebiete in Ostpreußen, Schlesien und Pommern waren verlassen, totes Land mit leeren Bauernhöfen. Hunderttausende Waisen streunten wie verwilderte Hunde durch Süd- und Osteuropa, stahlen und bettelten. Wenn sie Glück hatten, nahm sie eine Familie für eine Weile auf. Wenn nicht, gingen sie im Winter zugrunde.
Der stille Winkel am Stadtrand, in dem ich aufwuchs, war weit weg von diesem Schrecken. Meine Eltern vertrauten der Medizin und der Wiener Gesundheitspolitik. Ich erhielt jede Impfung, die angeboten wurde. Das war in meiner Volksschule nicht selbstverständlich. Manche Kinder hausten unter ärmlichsten Bedingungen, in Schrebergartenhütten oder Kellerwohnungen. Einige Buben trugen dunkle Hosen und Jacken aus uraltem Zeug. Ihre Eltern standen Kinderkrankheiten stoisch gegenüber. Sie waren unvermeidlich. Die Schule war ein Ort der Fürsorge, wo Kinder täglich einen Viertelliter Milch bekamen und unsere Lehrerin, die wunderbare Emma Hafner, ihnen außer Lesen, Schreiben und Rechnen auch Zähneputzen und das Händewaschen nach dem Klo beibrachte. Die Schulärztin untersuchte uns auf TBC, klebte einmal im Jahr ein quadratisches Pflaster auf die Brust und sah nach zwei Tagen nach, ob die Tuberkelprobe aufgegangen war. Weit verbreitet waren Masern, oft von schweren Mittelohrentzündungen begleitet, Röteln, Feuchtblattern und Mumps. Brach in einer Klasse Scharlach aus, war ungewiss, ob das Kind es überstand. Es wurde sofort in die Infektionsabteilung eines Spitals gebracht und blieb dort sechs Wochen unter strenger Quarantäne. Die Schule wurde geschlossen und desinfiziert. Der Geruch des hölzernen Klassenbodens, der regelmäßig mit Karbol eingelassen wurde, ist unvergesslich. Auch die Flasche mit Lebertran, ein Esslöffel täglich, um Rachitis vorzubeugen. Und die Angst der Eltern vor Polio.
Polio ist nicht heilbar. In den fünfziger Jahren paralysierte und tötete Polio Jahr für Jahr eine halbe Million Kinder. Die Zeitungen brachten Fotos von Kindern in der Eisernen Lunge, die regungslos in der riesigen Röhre liegen mussten, weil sie nicht selbständig atmen konnten. Dieses grässliche Ding, aus dem nur der Kopf des Kindes herausschaute, mit dem Spiegel darüber, damit es sein Gesicht sehen konnte! Lähmungen, die den kleinen Körper erstickten oder verkrüppelten! Als die Salk-Impfung zu haben war, bekam ich sie sofort ins Hinterteil, dreimal hintereinander.
Unser Milieu, das heißt: die kommunistischen Rückkehrer, wurde von zwei Kinderärztinnen betreut, die aus der Emigration mit der Überzeugung zurückgekommen waren, dass Impfungen und Hygiene die beiden Säulen der modernen Medizin sind: Olga Kurz und Gertrude Kreilisheim. Tante Olga war während des Krieges in London, Tante Gerti in New York. Sie hatte in Harlem an einer Kinderklinik gearbeitet und betrieb nach ihrer Rückkehr eine Kassenpraxis, absolvierte zehn Visiten am Tag und ging abends zu den Donauschiffern, um ihre Kinder zu untersuchen und zu impfen. Auch Tante Olga zirkulierte zwischen Kinderambulatorium, Praxis und Hausbesuchen. Sie war für ihre barsche Tonart bekannt und duldete keinen Widerspruch, wenn es um das Wohl der Kinder ging. Einmal schickte meine Mama sie zu einem Nachbarsbuben, der hohes Fieber hatte. Sein bellender Husten war bis auf den Gang zu hören. Tante Olga untersuchte das Kind, verständigte die Rettung und ordnete an, die Wohnung zu desinfizieren. Ihr Blick war düster, als sie nachher bei uns eine Tasse Tee trank. »Der Bub hat Diphtherie«, sagte sie, »und eine engstirnige Mutter. Sie hat das Kind nicht impfen lassen. Der Karli wird von allein damit fertig, hat sie gesagt. Hast du schon so was gehört? Der Karli wird sterben, wenn die Diphtherie ihm den Hals zuschnürt.« Dann rief sie das Gesundheitsamt an, um den Fall zu melden, warf den Wintermantel über und eilte weiter.
Mama verließ die Wohnung nur, um einzukaufen, den kleinen Bruder in den Kindergarten zu bringen und abzuholen, zum Friseur zu gehen und Besorgungen zu machen. Aber wenn sie mit Papa ausging, zu Empfängen oder ins Theater, verwandelte sie sich in eine Dame, frisch frisiert und erstklassig angezogen.
Die Eltern hatten einen Schneider, einen ungarischen Juden, der im Untergrund überlebt hatte. Manchmal begleitete ich Papa am Sonntagvormittag zu den Anproben. Herr Singer, ein großer, schweigsamer Mensch, umkreiste ihn langsam, mit Stecknadeln zwischen den Lippen, hob hier, zupfte da, hielt diesen und jenen Knopf an den Stoff. Er galt als schwierig, weil er sich wenig sagen ließ und ewig für einen Anzug brauchte. Der sonst so ungeduldige Vater nahm es gelassen hin. Menschen, erklärte er, die ein schweres Leben mit sich herumschleppen, sind halt schwierig.
Herr Singer nähte auch für Mama, Mäntel und Kostüme. Sie war eine schöne Frau und der sanfteste Mensch, den ich je kennengelernt habe, fügsam ihrem Mann gegenüber, ausgleichend und freundlich, zurückhaltend in ihren Ansprüchen, ohne ein lautes Wort, aber nicht unterwürfig. Ganz anders der Vater. Er war ebenso gefühlvoll und warmherzig wie autoritär und aufbrausend und hatte einen Hang zum Starrsinn, aber wenn es darauf ankam, strahlte er Ruhe und Entschlossenheit aus. Auf ihn war immer Verlass. Er war der Fixstern, um den sich ihr Leben drehte, ein ergebener Ehemann, der alles tat, um es ihr so angenehm wie möglich zu machen, nach seinen Maßstäben natürlich. Er trug sie auf Händen, und sie hielt sein wechselhaftes Temperament aus und dass er bestimmte, welche Kleider sie fürs Bessere trug.
Jeden Morgen stand sie als Erste auf, zündete die Gasflammen in der Küche an, damit es warm wurde, röstete den Toast, denn das Frühstück war englisch, machte Sandwiches für die Schule und wandte sich dann dem Haushalt zu. Ich hatte nie den Eindruck, dass sie unter ihrem Dasein litt. Ihre Wertschätzung als Hausfrau war hoch. Mama hatte eine tüchtige Helferin, die Oma Swoboda aus der Lockerwiese, mit schneeweiß gewelltem Haar und abgearbeiteten Händen, aus denen dicke Adern wuchsen. Sie übernahm das Bügeln und Sockenstopfen und übernachtete auf der Couch, wenn die Eltern ausgingen, hatte unsere Schlüssel und eine eigene Lade mit Nachthemd, Bettzeug und einem Waschbeutel. Gutgelaunt breitete sie eine alte Decke und ein Leintuch im Wohnzimmer über den Esstisch, um beim Bügeln Radio zu hören, das war ihr das Liebste.
Oma Swoboda