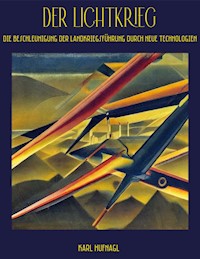
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Im Zeichen der Zeitenwende findet eine Reorientierung zu einer Politik der militärischen Stärke statt. Gleichzeitig schreitet die technische Entwicklung weiter voran und wirft die Frage auf, wohin sich die Kriegsführung entwickelt. Dieses Buch soll für einen Teilaspekt zukünftiger Streitkräfte Anregungen und Orientierung bieten. Die Rahmenbedingungen der Landkriegsführung werden von dem Wechselspiel der Potentiale von Feuer und Bewegung vorgegeben, die wiederum Ausdruck der technischen Entwicklung sind. In einer tiefgehenden historischen Analyse wird der Verlauf dieser Potentiale nachgezeichnet und ein Ausblick auf die nahe Zukunft eröffnet. Im Ergebnis überwiegt das Feuer deutlich, was kostspielige Abnutzungskriege begünstigt. Der Lichtkrieg schildert in einer konkreten Vision, wie demgegenüber mit der innovativen Kombination von neuen Technologien zu einem ganzheitlichen militärischen Konzept die Bewegung wieder aufgewertet werden kann. Damit bietet er eine Lösung zur Herstellung zukünftiger militärischer Überlegenheit, die der Abschreckung, sowie der Erfüllung unserer Sicherheitsversprechen unseren Europäischen Partnern gegenüber dient.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 282
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
EINLEITUNG
DAS VERHÄLTNIS VON FEUER UND BEWEGUNG
Bewegung im Ersten Weltkrieg
Feuer im Ersten Weltkrieg
Überwinden des Stellungskrieges
Zwischenkriegszeit und Zweiter Weltkrieg
Kalter Krieg
Vom Ende des Kalten Krieges bis heute
DIE BEWEGUNG WIEDER AUFWERTEN
Naheliegend: leichtere Kampffahrzeuge
Notwendig: Landfahrzeuge hinter sich lassen
DAS UNIVERSALFLUGOBJEKT
Allgemeines über Multikopter
Allgemeines über Hubschrauber
Synthese aus den Anforderungen
FÄHIGKEITEN DES FLIEGENDEN GROßVERBANDES
Kommunikation
Aufklärung
Führung
Kampf
Logistik
OPTIONEN FÜR OPERATIONEN
Der Luftkrieg
Die feindliche Luftwaffe
Unterdrückung feindlicher Flugabwehr
Offensive Operationen
Luftlandungen
Rotationsoperation
Lichtblitz
ZUSAMMENFASSUNG
LITERATUR
EINLEITUNG
Nachdem Deutschland sich bequem im vermeintlichen Ende der Geschichte eingerichtet hatte, rief Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine die Geister der Vergangenheit auf brutale Weise zurück. Nun hilft lamentieren niemandem weiter, wir müssen den Tatsachen ins Auge sehen: „Die Geschichte“, verstanden als Logik von Großmachtgebahren und als Recht des Stärkeren, ist zurück. Das Militärische und Geopolitische ist wieder eine Kategorie der Politik, doch die deutsche Regierung und auch die deutsche Gesellschaft stehen demgegenüber mehr oder weniger unvorbereitet da, materiell sowieso, aufgrund früheren mangelnden Interesses aber auch intellektuell. Um das Ruder herumzureißen reicht daher ein Geldsegen alleine nicht aus, sondern das Militärische muss auch denkerisch bearbeitet werden. Die deutsche Verantwortung für die Sicherheit unserer europäischen Verbündeten ist dabei zu wichtig, um diese Frage allein den Generälen zu überlassen, sie geht alle etwas an. Deshalb soll dieses Buch ein Angebot darstellen, einen Beitrag zur Debatte über unsere äußere Sicherheit und die unserer Verbündeten zu leisten.
Dieses Buch möchte eine neue Manier von Landoperationen vorstellen, welche in der Zukunft möglich sein werden. Für diese wurde der Name Lichtkrieg gewählt, nicht nur, weil Laser eine große Rolle darin spielen, sondern auch, weil das leitende Prinzip das der größtmöglichen Geschwindigkeit ist, sowohl physisch, als auch mental und organisatorisch. Die Sprache in diesem Werk ist bewusst einsteigerfreundlich gehalten, weil Militärs die Angewohnheit haben, durch Abkürzungen, Akronyme und Fachsprache Eintrittsbarrieren zu ihrem Diskurs zu errichten, die nicht notwendigerweise hilfreich dabei sind, einen fachlichen Austausch mit der Öffentlichkeit zu fördern.
Um ein besseres Verständnis für diese Probleme bei der Leserschaft auszubilden, wird an erster Stelle eine historischen Abhandlung über die Verhältnisse von Feuer und Bewegung vom Ersten Weltkrieg bis heute dargelegt. Wer sich hierfür nicht interessiert oder gleich zum Punkt kommen möchte, kann diesen Teil gerne überspringen. Danach folgt eine kurze Prognose der wahrscheinlichen Entwicklung westlicher Landstreitkräfte, mit der bestimmte aktuelle Probleme angegangen werden sollen. Auch dieser Teil kann, so man möchte, übersprungen werden, was jedoch nicht empfohlen wird. Dann fängt die eigentliche Argumentationskette an. Ausgehend von den bis dahin geschilderten Problemen und Lösungsansätzen werden diese Lösungsansätze als ungenügend verworfen und eine praktikable Lösung wird Stück für Stück entwickelt, bis sie sich vor dem Auge der Leserschaft zu einem sinnvollen Ganzen gefügt haben wird
Dieses Ganze ist eine zukünftige Lösung für ein Problem der Zukunft, nämlich eine mögliche neue Art der militärischen Operationsführung auf dem Gefechtsfeld von morgen. Doch die Zukunft ist bekanntlich ungewiss.
Umso wichtiger ist es, durch gründliches Nachdenken für etwas mehr Klarheit zu sorgen. Vollständige Klarheit freilich wird erst durch die Gegenwart geschaffen, wenn die Zukunft schon eingetreten ist. Doch dann ist es bereits zu spät dafür, noch etwas zu verändern. Die Zukunft ist jedoch ungewiss, gerade weil sie offen ist. Das bedeutet, dass wir selbst die Zukunft verändern können, indem wir auf sie einwirken und uns so gut wie möglich für diese aufstellen. Natürlicherweise arbeitet man hin zu einem Szenario, das als positiv wahrgenommen wird, damit einem später nicht der leere Trost bleibt: „Es ist, wie es ist“.
Andere wollen die Zukunft ebenfalls bearbeiten, aber ihre Analysen und Zielvorstellungen mögen von den eigenen abweichen, weil sie andere Interessen und eine andere Weltsicht und damit auch ein anderes Bild von der Zukunft haben. Wegen dieser Vielfalt an Zukunftsentwürfen spricht man auch von Zukünften im Plural. Die Herausforderung ist es nun, sich in dem Dickicht der Komplexität der vielen auch miteinander konkurrierenden Zukünfte zurechtzufinden und dabei klar den eigenen Weg zu erkennen.
Paradoxerweise muss man hierfür zuerst in die Vergangenheit schauen, wie der Historiker Reinhart Koselleck feststellt:
„Prognosen sind nur möglich, weil es formale Strukturen in der Geschichte gibt, die sich wiederholen, auch wenn ihr konkreter Inhalt jeweils einmalig und für die Betroffenen überraschend bleibt. Ohne Konstanten verschiedener Dauerhaftigkeit im Faktorenbündel kommender Ereignisse wäre es unmöglich, überhaupt etwas vorauszusagen."1
Die Fähigkeit zur Analyse, zur Prognostik, zur Planung und schließlich auch zum Handeln ist essenziell wichtig. Sie wächst in ihrer Bedeutung mit der Tragweite im Falle des Versagens. Ganz besonders ist dies bei der Kriegsführung der Fall. In diesem Sinne wollen wir uns an Sun Tsu, einen zeitlosen Klassiker, erinnern: „Die Kunst des Krieges ist für den Staat von entscheidender Bedeutung. Sie ist eine Angelegenheit von Leben und Tod, eine Straße, die zur Sicherheit oder in den Untergang führt. Deshalb darf sie unter keinen Umständen vernachlässigt werden.“2 Wenn in Deutschland dieser Satz vor der „Zeitenwende“ allseits Befremden ausgelöst haben mag, so ist die historischgeopolitische Privilegierung, der diese Naivität allein entspringen kann, eigentlich ein Grund zur Freude. Diesen Menschen sei ein Gespräch mit unseren europäischen Nachbarn in Polen oder Litauen empfohlen. Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine scheint jedoch bei vielen in dieser Hinsicht zu einem Umdenken geführt zu haben, für abschließende Bewertungen ist es allerdings noch zu früh.
Das Grundgesetz jedenfalls hält es mit Sun Tsu, wenn es in Artikel 87a GG heißt: „Der Bund stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf.“ Hinter dem harmloser klingenden Begriff Verteidigung steht gedanklich jedoch die potentielle Kriegsführung. Ein Krieg fängt schließlich erst an, wenn sich die Angegriffenen verteidigen. Die Angegriffenen führen dann Krieg, auch wenn sie dies nicht gewollt haben. Sie haben schließlich in einer solchen Verteidigungssituation das vitalste Interesse, sich ihrer gegebenen Mittel im Kampf zu bedienen, um sich gegen den Angreifer durchzusetzen. Dies ist nach Clausewitz die Kriegskunst im eigentlichen Sinne, die nicht besser als mit dem Namen Kriegsführung bezeichnet werden könne.3
Es ist notwendig, sich bereits vor einem Verteidigungsfall bestmöglich auf diesen vorzubereiten und geeignete Mittel für diesen zu schaffen, dies ist der Auftrag unseres Grundgesetzes. Alle solchen Tätigkeiten zur Schöpfung der Streitkräfte, also Aushebung, Bewaffnung, Ausrüstung und Übung, werden von Clausewitz als Kriegskunst im weiteren Sinne bezeichnet4 und um diese drehen sich die hier ausgebreiteten Überlegungen. Die Kriegskunst ist eine Kunst, weil sie in ihrer Gesamtheit keine kalte Wissenschaft, sondern ein menschliches Unterfangen ist, aber nicht, weil sie zu den schönen Künsten zählen würde. Das Betrügen oder das Hacken von Computersystemen könnte man schließlich im hier gemeinten Wortsinne auch als Kunst ansehen.
Der wichtigste Dienst unserer Streitkräfte ist ihr Beitrag zur Abschreckungsfähigkeit der NATO, um die Bundesrepublik und unsere europäischen Verbündeten schützen zu können und in der Kostenkalkulation von möglichen Aggressoren militärische Gewalt unattraktiv erscheinen zu lassen. Kämpfen können, um nicht kämpfen zu müssen, ist in dieser Beziehung ein häufig genannter, weil treffender Sinnspruch. Da sich die Kriegskunst im steten Wandel befindet, gilt es, um kämpfen zu können, nicht den Anschluss an diese Entwicklung zu verpassen. Doch in Zeiten von immer schneller auftretenden technologischen Neuerungen, die meistens aus dem zivilen Wirtschaftsleben kommen, erscheint der Pfad, den die Bundeswehr eingeschlagen hat, von Zaudern und Unsicherheit geprägt. Anstatt mutig und kühn anhand der vorhandenen (oder bald vorhandenen) Technologiebausteine eine Vision zu entwerfen, hat man den Eindruck, dass lieber die Ideen der Verbündeten, vornehmlich aus den USA, rezipiert werden. Ja, die Zukunft ist ungewiss, doch der Umgang mit der Notwenigkeit von rascher Veränderung ist in Deutschland ungenügend. Hier bedarf es einer grundlegenden Reform, denn die Welt wartet nicht auf die Bundeswehr, potentielle Gegner schon gar nicht. Um ein klein wenig Licht ins Dunkel zu bringen, sollen diese Ausführungen zeigen, wie sich Teile der Kriegskunst entwickeln können, wenn man stattdessen souverän diese Herausforderung annimmt. Es soll hier also ein Vorschlag für die Kriegsführung der Zukunft ausbuchstabiert werden.
Diese Ausführungen haben jedoch nicht den Anspruch, jede Facette der zukünftigen Kriegskunst bzw. der zukünftigen Ausrichtung von Streitkräften zu untersuchen, das könnten sie auch gar nicht leisten, sie sind bewusst unterkomplex gehalten. In ihnen soll es nur um symmetrische Auseinandersetzungen gehen, um Operationen von professionellen Streitkräften gegen professionelle Streitkräfte und auch nur darum, wie Operationen in der Zukunft ausgeführt werden könnten, nicht konkret warum oder wozu. Ein demokratisches Militär ist ohnehin dem Frieden und dem Völkerrecht verpflichtet. Deshalb drehen sich diese Ausführungen nicht um hybride Kriegsführung, nichtlineare Kriegsführung, irreguläre Kriegsführung, oder was für Namen man sonst noch für jene Instrumente finden mag. Auch das weite Feld der sogenannten Informationsoperationen und sogar der fundamental wichtige Bereich von IT-Sicherheit und Cyberkrieg werden hier außen vor gelassen, ebenso die Thematik der Atomwaffen. Nicht einmal der klassische Luftkampf oder der Weltraum werden tiefgründig durchleuchtet, sondern alle Genannten nur dort behandelt, wo es für den Fortgang der Argumentation notwendig erscheint. Das Ziel hierbei ist, dass die nachfolgenden Gedanken durch diese Beschränkungen an Klarheit gewinnen werden.
Als Menschen können wir irren und das gilt in gehobenem Maße für Vorhersagen, erst recht, wenn so viele Bereiche unseres Daseins in immer rascherer, aber auch unerwarteter Veränderung begriffen sind. Die Zukunft exakt vorherzusagen ist sowieso unmöglich, weshalb das Hauptziel militärischer Prognostik vielmehr darin liegt, nicht völlig daneben zu liegen, denn dann kann die Katastrophe schnell folgen, wie wir im historischen Teil sehen werden. Rigorose Kritik und ein reger Austausch sind daher essentiell, um unplausible oder auf falschen Annahmen basierende Vorhersagen auszusieben, Halbwissen und Missverständnisse zu berichtigen und die Verbesserung und Schärfung von Vorschlägen zu bewirken. In diesem Text werden viele Themen theoretisch behandelt, in denen einige eine Expertise aus der Praxis besitzen. In diesem Sinne ist jede Kritik an den hier ausgebreiteten Ideen willkommen, je fundamentaler, desto besser. Zögern Sie nicht, treten Sie mit aller Kritik, die Sie haben, an den Autor.
1 Reinhart Koselleck. Zeitschichten. Frankfurt am Main, 2003. S. 208.
2 Sun Tsu. Die Kunst des Krieges. Hamburg, 2008. S. 19.
3 Carl von Clausewitz. Vom Kriege. Hamburg, 2008. S.106.
4 Ebd.
DAS VERHÄLTNIS VON FEUER UND BEWEGUNG
Seitdem der Mensch Fernwaffen zur Kriegsführung benutzt, vor allem seit deren absoluter Dominanz gegenüber dem persönlichen Nahkampf, strukturiert das Prinzip von Feuer und Bewegung das Kampfgeschehen. Damit ist auf der taktischen Ebene das Wechselspiel und Zusammenwirken vom Beschuss feindlicher Kräfte und der Bewegung eigener Kräfte gemeint. Das Prinzip ist allerdings, wenn auch nicht als konkrete Handlungsanleitung, so doch für die Analyse weit größerer Zusammenhänge dienlich. Dazu zunächst ein paar grundlegende Informationen über diese Analysebegriffe.
Bewegung:
„Bewegungen sind […] das dynamische Moment der Kampfkraft, das Mittel der zeitnahen Zusammenführung von Truppen am entscheidenden Ort, mit dem Ziel der Überraschung, bzw. um eine physische, psychologische oder moralische Überlegenheit zu erreichen. […] Wirksame Bewegungen können den Feind aus dem Gleichgewicht bringen, ihn zu Gegenmaßnahmen herausfordern und schließlich seine Niederlage herbeiführen. Bewegungen werden in der taktischen, operativen und strategischen Ebene ausgeführt. […] Außerdem tragen sie dazu bei, die Initiative zu erlangen und zu behalten, Erfolge zu nutzen, Handlungsfreiheit zu bewahren und die Verwundbarkeit der eigenen Truppe zu verringern. […] Voraussetzungen für wirksame Bewegungen auf den unterschiedlichen Führungsebenen sind die Beweglichkeit in der Luft und am Boden, die Kenntnis des Feindes und des Geländes, eine beständige Führung, flexible Einsatzverfahren, vernünftige Gliederung und eine zuverlässige logistische Unterstützung.“5
Feuer:
„Feuer ist das vernichtende Element, das für die Zerstörung der Fähigkeiten und des Kampfwillens des Feindes von wesentlicher Bedeutung ist. Das Feuer unterstützt die eigene Bewegung, zerschlägt bzw. zerstört Feindkräfte, seine Anlagen und Einrichtungen, setzt die Wirkung seiner Artillerie, Luftverteidigung und Luftunterstützung herab und kann die Unterbrechung der Bewegung, Feuerunterstützung, Führung und Versorgung der Feindkräfte bewirken.“6
Im Folgenden wird mit „Feuer“ und „Bewegung“ auch das Potential oder die Möglichkeiten der Bewegung beziehungsweise des Feuers gemeint sein, welches vor allem durch die verfügbare Technologie vorgegeben wird. Die Veränderungsmacht früherer Technologien bildet dabei die Möglichkeit für Potentiale und Potentialerwartungen neuer Technologien aus.7 Das Potential einer Technologie „enthält keine wesentliche Zweckbestimmung“, der Potentialbegriff ist nicht gleichbedeutend mit Anwendungsmöglichkeiten, vielmehr fordern Potentiale zur Anwendungssuche auf.8 Das bedeutet, das Potential ist das, was prinzipiell möglich ist und nicht unbedingt das, was tatsächlich umgesetzt wird.
Durch die Industrialisierung und dem Voranschreiten der technologischen Entwicklung wurden den Armeen sukzessive immer mehr und immer leistungsfähigere Mittel zur Kriegsführung zur Verfügung gestellt. Damit erhielten und erhalten immer noch sowohl das Feuer, als auch die Bewegung eine Steigerung. Das Entscheidende dabei ist jedoch, dass dies nicht stetig linear geschieht, sondern sich das Verhältnis von Feuer und Bewegung verändern kann, zum Beispiel, indem auf der Seite des Feuers ein verbessertes oder gar neues System eingeführt wird, während auf der Seite der Bewegung zunächst alles beim Alten bleibt. Das Verhältnis von Feuer und Bewegung auf höherer Ebene wird darum von dem Potential der zur Verfügung stehenden Technologie (und dem Grad ihrer Nutzbarmachung) vorgegeben. Dieses Verhältnis ist extrem folgenreich, denn es bestimmt im Grunde das Verhältnis von Angriff und Verteidigung. Wenn das Feuer dominiert, wird die Verteidigung begünstigt, wenn die Bewegung überwiegt, wird der Angriff begünstigt. Die Folgen dessen wirken sich, wie man sich denken kann, direkt auf die strategische Kalkulation der Akteure aus, womit Zeiten, in denen der Angriff im Vorteil ist, als tendenziell instabiler und konfliktreicher gelten. Welche welthistorischen Folgen das Verhältnis von Feuer und Bewegung nach sich gezogen hat, vor allem dann, wenn es nicht beachtet oder falsch eingeschätzt wurde, soll exemplarisch die Betrachtung des Ersten und Zweiten Weltkrieges durch diese Brille aufzeigen.
5 Lautsch, Siegfied. Grundzüge des operativen Denkens in der NATO. Ein zeitgeschichtlicher Rückblick auf die 1980er Jahre. Berlin, 2018. S.99f. Diese Grundsätze sind auch heute noch gültig.
6 Ebd. S. 100f.
7 Andreas Kaminski. Technik als Erwartung. Grundzüge einer allgemeinen Technikphilosophie. Bielefeld, 2010. S. 33.
8 Ebd. S. 85f.
Bewegung im Ersten Weltkrieg
Fangen wir zuerst bei der Technologie und den Möglichkeiten der Bewegung zu Beginn des Ersten Weltkriegs an. Die Eisenbahn war zu diesem Zeitpunkt fest etabliert und hatte ihre Auswirkungen, sowohl geoökonomisch, als auch geostrategisch bereits in den Jahrzehnten zuvor gezeigt. Der für alle Beobachter überraschend schnelle Sieg der preußischen Truppen über die Österreicher 1866 war unter anderem durch die schnelle Verlegung der gleichfalls schnell mobilisierten Truppen mittels eigens zu diesem Zweck strategisch angelegten Bahnen möglich. Mit der Eisenbahn ist es erstmals in der Menschheitsgeschichte möglich geworden, große Mengen von Material und Truppen zügig über den Landweg zu transportieren, mit einer Transportleistung, die bis dato allein Schiffen vorbehalten war. Damit verschob sich auch das strategische Verhältnis von Landmacht und Seemacht in Richtung ersterer.
Die Eisenbahn scheint damit die allgemeine Mobilität auf der strategischen Ebene zu verbessern, was eine Steigerung der Bewegung und folglich einen Vorteil des Angriffs nach sich gezogen hätte. Doch so einfach ist es nicht, man muss unterscheiden zwischen taktischer Beweglichkeit im Felde und den logistischen Möglichkeiten, diese Beweglichkeit in der Tiefe unterfüttern zu können, das heißt, über eine längere Distanz im operativ-strategischen Maßstab hinweg den Angriff vortragen zu können. Da das Verhältnis von Feuer und Bewegung technologiedeterminiert ist, müssen auch die Eigenheiten der zugrunde liegenden Technologien mitberücksichtigt werden. Eine Eisenbahn ist an ihr Streckennetz gebunden, eine freie Verschiebung des Transportgutes ist darum nicht möglich und das umliegende Gebiet der Bahnstrecke muss unter eigener Kontrolle stehen, um einen zuverlässigen Transport zu gewährleisten. Damit erstreckt sich im Konfliktfall die Möglichkeit, die Eisenbahn für die Offensive zu gebrauchen, darin, sie zur Mobilisierung zu nutzen und große Truppenverbände zur Grenze zu bringen, das heißt, in der Logistik im rückwärtigen Raum. Jenseits der Grenze ist die Fähigkeit zur offensiven Nutzung der Mobilität beschränkt oder nicht vorhanden, da ein sich zurückziehender Feind seine Gleise sprengen wird und damit unbrauchbar macht oder das Gleisnetz eine andere Spurweite als das Eigene aufweist, wie im Fall von Russland und der Sowjetunion. Dem verteidigenden Staat steht allerdings hinter der Front immer noch dessen Eisenbahnnetz zur Verfügung, um Reserven und Verstärkungen schnell und effektiv in die Nähe der Stellen zu bringen, an denen er unter Angriff steht.
Die Schienengebundenheit der Eisenbahn stärkt damit die zur Verteidigung nutzbare Mobilität in weit größerem Maße als die zum Angriff nutzbare. Ausnahme ist hier die Bereitstellung von angriffsfähigen Verbänden im Grenzgebiet in der Anfangsphase eines Krieges. Hinzu kommt, dass derselbe Effekt durch die Möglichkeit des Transportes großer Mengen an Munition ebenfalls im Verhältnis die Verteidigung stärkt. Man kann also sagen, die taktische Mobilität bleibt von der Eisenbahn unberührt, ihre Inflexibilität steht einer allgemeinen Steigerung der Beweglichkeit im Wege. Im Ersten Weltkrieg hat sich dann gezeigt, dass die Heere nur höchstens 120 km vom letzten Entladepunkt operieren konnten, weil jenseits dessen die Logistik untragbar wurde. In der Regel kamen jedoch bereits jenseits der 40 km große logistische Probleme auf.
Automobile und Lastwagen waren zwar zu Beginn des Ersten Weltkrieges bereits vorhanden, aber noch in weit geringerem Maße verbreitet und leistungsfähig als heutzutage (5000 LKW zu Beginn auf deutscher Seite, für das Vorrücken von zwei deutschen Korps während der Marne-Schlacht um 100 km pro Tag wären 18.000 nötig gewesen9). Zudem waren sie nur für die Nutzung von Straßen geeignet und genauso wie die in großem Umfang genutzten Pferde in offenem Gelände sehr verwundbar.
Die tragende Säule der offensiven Mobilität war somit immer noch wie seit Urzeiten der Fußmarsch, zusammen mit dem Pferdegespann. Eine querschnittlich pferdgestützte strategische Mobilität, wie die Mongolen sie besaßen und mit der diese das größte zusammenhängende Reich der Menschheitsgeschichte schufen, war durch das Gewicht der industriellen Waffentechnik und ihrer Versorgung nicht möglich, darüber durch die verfügbare Feuerkraft auch zu verwundbar. In den Jahren vor dem Weltkrieg ist die Mobilität darum sogar verhältnismäßig wieder gesunken.10
Es macht einen Unterschied, von welcher Größenordnung der Bewegung die Rede ist. Je größer der Maßstab, desto gewichtiger wird die Frage nach dem langsamsten Mitglied des Verbandes und desto größer wird der Einfluss der Logistik sein. Gemeinhin trifft man eine Einteilung in taktisch, operativ und strategisch, wobei taktisch die Ebene des Gefechtes bezeichnet, strategisch die politische und höchste militärische Ebene und operativ eine diese beiden verbindende Zwischenebene bezeichnet, deren Maßstab einige dutzend bis ein paar hundert Kilometer umfassen kann.
Da aber die technischen Mittel fehlten, weder taktisch, noch operativ oder strategisch in Feindesland die Bewegung steigern zu können, spielte diese Unterscheidung nur insofern eine Rolle, zu beurteilen, wie weit eine Offensive reichen konnte, bevor das Ende der Versorgungsreichweite erreicht war, nicht jedoch, wie schnell die Offensive war. Eine Offensive konnte somit zur Zeit des Ersten Weltkriegs wortwörtlich nur so schnell voranschreiten, wie die Soldaten marschieren konnten, das heißt, maximal in Schrittgeschwindigkeit oder sogar nur in dem Maße voranschreiten, wie die Artillerie von den Pferdegespannen vorwärts gebracht werden konnte. Damit bewegte sie sich auf dem selben Niveau wie zu Zeiten der Napoleonischen Kriege, während sich die Feuerkraft bereits tief im Industriezeitalter befand.11 Die Marschleistung der deutschen Truppen in der kurzen Phase des Bewegungskrieges zu Beginn des Ersten Weltkrieges, als der sogenannte Schlieffenplan12 in die Tat umgesetzt werden sollte, ist zwar beeindruckend, doch war die Geschwindigkeit des Vorstoßes und vor allem die des versuchten Umfassungsmanövers letztendlich zu langsam, um Frankreich wie erhofft schnell zu besiegen.
Um den Plan kurz und knapp zusammenzufassen: da Deutschland sich wegen schlechter Außenpolitik in der Lage befand, bei einem Krieg sowohl gegen Frankreich, als auch gegen das damals noch angrenzende Russland kämpfen zu müssen, entwarfen die Militärs und allen voran der Generalstabschef Graf von Schlieffen einen Plan, um in dieser schwierigen Situation dennoch zu siegen, oder sich zumindest in eine vorteilhafte Position für Friedensverhandlungen zu bringen. Beruhend auf der Annahme, dass durch überlegene Planung, Organisation und Infrastruktur die Mobilisierung auf deutscher Seite schneller abläuft als auf französischer und vor allem auf russischer Seite, wollte man dieses Zeitfenster des Mobilisierungsvorsprunges gegenüber Russland nutzen, indem mit fast der gesamten verfügbaren Armee erst in einem schnellen Manöver Frankreich entscheidend geschlagen werden sollte, um dann anschließend die Armee von dort abziehen zu können und sich mit der Hauptmacht der Verteidigung gegen eine russische Offensive zu widmen.
Für den daran anschließenden Krieg gegen Russland gab es allerdings keine Pläne, einerseits, weil es absolut unrealistisch gewesen wäre, so weit in eine chaotische Situation hinein planen zu wollen, andererseits, weil die Generäle im Grunde selbst nicht wussten, wie man Russland in einem Landkrieg besiegen sollte. Bekanntermaßen konnte der Plan nicht wie beabsichtigt ausgeführt werden. In der Anfangsphase beruhte er maßgeblich auf der Geschwindigkeit der Offensive gegen Frankreich. Es war vorgesehen, den erwarteten Hauptstoß Frankreichs auf das Gebiet Lothringens nicht starr abzuwehren, sondern sich langsam zurückfallen zu lassen, um den Großteil der französischen Streitkräfte nach Osten mitzuziehen. Hierfür war nur ein kleiner Teil der verfügbaren Truppen angedacht, der einen massiven Angriff auch gar nicht abwehren können sollte. Der Schwerpunkt der deutschen Truppen war weiter nördlich angesiedelt und sollte mit einer Offensive in einem großen Bogen erst nach Westen vorstoßen und danach mit einem Schwenk nach Süden den Großteil der französischen Streitkräfte umfassen, einkesseln und anschließend vernichten.13 Um die französische Verteidigung zu umgehen, befand man einen Durchmarsch durch das neutrale Belgien als militärisch am zweckdienlichsten. Dieser Plan stellte im Grunde eine operative Lösung für ein strategisches Problem dar. Mehr noch, er beruhte auf falschen oder doch zumindest fragwürdigen Annahmen.
Die Marschleistung der deutschen Truppen war wie gesagt beeindruckend, doch war die Geschwindigkeit des Vorstoßes, vor allem des äußeren nördlichsten Teiles des Angriffsflügels nicht ausreichend, um eine Umfassung der französischen Kräfte zu erreichen. Dafür fehlten tausende von Lastkraftwagen, die die deutsche Industrie zu diesem Zeitpunkt noch nicht hatte herstellen können. Die Franzosen wiederum konnten reagieren, indem sie mithilfe der Eisenbahn Truppen zur Verteidigung und für einen Gegenstoß verschieben und zusammenziehen konnten, womit die deutsche Offensive gestoppt wurde, der Schlieffenplan fehlschlug und Deutschland sich in der so gefürchteten Situation des Zweifrontenkrieges befand. Es wurde also die zeitgenössische Beschaffenheit der Bewegung nicht ausreichend berücksichtigt. Dazu kam, dass Russland doch schneller mobilisierte als in den Plänen veranschlagt und der Generalstab sich gezwungen sah, substanzielle Truppenverbände zur Verteidigung Ostpreußens aus Frankreich abzuziehen, die dann in der entscheidenden Schlacht an der Marne fehlten. Nebenbei hatte das Deutsche Reich durch die Verletzung der belgischen Neutralität Großbritannien in den Krieg gegen sich hineingezogen, obwohl in der britischen Elite und in deren politischer Diskussion davor ansonsten keine automatische oder rasche Kriegserklärung an das Deutsche Reich klar favorisiert wurde. Im Ersten Weltkrieg zeigte sich auch an der Ostfront, wo das Kriegsgeschehen noch am ehesten den Charakter eines Bewegungskrieges hatte, dass die Möglichkeiten der operativen Bewegung zu gering waren, um russische Großverbände zu umfassen und einzukesseln. Stattdessen konnten sich die russischen Truppen jedes Mal geschickt der Umfassung durch Rückzug entziehen. (Ausnahme: die Schlacht bei Tannenberg 1914).
9 MARTIN VAN CREVELD. Supplying war. Logistics from Wallenstein to Patton Cambridge, 1977. S. 137.
10 Ebd. S. 113.
11 Christian Th. Müller. Jenseits der Materialschlacht. Der Erste Weltkrieg als Bewegungskrieg. Paderborn, 2018. S. 31.
12 In der Forschung wird von manchen die Existenz eines „Schlieffenplanes“ als solchem gänzlich in Frage gestellt, andere sind dazu übergegangen, den „Schlieffenplan“ des Jahres 1914 als „Moltkeplan“ zu bezeichnen, weil der damalige Generalstabschef Moltke d.J. den ursprünglichen Plan an entscheidenden Stellen modifiziert hatte.
13 Im militärischen Sprachgebrauch ist mit „Vernichten“ gemeint, die Kampfkraft des Gegners zu neutralisieren. Dies kann durch Brechen der Moral, durch Gefangennahme, durch Verwirrung und Desorganisation, dem Zerfallen der Ordnung und das Auflösen der taktischen Einheiten, durch Zerstörung oder Unbrauchbarmachen von Material und schließlich auch durch Verwundung und Tötung feindlicher Kombattanten geschehen. Der Begriff ist deshalb nicht, man muss dies ausdrücklich klar machen, um Missverständnisse zu vermeiden, als physische Vernichtung der gesamten Soldaten eines gegnerischen Verbandes gemeint.
Feuer im Ersten Weltkrieg
Doch nicht nur das Element der Bewegung war für den Plan Schlieffens unzureichend, auch die Verschiebung auf die Seite des Feuers zeigte massive Auswirkungen. Mit dem Aufkommen von wassergekühlten Maschinengewehren hatte der Verteidiger ein Mittel an der Hand, den Angriff selbst großer Massen Infanterie über offenes Feld zu stoppen, weil er das Gebiet vor seinem Maschinengewehr quasi in eine Todeszone verwandelte. Hinzu kam die Entwicklung von Schnellfeuergeschützen, also leichter Artillerie mit hoher Feuergeschwindigkeit, die aus verdeckter Stellung ohne Sichtkontakt feuerten, und auf deutscher Seite auch noch die Entwicklung von schwerer Artillerie, die gewaltige Granaten verschoss. Diese technische Entwicklung stärke massiv die Feuerkraft und verschob damit das Gewicht erheblich hin zur Verteidigung. Besonders das Maschinengewehr war hierfür verantwortlich. In Verbindung mit dem ebenfalls relativ neuen Stacheldraht, einem billigen und dabei gleichzeitig effektiven Mittel zur Hemmung von Bewegung der Infanterie, war es praktisch nicht mehr möglich, gegen eine einigermaßen vorbereitete Verteidigung einen erfolgreichen Angriff zu führen.
Schon von damaligen militärischen Beobachtern wurde die gravierende Auswirkung des Stacheldrahtes auf die Gefechtsführung vor dem Krieg verkannt und dies setzt sich auch in der Nachschau fort, vermutlich, weil Stacheldraht das ziemliche Gegenteil einer Hightecherfindung ist. Auch wenn von materiellem Aufwand und Opferzahlen her die Artillerie im Ersten Weltkrieg überwog, so war es doch das Maschinengewehr, welches letztendlich die Hoheit der Verteidigung sicherstellte. Nur mit dem Einsatz massiven eigenen Feuers und der Inkaufnahme horrender Verluste waren Angriffe unter diesen Bedingungen noch erfolgversprechend, doch auch das reichte höchstens für taktische Erfolge aus, wie die weitere Entwicklung des Krieges gezeigt hat.
Die technologischen Verhältnisse der Zeit des Ersten Weltkriegs hatten eine starke Überlegenheit der Verteidigung zur Folge. Die allgemeine Auffassung ist, dass dies von den verantwortlichen Militärs ignoriert oder falsch eingeschätzt wurde und dann mit Einsetzen der Kampfhandlungen das böse Erwachen kam. In der Forschung stellt sich dieses Bild jedoch anders dar, auch wenn das die Militärs (rückblickend) nicht besser aussehen lässt. So zeigte sich die tödliche Kombination von Maschinengewehr und Stacheldraht bereits im Russisch-Japanischen-Krieg von 1904/05 und wurde sehr wohl von den beobachtenden Militärs registriert und diskutiert, zumindest, was das MG angeht. Im Grunde war seit der Zeit der Hinterlader (also spätestens ab 1866) die Verteidigung auf der taktischen Ebene klar überlegen, und alle wussten das auch. Jede weitere Steigerung der Feuerkraft zementierte diesen Zustand weiter. Die Schlussfolgerung war bloß nicht, deshalb vom Angriff abzusehen, die Pläne grundsätzlich zu überarbeiten und sich neue Lösungen zu überlegen, sondern im Gegenteil, noch verbissener noch größeren Fokus auf den ersten, massiven Schlag zu legen, der dann alles entscheiden sollte. Der vorherrschende Angriffsgeist sollte seine Jünger behalten, die Betonung des „Willens“ zum Angriff und der „Moral“ wurde noch weiter akzentuiert, schließlich hatten die Japaner vermeintlich gezeigt, dass Angriffe noch Erfolg haben können, wenn man nur opferbereit genug ist.
Wenn man über vergangene Zeiten und ihre Menschen urteilt, so tut man ihnen Unrecht, heutige gesellschaftliche und moralische Maßstäbe an sie anzulegen und mit dem überlegenen Nachwissen des Epigonen zu hantieren.
„Je ferner das historische Ereignis, desto mehr schwindet das Bewusstsein für die Offenheit der damaligen Situation […]. Es gehört ein hohes Abstraktionsvermögen gegenüber dem gewandelten historischen Kontext dazu, um auch in späterer Zeit noch an der historischen Offenheit der Zukunft in einem vergangenen Zeitpunkt festzuhalten.“14
Dennoch kann man im Lichte des damals Wissbaren und Denkbaren Urteile fällen. In Anbetracht der Vielzahl an technischen Revolutionen im Bereich des Militärischen, neben den genannten Entwicklungen zum Beispiel noch die Einführung von Telephonen und Fernsprechern, dem Aufkommen von Zeppelinen und Kraftfahrzeugen, neben massiven sozio-ökonomischen Umwälzungen wie dem Anwachsen der Heere zu Millionenheeren, war die militärische Intelligenz mit einem ganzen Problembündel konfrontiert. Es gab zwar einige fachspezifische Überlegungen zu den Auswirkungen dieser oder jener technischen Neuerung auf den Zukunftskrieg, aber ein aus der Kombination dieser Zukunftsvorstellungen aggregiertes Gesamtbild des zukünftigen Krieges zu entwerfen, ist ein schweres Unterfangen und das ist es heute ebenso wie damals.
In diesem Lichte kann der deutschen Armee sogar attestiert werden, den richtigen Pfad eingeschlagen zu haben, was die Einführung von feldgrauen Uniformen anbelangt, die unbedingte Ausnutzung des Geländes zur Deckung, die größere Selbstständigkeit der niedrigen Führungsebenen im Gefecht oder das mögliche Eingraben bei Beschuss (obwohl es aus heutiger Sicht unglaublich klingt, verbot die französische Heeresführung ihren Soldaten anfangs, sich bei Beschuss einzugraben, weil dadurch nach ihrer Meinung der Angriffsgeist gelitten hätte). Allerdings muss kritisiert werden, dass der richtige Weg nur zaghaft beschritten wurde und nicht in dem erforderlichen Umfang zu Ende gegangen wurde. Noch immer galt die Schützenlinie mit den Infanteriegewehren als Träger infanteristischer Feuerkraft, nicht die MGs. Noch immer hing das Angriffsverfahren davon ab, die feindliche Artillerie erfolgreich zu bekämpfen, obwohl diese in ihren verdeckten Stellungen fast nicht auszumachen und darum fast nicht zu bekämpfen war. Die Notwendigkeit leichter, beweglicher MGs wie des dänischen Madsen MG und anderer leichter Infanterieunterstützungswaffen wie der später im Krieg entwickelte Stokes-Mörser wurden verkannt.
Die Diskrepanz zwischen der Stärke der Verteidigung und der Wirksamkeit des eigenen Angriffsverfahrens sollte die Moral wettmachen, die in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg von allen Seiten zum ermöglichenden Faktor stilisiert wurde.
Das eigentliche Versagen der deutschen militärischen Elite bestand jedoch darin, trotz der türmenden Überlegenheit der taktischen und operativen Verteidigung trotzig am Angriff festzuhalten, anstatt diese Tatsache anzuerkennen und vor allem auch der politischen Führung des Reiches zu vermitteln und daraus ein politisch-strategisches Konzept abzuleiten.
Außerdem ist es einfach nicht richtig, dass es niemanden gab, der den Gefechtsverlauf des Ersten Weltkriegs genau hätte vorhersehen können, es gab diese Person nämlich, nur war sie kein Militär, sondern Zivilist. Johann von Bloch,15 ein ehemaliger Banker und „Eisenbahnkönig“ aus dem russischen Teil Polens, versuchte durch intensives Studium der damaligen militärischen Fachliteratur und mittels quantitativer Methoden zu zeigen, dass im Falle eines Krieges zwischen den Großmächten in Europa die Feuerkraft von Maschinengewehren und schnell feuernden Feldkanonen so gewaltig ist, dass, wie es bekanntlich auch eingetreten ist, sich ein mehrere hundert Meter breiter Streifen Niemandsland zwischen den Heeren bilden würde. Dies alles konnte in seinem sechsbändigen Werk Der zukünftige Krieg in seiner technischen, volkswirtschaftlichen und politischen Bedeutung, welches 1899 in deutscher Übersetzung vorlag, nachgelesen werden. Doch die wenigsten der Berufsmilitärs hörten dem Organisator der Haager Friedenskonferenz und Nominierten für den ersten Friedensnobelpreis zu (oder wollten es wahrhaben, wie der britische Militärtheoretiker Liddell Hart in der Zwischenkriegszeit zugab16).
Freilich, alleine durch Verteidigung zu siegen bedeutet, den Feind zu ermatten, seine Kräfte aufzuzehren, bis er die Zwecklosigkeit weiterer Angriffe einsieht, ihm die Mittel für weitere Angriffe fehlen oder er fürchtet, keine ausreichenden Mittel zur Verteidigung eines etwaigen Gegenangriffes zur Verfügung zu haben. Rein wirtschaftlich betrachtet schien das Deutsche Reich mit einer solchen Strategie wenig gewinnen zu können, wenn man gegen Frankreich (mit dessen Kolonien) und Russland, das in Rohstoffangelegenheiten autark war, gleichzeitig zu kämpfen hatte, wahrscheinlich auch noch gegen das britische Empire (mit dessen Kolonien), womit Deutschland von der Seeversorgung abgeschnitten worden wäre und somit langsam aber sicher stranguliert würde.
Allerdings lässt diese Sicht die politische Ebene außer Acht. Das Britische Empire ist schließlich hauptsächlich wegen der deutschen Verletzung der belgischen Neutralität in den Krieg eingetreten. Bei einer reinen Verteidigungshaltung im Westen wäre dieser Kriegseintritt entweder gar nicht oder mit erheblicher Verzögerung eingetreten. Womöglich hätte sogar Frankreich die belgische Neutralität selbst gebrochen, um einen Angriff auf das Ruhrgebiet zu wagen. Dann wäre es der britischen Öffentlichkeit nicht zu vermitteln gewesen, an Seiten des Aggressors Frankreich gegen den Verteidiger Deutschland in den Krieg zu ziehen und das auch noch im Bündnis mit dem russischen Zarenreich, lange Jahre der eigentliche Konkurrent des Empire und Hort der Autokratie. Auch stellt sich die Frage, wie lange die französische Bevölkerung es geduldet hätte, zahllose junge Männer beim Anrennen auf deutsche Stellungen zu opfern, wenn das eigene Land nicht angegriffen wird und es eigentlich um einen serbisch-österreichischen Konflikt ging.
Dass der Krieg im Osten trotz der immensen Opfer und des Materialaufwandes im Westen einen aus deutscher Sicht erfolgreichen Ausgang nahm, ist bekannt. Hier war es eben der politische Faktor, der den Ausschlag gegeben hatte, einerseits in Form von zahlreichen Unabhängigkeitsbestrebungen der von Russland beherrschten Völkerschaften als auch durch Unzufriedenheit, Unruhe und Spaltung innerhalb der russischen Bevölkerung selbst, war es doch auch die deutsche Unterstützung Lenins, die das innere Gefüge des Russischen Reiches erschütterte und Finnland, Polen, die baltischen Staaten, sowie für kurze Zeit die Ukraine aus dem Imperium löste, was de facto das strategische Problem eines Zweifrontenkrieges beseitigte.
Vereinfacht gesagt hatte das Zarenreich durch die Realität eines materialintensiven Krieges seine wirtschaftlichen Kräfte überspannt, um mit dem Deutschen Reich mithalten zu können, wobei vor allem die Produktion von Artilleriegranaten als Maßstab zu nehmen ist. Die Folge war eine starke Geldentwertung, die die Bevölkerung empfindlich traf und den wirtschaftlichen Boden für die revolutionäre Stimmung bereitete. Die hohen Verluste, die die russischen Truppen zu verzeichnen hatten, trugen ebenfalls dazu bei.
14 Lucian Hölscher. Die Entdeckung der Zukunft. Göttingen, 2016. S. 12.
15 Manchmal auch Ivan Bloch oder Ivan von Bloch genannt.
16 Liddell Hart. The British Way in Warfare. London, 1932. S. 123.
Überwinden des Stellungskrieges
Auf beiden Seiten wurde die Situation des Stellungskrieges missbilligt und über Lösungen zur Rückkehr zum Bewegungskrieg nachgedacht. Als Mittel zur Überwindung des Stellungskrieges ist der Durchbruch zentral. Da sich die Westfront die ganze Strecke von der neutralen Schweiz bis zur Nordsee entlangzog, war eine Umgehung mit anschließender Umfassung der feindlichen Hauptkräfte (der Fetisch des deutschen Heeres vor dem Krieg) unmöglich. Stattdessen musste erst die Front an einer Stelle durchbrochen werden, der Durchbruch musste stabilisiert und Truppen durch diese Öffnung in ausreichender Masse geschleust werden, um im offenen Hinterland der Front wieder bewegliche Operationen ausführen zu können.
Ein Mittel zu diesem Zweck wurde auf deutscher Seite in den Stoßtrupps bzw. Sturmbataillonen ersonnen. Sie unterschied vom herkömmlichen Infanterieeinsatz, dass sie mit mehr (beweglicher) Feuerkraft ausgestattet waren: erste Flammenwerfer, erste Maschinenpistolen, mehr leichte Maschinengewehre17 auf niedrigeren Hierarchieebenen, leichte Minenwerfer für indirektes Feuer und vor allem viele Handgranaten. Daneben wurde darauf Wert gelegt, den Einsatz von Feuer und Bewegung aus einer Hand lokal auf das taktische Ziel hin zu koordinieren, um eine zeitlich und lokal begrenzte Feuerüberlegenheit zu erreichen.





























