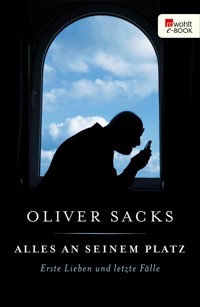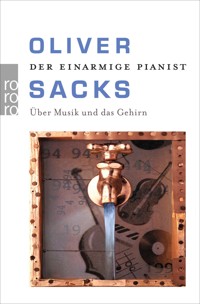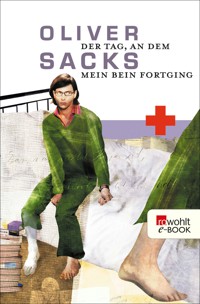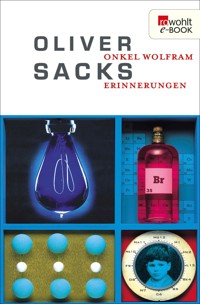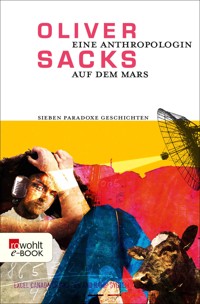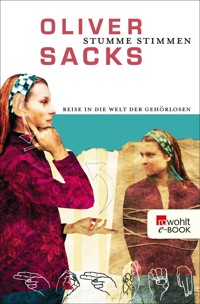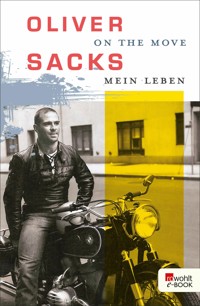9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Ein Musikwissenschaftler tätschelt Hydranten, weil er sie für spielende Kinder hält. Eine 90-jährige Frau bekommt plötzlich wieder Appetit auf junge Männer. Ein Student kann eine Zeitlang riechen wie ein Hund – und vermisst es, als es vorbei ist: Eine winzige Hirnverletzung, ein kleiner Tumult in der cerebralen Chemie, und Menschen geraten in eine andere Welt, in die Gesunde nicht vordringen. Oliver Sacks' Bestseller erzählt von ihnen in 24 faszinierenden Fallgeschichten. «Oliver Sacks hat die medizinische Fallstudie zur literarischen Kunstform erhoben.» DER SPIEGEL
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 430
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Oliver Sacks
Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte
Über dieses Buch
Ein Musikwissenschaftler tätschelt Hydranten, weil er sie für spielende Kinder hält. Eine 90-jährige Frau bekommt plötzlich wieder Appetit auf junge Männer. Ein Student kann eine Zeitlang riechen wie ein Hund – und vermisst es, als es vorbei ist: Eine winzige Hirnverletzung, ein kleiner Tumult in der cerebralen Chemie, und Menschen geraten in eine andere Welt, in die Gesunde nicht vordringen. Oliver Sacks’ Bestseller erzählt von ihnen in 24 faszinierenden Fallgeschichten.
«Oliver Sacks hat die medizinische Fallstudie zur literarischen Kunstform erhoben.»
DER SPIEGEL
Vita
Oliver Sacks, geboren 1933 in London, war Professor für Neurologie und Psychiatrie an der Columbia University. Er wurde durch die Publikation seiner Fallgeschichten weltberühmt. Nach seinen Büchern wurden mehrere Filme gedreht, darunter «Zeit des Erwachens» (1990) mit Robert De Niro und Robin Williams. Oliver Sacks starb am 30. August 2015 in New York City.
Bei Rowohlt erschienen unter anderem seine Bücher «Awakenings – Zeit des Erwachens», «Der Tag, an dem mein Bein fortging», «Der einarmige Pianist» und «Drachen, Doppelgänger und Dämonen». 2015 veröffentlichte er seine Autobiographie «On the Move».
Impressum
Neuausgabe
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, September 2023
Copyright © 1987 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
«The Man Who Mistook His Wife For a Hat» Copyright © 1985 by Oliver Sacks
Der Verlag dankt Prof. Dr. Thomas Lindner, Hamburg, für die Überprüfung der Fachterminologie.
Covergestaltung zero-media.net, München
Coverabbildung FinePic®
Das Vorwort von 2013 wurde übersetzt von Hainer Kober
ISBN 978-3-644-00086-5
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Widmung
Motti
Vorwort (2013)
Vorwort der Originalausgabe (1985)
Teil eins Ausfälle
Einleitung
1 Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte
Nachschrift
2 Der verlorene Seemann
Nachschrift
3 Die körperlose Frau
Nachschrift
4 Der Mann, der aus dem Bett fiel
Nachschrift
5 Hände
Nachschrift
6 Phantome
Phantomfinger
Verschwindende Phantomglieder
Phantombeine
Leblos oder lebendig?
Nachschrift
7 Schräglage
8 Augen rechts!
Nachschrift
9 Die Ansprache des Präsidenten
Teil zwei Überschüsse
Einleitung
10 Witty Ticcy Ray
11 Amors Pfeil
Nachschrift
12 Eine Frage der Identität
13 Ja, Vater-Schwester
Nachschrift
14 Die Besessenen
Teil drei Reisen
Einleitung
15 Erinnerung
Nachschrift
16 Nostalgische Ausschweifungen
17 Reise nach Indien
18 Hundenase
Nachschrift
19 Mord
20 Die Visionen der heiligen Hildegard
Teil vier Die Welt der Einfältigen
Einleitung
21 Rebecca
Nachschrift
22 Ein wandelndes Musiklexikon
Nachschrift
23 Die Zwillinge
Nachschrift
24 Der autistische Künstler
Nachschrift
Allgemeine Literaturhinweise
Literaturhinweise zu den einzelnen Kapiteln
Glossar
Register
Für Dr. Leonard Shengold
Ein Gespräch über Krankheiten ist eine Art Erzählung aus Tausendundeiner Nacht.
WILLIAM OSLER
Der Arzt beschäftigt sich (im Gegensatz zum Naturwissenschaftler) nur mit einem einzigen Organismus, nämlich dem des Menschen, der seine Identität unter widrigen Umständen zu bewahren sucht.
IVY MCKENZIE
Vorwort (2013)
Meine Eltern waren beide Ärzte, daher wuchs ich in einem Haus voller medizinischer Geschichten auf. Beim Abendessen erzählten Vater und Mutter häufig von Patienten, die sie tagsüber behandelt hatten – Geschichten von Lebenswegen, die durch Krankheit oder Verletzung unterbrochen wurden (manchmal durch neurologische Erkrankungen oder Verletzungen, denn beide Eltern hatten eine neurologische Fachausbildung durchlaufen, bevor sie sich auf andere Gebiete spezialisierten.) Obwohl ich mich als Schüler zunächst zur Chemie und dann zur Botanik und Meeresbiologie hingezogen fühlte, war es womöglich unvermeidlich, dass ich mich zuletzt in der Medizin mit ihren Studien und Geschichten über Menschen wiederfand.
Als ich, wie meine beiden älteren Brüder, ein Medizinstudium begann, waren es die Leiden und Geschichten der Patienten, die meine Phantasie beflügelten, eine Erfahrung, die sich mir unauslöschlich einprägte. Vorlesungen und Lehrbücher lenkten eher von der lebendigen Erfahrung ab und hinterließen so gut wie keine Eindrücke. Allerdings war ich von den Fallgeschichten fasziniert, von denen es in der medizinischen Literatur des 19. Jahrhunderts wimmelte – anschauliche, eingehende Beschreibungen von Patienten mit neurologischen oder psychiatrischen Problemen.
Als junger Arzt bekam ich es 1966 mit den Patienten zu tun, die ich später in Awakenings – Zeit des Erwachens beschrieb. Ihre Situation war in vielerlei Hinsicht einzigartig: Diese Menschen waren, so verschieden sie auch sein mochten, alle in einem fast katatonischen Zustand gefangen und jahrzehntelang in einem Krankenhaus für chronisch kranke Menschen untergebracht. Ihr „Erwachen“ aus dem erstarrten Schneewittchen-Zustand, ihre Rückkehr ins Leben ließ sich nicht auf Erhebungen oder Zahlen reduzieren; dazu waren individuelle, sehr persönliche Erzählungen erforderlich. Dagegen beschrieb ich in Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte nach zwanzig Jahren medizinischer Praxis Patienten mit einer Vielzahl neurologischer Störungen, einige von längerer Dauer, andere nicht. Einige dieser Patienten, etwa Dr. P., der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte, konnten ein weitgehend uneingeschränktes Leben außerhalb von Institutionen führen, sodass ich ihn und seine Frau in ihren eigenen vier Wänden, ihrer persönlichen Umgebung, besuchen konnte.
Fast dreißig Jahre sind seit dem Erscheinen von Hut vergangen, und einige der beschriebenen Patienten sind noch am Leben und bei guter Gesundheit. Witty Ticcy Ray, den ich 1971 kennenlernte, führt trotz seines Tourette-Syndroms ein erfülltes Leben und hat häufig mit mir Kontakt. Ray weckte bei mir ein starkes, lebenslanges Interesse für das Tourette-Syndrom. Seither habe ich über viele andere Menschen mit dem Syndrom geschrieben, unter anderem eine längere Fallgeschichte (ursprünglich sollte sie „Der erste fliegende Tourette-Chirurg der Welt“ heißen) die unter dem Titel „Das Leben eines Chirurgen“ in der Sammlung Eine Anthropologin auf dem Mars veröffentlicht wurde.
An die im Hut beschriebenen Menschen denke ich noch oft zurück und entdecke immer neue Aspekte in ihren Geschichten. Lilian Kallir, eine bekannte Pianistin, schrieb mir etwa fünfzehn Jahre nach der Veröffentlichung von Hut, sie habe die Fähigkeit verloren, Gegenstände in ihrer Umgebung zu erkennen. Sie verglich sich mit Dr. P., obwohl sie mit ihren Problemen des visuellen Erkennungsvermögens ganz anders umging als er. Lilian litt unter sogenannter posteriorer kortikaler Atrophie, ein Fachbegriff, der Jahre nach der Veröffentlichung von Hut eingeführt wurde, um ein spezifisches, Alzheimer-ähnliches Syndrom zu beschreiben. Obwohl ich damals keine konkrete Diagnose für Dr. P. stellen konnte, half mir die Begegnung mit Lilian Jahre später, eine Antwort zu finden.
Jimmie, „Der verlorene Seemann“, zeigte mir, wie das Leben für einen Menschen mit einer tiefgreifenden Amnesie ist, die ich später auch bei anderen Patienten erforschte, etwa bei Greg, („Der letzte Hippie“ in der Anthropologin) und Clive Wearing, dem Dirigenten, dessen Geschichte ich in Der einarmige Pianist erzähle. Nur wenn man Fallgeschichten von Menschen mit ähnlichen Syndromen zusammenträgt, sie vergleicht und einander gegenüberstellt, kann man die Mechanismen, die am Werk sind, und deren Auswirkungen in einem individuellen Leben ganz verstehen.
„Erinnerung“, die Geschichte über die beiden alten Damen mit musikalischen Halluzinationen, inspirierte mich zu einer eingehenderen Beschäftigung zunächst mit solchen Halluzinationen (in Der einarmige Pianist) und dann mit Halluzinationen im Allgemeinen (in Drachen, Doppelgänger und Dämonen). Phantomglieder werden in Hut kurz und in Drachen ausführlich beschrieben. Das letzte Kapitel in Hut, „Der autistische Künstler“, veranlasste mich zu weit ausführlicheren Fallgeschichten über Stephen Wiltshire, einen anderen autistischen Savant, und Temple Grandin, eine bemerkenswerte Frau mit Asperger-Syndrom (beide sind in Eine Anthropologin auf dem Mars erschienen).
Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte, Anfang der 1980er Jahre geschrieben, enthält zahlreiche Wörter, die heute glücklicherweise aus der Mode gekommen sind. „Idiot savant“, „debil“, „unbeholfen“ und ähnliche waren damals üblich, und daher habe ich sie hier stehengelassen. Entsprechend wurden damals Patienten als „psychotisch“ eingestuft, die man heute anders diagnostizieren würde. „Asperger-Syndrom“ und sogar „Alzheimer-Krankheit“ gehörten noch nicht zum medizinischen Wortschatz.
Mit einigen Dingen, die ich in Hut geschrieben habe, bin ich heute nicht mehr einverstanden, und in vielen Fällen habe ich, so hoffe ich, gelernt, diese Patienten differenzierter zu betrachten. Doch für mich bleiben sie alle lebendig, ihre Geschichten entwickeln sich weiter und verändern sich, wie es bei uns allen der Fall ist.
Der methodische Ansatz der Fallgeschichten, bei dem nicht nur die Auswirkung der Krankheiten beschrieben wird, sondern die ganze Lebenswirklichkeit der Patientenexistenz, erlebte seinen Höhepunkt im 19. Jahrhundert, doch Ende des 20. Jahrhunderts, mit dem Aufstieg einer stärker technologisch und quantitativ ausgerichteten Medizin, war er fast ausgestorben. Als ich dann in den 1970er und 1980er Jahren meine eigenen Fallgeschichten zu schreiben begann, war es praktisch unmöglich, sie in medizinischen Zeitschriften unterzubringen, denn die verlangten Diagramme, Tabellen und eine „objektive“ Sprache. Längere, persönlichere und detaillierte Fallgeschichten galten als veraltet und „unwissenschaftlich“. Nun wandelt sich das Bild erneut – viele medizinische Fakultäten bieten Kurse in narrativer Medizin an, und ganze Generationen von jüngeren Neurologen betrachten heute die Fallgeschichte als ein wichtiges Teilgebiet der Medizin. Häufig wird der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte als ein Grund für diese Renaissance der Fallgeschichten genannt, und ich fände es schön, wenn es so wäre.
Mit dem Aufstieg der Neurowissenschaft und all ihren Wundern wird es noch wichtiger, die persönliche Erzählung zu bewahren, damit wir weiterhin in der Lage sind, jeden Patienten als unverwechselbares Individuum zu sehen, das eine eigene Geschichte besitzt und über besondere Strategien verfügt, um sich anzupassen und zu überleben. Mögen sich auf unserem Gebiet auch Wissen und Erkenntnis entwickeln und wandeln, so bleibt doch die Phänomenologie menschlicher Krankheit und Gesundheit weitgehend eine Konstante, daher kann die Fallgeschichte, die sorgfältige und individuelle Beschreibung des Patienten, nie obsolet werden.
New York, O.W. S.
Vorwort der Originalausgabe (1985)
«Das Letzte, was man findet, wenn man ein Werk schreibt, ist, dass man weiß, womit man beginnen soll», notiert Pascal. Nachdem ich diese merkwürdigen Geschichten geschrieben, zusammengestellt und geordnet, einen Titel gefunden und zwei Motti ausgesucht habe, muss ich mich nun mit der Frage beschäftigen, was ich getan habe – und warum.
Meine Entscheidung für zwei Motti, die Gegensätzliches zum Ausdruck bringen – ebenjene Gegensätzlichkeit, die für Ivy McKenzie zwischen dem Arzt und dem Naturwissenschaftler besteht –, entspricht den zwei Seelen in mir selbst: Ich fühle mich sowohl als Naturwissenschaftler wie auch als Arzt; ich interessiere mich gleichermaßen für Menschen wie für Krankheiten; und vielleicht machen sich diese zwei Seelen auch in der Tatsache bemerkbar, dass ich gleichermaßen, wenn auch nur unzulänglich, theoretisch und szenisch arbeite, mich gleichermaßen zum Wissenschaftlichen wie zum «Romantischen» hingezogen fühle, dass ich stets diese beiden Elemente im menschlichen Sein wiederfinde, nicht zuletzt im Kranksein, jenem wesentlichen Merkmal des Menschen. Auch Tiere werden krank, aber nur der Mensch kann Krankheit als solche erfahren.
Meine Arbeit, mein Leben gehört den Kranken – aber sie und ihre Krankheit bringen mich auf Gedanken, auf die ich sonst vielleicht nicht kommen würde. Das geht so weit, dass ich den Drang fühle, mich Nietzsche anzuschließen, der schreibt: «Und was die Krankheit angeht: würden wir nicht fast zu fragen versucht sein, ob sie uns überhaupt entbehrlich ist?», und die Fragen, die die Krankheit aufwirft, als grundsätzliche Fragen der Existenz anzusehen. Meine Patienten stellen mich ständig vor Fragen, und meine Fragen führen mich ständig zu neuen Patienten – so kommt es, dass es in diesen Geschichten oder Untersuchungen eine stete Bewegung vom einen zum anderen gibt.
Untersuchungen, ja – aber warum Geschichten oder Fallstudien? Das historische Konzept von Krankheit, der Gedanke, dass eine Krankheit vom Auftreten der ersten Anzeichen über ihren Höhepunkt, ihre Krisis und weiter bis zu ihrem glücklichen oder letalen Ausgang einen bestimmten Verlauf nimmt, geht auf Hippokrates zurück. Er war es also, der die Krankengeschichte, das heißt die Beschreibung oder anschauliche Darstellung des Krankheitsverlaufs, eingeführt hat – exakt das also, was mit dem alten Wort «Pathographie» bezeichnet wird. Solche Krankengeschichten sind eine Art Naturgeschichte – sie verraten uns jedoch nichts über das Individuum und seine Geschichte; sie sagen nichts über die Person und ihre Erfahrungen im Kampf gegen die Krankheit aus. In einer knappen Krankengeschichte gibt es kein «Subjekt» – es wird in der modernen Anamnese nur mit einer oberflächlichen Beschreibung erfasst («ein trisomischer, weiblicher Albino von einundzwanzig Jahren»), die ebenso auf eine Ratte wie auf einen Menschen zutreffen könnte. Um die Person – den leidenden, kranken und gegen die Krankheit ankämpfenden Menschen – wieder in den Mittelpunkt zu stellen, müssen wir die Krankengeschichte zu einer wirklichen Geschichte ausweiten; nur dann haben wir sowohl ein «Wer» als auch ein «Was», eine wirkliche Person, einen Patienten, der in seiner Beziehung zur Krankheit, in seiner Beziehung zum Körperlichen fassbar wird.
Für die Psychologie und die Feinbereiche der Neurologie ist das Wesen des Patienten von großer Bedeutung, denn hier geht es ja in der Hauptsache um seine Persönlichkeit, und seine Krankheit und seine Identität können nicht unabhängig voneinander betrachtet werden. Solche Störungen, deren Studium und deren Beschreibung erfordern eine neue Disziplin, die man «Neurologie der Identität» nennen könnte, denn sie beschäftigt sich mit den neuralen Grundlagen des Selbst, der uralten Frage nach dem Zusammenhang zwischen Gehirn und Geist. Es mag sein, dass – notwendigerweise – eine kategorische Kluft zwischen dem Psychischen und dem Physischen besteht; Untersuchungen und Geschichten jedoch, die sich gleichzeitig und untrennbar auf beides beziehen – und diese sind es, die mich besonders faszinieren und die ich hier vorstellen will –, mögen dennoch dazu dienen, beide Bereiche einander anzunähern und uns in den Stand zu versetzen, den Schnittpunkt von Funktion und Leben, die Auswirkungen physiologischer Prozesse auf die Biographie zu erhellen.
Die Tradition höchst menschlicher Geschichten von Kranken erreichte ihren Höhepunkt im 19. Jahrhundert. Ihr Niedergang begann mit dem Aufstieg einer unpersönlichen neurologischen Wissenschaft. Der große russische Neuropsychologe Alexander R. Lurija schrieb: «Die Kunst, etwas zu beschreiben, jene Kunst, die die großen Psychiater und Neurologen des 19. Jahrhunderts beherrschten, ist heute fast ausgestorben … Sie muss wiederbelebt werden.» Seine eigenen Spätwerke, zum Beispiel ‹The Mind of a Mnemonist› und ‹The Man with a Shattered World›, sind Versuche, diese verlorengegangene Tradition wiederaufleben zu lassen. Die Krankengeschichten in diesem Buch knüpfen an diese alte Tradition an: an die des 19. Jahrhunderts, von der Lurija spricht, an die des ersten medizinischen Historikers Hippokrates und an die universelle und seit uralten Zeiten bestehende Tradition, nach der Patienten Ärzten ihre Geschichte erzählt haben.
Klassische Sagen und Legenden sind von archetypischen Figuren, von Helden, Opfern, Märtyrern und Kriegern bevölkert. Die Patienten eines Neurologen sind Verkörperungen dieser Figuren – und die, von denen in diesen sonderbaren Geschichten die Rede sein wird, sind sogar noch mehr als das. Wie sollen wir beispielsweise den «verlorenen Seemann» oder die anderen seltsamen Menschen, die in diesem Buch auftreten, in jene mythischen und metaphorischen Kategorien einordnen? Man könnte sagen, sie seien Reisende, unterwegs in unvorstellbare Länder – Länder, von deren Existenz wir sonst nichts wüssten. Dies ist der Grund, warum ihr Leben und ihre Reisen für mich etwas Märchenhaftes haben. Darum habe ich als erstes Motto den Satz von William Osler gewählt, und darum erscheint es mir angebracht, dieses Buch nicht nur als eine Sammlung von Fällen, sondern auch als eine Sammlung von Geschichten und Märchen zu bezeichnen. In diesem Bereich sehnt sich der Wissenschaftler danach, mit dem Romantiker zu verschmelzen – Lurija sprach in diesem Zusammenhang gern von der «romantischen Wissenschaft». Beide treffen sich im Schnittpunkt von Tatsache und Legende, jenem Schnittpunkt, der charakteristisch ist für das Leben der in diesem und in meinem früheren Buch ‹Awakenings› (‹Bewusstseinsdämmerungen›) beschriebenen Menschen.
Aber mit welchen Tatsachen, welchen Legenden werden wir konfrontiert! Womit sollen wir sie vergleichen? Vielleicht gibt es dafür keine bestehenden Modelle, Metaphern oder Mythen. Ist vielleicht eine Zeit neuer Symbole, neuer Mythen angebrochen?
Acht der Kapitel in diesem Buch sind bereits vorher erschienen: «Der verlorene Seemann», «Hände», «Die Zwillinge» und «Der autistische Künstler» im New York Review of Books (1984 und 1985) und «Witty Ticcy Ray», «Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte» und «Erinnerung» im London Review of Books (1981, 1983, 1984), wo eine gekürzte Fassung der letzten Geschichte den Titel «Musical Ears» trug. «Schräglage» erschien 1985 in The Sciences. Ein sehr früher Bericht eines meiner Patienten – die «Vorlage» für Rose R. in ‹Bewusstseinsdämmerungen› und für Deborah in ‹Eine Art Alaska› von Harold Pinter (der sich von jenem Buch inspirieren ließ) – findet sich in «Nostalgische Ausschweifungen» (es erschien ursprünglich im Frühjahr 1970 unter dem Titel «Incontinent Nostalgia Induced by L-Dopa» in Lancet). Die ersten beiden der vier «Phantome» wurden 1984 im British Medical Journal unter der Rubrik «Klinische Kuriosa» beschrieben. Zwei kurze Beiträge stammen aus früheren Büchern: «Der Mann, der aus dem Bett fiel» ist dem Buch ‹A Leg to Stand On› (‹Der Tag, an dem mein Bein fortging›) entnommen, und «Die Visionen der heiligen Hildegard» ist in ‹Migräne› enthalten.
Die übrigen zwölf Kapitel sind neu und bisher unveröffentlicht[*] und wurden im Herbst und Winter des Jahres 1984 verfasst.
Zu den Kollegen, denen ich besonderen Dank schulde, gehört der verstorbene James Purdon Martin, dem ich Videoaufnahmen von «Rebecca» und «Mr. MacGregor» gezeigt und mit dem ich diese Fälle ausführlich diskutiert habe – die Kapitel «Die körperlose Frau» und «Schräglage» sind auch Ausdruck meiner Dankbarkeit. Michael Kremer, der zu meiner Zeit in London mein «Chef» war, schilderte mir nach der Lektüre meines Buches ‹Der Tag, an dem mein Bein fortging› einen sehr ähnlichen Fall, den er selbst behandelt hat – beide Fälle sind nun in «Der Mann, der aus dem Bett fiel» zusammengefasst. Donald Macrae hat durch Zufall nur zwei Jahre nachdem ich «Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte» geschrieben hatte, einen außergewöhnlichen und frappierend ähnlichen Fall von visueller Agnosie entdeckt, der verkürzt in der Nachschrift jenes Kapitels beschrieben wird. Ganz besonders möchte ich meiner Freundin und Kollegin Isabelle Rapin aus New York danken, mit der ich viele der hier beschriebenen Fälle erörtert habe; sie hat mich Christina (der «körperlosen Frau») vorgestellt und kannte José, den «autistischen Künstler», als er noch ein Kind war.
Außerdem möchte ich mich für die selbstlose Hilfe und die Großzügigkeit der Patienten (und in einigen Fällen der Verwandten dieser Patienten) bedanken, deren Geschichten ich hier erzähle. Sie haben (sehr oft jedenfalls) gewusst, dass es noch keine Möglichkeit gibt, ihnen direkt zu helfen, und dennoch haben sie es mir gestattet und mich sogar dazu ermutigt, über ihr Leben zu schreiben – in der Hoffnung, andere möchten lernen, verstehen und eines Tages vielleicht in der Lage sein zu heilen. Wie auch in ‹Bewusstseinsdämmerungen› habe ich aus Gründen der Diskretion und der ärztlichen Schweigepflicht die Namen und einige Details von untergeordneter Bedeutung verändert. Es ist jedoch immer mein Ziel gewesen, das grundsätzliche «Lebensgefühl» meiner Patienten wahrheitsgetreu wiederzugeben.
Schließlich möchte ich noch meine Dankbarkeit – die mehr ist als bloße Dankbarkeit – gegenüber meinem Mentor und Arzt ausdrücken: Ihm habe ich dieses Buch gewidmet.
New York, 10. Februar 1985 O.W. S.
Teil einsAusfälle
Einleitung
Das Lieblingswort der Neurologen ist «Ausfall». Es bezeichnet die Beeinträchtigung oder Aufhebung einer neurologischen Funktion: den Verlust der Sprechfähigkeit, den Verlust der Sprache, den Verlust des Gedächtnisses, den Verlust des Sehvermögens, den Verlust der Geschicklichkeit, den Verlust der Identität und zahllose andere Mängel und Verluste spezifischer Funktionen (oder Fähigkeiten). Für jede dieser Funktionsstörungen (ein weiterer beliebter Ausdruck) gibt es eine privative, das Fehlen hervorhebende Bezeichnung: Aphonie, Aphasie, Alexie, Apraxie, Agnosie, Amnesie, Ataxie. Jede spezifische neurale oder mentale Funktion, deren ein Patient durch Krankheit, Verletzung oder Entwicklungsstörungen ganz oder teilweise beraubt sein kann, lässt sich mit einem besonderen Wort benennen.
Die wissenschaftliche Analyse der Beziehung zwischen Gehirn und Geist begann 1861, als Broca in Frankreich herausfand, dass gewisse Schwierigkeiten des Patienten, sich sprachlich auszudrücken (Aphasie), durchweg als Symptom auftraten, dem die Zerstörung eines bestimmten Teils der linken Gehirnhälfte vorausgegangen war. Daraus entwickelte sich eine zerebrale Neurologie, die es im Laufe der Jahrzehnte ermöglichte, das menschliche Gehirn zu «kartographieren» und spezifische Fähigkeiten – linguistische, intellektuelle, perzeptive usw. – gleichermaßen spezifischen «Zentren» im Gehirn zuzuordnen. Gegen Ende des Jahrhunderts wiesen kritische Beobachter – vor allem Freud in seinem Buch ‹Zur Auffassung der Aphasien› (1891) – darauf hin, dass diese Art der Lokalisation grob vereinfachend sei, dass alle mentalen Leistungen eine komplizierte innere Struktur aufwiesen und auf einer ebenso komplexen physiologischen Grundlage basieren müssten. Nach Freuds Meinung galt dies besonders für bestimmte Störungen der Wahrnehmung und des Wiedererkennens, für die er die Bezeichnung «Agnosie» einführte. Für ein wirkliches Verständnis der Aphasie und der Agnosie würde, so meinte er, eine neue, differenziertere Wissenschaft erforderlich sein.
Diese neue, mit der Beziehung zwischen Gehirn und Geist befasste Wissenschaft, die Freud vorschwebte, haben während des Zweiten Weltkriegs in Russland A.R. Lurija (und sein Vater R.A. Lurija), Leontjew, Bernstein und andere ins Leben gerufen: die «Neuropsychologie». Die Entwicklung dieses ungeheuer fruchtbaren Wissenschaftszweiges war das Lebenswerk von A.R. Lurija. In Anbetracht der revolutionären Bedeutung dieser neuen Erkenntnisse dauerte es recht lange, bis sie im Westen bekannt wurden. Sie wurden erstmals systematisch in dem umfangreichen Buch ‹Die höheren kortikalen Funktionen des Menschen und ihre Störungen bei örtlichen Hirnschädigungen› (deutsche Übersetzung 1970) und, später noch einmal, auf ganz andere Weise, nämlich in Form einer Biographie oder «Pathographie», in dem Buch ‹The Man with a Shattered World› (etwa: «Der Mann, dessen Welt in Scherben fiel») vorgestellt. Obwohl diese Bücher auf ihre Art fast vollkommen waren, blieb doch ein ganzer Bereich, den Lurija nicht behandelt hatte. ‹Die höheren kortikalen Funktionen des Menschen› befasste sich nur mit jenen Funktionen, die der linken Gehirnhälfte zugeordnet sind; und auch bei Sasetzkij, dem Mann, dessen Fall in ‹The Man with a Shattered World› beschrieben wird, war die linke Gehirnhälfte schwerbeschädigt – die rechte dagegen intakt. Kurzum: Die gesamte Geschichte der Neurologie und der Neuropsychologie ist eine Geschichte der Erforschung der linken Gehirnhälfte.
Ein wichtiger Grund für die Vernachlässigung der rechten Hemisphäre besteht darin, dass es leicht ist, die Auswirkungen verschiedenster Verletzungen der linken Seite zu demonstrieren, während die entsprechenden Syndrome der rechten Gehirnhälfte weit weniger deutlich ausgeprägt sind. Man hält sie, gewöhnlich mit leichter Verachtung, für «primitiver» als die linke, die als einzigartige Blüte der menschlichen Evolution gilt. Und in gewisser Weise stimmt das auch: Die linke Gehirnhälfte ist differenzierter und spezialisierter – sie stellt die letzte Entwicklungsstufe des Gehirns der Primaten, vor allem des Menschen dar. Andererseits ist die rechte Hälfte in entscheidendem Maße an der Wahrnehmung der Wirklichkeit beteiligt, eine Fähigkeit, über die jedes Lebewesen verfügen muss, um überleben zu können. Die linke Hemisphäre funktioniert wie ein Computer, der dem ursprünglichen Gehirn angefügt ist und Programme und schematische Abläufe zu bewältigen vermag; die klassische Neurologie aber beschäftigte sich mehr mit schematischen Abläufen als mit der Realität, sodass man einige Syndrome der rechten Gehirnhälfte nach ihrer Entdeckung lediglich als wunderliche Phänomene abtat.
In der Vergangenheit haben einige Wissenschaftler – so zum Beispiel Anton in den neunziger Jahren des 19. Jahrhunderts und Pötzl 1928 – versucht, die Syndrome der rechten Gehirnhälfte zu untersuchen, aber diese Versuche sind ihrerseits wieder auf bizarre Weise ignoriert worden. In ‹The Working Brain›, einem seiner letzten Bücher, widmet Lurija den Syndromen der rechten Gehirnhälfte einen kurzen, aber vielversprechenden Abschnitt. Er endet mit den Worten: «Diese noch immer völlig unerforschten Defekte bringen uns zu einem der grundlegendsten Probleme: Welche Rolle spielt die rechte Gehirnhälfte im direkten Bewusstsein? … Die Erforschung dieses höchst wichtigen Bereiches ist bis jetzt vernachlässigt worden … Gegenwärtig bereite ich eine Reihe von Berichten vor, die eine detaillierte Analyse enthalten werden.»
Einige dieser Berichte schrieb Lurija noch in den letzten Monaten seines Lebens, als er schon todkrank war. Ihre Veröffentlichung erlebte er nicht mehr – und sie wurden nie in Russland publiziert. Er schickte sie an R.L. Gregory in England, und sie werden demnächst in Gregorys ‹Oxford Companion to the Mind› erscheinen.
Ein Neurologe, der Defekte der rechten Hemisphäre erforschen will, steht vor erheblichen inneren und äußeren Schwierigkeiten. Es ist für Patienten mit bestimmten Syndromen der rechten Gehirnhälfte nicht nur schwierig, sondern unmöglich, ihre eigene Störung zu erkennen – dies ist eine besondere und spezifische Form der «Anosagnosie», wie Babinski sie genannt hat. Und auch für den einfühlsamsten Beobachter ist es außerordentlich schwer, sich in die innere Verfassung, die «Situation» solcher Patienten, zu versetzen, denn diese ist fast unvorstellbar weit von allem entfernt, was er selbst je erlebt hat. Im Gegensatz dazu kann man sich in die Syndrome der linken Gehirnhälfte relativ leicht hineinversetzen. Obwohl die Syndrome der rechten Gehirnhälfte ebenso häufig sind wie die der linken – und warum sollten sie das auch nicht sein? –, wird man in der neurologischen und neuropsychologischen Literatur auf tausend Beschreibungen von Syndromen der linken Hemisphäre nur eine Beschreibung von Störungen der rechten finden. Es ist, als seien diese Symptomkomplexe dem «neurologischen Naturell» irgendwie fremd. Und doch haben sie, wie Lurija sagt, eine fundamentale Bedeutung: Vielleicht erfordern und fördern sie eine neue Art der Neurologie, eine «personalistische» oder (wie Lurija sich gern ausdrückte) eine «romantische» Wissenschaft, denn hier eröffnen sich der Forschung die physischen Grundlagen der persona, des Selbst. Eine solche Forschung begänne nach Lurijas Meinung am besten mit einer Geschichte – der detaillierten Krankengeschichte eines Mannes mit einer tiefgreifenden Störung der rechten Gehirnhälfte. Diese Krankengeschichte wäre das Gegenteil und Gegenstück zur Geschichte von dem «Mann, dessen Welt in Scherben fiel». In einem seiner letzten Briefe schrieb mir Lurija: «Veröffentlichen Sie solche Geschichten, auch wenn sie nichts weiter sind als Skizzen. Es ist ein Reich des Wunderbaren.» Ich gestehe, dass mich diese Störungen faszinieren, denn sie erschließen, vielmehr: sie versprechen uns Einblicke in Bereiche, von denen man bisher kaum eine Vorstellung hatte, und geben Anstöße zur Entwicklung einer offeneren und weiträumigeren Neurologie und Psychologie, die sich in aufregender Weise von der recht starren und mechanistischen Neurologie der Vergangenheit unterscheidet.
Es sind also weniger die Ausfälle im traditionellen Sinne, die mich interessieren, als vielmehr die neurologischen Störungen, die sich auf das Selbst auswirken. Solche Störungen können von mancherlei Art sein und ebenso aus einer Übersteigerung wie aus einer Beeinträchtigung von Funktionen entstehen. Daher erscheint es vernünftig, diese beiden Kategorien getrennt zu untersuchen. Ich möchte jedoch gleich zu Anfang darauf hinweisen, dass eine Krankheit nie lediglich ein Überschuss oder eine Einbuße ist, sondern dass es immer eine Reaktion des betroffenen Organismus oder des Individuums gibt, die darauf abzielt, etwas wiederherzustellen, zu ersetzen, auszugleichen und die eigene Identität zu bewahren, ganz gleich, wie seltsam die Mittel zu diesem Zweck auch sein mögen. Es ist ein wesentlicher Teil unserer Aufgabe als Ärzte, nicht nur die pathogene Schädigung des Nervensystems, sondern auch diese Mittel zu untersuchen und zu beeinflussen.
Ivy McKenzie hat diesen Punkt eindrucksvoll unterstrichen: «Was macht denn eigentlich einen ‹Symptomkomplex› oder eine ‹neue Krankheit› aus? Der Arzt beschäftigt sich nicht, wie der Naturwissenschaftler, mit einer Vielfalt verschiedener Organismen, die theoretisch einer durchschnittlichen Umgebung auf durchschnittliche Weise angepasst sind, sondern nur mit einem einzigen Organismus, nämlich dem des Menschen, der seine Identität unter widrigen Umständen zu bewahren sucht.»
Diese Dynamik, dieses «Streben nach Bewahrung der Identität», so sonderbar die Mittel und Auswirkungen dieses Strebens auch sein mögen, hat die Psychiatrie schon vor langer Zeit erkannt, und diese Erkenntnis ist, wie so vieles andere, eng mit dem Werk Sigmund Freuds verknüpft. So waren für ihn Wahnvorstellungen nicht primäre Erscheinungen, sondern der (wenn auch fehlgeleitete) Versuch der Wiederherstellung, der Rekonstruktion einer Welt, die dem Chaos anheimgefallen ist. Ebendies meint Ivy McKenzie, wenn er schreibt: «Die Pathophysiologie des Parkinson-Syndroms ist die Beschreibung eines organisierten Chaos, eines Chaos, das in erster Linie durch die Zerstörung wichtiger Integrationen entstanden und im Verlauf des Rehabilitationsprozesses auf einer unsicheren Basis reorganisiert worden ist.»
So wie ich in meinem Buch ‹Bewusstseinsdämmerungen› ein «organisiertes Chaos» untersucht habe, das als Folge einer einzigen, wenn auch vielgestaltigen Krankheit auftritt, so sind die folgenden Beiträge eine Reihe ähnlicher Untersuchungen des organisierten Chaos, das durch eine große Vielfalt verschiedener Krankheiten hervorgerufen wird.
Der in meinen Augen wichtigste Fall in diesem ersten Abschnitt «Ausfälle» ist der einer besonderen Art von visueller Agnosie: «Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte». Meiner Meinung nach ist er von fundamentaler Bedeutung. Solche Fälle stellen ein unantastbares Axiom der klassischen Neurologie in Frage – insbesondere die Annahme, dass jede Hirnverletzung das (um mit Kurt Goldstein zu sprechen) «abstrakte und kategorielle Vermögen» schwächt oder auslöscht und das Individuum auf das Emotionale und Konkrete reduziert. (Eine sehr ähnliche These stellte in den sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts Hughlings-Jackson auf.) Hier, im Fall von Dr. P., ist jedoch das genaue Gegenteil der Fall: Dieser Mann hat (wenn auch nur im visuellen Bereich) das Emotionale, das Konkrete, das Persönliche, das «Reale» völlig verloren … und ist gleichsam, mit geradezu absurden Konsequenzen, auf das Abstrakte und Kategorielle reduziert. Was hätten wohl John Hughlings-Jackson und Kurt Goldstein daraus geschlossen? Ich habe sie in Gedanken oft gebeten, Dr. P. zu untersuchen, und sie dann gefragt: «Nun, meine Herren, was sagen Sie jetzt?»
1Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte
Dr. P. war ein ausgezeichneter Musiker. Er war lange Zeit ein berühmter Sänger gewesen, bevor er einem Ruf als Professor an die hiesige Musikhochschule gefolgt war. Hier fiel er erstmals durch gewisse seltsame Verhaltensweisen auf, und zwar im Umgang mit seinen Studenten. Manchmal geschah es, dass Dr. P. einen Studenten, der vor ihm stand, nicht erkannte – genauer gesagt: Er erkannte sein Gesicht nicht. Sobald der Student ihn dann ansprach, konnte er ihn anhand seiner Stimme identifizieren. Solche Vorfälle ereigneten sich immer häufiger, und in seiner Umgebung war man deswegen peinlich berührt, beunruhigt – und manchmal auch erheitert. Dr. P. war nämlich nicht nur in zunehmendem Maße außerstande, Gesichter zu erkennen, sondern er sah auch Gesichter, wo gar keine waren: Auf der Straße tätschelte er im Vorbeigehen Hydranten und Parkuhren, weil er sie für Kinder hielt; liebenswürdig sprach er geschnitzte Pfosten an und war erstaunt, wenn sie keine Antwort gaben. Anfangs lachten alle, Dr. P. eingeschlossen, über diese merkwürdigen Fehlleistungen. Und hatte er nicht immer schon einen verschrobenen Sinn für Humor gehabt und Paradoxien und Späße geliebt? Seine musikalischen Fähigkeiten waren so beeindruckend wie eh und je, er fühlte sich sehr wohl, und seine Fehler waren so komisch und wirkten so genial, dass man sie kaum ernst nehmen oder in ihnen Anzeichen einer Krankheit sehen konnte. Der Gedanke, dass «irgendetwas nicht in Ordnung sein» könnte, kam Dr. P. erst etwa drei Jahre später, als er Diabetes bekam. Da er wusste, dass sich diese Krankheit auf die Augen auswirken kann, suchte er einen Augenarzt auf, der eine genaue Anamnese aufnahm und seine Augen gründlich untersuchte. «Mit Ihren Augen ist alles in Ordnung», sagte der Arzt schließlich, «aber mit dem Sehzentrum Ihres Gehirns stimmt etwas nicht. Sie brauchen keinen Augenarzt, sondern einen Neurologen.» Und so kam Dr. P. zu mir.
Schon nach wenigen Minuten war ich mir sicher, dass es sich bei ihm nicht um einen einfachen Hirnabbau handelte. Er war ein außergewöhnlich kultivierter und charmanter Mann, der sich gewählt und flüssig auszudrücken wusste und über Phantasie und Humor verfügte. Ich konnte mir nicht vorstellen, warum man ihn an unsere Klinik überwiesen hatte.
Aber er hatte tatsächlich etwas Merkwürdiges an sich. Beim Sprechen wandte er sich mir zu und sah mich an, und doch war da irgendetwas – es war schwer, den Finger darauf zu legen. Schließlich fiel mir auf, dass er sich nicht mit den Augen, sondern mit den Ohren auf mich konzentrierte. Anstatt mich anzusehen, mich zu betrachten, mich «in sich aufzunehmen», wie es gewöhnlich der Fall ist, fixierten mich seine Augen mit abrupten, seltsamen Bewegungen – sein Blick richtete sich auf meine Nase, auf mein rechtes Ohr, fuhr hinab zu meinem Kinn, hinauf zu meinem rechten Auge – als betrachteten (oder studierten) sie diese einzelnen Gesichtszüge, ohne mein ganzes Gesicht und seinen Ausdruck, also «mich» als Ganzes zu sehen. Ich bin mir nicht sicher, ob mir das damals schon voll bewusst war, aber es hatte etwas Irritierendes. Es war ein Bruch in dem normalen Wechselspiel von Blick und Gesichtsausdruck. Er sah mich an, seine Augen tasteten mich ab, und doch …
«Was führt Sie zu mir?», fragte ich ihn schließlich.
«Ich weiß auch nicht», antwortete er und lächelte. «Mir fehlt nichts, aber andere Leute scheinen zu glauben, dass irgendetwas mit meinen Augen nicht stimmt.»
«Aber Sie selbst haben keine Probleme damit?»
«Nein, nicht direkt. Ich mache nur gelegentlich Fehler.»
Ich verließ für kurze Zeit den Raum, um mit seiner Frau zu sprechen. Als ich zurückkam, saß Dr. P. ruhig und eher aufmerksam hinaushorchend als hinaussehend am Fenster. «Der Verkehrslärm», sagte er, «die Straßengeräusche und das Rauschen von Zügen in der Entfernung – das ist fast wie eine Symphonie, finden Sie nicht? Kennen Sie Honeggers ‹Pacific 234›?»
Was für ein reizender Mann, dachte ich. Es war doch alles in Ordnung mit ihm. Ob er damit einverstanden sei, dass ich ihn untersuche, fragte ich ihn.
«Aber natürlich, Dr. Sacks.»
Die beruhigende Routine der neurologischen Untersuchung – Muskeltonus, grobe Kraft, Reflexstatus, Koordination – überdeckte meine, und vielleicht auch seine, Besorgnis. Als ich seine Reflexe prüfte – die auf der linken Seite eine Spur abnorm waren –, ereignete sich der erste merkwürdige Vorfall. Ich hatte ihm den linken Schuh ausgezogen, um mit einem Schlüssel über seine Fußsohle zu streichen (ein vielleicht komisch wirkender, aber unerlässlicher Test der Reflexe), und ihn gebeten, seinen Schuh wieder anzuziehen, während ich meinen Augenspiegel zusammensetzte. Zu meiner Überraschung hatte er eine Minute später seinen Schuh noch nicht wieder angezogen.
«Kann ich Ihnen helfen?», fragte ich.
«Wobei? Wem?»
«Kann ich Ihnen helfen, den Schuh wieder anzuziehen?»
«Ach», sagte er, «den Schuh hatte ich ganz vergessen», und fügte mit leiser Stimme hinzu: «Den Schuh? Den Schuh?» Er schien verwirrt.
«Ihren Schuh», wiederholte ich. «Sie sollten ihn vielleicht lieber wieder anziehen.»
Ohne den Schuh zu beachten, sah er mit intensiver, aber irregeleiteter Konzentration an sich hinunter. Schließlich blieb sein Blick an seinem Fuß hängen: «Das ist doch mein Schuh, oder?»
Hatte ich mich ver-hört? Hatte er sich ver-sehen?
«Meine Augen», sagte er erklärend und berührte seinen Fuß mit der Hand. «Das ist mein Schuh, nicht wahr?»
«Nein, das ist Ihr Fuß. Ihr Schuh ist dort.»
«Ah, und ich dachte, das sei mein Fuß.»
Machte er Witze? War er verrückt? War er blind? Wenn das einer seiner «seltsamen Fehler» war, dann war es der seltsamste Fehler, den ich je gesehen hatte.
Um weiteren Komplikationen vorzubeugen, half ich ihm, seinen Schuh (seinen Fuß) anzuziehen. Dr. P. schien gelassen, unbekümmert zu sein – fast hatte ich den Eindruck, als amüsiere ihn der Zwischenfall. Ich setzte meine Untersuchung fort. Sein Sehvermögen war gut: Er hatte keinerlei Schwierigkeiten, eine Nadel auf dem Boden zu erkennen; nur manchmal, wenn sie zu seiner Linken lag, entging sie ihm.
Er konnte also gut sehen, aber was sah er? Ich schlug eine Zeitschrift auf und bat ihn, einige der Bilder darin zu beschreiben.
Seine Reaktion war äußerst merkwürdig. Seine Augen huschten von einem Objekt zum nächsten, sie registrierten winzige Einzelheiten, individuelle Eigenarten, wie sie es mit meinem Gesicht getan hatten. Ein auffallend heller Punkt, eine Farbe, eine Form erregte seine Aufmerksamkeit und ließ ihn eine Bemerkung machen – aber in keinem Fall nahm er das Bild in seiner Ganzheit in sich auf. Er konnte nicht das Ganze sehen, sondern nur Details, die er wie ein Radarschirm registrierte. Nie trat er in eine Beziehung zu dem Bild – nie befasste er sich sozusagen mit der Physiognomie der Abbildung. Er hatte keinerlei Begriff von Landschaft oder Szenerie.
Ich zeigte ihm das Titelbild der Zeitschrift, eine endlose Reihe von Sanddünen in der Sahara.
«Was sehen Sie hier?», fragte ich.
«Ich sehe einen Fluss», sagte er. «Und am Ufer ist ein kleines Gasthaus mit einer Terrasse. Auf der Terrasse sitzen Leute und essen. Hier und da stehen bunte Sonnenschirme.» Er sah – wenn man das «sehen» nennen kann – an der Zeitschrift vorbei in die Luft und plauderte ungezwungen über nichtexistente Dinge, als hätte das Fehlen von Gegenständen auf dem Bild ihn dazu gezwungen, sich den Fluss, die Terrasse und die bunten Sonnenschirme vorzustellen.
Ich muss entsetzt dreingeblickt haben, aber er schien davon überzeugt zu sein, dass er seine Sache gut gemacht hatte. Ein Lächeln spielte um seinen Mund. Außerdem hatte er anscheinend den Eindruck, die Untersuchung sei abgeschlossen, denn er sah sich nach seinem Hut um. Er streckte die Hand aus und griff nach dem Kopf seiner Frau, den er hochzuheben und aufzusetzen versuchte. Offenbar hatte er seine Frau mit einem Hut verwechselt! Seine Frau sah aus, als sei sie derlei gewohnt.
Die konventionelle Neurologie (oder Neuropsychologie) bot keine Erklärung für das, was geschehen war. In gewissen Bereichen schien Dr. P. völlig normal, in anderen jedoch absolut und auf unerklärliche Weise gestört zu sein. Wie konnte er einerseits seine Frau mit einem Hut verwechseln und andererseits offenbar immer noch als Professor an einer Hochschule für Musik unterrichten?
Ich musste nachdenken und ihn noch einmal untersuchen – und zwar in seiner Wohnung, seiner vertrauten Umgebung.
Einige Tage später besuchte ich Dr. P. und seine Frau. Ich hatte verschiedene Dinge dabei, mit denen ich seine Wahrnehmung testen wollte, unter anderem die Noten der «Dichterliebe» (ich wusste, dass er Schumann liebte). Frau P. öffnete mir und bat mich herein. Die Einrichtung der geräumigen Wohnung ließ mich an Berlin um die Jahrhundertwende denken. Im Mittelpunkt des Wohnzimmers stand ein herrlicher alter Bösendorfer-Flügel, umgeben von Notenständern, Instrumenten, Noten … In dem Zimmer gab es auch Regale mit Büchern, und an den Wänden hingen Gemälde, aber die Musik stand im Mittelpunkt. Dr. P. trat ein und ging zerstreut mit ausgestrecktem Arm auf die Standuhr zu, aber als er meine Stimme hörte, bemerkte er seinen Irrtum und schüttelte mir die Hand. Wir unterhielten uns ein wenig über Konzerte und Aufführungen, die in letzter Zeit stattgefunden hatten, und dann fragte ich ihn schüchtern, ob er mir wohl die Freude machen würde zu singen.
«Ah, die ‹Dichterliebe›!», rief er. «Aber ich kann keine Noten mehr lesen. Würden Sie mich begleiten?»
Ich sagte, ich wolle es versuchen. Auf dem wunderbaren alten Flügel klang sogar mein Klavierspiel fehlerfrei, und Dr. P. begann zu singen. Ein gealterter Fischer-Dieskau, aber mit unendlich weicher Stimme. Sie war, ebenso wie sein Gehör, vollkommen, und er verfügte über ein äußerst präzises musikalisches Auffassungsvermögen. Es war offenkundig, dass die Musikhochschule ihn nicht aus Barmherzigkeit beschäftigte.
Dr. P.s Schläfenlappen waren also intakt: Der für das musikalische Empfinden zuständige Teil der Großhirnrinde arbeitete einwandfrei. Wie aber, so fragte ich mich, stand es mit den Scheitel- und Hinterhauptlappen, besonders mit jenen Bereichen, in denen die Umsetzung visueller Eindrücke stattfindet? Zu meiner Ausrüstung für neurologische Untersuchungen gehören auch einige regelmäßige (platonische) Körper, und ich beschloss, meine Tests mit ihnen zu beginnen.
«Was ist das?», fragte ich und zeigte ihm den ersten Körper.
«Ein Würfel natürlich.»
«Und das?», fragte ich und holte den nächsten hervor.
Er bat mich, den Körper näher betrachten zu dürfen, und untersuchte ihn rasch und systematisch. «Ein Dodekaeder. Die anderen brauchen Sie gar nicht erst herauszuholen – einen Ikosaeder erkenne ich ebenfalls.»
Abstrakte Formen bereiteten ihm offenbar keine Probleme. Wie stand es mit Gesichtern? Ich zeigte ihm Spielkarten. Alle identifizierte er sofort, auch die Buben, Damen, Könige und Joker. Aber diese Bilder waren ja stilisiert, und es war unmöglich zu sagen, ob er die Gesichter erkannte oder lediglich die Muster. Ich beschloss, ihm ein Buch mit Karikaturen zu zeigen, das ich in meiner Aktentasche mitgebracht hatte. Auch hier schnitt er in den meisten Fällen gut ab. Sobald er ein Erkennungsmerkmal wie Churchills Zigarre sah, konnte er das Gesicht identifizieren. Aber auch Karikaturen sind ja formal und schematisch. Ich musste feststellen, ob er mit wirklichen, erscheinungsgetreu dargestellten Gesichtern etwas anfangen konnte.
Ich schaltete den Fernseher ein, stellte den Ton ab und fand, nach einigem Suchen, ein Programm, auf dem ein alter Film mit Bette Davis gezeigt wurde. Es lief gerade eine Liebesszene. Dr. P. erkannte die Schauspielerin nicht, aber das mochte auch daher rühren, dass sie in seiner Welt nicht vorkam. Bemerkenswerter war, dass er den Ausdruck auf ihrem Gesicht und dem ihres Partners nicht zu deuten vermochte, obwohl sich ihr Mienenspiel im Verlauf einer einzigen turbulenten Szene von glühender Sehnsucht über Leidenschaft, Überraschung, Abscheu und Wut bis zur romantischen Versöhnung bewegte. Auf nichts von alledem konnte sich Dr. P. einen Reim machen. Er vermochte weder genau zu sagen, was auf dem Bildschirm vor sich ging und welche Rollen die Schauspieler spielten, noch welchen Geschlechts sie waren. Er verstand von der Szene, die sich vor seinen Augen abspielte, so viel wie ein Marsmensch.
Es war natürlich möglich, dass einige seiner Schwierigkeiten mit der Irrealität dieser Hollywood-Welt zu tun hatten, und mir kam der Gedanke, dass es ihm möglicherweise leichterfallen würde, Gesichter zu identifizieren, die in seinem eigenen Leben eine Rolle spielten. An den Wänden hingen Fotografien von seiner Familie, seinen Kollegen, seinen Studenten und von ihm selbst. Ich hatte gewisse Bedenken, als ich einige davon auswählte und ihm vorlegte. Was vor dem Fernsehgerät noch komisch oder lächerlich gewesen war, bekam nun, da es um das wirkliche Leben ging, etwas Tragisches. Alles in allem erkannte er niemanden – weder seine Familie noch seine Kollegen, seine Studenten oder sich selbst. Einstein erkannte er an dem charakteristischen Schnurrbart und der Frisur, und dasselbe war bei ein oder zwei anderen Bildern der Fall. «Ach, Paul!», sagte er, als ich ihm ein Porträt seines Bruders zeigte. «Dieses eckige Kinn und die großen Zähne … Ich würde Paul unter tausend Leuten herausfinden.» Aber war es Paul, den er erkannte, oder zwei, drei Besonderheiten, die es ihm ermöglichten, gezielt Vermutungen anzustellen? Sobald diese auffallenden «besonderen Kennzeichen» fehlten, war er völlig ratlos. Aber ihm fehlte nicht nur das Erkennungsvermögen, die gnosis – seine ganze Vorgehensweise war irgendwie grundfalsch: Er ging an diese Bilder – selbst an die von Menschen, die ihm nahestanden – heran, als handle es sich um abstrakte Puzzles oder Tests. Er betrachtete sie nicht, er setzte sich selbst nicht in Beziehung zu ihnen. Kein Gesicht war ihm vertraut, kein einziges war für ihn ein «Du». Jedes von ihnen stellte für ihn ein «Es», eine Ansammlung von Elementen dar. Dr. P. verfügte also über eine formale, aber über keinerlei personale Gnosis. Das erklärte seine Indifferenz, seine Blindheit für die Sprache der Mimik. Für uns ist ein Gesicht Ausdruck der Persönlichkeit – wir sehen das Individuum gewissermaßen durch seine persona, sein Gesicht. Für Dr. P. jedoch existierte keine persona in diesem Sinne – keine äußerliche persona und keine innere Persönlichkeit.
Auf dem Weg zu ihm hatte ich mir eine auffällige rote Rose gekauft und sie in mein Knopfloch gesteckt. Nun zog ich sie heraus und gab sie ihm. Er nahm sie in die Hand wie ein Botaniker oder Morphologe, der eine Probe untersucht – nicht wie ein Mensch, dem man eine Blume überreicht.
«Etwa fünfzehn Zentimeter lang», bemerkte er. «Ein rotes, gefaltetes Gebilde mit einem geraden grünen Anhängsel.»
«Ja», ermunterte ich ihn, «und was meinen Sie, was es ist, Dr. P.?»
«Schwer zu sagen.» Er schien verwirrt. «Ihm fehlt die einfache Symmetrie der anderen Körper, obwohl es vielleicht eine eigene, höhere Symmetrie besitzt … Ich glaube, es könnte eine Blume oder eine Blüte sein.»
«Könnte sein?», fragte ich nach.
«Könnte sein», bestätigte er.
«Riechen Sie doch einmal daran», schlug ich vor, und wieder sah er irgendwie verdutzt aus, als hätte ich ihn gebeten, eine höhere Symmetrie anhand ihres Geruchs zu identifizieren. Aber höflich wie er war, kam er meiner Aufforderung nach und hielt die Rose an seine Nase. Mit einem Mal hellte sich sein Gesicht auf.
«Herrlich!», rief er. «Eine junge Rose. Welch ein himmlischer Duft!» Er begann zu summen. «Die Rose, die Lilie …» Es hatte den Anschein, als vermittle sich ihm die Realität nicht über den Gesichts -, sondern über den Geruchssinn.
Ich unternahm noch einen letzten Versuch. Es war ein kalter Vorfrühlingstag, und ich hatte meinen Mantel und meine Handschuhe auf das Sofa gelegt.
«Was ist das?», fragte ich und zeigte ihm einen Handschuh.
«Darf ich das mal sehen?», bat er mich und untersuchte den Handschuh ebenso eingehend wie zuvor die geometrischen Körper.
«Eine durchgehende Oberfläche», sagte er schließlich, «die eine Umhüllung bildet.» Er zögerte. «Sie scheint – ich weiß nicht, ob das das richtige Wort dafür ist – fünf Ausstülpungen zu haben.»
«Ja», sagte ich vorsichtig. «Sie haben mir eine Beschreibung gegeben. Sagen Sie mir nun, was es ist.»
«Eine Art Behälter?»
«Ja, aber für was?»
«Für alles, was man hineintut!», antwortete Dr. P. lachend. «Da gibt es viele Möglichkeiten. Man könnte es zum Beispiel als Portemonnaie verwenden, für fünf verschiedene Münzgrößen. Man könnte …»
Ich unterbrach seinen Gedankenfluss. «Kommt es Ihnen nicht bekannt vor? Könnten Sie sich vorstellen, dass es an einen Teil Ihres Körpers passen würde?»
Er machte ein ratloses Gesicht.[*]
Kein Kind würde von «einer durchgehenden Oberfläche, die eine Umhüllung bildet» sprechen, aber jedes Kind, selbst ein Kleinkind, würde einen Handschuh augenblicklich als solchen erkennen und in ihm etwas Vertrautes sehen, da seine Form der der Hand ähnelt. Nicht so Dr. P. Nichts, was er sah, war ihm vertraut. In visueller Hinsicht irrte er in einer Welt lebloser Abstraktionen umher. Es gab für ihn keine wirkliche visuelle Welt, da er kein wirkliches visuelles Selbst besaß. Er konnte über Dinge sprechen, aber er sah sie nicht als das, was sie sind. Hughlings-Jackson schrieb über Patienten, deren linke Gehirnhälfte geschädigt war und die an Aphasie litten, sie hätten die Fähigkeit zu «abstrakten» und «propositionalen» Gedanken verloren, und verglich sie mit Hunden (oder vielmehr verglich er Hunde mit Patienten, die an Aphasie litten). Dr. P.s Gehirn dagegen arbeitete wie ein Computer. Gleichgültig wie ein Computer stand er der visuellen Welt gegenüber, und – was noch verblüffender war – wie ein Computer analysierte er sie, indem er sich an charakteristische Merkmale und schematische Beziehungen hielt. Er erkannte, wie bei einem Phantombild, schematische Strukturen, ohne damit auch deren Essenz zu erfassen.
Meine Untersuchungen hatten mir bisher keinen Zugang zu Dr. P.s innerer Realität verschafft. Waren sein visuelles Gedächtnis und das entsprechende Vorstellungsvermögen eigentlich noch intakt? Ich bat ihn, in seiner Erinnerung oder in seiner Vorstellung einen der Plätze in unserer Stadt zu überqueren und mir die Gebäude zu beschreiben, an denen er vorbeikam. Er zählte die auf der rechten Seite, nicht aber die zu seiner Linken auf. Dann bat ich ihn, sich vorzustellen, er betrete den Platz von Süden her. Wieder beschrieb er nur die Gebäude zur Rechten, ebenjene, die er zuvor nicht genannt hatte. Die Häuser auf der gegenüberliegenden Seite, die er gerade eben noch vor seinem inneren Auge «gesehen» hatte, blieben jetzt unerwähnt – wahrscheinlich «sah» er sie nicht mehr. Es war offensichtlich, dass seine Schwierigkeiten mit der linken Seite, seine das Gesichtsfeld betreffenden Ausfälle, gleichermaßen innerer wie äußerer Natur waren und seine visuelle Erinnerung und Vorstellung in zwei Hälften teilten.
Wie sah es nun auf einer höheren Ebene mit diesem inneren visuellen Vorstellungsvermögen aus? Ich dachte an die fast halluzinatorische Intensität, mit der Tolstoi seine Figuren beschreibt und mit Leben erfüllt, und fragte Dr. P., ob er ‹Anna Karenina› kenne. Er konnte sich ohne Schwierigkeiten an bestimmte Vorfälle in diesem Roman erinnern und die Handlung fehlerfrei nacherzählen, ließ jedoch die visuellen Charakteristika von Figuren und Szenen aus. Er wusste noch, was die Personen gesagt, nicht aber, wie sie ausgesehen hatten; und obwohl er ein bemerkenswertes Gedächtnis hatte und auf Befragen Beschreibungen visueller Art fast wörtlich zitieren konnte, sagten ihm diese offenbar nichts – sie entbehrten für ihn sensorischer, imaginativer und emotionaler Realität. Der Befund war klar: Es lag bei ihm auch eine innere Agnosie vor.[*]
Ich merkte jedoch bald, dass dies nur bei bestimmten Formen der Visualisierung der Fall war. Wenn es um Gesichter oder Szenen ging, um Erzählungen und Schauspiele, bei denen bildliche Eindrücke im Vordergrund stehen, war sie stark beeinträchtigt, ja fast nicht vorhanden. Die Visualisierung von Schemata jedoch war erhalten geblieben, vielleicht sogar verstärkt worden. Als ich mit ihm eine Partie Blindschach spielte, fiel es ihm nicht schwer, sich das Schachbrett und die Züge vorzustellen – er schlug mich sogar vernichtend.
Lurija schrieb über den Patienten Sasetzkij, er habe die Fähigkeit, Spiele zu spielen, völlig verloren, seine «lebhafte Phantasie» jedoch sei unversehrt. Sasetzkij und Dr. P. lebten in Welten, die einander spiegelbildlich entsprachen. Der traurigste Unterschied zwischen beiden aber war, dass Sasetzkij, wie Lurija bemerkt, «mit der verbissenen Zähigkeit eines Verurteilten versuchte, seine verlorengegangenen Fähigkeiten wiederzuerlangen», während Dr. P. nicht kämpfte und nicht wusste, was er verloren hatte – ja nicht einmal wusste, dass etwas verlorengegangen war. Aber wessen Fall war tragischer, wer war mehr verdammt? Der Mann, der um seinen Zustand wusste, oder der, der sich dessen nicht bewusst war?
Als die Untersuchung beendet war, bat uns Frau P. zu Tisch. Es gab Kaffee und verschiedene köstliche, kleine Kuchen. Dr. P. machte sich fröhlich summend und mit Appetit darüber her. Geschwind, ohne nachzudenken, mit fließender, ja geradezu melodischer Bewegung zog er den Kuchenteller zu sich heran und wählte einige Stücke aus. Es war ein dahineilender Strom, ein Lied aus Essen und Trinken, das plötzlich durch ein lautes, energisches Klopfen an der Tür unterbrochen wurde. Aufgeschreckt, fassungslos, wie gelähmt durch die Unterbrechung, hörte Dr. P. auf zu essen und verharrte mit einem Gesichtsausdruck, in dem sich unbestimmte, ziellose Verwirrung spiegelte, bewegungslos am Tisch. Er sah den Tisch, aber er erkannte ihn nicht mehr; er nahm ihn nicht mehr als einen Tisch wahr, an dem er Kuchen aß. Seine Frau schenkte ihm Kaffee ein, und der Duft stieg ihm in die Nase und brachte ihn in die Wirklichkeit zurück. Gleich darauf nahm er die Melodie des Essens wieder auf.
Ich fragte mich, wie er wohl sein Leben bewältigte. Was geschah, wenn er sich anzog, auf die Toilette ging, ein Bad nahm? Ich folgte seiner Frau in die Küche und fragte sie, wie er es zum Beispiel schaffte, sich anzuziehen: «Es ist genau wie beim Essen», erklärte sie. «Ich lege ihm seine Kleider an der gewohnten Stelle hin, und er zieht sich ohne Schwierigkeiten an. Dabei singt er vor sich hin. Das tut er bei allem, was er macht. Aber wenn er unterbrochen wird und den Faden verliert, ist er ratlos – dann weiß er mit seinen Kleidern oder mit seinem eigenen Körper nichts anzufangen. Er singt die ganze Zeit: Esslieder, Anziehlieder, Badelieder, alles Mögliche. Er kann nichts tun, ohne ein Lied daraus zu machen.»
Während wir miteinander sprachen, wurde ich auf die Bilder an den Wänden aufmerksam.
«Ja», sagte Frau P., «er war nicht nur Sänger, sondern auch ein talentierter Maler. Seine Bilder wurden jedes Jahr in der Hochschule ausgestellt.»
Neugierig betrachtete ich die Gemälde. Sie waren chronologisch geordnet. Alle seine früheren Werke waren realistisch, wirklichkeitsgetreue Darstellungen. Sie drückten Stimmungen aus und gaben eine Atmosphäre wieder, waren aber detailliert und konkret. Über die Jahre aber trat die Lebhaftigkeit, der konkrete, naturalistische Stil immer mehr hinter abstrakten, ja geometrischen und kubistischen Formen zurück. Die letzten Bilder schließlich waren, wenigstens für mich, völlig unverständlich: Sie bestanden nur noch aus chaotischen Linien und Farbklecksen. Ich sprach Frau P. darauf an.
«Ach, was seid ihr Ärzte doch für Philister!», rief sie. «Sehen Sie denn nicht seine künstlerische Entwicklung? Er hat den Realismus früherer Jahre abgestreift und sich der abstrakten, stilisierten Kunst zugewandt.»
Nein, das ist es nicht, dachte ich (hütete mich aber, dies vor Frau P. auszusprechen). Ihr Mann hatte tatsächlich dem Realismus den Rücken gekehrt und sich der stilisierten Wiedergabe des Abstrakten zugewandt, aber es handelte sich hierbei nicht um eine künstlerische, sondern eine pathologische Entwicklung – um die Entwicklung einer tiefgreifenden visuellen Agnosie, in deren Verlauf sich jede Fähigkeit zur Vorstellung und Vergegenständlichung, jeder Sinn für das Konkrete, die Realität, auflöste. Diese Bilder waren Zeugnis einer pathologischen Entwicklung, die nicht in den Bereich der Kunst, sondern in den der Neurologie fiel.