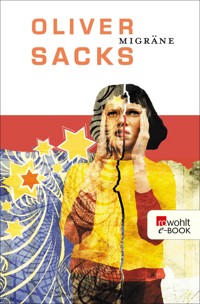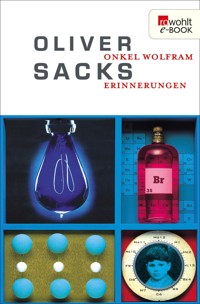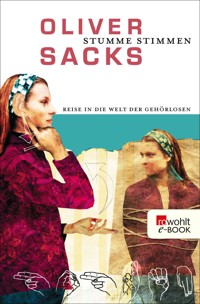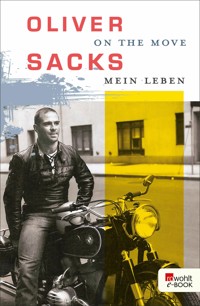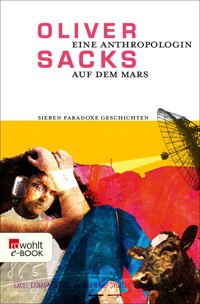
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Die Zeitschrift «Bild der Wissenschaft» kürte 1995 in der Rubrik Unterhaltung «Eine Anthropologin auf dem Mars» zum Wissenschaftsbuch des Jahres. Die Begründung: Das Buch, das ein Thema am spannendsten präsentiert: «In sieben spannenden Fallgeschichten führt der Mann mit dem Röntgenblick für die Abgründe der Seele seine Leser in das Paradox, in das surreale Universum von Individuen, die durch einen Defekt unter der Schädeldecke einen integralen Aspekt des In-der Welt-Seins verloren haben, das Farbgefühl oder den Bezug zur Gegenwart zum Beispiel.»
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 576
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Oliver Sacks
Eine Anthropologin auf dem Mars
Sieben paradoxe Geschichten
Über dieses Buch
Die Zeitschrift «Bild der Wissenschaft» kürte 1995 in der Rubrik Unterhaltung «Eine Anthropologin auf dem Mars» zum Wissenschaftsbuch des Jahres. Die Begründung:
Das Buch, das ein Thema am spannendsten präsentiert: «In sieben spannenden Fallgeschichten führt der Mann mit dem Röntgenblick für die Abgründe der Seele seine Leser in das Paradox, in das surreale Universum von Individuen, die durch einen Defekt unter der Schädeldecke einen integralen Aspekt des In-der-Welt-Seins verloren haben, das Farbgefühl oder den Bezug zur Gegenwart zum Beispiel.»
Vita
Oliver Sacks, geboren 1933 in London, war Professor für Neurologie und Psychiatrie an der Columbia University. Er wurde durch die Publikation seiner Fallgeschichten weltberühmt. Nach seinen Büchern wurden mehrere Filme gedreht, darunter «Zeit des Erwachens» (1990) mit Robert De Niro und Robin Williams. Oliver Sacks starb am 30. August 2015 in New York City.
Bei Rowohlt erschienen unter anderem seine Bücher «Awakenings – Zeit des Erwachens», «Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte», «Der Tag, an dem mein Bein fortging», «Der einarmige Pianist» und «Drachen, Doppelgänger und Dämonen». 2015 veröffentlichte er seine Autobiographie «On the Move».
Impressum
Das Vorwort, «Der farbenblinde Maler», «Der letzte Hippie», «Sehen oder nicht sehen» und den Dank übersetzte Alexandre Métraux, «Das Leben eines Chirurgen», «Wunderkinder» und die Literaturempfehlungen Hainer Kober, «Die Landschaft seiner Träume» und «Eine Anthropologin auf dem Mars» Jutta Schust.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg bei Reinbek, April 2019
Copyright © 1995 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Die Originalausgabe erschien 1995 im Verlag Alfred A. Knopf, New York/Toronto, unter dem Titel «An Anthropologist on Mars: Seven Paradoxical Tales»
«An Anthropologist on Mars: Seven Paradoxical Tales» Copyright © 1995 by Oliver Sacks
All Righs Reserved
Frühere Fassungen der Essays erschienen in «The New York Review of Books» («Der farbenblinde Maler» und «Der letzte Hippie») und «The New Yorker» («Eine Anthropologin auf dem Mars», «Die Landschaft seiner Träume», «Wunderkinder», «Sehen oder nicht sehen» und «Das Leben eines Chirurgen»)
Covergestaltung any.way, Hamburg
Coverabbildung Heidi Sorg, München
ISBN 978-3-644-00083-4
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Widmung
Motto
Vorwort
Der farbenblinde Maler
Der letzte Hippie
Das Leben eines Chirurgen
Sehen oder nicht sehen
Die Landschaft seiner Träume
Wunderkinder
Eine Anthropologin auf dem Mars
Dank
Zur Lektüre empfohlen
Vorwort
Der farbenblinde Maler
Der letzte Hippie
Das Leben eines Chirurgen
Sehen oder nicht sehen
Die Landschaft seiner Träume
Wunderkinder
Eine Anthropologin auf dem Mars
Bibliographie
Den sieben Menschen gewidmet, deren Geschichten hier erzählt werden
Die Welt ist nicht nur sonderbarer, als wir es uns vorstellen; sie ist auch sonderbarer, als wir es uns vorstellen können.
J.B.S. Haldane
Frage nicht, welche Krankheit die Person hat, sondern welche Person die Krankheit hat.
William Osler zugeschrieben
Vorwort
Ich schreibe gerade mit der linken Hand, obgleich ich weitgehend rechtshändig orientiert bin. Vor einem Monat wurde ich an der rechten Schulter operiert und darf – und kann – jetzt den rechten Arm nicht bewegen. Ich schreibe langsam, unbeholfen – aber von Tag zu Tag auch leichter, fließender. Ich passe mich an, lerne – nicht nur das Schreiben mit der linken Hand, sondern auch Dutzende anderer linkshändiger Fertigkeiten. Inzwischen sind auch die Zehen geschickt geworden – sie helfen bei Greifhandlungen und kompensieren so den Ausfall des unbeweglichen Arms. Ich bin ziemlich aus dem Gleichgewicht geraten, als ich die ersten Tage ohne den rechten Arm auskommen mußte, aber jetzt gehe ich anders, habe eine andere Balance entdeckt. Ich entwickle andere Verhaltensmuster, andere Gewohnheiten – eine andere Identität, könnte man sagen, jedenfalls in dieser einen Lebenssphäre. Einige Programme und Schaltkreise in meinem Gehirn müssen Veränderungen durchlaufen, Modifikationen der synaptischen Gewichtungen und Verbindungen und Signale (so feiner Natur allerdings, daß sie mittels unserer heutigen Aufnahmeverfahren noch nicht sichtbar gemacht werden können).
Einige meiner Anpassungsleistungen erfolgten gezielt und nach Plan, andere ergaben sich durch Versuch und Irrtum (in der ersten Woche nach der Operation verletzte ich mich an allen fünf Fingern der linken Hand) – doch die meisten traten von selbst ein, unbewußt, durch Umprogrammierungen, von denen ich nichts weiß (so wie ich nicht weiß und wissen kann, wie ich normalerweise gehe). Wenn alles gutgeht, werde ich im kommenden Monat anfangen können, mich wieder auf den vollen (und «natürlichen») Gebrauch des rechten Arms einzustellen, ihn wieder in mein Körperbild, mein Selbst, zu integrieren, und so erneut zum Rechtshänder werden.
Doch ist Genesung unter solchen Umständen keineswegs ein so einfacher, automatischer Vorgang wie die Vernarbung von Gewebe – sie erfordert viele ineinandergreifende Muskel- und Haltungsanpassungen, ganze Sequenzen neuer Bewegungsmuster (und ihre Synthese); ich werde lernen, experimentieren, mich auf die Suche nach einem Weg zur Gesundheit begeben müssen. Mein Chirurg, ein verständnisvoller Mensch, der sich der gleichen Operation hat unterziehen müssen, sagte mir: «Es gibt allgemeine Regeln, Einschränkungen und Empfehlungen. Aber alle Besonderheiten müssen Sie selbst herausfinden.» Jay, mein Physiotherapeut, äußerte sich auf ähnliche Weise: «Die Anpassung geht bei jedem anders vor sich. Das Nervensystem schafft sich seine eigenen Wege. Sie sind Neurologe – Sie müssen das doch Tag für Tag erleben.»
Die Phantasie der Natur, schreibt Freeman Dyson, ist reicher als unsere eigene, und er spricht von der Vielfalt der unbelebten und belebten Welten, der unüberschaubaren Fülle der physischen und der Lebensformen. Als Arzt studiere ich den Reichtum der Natur an den Phänomenen von Gesundheit und Erkrankung, an den unendlich vielen individuellen Arten der Anpassung, durch die Menschen, menschliche Organismen, konfrontiert mit den Herausforderungen und Wechselfällen des Lebens, sich selbst wiederherstellen.
Ausfälle, Störungen, Krankheiten können in diesem Sinne eine paradoxe Rolle spielen, denn sie bringen latente Kräfte, Entwicklungen, Evolutionen zum Vorschein, Formen des Lebens, die wir sonst nicht wahrnehmen, ja uns noch nicht einmal vorstellen könnten. Das Paradox der Krankheit, ihr «schöpferisches» Potential, ist das zentrale Thema dieses Buches.
Die Verwüstungen, die Entwicklungsstörungen oder Krankheiten anrichten, mögen uns erschrecken, und doch kann man in ihnen zuweilen etwas Schöpferisches entdecken. Denn wenn sie auch einzelne Wege zerstören, einzelne Arten von Tätigkeiten, so können sie andererseits das Nervensystem dazu veranlassen, andere Wege und Handlungsmöglichkeiten zu schaffen, und es so zu unerwartetem Wachstum nötigen. Diese andere Seite von Fehlentwicklungen und Erkrankungen entdecke ich potentiell bei fast jedem Patienten, und sie zu beschreiben ist mein wichtigstes Ziel.
Ähnliche Überlegungen hat Alexander Lurija angestellt, der wie kein anderer Neurologe seiner Zeit die Langzeitentwicklung von Patienten, die an den Folgen von Hirntumoren, Hirnverletzungen oder Schlaganfällen litten, ebenso untersucht hat wie die Anpassungsleistungen, die sie vollbrachten, um zu überleben. Als junger Forscher befaßte er sich auch (gemeinsam mit seinem Mentor Lew Wygotskij) mit gehörlosen und blinden Kindern. In einem Bericht über diese Untersuchungen hebt Wygotskij die intakten Fähigkeiten dieser Kinder gegenüber ihren Defiziten hervor:
Ein behindertes Kind repräsentiert einen qualitativ anderen, einmaligen Entwicklungstyp … Erreicht ein blindes oder gehörloses Kind die gleiche Entwicklungsstufe wie ein gesundes, geschieht dies beim behinderten Kind auf eine andere Weise, auf anderen Wegen und mit anderen Mitteln, und es ist für den Pädagogen besonders wichtig, daß er den einzigartigen Kurs kennt, auf den er das Kind führen muß. Dank seiner Einzigartigkeit verwandelt sich das Minus der Behinderung in ein Plus der Kompensation.
Die Tatsache, daß solche radikalen Adaptionen stattfinden können, veranlaßte Lurija, eine neue Auffassung vom Gehirn zu entwickeln, es nicht als fest programmiertes und statisches, sondern als dynamisches und aktives Organ zu betrachten, als ein überaus effizientes, anpassungsfähiges System, das auf Entwicklungen und Veränderungen eingerichtet ist und sich unentwegt auf die Bedürfnisse des Organismus einstellt – vor allem das Bedürfnis, eine kohärente Welt und eine stabile Identität zu schaffen, so beeinträchtigt die Hirnfunktionen auch sein mögen. Daß das Gehirn bis ins feinste differenziert ist, liegt auf der Hand: Es gibt Hunderte winziger Regionen, die für jeden Aspekt der Wahrnehmung und des Verhaltens unabdingbar sind (von der Farb- oder Bewegungswahrnehmung bis hin – möglicherweise – zur geistigen Orientierung eines Individuums). Das Rätsel ist, wie sie zusammenarbeiten, wie sie aufeinander abgestimmt sind, das Selbst, die Identität eines Menschen hervorzubringen.[*]
Dieser Aspekt der Plastizität, der enormen Anpassungsbereitschaft unseres Gehirns auch unter den besonderen (und oft grauenhaften) Bedingungen neuraler oder sensorischer Komplikationen, bestimmt mehr und mehr meine eigene Wahrnehmung von meinen Patienten. Er ist so dominant geworden, daß ich mich gelegentlich frage, ob es nicht dringend notwendig sei, die Begriffe «Gesundheit» und «Krankheit» selbst neu zu definieren, sie mehr unter dem Gesichtspunkt der Fähigkeit eines Organismus zu betrachten, eine neue, den veränderten Dispositionen und Bedürfnissen entsprechende Organisation und Ordnung aufzubauen, als aus dem Blickwinkel einer streng definierten «Norm».
Krankheit impliziert eine Beengung des Lebens, doch zu solchen Beengungen muß es nicht kommen. Fast alle meine Patienten, so scheint es mir, welche Probleme auch immer sie haben, greifen nach dem Leben – nicht nur trotz ihrer Umstände, sondern oft gerade wegen ihrer und mit ihrer Hilfe.
Es folgen nun sieben Erzählungen von natürlichen Verläufen – und der menschlichen Seele –, die unerwartet aus der Bahn geworfen wurden. Die Menschen in diesem Buch sind von neurologischen Ausfällen so verschiedener Art wie dem Touretteschen Syndrom, dem Autismus, der Amnesie, der totalen Farbenblindheit heimgesucht worden. Sie sind exemplarische Beispiele für diese Syndrome, sie sind «Fälle» im traditionellen medizinischen Sinne– doch gleichermaßen sind sie einzigartige Individuen, von denen ein jedes eine eigene Welt bewohnt (und gewissermaßen geschaffen hat).
Es sind Geschichten vom Überleben, einem Überleben unter veränderten, manchmal radikal veränderten Bedingungen, einem Überleben, das durch unsere wunderbaren (wenn auch zuweilen gefährlichen) Fähigkeiten zur Wiederherstellung und Anpassung ermöglicht wird. In früheren Büchern habe ich über die «Erhaltung» und (seltener) über den «Verlust» des Selbst bei neurologischen Störungen geschrieben. Inzwischen bin ich zu der Überzeugung gelangt, daß diese Bezeichnungen zu einfach sind – daß sich in solchen Situationen weder eine Erhaltung noch ein Verlust, sondern vielmehr eine Anpassung oder, bei tiefgreifend veränderter Hirntätigkeit und «Realität», eine Umbildung der Identität einstellt.
Wenn ein Arzt eine Krankheit ergründen will, muß er die Identität erkunden, die inneren Welten, die die Patienten unter dem Druck der Symptome erschaffen. Aber die Realitäten der Patienten, die Arten, wie sie und ihre Gehirne ihre eigenen Welten konstruieren, lassen sich über Verhaltensbeobachtungen – also von außen – nicht vollständig erschließen. Zusätzlich zum objektiven Ansatz des Wissenschaftlers und Naturforschers müssen wir uns einer intersubjektiven Vorgehensweise bedienen, um so, wie Foucault schreibt, «in das Innere des kranken Bewußtseins vorzudringen» und «die pathologische Welt mit den Augen des Patienten zu sehen». Keiner hat klüger über das Wesen und die Notwendigkeit einer solchen Anschauung oder Empathie geschrieben als Gilbert Keith Chesterton in Ausführungen, die er seinem gläubigen Detektiv Father Brown in den Mund legt. Als Father Brown nach seiner Methode, seinem «Geheimnis», gefragt wird, antwortet er:
Wissenschaft ist etwas Großartiges, wenn man mit ihr umgehen kann; in ihrem wirklichen Sinn eines der großartigsten Worte auf Erden. Was aber meinen die Leute neun von zehn Mal, wenn sie es heutigentags verwenden? Wenn sie sagen, Verbrechensaufklärung ist eine Wissenschaft? Wenn sie sagen, Kriminologie ist eine Wissenschaft? Sie meinen, daß sie sich außerhalb des Mannes begeben und ihn studieren, als sei er ein riesiges Insekt; sie würden sagen: in einem kalten unparteiischen Licht; ich sage: in einem toten und entmenschlichten Licht. Sie meinen, daß sie sich weit von ihm fort begeben, als wäre er ein fernes prähistorisches Monstrum; daß sie auf die Form seines «kriminellen Schädels» starren, als handele es sich um einen unheimlichen Auswuchs wie das Horn auf der Nase des Nashorns. Wenn ein Wissenschaftler von einem Typus spricht, meint er niemals sich selbst, sondern immer seinen Nachbarn; und wahrscheinlich seinen ärmeren Nachbarn. Ich leugne nicht, daß das kalte Licht manchmal sein Gutes haben mag; obwohl es in gewissser Weise das genaue Gegenteil von Wissenschaft ist. Es ist nicht nur von jedem Wissen fern, es unterdrückt in Wahrheit, was wir wissen. Es ist wie einen Freund als einen Fremden behandeln und so tun, als ob etwas Vertrautes in Wirklichkeit fern und geheimnisvoll sei. Es ist wie behaupten, daß ein Mann einen Rüssel zwischen den Augen habe oder daß er alle vierundzwanzig Stunden in einen Anfall von Fühllosigkeit stürze. Das, was Sie «das Geheimnis» nennen, ist genau das Gegenteil. Ich versuche nicht, mich außerhalb des Menschen zu begeben. Ich versuche vielmehr, in den Mörder hineinzukommen.
Die Exploration tiefgreifend veränderter Identitäten und Welten läßt sich nicht einfach in einer Praxis oder einem Büro durchführen. Der französische Neurologe François Lhermitte geht in dieser Hinsicht besonders sensibel vor. Statt seine Patienten nur in der Klinik zu beobachten, sucht er sie zu Hause auf, geht mit ihnen in Restaurants oder Theater, macht mit ihnen Ausflüge im Auto und nimmt so weit wie möglich an ihrem Leben teil. (Ähnlich verhält oder verhielt es sich mit den Hausärzten. Als sich mein Vater auch als Neunzigjähriger noch nicht mit dem Gedanken anfreunden konnte, sich aus dem Berufsleben zurückzuziehen, sagten wir ihm: «Gib wenigstens die Hausbesuche auf», aber er antwortete: «Nein, ich behalte die Hausbesuche bei und gebe dafür alles andere auf.»)
Mit diesen Vorstellungen im Kopf zog ich meinen weißen Kittel aus, vermied alles in allem die Kliniken, in denen ich die vergangenen zwanzig Jahre verbracht hatte, und erkundete die Lebenswelten meiner Protagonisten, wobei ich mir teils wie ein Naturforscher vorkam, der seltene Lebensformen analysiert, teils wie ein Anthropologe, wie ein Neuroanthropologe, der Feldforschung betreibt. Vor allem aber fühlte ich mich als Arzt, der von hier und dort zu Hausbesuchen geholt wurde, Hausbesuchen in den fernen Grenzbezirken der menschlichen Erfahrung.
Dies sind also Geschichten von Metamorphosen, die durch neurologischen Zufall zustande kamen, aber Metamorphosen zu anderen Seinszuständen und Lebensformen, die bei all ihrer Andersartigkeit nichts von ihrer menschlichen Natur verlieren.
Der farbenblinde Maler
Anfang März 1986erhielt ich den folgenden Brief:
Ich bin Maler, ziemlich erfolgreich sogar, und kürzlich fünfundsechzig geworden. Am 2. Januar dieses Jahres hatte ich einen Unfall – ein kleiner Lastwagen rammte mein Auto auf der Beifahrerseite. In der Notaufnahme eines regionalen Krankenhauses teilte man mir mit, daß ich eine Gehirnerschütterung erlitten habe. Bei Sehtests wurde dann festgestellt, daß ich weder Buchstaben noch Farben erkennen konnte. Die Buchstaben glichen griechischen Lettern. Was auch immer ich anschaute, es sah aus wie auf einem Schwarzweiß-Fernsehschirm. Nach einigen Tagen konnte ich Buchstaben wiedererkennen, und ich bekam Adleraugen – ich kann einen Wurm sehen, der sich einen Häuserblock von mir entfernt auf dem Boden windet. Die Sehschärfe ist unglaublich. ABER – ICH BIN ABSOLUT FARBENBLIND. Ich bin von einem Augenarzt zum anderen gelaufen – keiner weiß mit dieser Farbenblindheit etwas anzufangen. Ich habe Neurologen aufgesucht – ohne Erfolg. Selbst unter Hypnose kann ich keine Farben mehr wahrnehmen. Alle möglichen Tests sind durchgeführt worden – was Sie sich nur denken können. Mein brauner Hund ist dunkelgrau. Tomatensaft ist schwarz. Und die Farbfernsehbilder sind ein grauer Mischmasch …
Ob mir je zuvor ein derartiger Fall bekannt geworden sei, wollte der Verfasser des Briefes wissen. Könne ich erklären, was da mit ihm geschehe – und könne ich irgend etwas für ihn tun?
Das war ein höchst ungewöhnlicher Brief. Farbenblindheit ist nach herkömmlichem Verständnis etwas Angeborenes – die Schwierigkeit, Rot und Grün (oder andere Farben) zu unterscheiden, oder (in sehr seltenen Fällen) das Unvermögen, überhaupt Farben wahrzunehmen, das durch Schädigungen der farbempfindlichen Zapfenzellen der Netzhaut verursacht wird. Bei dem Verfasser des Briefes, Jonathan I., dagegen lag der Fall offensichtlich anders. Sein ganzes Leben lang hatte er mit gesunden Augen in die Welt geblickt, seine Zapfenzellen waren von Geburt an intakt gewesen. Und erst nach fünfundsechzig Jahren normaler Farbwahrnehmung war er farbenblind geworden – total farbenblind, als schaue er «auf einen Schwarzweiß-Fernsehschirm». Die Plötzlichkeit der Veränderung vertrug sich nicht mit den gewöhnlich langsam voranschreitenden Degenerationsprozessen, von denen die Zapfen in der Netzhaut betroffen sein können. So deutete der Befund auf einen Ausfall auf höherer Ebene hin, in jenen Hirnregionen, die auf die Farbwahrnehmung spezialisiert sind.
Die durch eine Hirnschädigung verursachte totale Farbenblindheit, die sogenannte zerebrale Achromatopsie, gehört, obwohl bereits vor dreihundert Jahren erstmals beschrieben, zu den seltenen Krankheitsbildern. Sie hat die Neurologen erregt, weil sie – wie andere Auflösungs- und Zerstörungsprozesse des Nervensystems auch – Einblick in die Mechanismen neuraler Konstruktion gewährt, hier: in die Mechanismen, mittels deren das Gehirn Farben «sieht» (oder schafft). Die Neugier wächst natürlich, wenn dieser Ausfall bei einem Künstler auftritt, einem Maler, für den Farbe eine zentrale Rolle gespielt hat und der über die Fähigkeit verfügt, unmittelbar bildlich umzusetzen wie auch zu beschreiben, was ihm widerfahren ist, und auf diese Weise die Fremdartigkeit und die mit der Behinderung einhergehende Bedrängnis wirklichkeitsnah zu vermitteln.
Farbe ist keine triviale Erscheinung. Vielmehr hat sie seit Jahrhunderten das leidenschaftliche Interesse großer Künstler, Philosophen und Naturwissenschaftler entfacht. Die erste Abhandlung des jungen Spinoza beschäftigte sich mit dem Regenbogen; die freudigste Entdeckung des jungen Newton war die Zerlegung des weißen Lichts in die Spektralfarben; Goethes Farbenlehre entspringt, wie Newtons Theorie des Lichts, Experimenten mit einem Prisma; Schopenhauer, Young, Helmholtz und Maxwell standen im 19. Jahrhundert gleichermaßen im Banne des Farbenproblems; und Wittgensteins letztes Werk waren die Bemerkungen über die Farben. Dennoch verdrängen wir fast alle fast ständig ihre Rätselhaftigkeit. An einem Fall wie dem des Jonathan I. können wir nicht nur die der Farbwahrnehmung zugrunde liegenden Hirnmechanismen und deren Physiologie untersuchen, sondern auch die Phänomenologie der Farben und ihre Bedeutsamkeiten für den einzelnen.
Nachdem ich I.s Brief erhalten hatte, rief ich meinen guten Freund und Kollegen Robert Wasserman, einen Augenspezialisten, an. Ich war davon überzeugt, daß wir I.s vielschichtige Situation gemeinsam erkunden und ihm, wenn möglich, helfen sollten. Wir trafen I. zum erstenmal im April 1986. Er war ein hochgewachsener, hagerer Mann mit einem kantigen, Intelligenz ausstrahlenden Gesicht. Obwohl ihn sein Zustand tief deprimierte, taute er bald auf und berichtete uns lebhaft und mit einigem Humor über sich. Dabei rauchte er unaufhörlich; seine unruhigen Finger waren von Nikotin gefärbt. Er berichtete über sein erfülltes, produktives Künstlerleben, das bei Georgia O'Keeffe in New Mexico begonnen, ihn in den vierziger Jahren als Bühnenmaler nach Hollywood, in den fünfziger Jahren zu den Abstrakten Expressionisten nach New York geführt hatte; später war er auch als Art Director und kommerziell arbeitender Kunstmaler tätig gewesen.
Wir erfuhren auch, daß der Verkehrsunfall eine vorübergehende Erinnerungslücke verursacht hatte. Noch am Spätnachmittag jenes 2. Januar hatte er der Polizei offenbar klar und detailliert über sich selbst und den Unfallhergang berichten können, war aber dann wegen der sich verstärkenden Kopfschmerzen nach Hause gefahren. Seiner Frau gegenüber klagte er, daß er Kopfschmerzen habe und sich verwirrt fühle, erwähnte aber den Unfall mit keinem Wort. Danach fiel er in einen tiefen, beinahe stuporösen Schlaf. Erst am nächsten Morgen, als seine Frau den Schaden am Auto entdeckte, fragte sie ihn, was geschehen sei. Als sie keine klare Antwort erhielt («Ich weiß nicht – vielleicht ist mir jemand reingefahren»), wußte sie, daß etwas Ernsthaftes vorgefallen sein mußte.
Dann fuhr I. in sein Atelier und fand dort einen Durchschlag des von der Polizei angefertigten Unfallberichts. Er hatte also einen Unfall gehabt, doch bizarrerweise war ihm die Erinnerung daran irgendwie abhanden gekommen. Vielleicht konnte der Bericht sein Gedächtnis wecken. Doch was sich seinen Blicken bot, war ihm fremd. Er sah nur verschiedene Buchstaben unterschiedlicher Größe; er sah sie deutlich – doch sie kamen ihm wie «Griechisch» oder «Hebräisch» vor.[*] Eine Lupe half auch nicht – nun setzte sich das Geschriebene aus großen griechischen oder hebräischen Buchstaben zusammen. (Diese Alexie oder Leseunfähigkeit dauerte fünf Tage und verschwand dann.)
Nun dämmerte es Jonathan I., daß er durch den Unfall einen Schlaganfall oder eine Hirnschädigung erlitten hatte, und er rief seinen Arzt an, der für ihn eine Untersuchung in der Klinik vereinbarte. Obwohl in dieser Phase, wie aus seinem Brief hervorgeht, Farberkennungsschwierigkeiten festgestellt wurden, die mit der Leseunfähigkeit einhergingen, blieb die Veränderung der Farbwahrnehmung bis zum nächsten Tag seinem subjektiven Erleben verschlossen.
Auch an jenem Morgen beschloß er, zur Arbeit zu gehen. Es war ein wolkenloser, sonniger Vormittag, doch obwohl er sich dessen bewußt war, kam es ihm vor, als fahre er im Nebel. Alles erschien ihm dunstig, gebleicht, grau, unscharf. Kurz vor seinem Atelier wurde er von der Polizei angehalten: Er habe rote Ampeln mißachtet – ob ihm das nicht aufgefallen sei. Nein, sagte er, er sei sich nicht bewußt, überhaupt eine rote Ampel gesehen zu haben. Die Polizisten forderten ihn auf, aus dem Wagen zu steigen. Betrunken war er nicht, wie sie feststellten, wohl aber wirr und in schlechter Verfassung. So händigten sie ihm einen Strafzettel aus und empfahlen ihm, einen Arzt aufzusuchen.
Erleichtert erreichte I. sein Atelier und hoffte nun, der schreckliche Dunst werde sich endlich auflösen und alles werde wieder klar zu sehen sein. Doch als er die Tür öffnete, fand er das Atelier, dessen Wände mit Bildern in grellen Farben behängt waren, grau und farblos vor. Die abstrakten Farbbilder, die ihn berühmt gemacht hatten, waren grau getönt oder schwarzweiß. Seine Werke, die ihm noch vor kurzem eine Fülle von Gedanken und Gefühlen beschert hatten, traten ihm nun fremd entgegen und hatten ihre Bedeutung für ihn verloren. Dies war der Moment, in dem er von der Schwere seines Verlustes überwältigt wurde. Er hatte ein Künstlerleben geführt; nun war seine Kunst sinnlos geworden, und er konnte sich nicht mehr vorstellen, worauf er seine Zukunft gründen sollte.
Die folgenden Wochen waren äußerst schwierig. «Man kann sich fragen», sagte I., «der Verlust der Farbwahrnehmung – was ist denn daran so schlimm? Einige meiner Freunde stellten diese Frage, und auch meiner Frau ging sie manchmal durch den Kopf, aber für mich war das alles furchtbar und abstoßend.» Er kannte die Farben aller Dinge, kannte sie sogar überaus genau (er konnte sie nicht nur benennen, sondern auch deren Nummer auf einer Farbskala, die er viele Jahre lang verwendet hatte, angeben). Er identifizierte das von van Gogh für den Billardtisch verwendete Grün ohne Zögern. Er kannte alle Farben seiner Lieblingsbilder, sah sie aber nicht mehr – weder wenn er sie betrachtete noch vor seinem geistigen Auge. Und vielleicht kannte er sie nunmehr auch nur aufgrund seines Sprachgedächtnisses.
Ihn plagte aber nicht nur die Abwesenheit von Farben, sondern auch das unappetitliche, «schmutzige» Aussehen dessen, was er sah – jedes Weiß schlierig, wie verschimmelt oder verwaschen, jedes Schwarz wie verstaubt. Alles sah falsch, unnatürlich, verschmutzt und unrein aus.[*]
Auch konnte Jonathan I. weder die veränderte Erscheinung anderer Menschen («wie belebte graue Statuen») noch die seines eigenen Spiegelbildes ertragen. Er ging Begegnungen aus dem Weg und verabscheute Geschlechtsverkehr. Die Haut anderer Menschen, seiner Frau, auch seine eigene Haut nahm er in einem abstoßenden Grauton wahr; «fleischfarben» erschien ihm nun «rattenfarben», und das änderte sich auch nicht, wenn er die Augen schloß, denn sein lebhaftes Vorstellungsvermögen war ihm erhalten geblieben, nur hatte es ebenfalls jegliche Farbigkeit verloren.
Die «Falschheit» aller Dinge störte ihn, rief sogar Ekel in ihm hervor – und dies in allen Momenten des täglichen Lebens. Jedes Nahrungsmittel war eklig, weil es grau und tot aussah. I. mußte also mit geschlossenen Augen essen. Das half ihm allerdings nicht viel, denn das mentale Bild einer Tomate war ebenso schwarz wie das Bild einer wirklichen Tomate in seinem Blickfeld. So ging er, unfähig, die inneren Bilder zu korrigieren, mehr und mehr dazu über, schwarze und weiße Nahrungsmittel zu bevorzugen – schwarze Oliven und weißen Reis, schwarzen Kaffee und Joghurt. Sie sahen wenigstens verhältnismäßig natürlich aus, wogegen ihm die meisten anderen, üblicherweise farbigen Nahrungsmittel abstoßend unnatürlich erschienen. Sein eigener brauner Hund kam ihm nun so fremd vor, daß er erwog, einen Dalmatiner zu kaufen.
Schwierigkeiten und Behinderungen aller Art machten ihm zu schaffen – von Verwechslungen der Ampelfarben (er mußte sich nun an der Position der Lichter orientieren) bis hin zur Unfähigkeit, sich passend zu kleiden. Seine Frau traf statt seiner die Wahl, doch diese Abhängigkeit ertrug er kaum; später wurden alle Kleidungsstücke in den Schränken und Schubladen geordnet – hier die grauen Socken, dort die gelben, die Krawatten durch Etiketten gekennzeichnet, die Jacken und Anzüge nach Kategorien sortiert, wodurch sich Verwechslungen und Dissonanzen vermeiden ließen. Feststehende ritualisierte Praktiken wurden für die Mahlzeiten ersonnen, denn sonst hätte er Senf mit Mayonnaise verwechselt oder, sofern er sich überwinden konnte, den schwärzlichen Mus zu sich zu nehmen, Ketchup mit Konfitüre.[*]
Monate vergingen. Im Frühjahr vermißte er die besonders leuchtenden Farben – er hatte Blumen immer gemocht, und nun konnte er sie nur an ihren Formen und Düften erkennen. Die Blauhäher hatten kein leuchtendblaues Gefieder mehr, sondern ein blaßgraues. I. sah kaum noch Wolken, denn ihr schmutziges Weiß schien sich vom Blau des Himmels, das jetzt zu einem bleichen Grauton geworden war, kaum noch zu unterscheiden. Auch rote und grüne Paprikaschoten waren ununterscheidbar geworden – beide sahen schwarz aus. Gelb- und Blautöne dagegen erschienen ihm weißlich.[*]
Gleichzeitig waren in I.s Wahrnehmung die Tonwertkontraste erheblich schärfer geworden; Zwischentöne verloren sich, besonders im direkten Sonnenlicht oder in grellem künstlichem Licht. I. erinnerte dies an die Wirkungen des Lichts einer Natriumdampflampe, das Farb- und Tonabstufungen schlagartig zerstört, oder an bestimmte Schwarzweißfilme, die Kontraste betonen. Zuweilen hoben sich Gegenstände wie Silhouetten scharfkantig vom Hintergrund ab. War der Kontrast dagegen normal oder schwach, lösten sie sich bis zur Unerkennbarkeit auf.
So trat sein brauner Hund vor dem Hintergrund einer hellen Straße als deutliche Silhouette hervor, wurde aber unsichtbar, sobald er vor einem Gebüsch stand. I. konnte die Gestalt eines Menschen noch auf eine Entfernung von achthundert Metern erkennen (wie er in seinem ersten Brief hervorgehoben hatte und später mehrmals wiederholte, hatte er «Adleraugen»), während er oft nicht in der Lage war, Gesichter zu identifizieren, bis sie sich dicht vor ihm befanden. Dies deutete tatsächlich eher auf einen Ausfall der Farb- und Farbtonwahrnehmung hin als auf eine Beeinträchtigung des visuellen Erkennens (Agnosie). Ein großes Problem ergab sich beim Autofahren dadurch, daß er Schatten oft für Risse oder Bruchstellen im Straßenbelag hielt, auf die er unwillkürlich reagierte, indem er jäh abbremste oder das «Hindernis» umfuhr.
Sendungen im Farbfernseher waren für ihn besonders unerträglich. Die Bilder waren stets unangenehm, oft auch unverständlich. So kam er auf die Idee, daß er mit einem Schwarzweißfernseher viel besser umzugehen verstünde. Das Sehen von Schwarzweißbildern erwies sich für ihn als verhältnismäßig normal, wogegen er die Betrachtung von Farbbildern stets als bizarr und unerträglich empfand. (Als wir ihn fragten, warum er die Farben eines Farbfernsehers nicht einfach «ausgeschaltet» habe, sagte er, er habe das Gefühl gehabt, die Tonwerte auf dem Schirm eines «entfärbten» Farbfernsehers sähen anders, nämlich weniger «normal», als die eines «echten» Schwarzweißfernsehers aus.) Anders als in seinem ersten Brief erklärte er uns nun, daß seine Welt nicht wirklich so beschaffen war wie in einem Schwarzweißfilm – in einer solchen Welt würde es sich viel leichter leben lassen. (Manchmal hat er sich gewünscht, er könnte eine Miniaturfernsehbrille tragen.)
Die Verzweiflung, die für ihn daraus entstand, seine Welt zu vermitteln, und die Nutzlosigkeit der herkömmlichen Schwarzweißanalogien trieben ihn schließlich einige Wochen später dazu, einen völlig grauen Raum – ein graues Universum – in seinem Atelier zu erschaffen, einen Raum, in dem die Tische, die Stühle und ein opulentes Abendessen, zum Servieren bereitgestellt, in verschiedenen Grautönen bemalt waren. Von dieser Anordnung, dreidimensional und in einer Tonwertskala gehalten, die sich erheblich von dem «Schwarz und Weiß» unterschied, das uns allen geläufig ist, ging eine wahrhaft makabre Wirkung aus, eine vollkommen andere als die einer Schwarzweißfotografie. Wie I. hervorhob, nehmen wir Schwarzweißbilder oder -filme deshalb hin, weil es sich um Repräsentationen der Welt handelt, um Versinnbildlichungen, die wir anschauen oder von denen wir uns abwenden können, wann immer wir wollen. Für ihn hingegen sei die Welt in Schwarzweiß eine Realität, dreihundertsechzig Grad um ihn herum, fest und dreidimensional, vierundzwanzig Stunden am Tag. Diese Realität habe er anderen nur dadurch vermitteln können, daß er einen völlig grauen Raum gestaltete. Aber natürlich müßte der Betrachter darin auch grau bemalt sein – sonst wäre er nicht Teil dieser Welt, sondern nur einer, der sie beobachtet. Ferner müßte der Betrachter wie I. das neurale Wissen um Farbe verlieren. Das wäre, fügte er hinzu, wie in einer Welt zu leben, die «in Blei gegossen» ist.
Später, sagte er, hätten sich Ausdrücke wie «grau» und «bleiern» nicht mehr geeignet, um einen ersten Eindruck von dieser Welt zu vermitteln. Er habe nicht die Erfahrung von «grau» gemacht, sondern von Eigenarten der Wahrnehmung, für die das herkömmliche Erleben, die herkömmliche Sprache kein Äquivalent biete.
I. konnte es nicht länger ertragen, Museen und Kunstgalerien zu besuchen oder Farbreproduktionen seiner Lieblingsbilder zu betrachten. Die Bilder waren nicht nur ihrer Farbigkeit beraubt, sondern sahen mit ihren ausgewaschenen oder «unnatürlichen» Grautönen zudem unzumutbar falsch aus (Schwarzweißfotografien dagegen ertrug I. besser). Darunter litt er besonders dann, wenn er die Künstler persönlich kannte, weil dann sein Sinn für deren Identität und die durch seine Wahrnehmungsstörung bedingte Herabwürdigung ihrer Werke einander widersprachen – und dasselbe widerfuhr ihm auch mit ihm selbst.
Einmal betrübte ihn ein Regenbogen, den er als farblosen Halbkreis am Himmel sah, und selbst seine gelegentlichen Migräneanfälle erschienen ihm als «schal» ; früher waren sie mit geometrischen Halluzinationen in gleißenden Farben einhergegangen, die nun ebenfalls verschwunden waren. Manchmal versuchte er, durch Druck auf seine Augen Farben hervorzubringen, aber auch die Blitze und Flecken, die er dann sah, waren farblos. Oft hatte er in lebendigen Farben geträumt, vor allem von Landschaften und Bildwerken; jetzt waren seine Träume ausgewaschen und blaß oder kraß und kontrastreich – ihnen fehlten sowohl die Farben als auch die sanften Tönungen.
Selbst das Musikhören war beeinträchtigt, denn früher hatte er dabei äußerst intensive synästhetische Empfindungen gehabt. Die Töne hatten sich unmittelbar in Farbeindrücke übertragen, so daß er jedes Musikstück simultan als ein Feuerwerk innerer Farben erlebt hatte. Mit dem Verlust der Fähigkeit, Farben zu erzeugen, ging auch diese Gabe verloren – seine innere «Farborgel» war verstummt, so daß er Musik nun ohne visuelle Begleitung hörte, Musik, der die Entsprechungen fehlten und die somit bis in die Wurzel verkümmert war.[*]
Kleine Freuden bereiteten ihm Zeichnungen; in früheren Jahren war er selbst ein guter Zeichner gewesen. Sollte er sich nicht nun wieder dem Zeichnen zuwenden? Der Gedanke reifte langsam in ihm, und er nahm erst feste Gestalt an, nachdem ihm andere wiederholt dazu geraten hatten. Sein erster Impuls war es gewesen, Farbbilder zu malen. Er hielt daran fest, daß er die Farben «kannte», obwohl er sie nicht mehr sah. So hatte er beschlossen, es mit Blumenbildern zu versuchen, indem er auf der Palette genau die Farben aussuchte, deren «Ton zu passen schien». Aber die Bilder erschlossen sich dem normalen Betrachter nicht, weil sie aus verwirrenden Farbgemischen bestanden. Erst als ein Freund, ebenfalls Künstler, von den Bildern Schwarzweiß-Polaroidaufnahmen machte, zeigten sich in ihnen sinnvolle Formen. Die Konturen waren exakt, die Farben hingegen allesamt falsch. «Nur Farbenblinde wie du werden deine Bilder verstehen», beteuerte einer seiner Freunde.
«Zwing dich nicht so», sagte ihm ein anderer, «du kannst jetzt nicht mit Farben arbeiten.» Widerstrebend ließ I. es zu, daß alle seine Farbbilder aus dem Atelier entfernt wurden. Es ist ja nur vorübergehend, dachte er. Bald werde ich wieder mit Farben malen.
Die ersten Wochen nach dem Unfall waren eine Zeit der Unruhe und Verzweiflung. I. war voller Zuversicht, daß er eines Morgens aufwachen würde und die Welt der Farben wie durch ein Wunder wiederhergestellt fände. Dieser Wunschtraum ging nie in Erfüllung, nicht einmal in seinen Träumen. Er träumte zwar, er stehe kurz davor, wieder Farben wahrzunehmen, doch beim Aufwachen mußte er jedesmal feststellen, daß sich nichts geändert hatte. Zudem lebte er in ständiger Angst, daß sich wiederholen würde, was ihm widerfahren war, und daß er dann sein Sehvermögen vollends verlöre. Er glaubte, einen Hirnschlag erlitten zu haben, der durch den Unfall verursacht worden war (oder diesen womöglich verursacht hatte), und fürchtete sich vor einem weiteren Schlaganfall, der jeden Moment einsetzen konnte. Neben den Sorgen um seinen Gesundheitszustand plagten ihn abgründige Gefühle der Verwirrung und Furcht, die zu artikulieren ihm fast unmöglich war und die gerade in jenem Monat, in dem er versucht hatte, mit Farben zu arbeiten, dem Monat, in dem er Farben noch zu «kennen» glaubte, überhand genommen hatten. Allmählich war die Angst in ihm aufgestiegen, daß nicht nur die Farbwahrnehmung und das farbliche Vorstellungsvermögen zerstört seien, sondern noch etwas Tieferliegendes, das sich kaum definieren ließ. Mit Farben kannte er sich aus, äußerlich, intellektuell, doch hatte er die Erinnerung daran verloren, das innere Wissen, das bis dahin Teil seiner Existenz gewesen war. Sein Leben lang hatte er Farberfahrung gesammelt, und diese war plötzlich zu einem historischen Artefakt geworden, etwas, zu dem er keinen Zugang, für das er kein Gefühl mehr hatte. Es schien, als sei ihm seine Vergangenheit, seine chromatische Vergangenheit, genommen, als sei das Farbwissen seines Gehirns vollständig gelöscht, ohne Spur, ohne innere Anhaltspunkte, die auf seine frühere Existenz hinwiesen.[*]
Anfang Februar ließ die Unruhe etwas nach; I. hatte, nicht nur gedanklich, sondern auch auf einer tieferen Ebene zu akzeptieren begonnen, daß er völlig farbenblind war und womöglich bleiben würde. Die Hilflosigkeit, in die er zunächst verfallen war, wich nach und nach einem Gefühl der Entschlossenheit: Wenn er nicht farbig malen konnte, dann eben schwarzweiß. Er nahm sich vor, in seiner Schwarzweißwelt zu leben, so gut es ging. Diese Entschlossenheit wurde durch eine Episode etwa fünf Wochen nach dem Unfall auf der Fahrt zu seinem Atelier noch bestärkt. Er sah die Sonne über dem Highway aufgehen, die feurigen Rottöne in tiefem Schwarz. «Die Sonne ging auf wie eine Bombe, wie eine riesige Atombombenexplosion», erzählte er später. «Hat irgendein Mensch je einen solchen Sonnenaufgang gesehen?»
Dieses Erlebnis hatte ihn dazu inspiriert, wieder zu malen, und er begann mit einem Schwarzweißbild, dem er den Titel Nuklearer Sonnenaufgang gab. Und er malte weiter, wandte sich wieder abstrakten Kompositionen zu – alle in Schwarz und Weiß. Die Furcht vor Erblindung verfolgte ihn zwar noch, doch sie gestaltete, schöpferisch gewandelt, die ersten «wirklichen» Bilder nach dem gescheiterten Versuch, farbig zu malen. Schwarzweißbilder gelangen ihm, befand er. Sein einziger Trost war die Arbeit im Atelier, wo er fünfzehn, manchmal auch achtzehn Stunden täglich zubrachte. Für ihn war es wie ein Überleben durch die Kunst: «Hätte ich nicht wieder malen können», sagte er später einmal, «hätte ich überhaupt nicht mehr weitergemacht.»
Seine ersten, im Februar und März entstandenen Schwarzweißbilder brachten heftige Gefühle – Wut, Angst, Verzweiflung, Erregung – zum Ausdruck, doch wurden diese durch die Kraft des künstlerischen Schaffens, das gleichzeitig enthüllt und einen Rahmen gibt, im Zaum gehalten. I. malte in diesen zwei Monaten Dutzende von Bildern gleichen Stils, was er zuvor noch nie gemacht hatte. Auf vielen dieser Bilder ist eine ungewöhnlich zerstückelte, kaleidoskopische Fläche mit abstrakten Formen zu sehen, die abgewandte, in Schatten gehüllte, traurige, wütende Gesichter und abgetrennte, verstreute, in Rahmen oder Schachteln befindliche Körperteile suggerieren. Die Bilder waren, verglichen mit den früher gemalten, von einer labyrinthischen Komplexität und hatten etwas Obsessives, Gequältes. Sie drückten auf symbolische Weise den Zustand der Pein aus, in dem sich I. befand.
Im Mai ging er – was faszinierend zu beobachten war – von diesen kraftvollen, aber erschreckenden und fremdartigen Bildern zu Sujets aus der Lebenswelt über, mit denen er sich in den vergangenen dreißig Jahren nicht ein einziges Mal befaßt hatte; zurück zu Tänzern etwa und Rennpferden. Diese Bilder waren, obwohl in Schwarzweiß gemalt, voller Bewegung, Vitalität und Sinnlichkeit; und sie gingen mit einem Wandel in I.s Leben einher – einer zaghaften Lockerung der Zurückgezogenheit und dem Wiedererwachen sozialer und sexueller Bedürfnisse, einer Minderung seiner Ängste und Depressionen, einer Rückwendung zum Leben.
In jener Zeit begann er auch – zum erstenmal in seinem Leben –, an Skulpturen zu arbeiten. Er schien alle intakt gebliebenen visuellen Wahrnehmungsmöglichkeiten auszuschöpfen und sich auf Formen, Umrisse, Bewegungen, räumliche Tiefe einzulassen, um sie – und das mit wachsender Intensität – zu erkunden. Zudem wandte er sich der Porträtmalerei zu. Da es ihm widerstrebte, lebende Modelle zu porträtieren, verwendete er Schwarzweißfotografien als Vorlage und ließ sich darüber hinaus von seiner Kenntnis der Person, von seinen Gefühlen für sie leiten. Das Leben war nur im Atelier erträglich, denn dort konnte er die Welt in kräftigen, markanten Formen neu konzipieren. Draußen dagegen, im wirklichen Leben, erschien sie ihm fremd, leer, tot und grau.
Das also ist die Geschichte, die Jonathan I. Bob Wasserman und mir erzählte, die Geschichte von einem abrupten und vollständigen Zusammenbruch der Farbwahrnehmung und von einem Menschen, der in einer Schwarzweißwelt zu leben versucht. Mir war eine solche Geschichte noch nie zu Ohren gekommen; noch nie hatte ich einen Menschen mit totaler Farbenblindheit kennengelernt. Und ich hatte keine Ahnung, was ihm zugestoßen war, ob sich sein Zustand jemals beheben oder doch lindern ließe.
Unsere erste Aufgabe bestand darin, die Ausfälle mit Hilfe verschiedener, auch unkonventioneller Tests genau zu bestimmen. Wir verwendeten unter anderem Alltagsgegenstände, Bilder – was immer sich gerade anbot. So verwiesen wir I. beispielsweise zuerst auf ein Regal mit blauen, roten und schwarzen Notizbüchern, das neben meinem Schreibtisch stand. Sofort griff er nach den blauen Kladden (es war ein leuchtendes Blau). «Sie sind blaß», sagte er. Die roten und schwarzen Kladden waren für ihn dagegen ununterscheidbar – «alle nur schwarz».
Danach legten wir ihm dreiunddreißig verschiedenfarbige Garnproben vor und baten ihn, diese zu klassifizieren. Zuerst sagte er uns, er könne sie nicht nach ihrer Farbe, sondern nur nach Grauwerten sortieren. Dann teilte er die Garnproben schnell und mühelos in vier seltsame, chromatisch beliebige Gruppen auf, denen er die Werte 0 bis 25, 25 bis 50, 50 bis 75 beziehungsweise 75 bis 100 Prozent auf einer Grautonskala zuordnete. (Nichts erschien ihm als reines Weiß, und selbst weißes Garn sah leicht «verfärbt» oder «schmutzig» aus.)
Wir selbst konnten natürlich die Angemessenheit dieser Klassifizierung nicht bestätigen, weil unsere Farbwahrnehmung mit der Vorstellung einer Grautonskala interferierte, ebenso wie den Betrachtern mit normal entwickelter Farbwahrnehmung der tonale Sinn seiner verwirrend polychromen Blumenbilder verschlossen geblieben war. Doch ein Schwarzweißfoto und Aufnahmen mit einer Schwarzweiß-Videokamera zeigten, daß I. in der Tat die Garnproben entsprechend einer Grautonskala sortiert hatte, die mit der mechanischen Umsetzung dieser optischen Geräte weitgehend übereinstimmte. Seine Klassifizierung war vielleicht etwas zu grob, doch das ließ sich auf die gesteigerte Wahrnehmung scharfer Kontraste, auf den Mangel an Tonabstufungen zurückführen, über den I. klagte. Als wir ihm einmal eine für Kunstmaler angefertigte Grautonskala mit ungefähr einem Dutzend Abstufungen zwischen Schwarz und Weiß zeigten, konnte er darauf nur drei oder vier Tonwerte unterscheiden.[*]
Wir legten I. auch die klassischen Ishihara-Farbfleckentafeln vor, auf denen Zahlenkonfigurationen in sanften Farbabstufungen für Menschen mit normalem Sehvermögen leicht erkennbar sind, nicht aber für jene, die an Farbenblindheit, welcher Art auch immer, leiden. I. nahm keine einzige dieser Zahlen wahr (während er auf bestimmten Tafeln etwas sah, das Farbenblinde, nicht aber Normalsichtige erkennen können; diese Tafeln sind so konzipiert, daß sich damit vorgebliche oder hysterische Farbenblindheit feststellen läßt).[*]
Zufällig stießen wir auf eine Postkarte, die wie geschaffen für einen Achromatopsie-Test war. Darauf war eine Küstenlandschaft abgebildet – eine Mole mit Anglern, die sich gegen die in dunklem Rot untergehende Sonne abzeichnet. I. erkannte weder die Angler noch die Mole, sah also nur den Halbkreis der unter den Horizont tauchenden Sonne.
Schwierigkeiten dieser Art ergaben sich nur bei Farbbildern, während I. Schwarzweißfotos oder -reproduktionen akkurat zu beschreiben vermochte; die Formerkennung war völlig unbeeinträchtigt. Seine Vorstellungs- und Erinnerungsbilder von Gegenständen und Abbildungen, die man ihm zuvor gezeigt hatte, waren außergewöhnlich lebhaft und präzise – aber eben farblos. So gab er mit raschen Strichen in Schwarzweiß ein klassisches Testbild wieder, auf dem ein farbiges Boot dargestellt ist: er betrachtete es intensiv, wandte den Blick davon ab und griff zu den Pinseln. Fragte man ihn nach den Farben vertrauter Gegenstände, bereiteten ihm Farbassoziationen oder -namen keinerlei Schwierigkeiten. (Patienten mit einer Farbenanomie können beispielsweise Farben genau klassifizieren, aber sie kennen deren Namen nicht mehr, ordnen also, verunsichert, etwa einer Banane die Farbe Blau zu. Ein Patient, der an Farbenagnosie leidet, kann dagegen Farben auch klassifizieren, würde aber nicht das geringste Zeichen der Verwunderung von sich geben, wenn man ihm eine blaue Banane zeigte. I. jedenfalls war von keiner dieser Störungen betroffen.[*] Er hatte (jetzt) keinerlei Schwierigkeiten mehr mit dem Lesen. Die Tests und die allgemeine neurologische Untersuchung hatten die Diagnose bestätigt: totale Farbenblindheit, Achromatopsie.
Wir konnten ihm folglich mitteilen, daß sein Problem einen realen Hintergrund hatte: Sein Leiden war nicht hysterischer Natur, sondern wurde durch eine echte, physiologisch bedingte Achromatopsie verursacht. Er nahm dies mit gemischten Gefühlen zur Kenntnis, wie uns schien, denn er hatte wohl ein wenig darauf gehofft, daß sich sein Leiden als ein Fall von Hysterie erweisen würde und somit als ein Zustand, der sich unter günstigen Umständen rückgängig machen ließ. Andererseits hatte ihn die Vorstellung von einer psychisch bedingten Störung ebenfalls beunruhigt und ihm das Gefühl gegeben, seine Probleme seien «nicht real» (was einige Ärzte angedeutet hatten). Die Ergebnisse unserer Untersuchung legitimierten in gewisser Weise seinen Zustand, doch schürten sie andererseits seine Befürchtungen hinsichtlich der Hirnschädigung und der Heilungsaussichten.
Auch wenn alles dafür sprach, daß die Achromatopsie zerebralen Ursprungs war, fragten wir uns, ob nicht auch das Rauchen als Entstehungsfaktor beteiligt gewesen sein mochte. Nikotin kann Sehschwäche (Amblyopie) verursachen und manchmal eben auch Achromatopsie. Aber in diesem Fall wäre der Ausfall auf die Wirkungen des Nikotins auf die Netzhautzellen zurückzuführen gewesen. Bei I. hatten wir es hingegen mit einer vorwiegend zerebral bedingten Behinderung zu tun: Möglicherweise waren kleine Hirnareale durch die Gehirnerschütterung zerstört worden; vielleicht hatte er aber auch kurz nach oder unmittelbar vor dem Unfall einen leichten Hirnschlag erlitten.
Unser Wissen über die zerebralen Funktionen der Farbrepräsentation hat sich nicht geradlinig entwickelt. Newton führte mit seinen berühmten Prisma-Experimenten im Jahre 1666 den Nachweis, daß das weiße Licht in Wahrheit zusammengesetzt ist. Es läßt sich in alle Farben des Spektrums zerlegen und aus diesen wieder zusammensetzen. Die Strahlen, die am meisten gebrochen werden, sehen wir als Violett, die am wenigsten gebrochenen als Rot; die übrigen Strahlen liegen im Spektrum zwischen diesen beiden Polen. Die Farben der Gegenstände werden – so Newtons Annahme – durch die «Fülle» der Strahlen hervorgerufen, die von diesen Gegenständen reflektiert werden, bevor sie das Auge erreichen. Um Farben wahrzunehmen, argumentierte Thomas Young 1802, bedürfe es keiner unüberschaubaren Vielfalt verschiedener Rezeptoren im Auge, von denen ein jeder auf eine bestimmte Wellenlänge anspreche (so wie ja auch Maler in der Lage sind, fast jede gewünschte Farbe aus wenigen Farben auf der Palette zu erschaffen), und er kam zu dem Schluß, daß drei Typen von Rezeptoren ausreichten.[*] Youngs glänzender Einfall, den er nebenher während einer Vorlesung äußerte, geriet in Vergessenheit, bis Hermann von Helmholtz fünfzig Jahre später im Verlauf seiner eigenen Untersuchungen über das Sehen an ihn anknüpfte und ihm eine präzise Formulierung gab. Deshalb sprechen wir heute von der Young-Helmholtzschen Hypothese. Für Helmholtz ist – wie zuvor schon für Young – die Farbe der unmittelbare Ausdruck der Wellenlänge von Licht, das durch jeden Rezeptor aufgenommen wird, und das Nervensystem überführt nur das eine in das andere: «Rotes Licht reizt die für Rot empfänglichen Fasern stark, die beiden anderen Fasertypen dagegen schwach – und daraus entsteht die Empfindung rot.»[*]
Hermann Wilbrand, der als Neurologe viele Patienten mit unterschiedlichsten visuellen Ausfällen behandelte – bei einigen war vor allem das Gesichtsfeld beeinträchtigt, bei anderen vor allem die Farbwahrnehmung, bei anderen wiederum vor allem die Gestaltwahrnehmung –, äußerte 1884 die Annahme, es müsse verschiedene optische Zentren in der primären Sehrinde geben, von denen ein jedes entweder auf «Lichteindrücke» oder auf «Farbeindrücke» oder auf «Gestalteindrücke» anspräche. Allerdings konnte er dafür keinen anatomischen Beweis erbringen. Daß Achromatopsie (und sogar Hemiachromatopsie) durch eine Schädigung eng umgrenzter Hirnareale hervorgerufen werden kann, wies vier Jahre später der Schweizer Augenarzt Louis Verrey nach. Er beschrieb den Fall einer sechzigjährigen Frau, die nach einem Hirnschlag im Hinterhauptlappen der linken Hemisphäre nun alles, was sich im rechten Gesichtsfeld befand, in Grautönen sah (die linke Sehfeldhälfte blieb farbig). Als das Gehirn dieser Patientin nach ihrem Tod untersucht wurde, stellte sich heraus, daß die Schädigung auf einen engen Bereich der Sehrinde (Gyrus lingualis) begrenzt gewesen war. Hier, folgerte Verrey, befinde sich «das Zentrum für den Farbensinn». Sofort wurden gegen die Annahme, daß ein derartiges Zentrum existiere, daß überhaupt irgendein Areal der Hirnrinde für die Farbwahrnehmung oder -repräsentation zuständig sei, Einwände erhoben und dann fast ein Jahrhundert lang stetig erneut vorgebracht. Die Gründe für diesen Meinungsstreit liegen sehr tief – in den Ursprüngen der Neurophilosophie.
John Locke vertrat im siebzehnten Jahrhundert eine sensualistische Philosophie (parallel zur physikalistischen Philosophie Newtons): Unsere Sinne seien Meßinstrumente, die für uns die Außenwelt in Empfindungen übertragen. Das Hören, das Sehen, jede Sinneswahrnehmung bestimmte Locke als gänzlich passiv und rezeptiv. Die Neurologen des ausgehenden neunzehnten Jahrhunderts schlossen sich eilfertig dieser Philosophie an, um sie für eine spekulative Hirnanatomie nutzbar zu machen. Die visuelle Wahrnehmung wurde mit «Sinnesempfindungen» oder «Sinneseindrücken» gleichgesetzt, die in einem exakten Punkt-für-Punkt-Verhältnis von der Netzhaut zur primären optischen Region im Gehirn weitergeleitet und dort subjektiv als Bilder erlebt würden. Die Farben, nahm man damals an, seien integraler Bestandteil eines jeden Bildes. Es gebe anatomisch gesehen keinen Raum für ein eigenständiges Farbenzentrum, ja es sei aus theoretischen Gründen sogar die Vorstellung von einem solchen Zentrum ausgeschlossen. Verreys 1888 Veröffentlichte Untersuchungen widersprachen somit dem wissenschaftlichen Dogma. Seine Beobachtungen wurden in Zweifel gezogen, seine Methoden kritisiert, seine Folgerungen abgelehnt. Doch der wirkliche Einwand, der sich hinter diesen Angriffen verbarg, war seinem Wesen nach doktrinär.
Ohne gesondertes Farbenzentrum, so lautete das gängige Argument, könne es auch keine isolierte Achromatopsie geben. Damit wurden Verreys Fallgeschichte sowie zwei ähnliche, in den neunziger Jahren bekannt gewordene Fälle aus dem Bewußtsein der Neurologen gedrängt, und das Thema zerebrale Achromatopsie verschwand in den darauffolgenden fünfundsiebzig Jahren so gut wie vollständig aus dem wissenschaftlichen Diskurs.[*] Erst 1974 wurde die nächste umfassende Fallstudie veröffentlicht.[*]
Jonathan I. selbst beherrschte ein geradezu unersättlicher Wissensdrang hinsichtlich dessen, was in seinem Gehirn vor sich ging. Er lebte nun ganz in einer Welt aus Dunkelheiten und Helligkeiten, doch fiel ihm auf, wie diese bei verschiedenen Lichtverhältnissen changierten; rote Objekte beispielsweise, die schwarz aussahen, wurden in den langwelligen Strahlen der Abendsonne etwas heller, was ihm erlaubte, Rückschlüsse auf die Rotfärbung dieser Objekte zu ziehen. Sehr deutlich trat dieses Phänomen auf, wenn sich die Art der Beleuchtung plötzlich änderte. Schaltete etwa jemand ein Neonlicht an, veränderte sich für I. die Helligkeit aller im Raum befindlichen Gegenstände. Er fühle sich nun in eine instabile Welt versetzt, kommentierte er diese Erfahrung, eine Welt, deren Hell und Dunkel in Einklang mit der jeweiligen Wellenlänge des Lichts fluktuiere, was in krassem Gegensatz stehe zu der relativen Stabilität, zur Konstanz der Welt der Farben, die er aus früheren Tagen kenne.[*]
All das läßt sich mit Hilfe der klassischen Farbenlehre natürlich kaum erklären, denn es paßt weder zur Newtonschen Auffassung von dem konstanten Verhältnis zwischen Wellenlänge und Farbe noch zum Bild der Zelle-zu-Zelle-Übertragung der Wellenlängen-Information von der Netzhaut zum Gehirn noch zur Hypothese der direkten Umsetzung dieser Information in Bilder. Ein derart simpler Prozeß (die neurologische Analogie zur Zerlegung und Zusammensetzung des Lichts mit Hilfe eines Prismas) reicht wohl kaum zur Erklärung der Vielschichtigkeit der Farbwahrnehmung im wirklichen Leben aus.
Die Unvereinbarkeit zwischen der klassischen Farbenlehre und der realen Farbwahrnehmung war bereits Goethe im ausgehenden achtzehnten Jahrhundert aufgefallen. Beeindruckt von der sichtbaren Realität farbiger Schatten und farbiger Nachbilder, von den Effekten verschiedener Zusammenstellungen und Beleuchtungen auf die Erscheinung der Farben und nicht zuletzt von Farb- und anderen optischen Täuschungen, gelangte er zu der Überzeugung, gerade diese Phänomene müßten Grundlage einer eigenständigen Farbenlehre werden, und er verkündete sein Credo, optische Täuschung sei optische Wahrheit. Goethe beschäftigte sich vor allem mit der Frage, wie wir Farben und Licht wahrnehmen, wie wir Welten – und Täuschungen – in Farbe erschaffen. Dies ließ sich, glaubte er, im Rahmen einer Newtonschen Theorie nicht beantworten, sondern nur mittels noch unbekannter Gesetzmäßigkeiten des Gehirns – womit er im Grunde genommen sagte: Optische Täuschung ist neurologische Wahrheit.
Die Farbenlehre, die in den Augen Goethes seinem gesamten dichterischen Werk ebenbürtig war, wurde von seinen Zeitgenossen im großen und ganzen abgelehnt und verharrt seitdem in einer Art Limbus, verworfen als Spleen, als Pseudowissenschaft eines großen Dichters. Aber die Forschung selbst verschloß sich den von Goethe beschriebenen «Anomalien» keineswegs unisono. Selbst Helmholtz hielt Vorträge über Goethe als Naturforscher – den letzten im Jahre 1892. Er war sich der Bedeutsamkeit der Farbkonstanz bewußt, jener Art, wie die Farbe von Gegenständen trotz der großen Schwankungen der Wellenlänge des auf sie fallenden Lichts unverändert bleibt, so daß wir sie stets als dieselben identifizieren können. Die Wellenlänge des von einem Apfel reflektierten Lichts beispielsweise variiert je nach Beschaffenheit der auf die Frucht treffenden Lichtstrahlen, und dennoch sehen wir ihn als rot. Dies kann offensichtlich nicht auf die bloße Umsetzung von Wellenlänge in Farbe zurückgeführt werden. So muß es einen Mechanismus geben, schloß Helmholtz, der den Beleuchtungsfaktor ausschaltet, und er verstand diesen Mechanismus als «unbewußten Schluß» oder «Induktionsschluß» (wobei er nicht der Frage nachging, wo ein solcher Schluß zustande kommen könnte). Für ihn war die Farbkonstanz ein Beispiel dafür, wie wir Wahrnehmungskonstanz im allgemeinen erreichen – wie wir also aus einem Chaos von Empfindungen eine stabile Wahrnehmungswelt konstruieren, die es so gar nicht geben könnte, wenn unsere Wahrnehmungen nichts anderes wären als passive Widerspiegelungen der unvorhersagbaren und beliebig eintretenden Erregungen unserer Sinnesorgane.
Auch Helmholtz' berühmter Zeitgenosse James Clerk Maxwell war seit seiner Studienzeit fasziniert von den Geheimnissen des Farbensehens. Er gab den Vorstellungen von den Grund- oder Primärfarben und von Farbmischungen eine präzise Definition, unter anderem mit Hilfe eines von ihm erfundenen Farbkreisels (dessen Farben bei genügend hoher Drehzahl eine Grauwahrnehmung hervorrufen) und einer grafischen Darstellung der Farben auf drei Achsen, eines Farbendreiecks, das angab, wie man jede beliebige Farbe durch Mischung der drei Primärfarben erhält. Maxwells Forschungen legten den Grundstein für die aufsehenerregende Demonstration von 1861, die zeigte, daß Farbfotografie möglich sei, obwohl die lichtempfindlichen Emulsionen selbst schwarzweiß waren. Er nahm einen Farbbogen dreimal auf, wobei er für jedes Foto einen anderen Filter – rot, grün und violett – verwendete. Nachdem er so drei Teilfarbauszüge erhalten hatte, setzte er sie zusammen, indem er sie übereinander, jede der drei Fotoplatten durch den entsprechenden Filter, auf einen Schirm projizierte (die mit dem Rotfilter gemachte Aufnahme wurde mit rotem Licht auf die Leinwand geworfen usw.). Plötzlich wurde der Bogen in seiner ganzen Farbenpracht sichtbar. Maxwell befaßte sich des weiteren mit der Frage, ob nicht auch im Gehirn Farben auf die gleiche Weise, durch Überlagerung von Teilfarbauszügen oder ihrer neuralen Entsprechungen, wahrgenommen werden – genauso wie in seinen Demonstrationen mit der Laterna magica.[*]
Maxwell war sich der Schwächen seines additiven Verfahrens schmerzlich bewußt: Die Farbfotografie konnte den Beleuchtungsfaktor nicht einfach ausschalten, so daß die Farbtöne in hoffnungsloser Unregelmäßigkeit mit den sich ändernden Wellenlängen des Lichts schwankten.
1957, rund neunzig Jahre nach Maxwells berühmter Vorführung, gelang es Edwin Land (der sich nicht nur als Erfinder der Land- und der Polaroid-Kamera, sondern auch als genialer Experimentator und Theoretiker einen Namen gemacht hat), die Farbwahrnehmung mit den Hilfsmitteln der Fotografie auf überraschende Weise zu veranschaulichen. Anders als Maxwell brauchte er nur zwei Schwarzweißtransparente. Er benutzte eine Spezialkamera, die es ihm ermöglichte, die beiden Bilder aus derselben Position gleichzeitig und mit nur einer Linse aufzunehmen. Danach projizierte er sie mit einem Zweilinsenprojektor übereinander auf einen Schirm. Zur Herstellung der Aufnahmen verwendete Land zwei Filter. Der eine ließ langwelliges Licht durch (roter Filter), der andere kurzwelliges (grüner Filter). Das erste Bild wurde dann durch einen Rotfilter projiziert, das zweite dagegen mit gewöhnlichem weißem, ungefiltertem Licht. Was kann dabei anderes entstehen als ein Bild in blassem Rot? wird man sich fragen. Aber statt dessen geschah etwas «Unmögliches». Die Aufnahme einer jungen Frau in bunten Farben wurde sichtbar – «blondes Haar, hellblaue Augen, roter Mantel, blaugrüner Kragen und eine überaus natürliche Hautfarbe», wie Land später schrieb. Woher stammten diese Farben, wie wurden sie erzeugt? Sie schienen nicht «in» den Transparenten oder dem Projektorlicht zu sein. Was da auf höchst einfache, aber überwältigende Weise vorgeführt wurde, waren «Farbtäuschungen» im Sinne Goethes, Täuschungen jedoch, die eine tiefe neurologische Wahrheit in sich bargen – daß die Farben nicht «draußen» in der Welt existieren oder, nach klassischer Theorie, ein mechanisches Korrelat der Wellenlänge sind, sondern vielmehr vom Gehirn konstruiert werden.
Lands Experimente riefen zunächst Ratlosigkeit hervor; sie ließen sich nicht einordnen, wie Anomalien, unbegreifbar. Sie waren im Rahmen bestehender Theorien nicht zu erklären, wiesen aber auch keinen Weg zu einem neuen theoretischen Ansatz. Zudem war es nicht ausgeschlossen, daß sich bei der Betrachtung das Wissen über die Farbigkeit von Gegenständen auf die Wahrnehmung eines abgebildeten Sujets auswirkte. Deshalb entschloß sich Land, die vertrauten Bilder aus der Alltagswelt durch gänzlich ungegenständliche, vielfarbige, aus geometrisch geformten Papierstücken zusammengesetzte Vorlagen zu ersetzen, die keine Hinweise auf die zu erwartenden Farben gaben. Da einige dieser ungegenständlichen Vorlagen Land vage an Bilder Piet Mondrians erinnerten, nannte er sie «Farbmondriane». Anhand dieser Farbmondriane, die von drei Projektoren mit Rot-, Grün- und Blaufilter (also Filter für langwelliges Licht) auf die Leinwand gestrahlt wurden, konnte Land nachweisen, daß zwischen der Wellenlänge des von einer Oberfläche reflektierten Lichts und deren wahrgenommener Farbe keine einfache Beziehung besteht, wenn diese Oberfläche zu einem komplexen vielfarbigen Sujet gehört.
Darüber hinaus ergab sich, daß ein Farbfleck (beispielsweise einer, der unter Normalbedingungen als grün erscheint) unter welcher Lichtquelle auch immer nur als weiß oder blaßgrau wahrgenommen wird, wenn man ihn von den ihn umgebenden Farben isoliert. Deshalb kann, wie Land zeigte, der grüne Fleck nicht als in sich grün gelten, sondern ihm wird die «Grünheit» teilweise durch seine Beziehungen zu den ihm benachbarten Bereichen der Mondriane gegeben.
Während Farbe nach der klassischen Lesart der Newtonschen Theorie eine absolute räumliche Gegebenheit ist, bestimmt durch die Wellenlänge des von jedem Punkt reflektierten Lichts, ist sie nach Lands Erkenntnissen weder räumlich noch absolut festgelegt, sondern hängt von der Erfassung einer ganzen Szenerie und vom Vergleich zwischen den Wellenlängen des von jedem Punkt und des von seiner jeweiligen Umgebung reflektierten Lichts ab. So müssen ständig Bezüge zwischen jedem Teil des Sehfelds und seiner Umgebung hergestellt werden, um zu einer ganzheitlichen Synthese zu kommen – Helmholtz' «unbewußtem Schluß». Land nahm an, daß diese Berechnung oder Korrelierung feststehenden Regeln folgt. So konnte er vorhersagen, welche Farbe von einem Beobachter unter welchen Bedingungen wahrgenommen wird. Dafür hatte er einen «Farbwürfel», einen Algorithmus, entwickelt, im Grunde ein Modell für den im Gehirn stattfindenden Vergleich zwischen den Helligkeitswerten aller Teile einer komplexen vielfarbigen Oberfläche bei variierender Wellenlänge. Während sich Maxwells Farbenlehre und Farbdreieck auf die Idee der Farbwertaddition gründeten, basiert Lands Modell auf der Idee des Farbwertvergleichs. Nach Land werden sogar Vergleiche zweierlei Art gezogen: erstens zwischen den reflektierten Strahlen aller Oberflächen eines Sehfeldausschnitts innerhalb bestimmter Wellenlängengruppen oder Wellenbänder (Land bezeichnet diesen Vorgang als eine für jedes Wellenband vorgenommene «Helligkeitserfassung»); zweitens der Vergleich der drei erfaßten Helligkeitswerte auf den drei Wellenbändern (die ungefähr den Wellenlängen des roten, grünen beziehungsweise blauen Lichts entsprechen). Erst Vergleiche dieser zweiten Art bringen Farbeindrücke hervor. Land hütete sich übrigens davor, irgendeine Hirnregion zu benennen, die für diese Operationen zuständig sein könnte, und er gab seiner Theorie des Farbensehens den Namen «Retinex-Theorie», um anzuzeigen, daß es mehrere unterschiedliche Interaktionsflächen zwischen Retina und Kortex geben mag.
Während Land das Problem, wie Farben für uns sichtbar werden, auf der psychophysischen Ebene untersuchte, indem er Versuchspersonen aufforderte, ihm über ihre Wahrnehmung komplexer, vielfarbiger, mosaikartig zusammengesetzter Oberflächen unter variierenden Beleuchtungsbedingungen zu berichten, ging der in London arbeitende Semir Zeki dieser Frage auf physiologischer Ebene nach; er setzte Mikroelektroden in die Sehrinde anästhesierter Affen ein und maß die durch Farbreize hervorgerufenen neuronalen Aktionspotentiale. In den frühen siebziger Jahren machte er eine umwälzende Entdeckung. Er identifizierte auf beiden Seiten des Affenhirns kleine Zellenbereiche im prästriären Kortex (auch Hirnrindenfeld V4 genannt), die speziell auf Farben anzusprechen schienen (Zeki bezeichnete sie als «farbkodierende Zellen»).[*] Was Wilbrand und Verrey neunzig Jahre zuvor postuliert hatten – ein für Farben zuständiges Zentrum im Gehirn –, wurde durch Zeki schließlich nachgewiesen.
Als der berühmte Neurologe Gordon Holmes Anfang der zwanziger Jahre mehr als zweihundert Fälle von Sehbehinderungen infolge von Kopfschußverletzungen dokumentiert hatte, war nicht ein einziger Fall von totaler Farbenblindheit darunter gewesen. Deshalb hatte er die Möglichkeit, daß es eine solche isolierte zerebrale Achromatopsie gebe, verworfen. Die Vehemenz, mit der diese Auffassung von einer derart renommierten Autorität vertreten worden war, hatte wesentlich dazu beigetragen, daß das klinische Interesse an diesem Thema zum Erliegen kam.[*] Zekis elegante und unbezweifelbare Beweisführung versetzte nun die Welt der Neurologie in helle Aufregung, und sie begann erneut, sich dem viele Jahre lang vernachlässigten Thema zuzuwenden. Nach der Veröffentlichung von Zekis Aufsatz im Jahre 1973 begannen wieder Fälle von Achromatopsie in der Fachliteratur aufzutauchen, und diese konnten mit den neuen Schichtaufnahmeverfahren (Computertomographie) untersucht werden, die den Neurologen früherer Tage nicht zur Verfügung gestanden hatten. Zum erstenmal bestand die Möglichkeit, in vivo sichtbar zu machen, welche Hirnregionen beim menschlichen Farbensehen aktiviert zu sein scheinen. Obwohl viele der in der Literatur beschriebenen Patienten auch unter anderen Ausfällen litten (Unstimmigkeiten im Gesichtsfeld, visuelle Agnosie, Alexie usw.), ließ sich doch recht eindeutig feststellen, daß die für die Achromatopsie maßgebende Läsion im medialen Assoziationskortex lokalisiert sein mußte, einem Bereich, der dem Hirnrindenfeld V4 beim Affen entspricht.[*] In den sechziger Jahren war der Nachweis gelungen, daß Zellen in der primären Sehrinde (genauer: im Hirnrindenfeld V1) bei Affen speziell auf Wellenlänge, nicht aber auf Farbe ansprechen. Dann zeigte Zeki, daß andere Zellen im Hirnrindenfeld V4 auf Farbe, nicht aber auf Wellenlänge reagieren (diese V4-Zellen erhalten jedoch Impulse von den V1-Zellen über eine zwischengeschaltete Struktur V2). Folglich erhält jede V4-Zelle Informationen über einen großen Ausschnitt des Gesichtsfeldes. So lag der Schluß nahe, daß die von Land in seiner Theorie postulierten zwei Stufen ein anatomisches und physiologisches Korrelat besitzen: Die Helligkeitserfassung für jedes Wellenband wird von den für Wellenlänge zuständigen Zellen in VI verarbeitet, aber erst durch den Vergleich oder die Korrelierung dieser verarbeiteten Informationen in den farbkodierenden Zellen von V4 entstehen Farben. Jede dieser V4-Zellen scheint als Landscher Korrelator oder als Helmholtzscher Urteilsmechanismus aktiv zu sein.
Das Farbensehen scheint also wie andere Grundformen des Sehens (Bewegungs-, Tiefen- und Gestaltwahrnehmung) nicht auf einem Wissenserwerb zu beruhen, ist also nicht durch Lernen und Erfahrung determiniert, sondern ein, wie Neurologen sagen, «Bottom-up»-Prozeß. So können Farben auch experimentell durch magnetische Reizung des Hirnrindenfeldes V4 hervorgerufen werden, bei der die Versuchsperson farbige Ringe und Halos «sieht», die man als Chromatophene bezeichnet.[*] Doch im Leben ist das Farbensehen Bestandteil unserer gesamten Erfahrung; es ist mit unseren Kategorisierungen und Werten eng verbunden, wird für jeden von uns Teil unserer Lebenswelt und unseres Selbst. Das Hirnrindenfeld V4 mag der eigentliche Farbgenerator sein, aber es kommuniziert mit hundert anderen Systemen im bewußtseinsfähigen Hirn; und vielleicht wird es durch diese auch moduliert. Die Integration findet auf den höheren Ebenen statt, wo sich die Farben mit Erinnerungsspuren, Erwartungen, Assoziationen und Wünschen verschmelzen, um für jeden von uns eine Welt mit Resonanz und Bedeutung hervorzubringen.[*]
Jonathan I. hatte nicht nur eine weitgehend «reine» zerebrale Achromatopsie entwickelt, frei von zusätzlichen Ausfällen der Gestalt-, Bewegungs- oder Tiefenwahrnehmung, sondern er war zudem ein hochintelligenter und beredter Zeuge des Geschehens – jemand, der mit großem Geschick zeichnen und beschreiben konnte, was er sah. Als er bei unserer ersten Begegnung von den «Fluktuationen» der Gegenstände und Oberflächen unter wechselnden Lichtverhältnissen berichtete, gab er die Welt gewissermaßen nicht in Farben, sondern in Wellenlängen wieder. Diese Erfahrung wich derart von allem ab, was er zuvor erlebt hatte, war so ungewohnt, so anomal, daß er für die Beschreibung keine Parallelen, keine Metaphern, keine Bilder oder Worte zu finden vermochte.
Als ich Professor Zeki anrief, um ihm über diesen außergewöhnlichen Patienten zu berichten, zeigte er großes Interesse und warf die Frage auf, wie I. wohl auf die Farbmondriane, die er und Land bei normalsichtigen Menschen und bei Tieren verwendet hatten, reagieren würde. Er schlug vor, nach New York zu kommen und sich mit uns – Bob Wasserman, dem Augenarzt, Ralph Siegel, dem Neurophysiologen, und mir – zu treffen, um Jonathan I. gründlich zu untersuchen. Kein Patient mit Achromatopsie war je auf diese Weise unter die Lupe genommen worden.
Wir verwendeten einen komplexen, leuchtenden Mondrian, der entweder durch weißes oder durch gefiltertes Licht beleuchtet wurde, wobei die Filter so beschaffen waren, daß sie jeweils nur Strahlen aus einem bestimmten Wellenband durchließen: langwellige (rot), mittelwellige (grün) oder kurzwellige (blau). Die Leuchtkraft der Lichtstrahlen wurde in jedem Testabschnitt konstant gehalten.