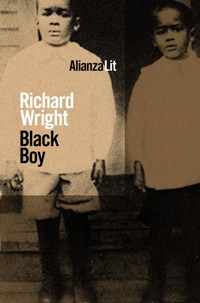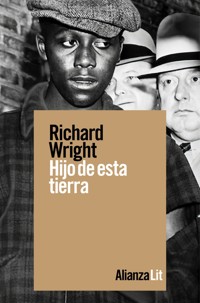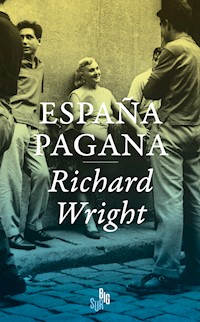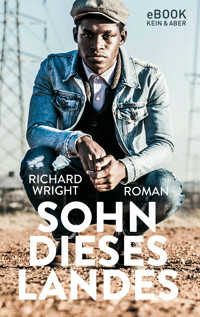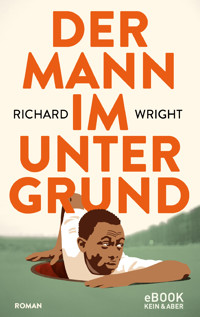
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kein & Aber
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Englisch
Erstmals in ungekürzter Form: Der wiederentdeckte Roman von einem der bedeutendsten afroamerikanischen Autoren der USA.
Es scheint ein Samstagabend wie jeder andere zu sein: Der schwarze Arbeiter Fred Daniels ist auf dem Weg nach Hause zu seiner hochschwangeren Frau, den Wochenlohn in der Hosentasche. Völlig unvermittelt halten ihn drei Polizisten an und verhaften ihn. Fred geht anfänglich noch von einem Missverständnis aus, aber als man ihn des Doppelmordes beschuldigt, ahnt er, in was für einen Albtraum er geraten ist. Schläge, Kreuzverhör, psychische Manipulation entfremden ihn von der Welt und der Realität: Er unterschreibt ein Geständnis, das ihm in einem schwachen Moment und unter falschen Versprechungen vorgelegt wird. So bleibt ihm nur die Flucht in den Untergrund – in das dunkle, nasse Labyrinth der Kanalisation.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 291
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
INHALT
» Über den Autor
» Über das Buch
» Buch lesen
» Impressum
» Weitere eBooks von Kein & Aber
» www.keinundaber.ch
ÜBER DEN AUTOR
Richard Wright (1908-1960) ist bis heute einer der einflussreichsten afroamerikanischen Schriftsteller des letzten Jahrhunderts. Zu seinen wichtigsten Veröffentlichungen gehören der Roman Sohn dieses Landes (2019 bei Kein & Aber erschienen), die Memoiren Black Boy (American Hunger)und die Kurzgeschichtensammlung Uncle Tom’s Children. Wright befasst sich in seinem eindringlichen Schreiben hauptsächlich mit dem Thema Rassismus, sein Werk trug dazu bei, die Beziehung zwischen Weißen und Schwarzen Mitte des 20. Jahrhunderts neu zu definieren.
ÜBER DAS BUCH
USA der 1940er Jahre, Samstagabend. Der schwarze Arbeiter Fred Daniels ist mit seinem Lohn in der Tasche auf dem Weg nach Hause zu seiner hochschwangeren Frau. Unvermittelt strahlt ihm das Licht einer Taschenlampe ins Gesicht. Bevor er weiß, wie ihm geschieht, wird Fred von drei Polizisten verhaftet. Er hält alles für ein Missverständnis, doch schnell wird die Angelegenheit bitterer Ernst. Die Anklage lautet: Vergewaltigung und Doppelmord an den weißen Nachbarn seines Arbeitgebers. Plötzlich befindet sich Fred in einem Albtraum aus Drohungen, Schlägen und psychischer Gewalt. So bleibt ihm nur die Flucht in den Untergrund - in das dunkle, kalte und feuchte Labyrinth der Kanalisation. Wright fängt mit Fred Daniels das Menschliche im Unmenschlichen und den Gerechtigkeitssinn in der größten Ungerechtigkeit ein und erschafft mit ihm einen unvergesslichen Charakter.
EINE EINLEITENDE BEMERKUNG
Einige Leser kennen den Titel dieses Romans vielleicht von einer Erzählung aus Richard Wrights Geschichtensammlung Eight Men. Bevor Der Mann im Untergrund zu dieser Erzählung wurde, war es ein längeres Manuskript, ein Roman, der 2021 zum ersten Mal im Original erschien und hiermit auch auf Deutsch verfügbar ist. Da sie um die Bedeutung und literarische Eigenständigkeit des Romans neben der Erzählung wusste, wandte sich Julia Wright, die ältere Tochter des Autors, an die Verleger der Library of America, in der die ungekürzten Versionen von Sohn dieses Landes (im Original Native Son) und Black Boy (American Hunger) erschienen waren, um zu sehen, ob nicht auch die Langfassung von Der Mann im Untergrund veröffentlicht werden sollte. Es war ihr ein Anliegen, dass der Roman zusammen mit dem Essay Erinnerungen an meine Großmutter erschien, der die Entstehung des Romans beschreibt, so wie es How Bigger Was Born schon für Sohn dieses Landes getan hatte. Es sei der Wunsch ihres Vaters gewesen, beide Werke zusammen herauszubringen.
Der Mann im Untergrund wurde zu einer Zeit geschrieben, als das Lynchen und Zusammenschlagen schwarzer Amerikaner in den Vereinigten Staaten (und zwar nicht nur im Süden) weit genug verbreitet war, um die Jim-Crow-Gesetze und die ungeschriebenen Verhaltensregeln zwischen Schwarzen und Weißen durchzusetzen. Wrights Roman fängt diese Atmosphäre der Angst ein und spiegelt zudem die Besorgnis in Bezug auf die voranschreitenden Ereignisse des Zweiten Weltkriegs, als das Schicksal der Welt auf der Kippe zu stehen schien. Wer mehr darüber erfahren möchte, wie Wright dazu kam, einen Roman zu schreiben, der, wie er selbst sagte, mehr als alles, was er zuvor geschrieben hat, »reiner Inspiration entsprungen ist«, und wer mehr auch über die vielen anderen Einflüsse erfahren möchte, sei auf den Essay Erinnerungen an meine Großmutter verwiesen, der an den Roman anschließt.
DERMANNIMUNTERGRUND
TEILEINS
Die große, weiße Tür schloss sich hinter ihm. Er zog sich seine zerschlissene Kappe tief über die Augen und lief in der sommerlichen Abenddämmerung zur Bushaltestelle zwei Straßen weiter. Es war Samstagabend, er hatte gerade seinen Lohn bekommen. Ein stetiger, leichter Wind vom Meer trocknete sein verschwitztes Hemd. Über ihm, über den Dächern der Mehrfamilienhäuser, trieben rote und purpurne Wolken. Er näherte sich einer Kreuzung, hielt inne und sah auf die schmale Rolle grüner Geldscheine in seiner rechten Hand. Im dunkler werdenden Zwielicht zählte er nach:
»Fünf, zehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn …«
Er ging weiter, gluckste: Yeah, sie machte niemals einen Fehler. Er war müde und glücklich, er mochte das Gefühl, wenn er samstagabends bezahlt wurde. Eine drückend heiße Woche lang hatte er mit aller Kraft für dieses Geld gearbeitet, um Brot kaufen und die Miete für die nächste Woche bezahlen zu können. Den Tag morgen würde er in der Kirche verbringen und sich am Montag, wenn er wieder zur Arbeit ging, wie neu fühlen. Vorsichtig, um es auf keinen Fall zu verlieren, schob er das ordentliche Bündel frischer Geldscheine sicher in die rechte Hosentasche, seine Arme schwangen frei neben seinem Körper. Plötzlich flammten die Straßenlaternen auf, und zwei träge gelbe Streifen fanden in der Ferne vor ihm zusammen.
»Mir tut die Hand vom Rasenmähen weh«, sagte er laut.
Vor ihm blickte das weiße Gesicht eines Polizisten über das Lenkrad eines Autos, zwei weitere weiße Gesichter beobachteten ihn vom Rücksitz. Für einen scheinbar endlosen Moment stand er unbeweglich in der lauen Luft des frühen Sommerabends, die mit Blasen bedeckte Hand erhoben, und starrte den nur verschwommen zu erkennenden Fahrer an, der eine grelle Stablampe direkt auf seine Augen gerichtet hielt. Er wartete darauf, dass sie ihm Fragen stellten, damit er ihnen einen befriedigenden Bericht über sich geben konnte. Schließlich war er Mitglied der White Rock Baptist Church und bei Mr und Mrs Wooten angestellt, die zu den bekanntesten Bürgern der Stadt gehörten.
»Komm her, Junge.«
»Ja, Sir«, hauchte er automatisch.
Er ging steif zum Trittbrett des Polizeiwagens.
»Was machst du hier?«
»Ich arbeite dahinten, Mister«, antwortete er. Seine Stimme war leise, atemlos, flehend.
»Für wen?«
»Mrs Wooten, gleich dahinten in Nummer 5679, Sir«, sagte er.
Die Tür des Polizeiwagens schwang auf, und der Mann hinter dem Lenkrad stieg aus. Sofort, wie auf ein verabredetes Zeichen hin, kamen auch die beiden anderen Polizisten heraus, und zu dritt traten sie ihm entgegen. Sie tasteten ihn von Kopf bis Fuß ab.
»Er ist sauber, Lawson«, sagte einer der Männer zum Fahrer des Wagens.
»Wie heißt du?«, fragte der Polizist, der Lawson genannt worden war.
»Fred Daniels, Sir.«
»Schon mal in Schwierigkeiten gewesen, Junge?«, fragte Lawson.
»Nein, Sir.«
»Was glaubst du, wohin du gehst?«
»Ich gehe nach Hause.«
»Wo wohnst du?«
»In der East Canal, Sir.«
»Mit wem wohnst du da?«
»Mit meiner Frau.«
Lawson wandte sich an den Polizisten rechts neben sich.
»Wir nehmen ihn besser mit, Johnson.«
»Aber, Mister!«, protestierte er jammernd mit hoher Stimme. »Ich hab doch nichts getan …«
»Schon gut«, sagte Lawson. »Reg dich ab.«
»Meine Frau kriegt ein Kind …«
»Das sagen sie alle. Komm«, sagte der rothaarige Mann, der Johnson genannt worden war.
Empörung brandete in ihm auf, und er fuhr zurück, weg von ihnen. Ihre Finger schlossen sich um seine Handgelenke, gruben sich ihm ins Fleisch. Sie schoben ihn zum Auto.
»Willst du dich schlagen, hä?«
»Nein, Sir«, sagte er schnell.
»Dann rein ins Auto, verdammt!«
Er stieg in den Wagen, und sie stießen ihn auf den Sitz. Zwei der Polizisten rutschten rechts und links neben ihn und hielten ihn an den Armen fest. Lawson setzte sich hinters Steuer. Aber seltsamerweise fuhren sie nicht los. Er wartete, wachsam, aber bereit zu gehorchen.
»Nun, Junge«, begann Lawson langsam, fast schon freundlich, »sieht aus, als wärst du dran, hä?«
Lawsons hintergründige Stimme ließ Hoffnung in ihm aufkommen.
»Mister, ich hab nichts gemacht«, sagte er. »Sie können Mrs Wooten dahinten fragen. Sie hat mich grade bezahlt, und ich war auf dem Weg nach Hause …« Seine Worte klangen wirkungslos, und er versuchte es auf eine andere Weise. »Hören Sie, Mister, ich bin in der White-Rock-Baptistenkirche. Wenn Sie mir nicht glauben, rufen Sie Reverend Davis an …«
»Hast es dir genau zurechtgelegt, wie, Junge?«
»Nein, Sir«, sagte er und schüttelte energisch den Kopf. »Ich sage die Wahrheit …«
Eine Reihe Fragen gab ihm neue Hoffnung.
»Wie heißt deine Frau?«
»Rachel, Sir.«
»Wann soll das Baby kommen?«
»Jede Minute, Sir.«
»Wer ist bei deiner Frau?«
»Meine Cousine, Ruby.«
»Ah, ja«, sagte Lawson bedächtig.
»Ich glaube, er passt, Lawson«, sagte der große, knochige Polizist, der bisher geschwiegen hatte.
Lawson lachte und ließ den Motor an.
»Nun, Junge, du wirst mit uns kommen müssen«, sagte er mit einer komischen Mischung aus Mitgefühl und Härte.
»Mister, rufen Sie Reverend Davis an … Ich unterrichte in der Sonntagsschule für ihn. Ich singe im Chor, und ich hab den Gesangsverein organisiert …«
»Leg ihm besser die Armbänder an, Murphy«, sagte Lawson.
Der große, knochige Mann ließ Handschellen um seine Handgelenke klicken.
»Angst, Junge?«, fragte Murphy.
»Ja, Sir«, antwortete er, obwohl er die Frage nicht wirklich verstand. Er hatte das gesagt, weil er ihnen gefallen wollte. Dann korrigierte er sich: »Oh, nein, Sir.«
»Wo sind deine Mutter und dein Vater, Junge?«, fragte Lawson.
»Sir? Oh, ja, Sir. Die sind tot …«
»Irgendwelche Verwandten in der Stadt?«
»Nein, Sir. Nur Cousine Ruby.«
»Kommt. Nehmen wir ihn mit«, sagte Lawson.
Sein Blick verschwamm mit den ersten Tränen seit seiner Kindheit. Der Wagen fuhr nordwärts, und er sah, dass es dunkel geworden war. Ja, sie bringen mich zum Revier in Hartsdale, dachte er. Er hatte keine Angst, nein, was das alles anging, sah blind vor sich hin und vertraute darauf, dass er ihnen am Ende eine Erklärung geben würde, die ihn befreite. Das alles war nur ein Traum, aber bald schon würde er erwachen und sich wundern, wie wirklich es ihm vorgekommen war. Der Wagen schaukelte, bog in die Court Street und raste über stählerne Straßenbahnschienen nach Westen. Was würde Rachel denken, wenn er nicht pünktlich nach Hause kam? Zu Tode würde sie sich sorgen. Er staunte, als er auf einer großen Uhr in einem Schaufenster sah, dass es sieben war. Bei der Vorstellung, wie sein warmes Abendessen auf dem Tisch auf ihn wartete, zog sich sein Magen zusammen. Nun, sobald er sich auf dem Revier ausreichend identifiziert hatte, würden sie ihn gehen lassen. Und später heute Abend, zu Hause bei Rachel, im Sessel beim Radio, würde er über diesen kleinen Vorfall lachen. Wenn er ihr die Geschichte erzählte, würde er die dramatischsten Teile hinauszögern und Rachel dazu bringen, ungeduldig viele Fragen zu stellen.
Der Wagen rumpelte voran, und der Anflug eines Lächelns umspielte seine Lippen. Die Sirene heulte auf, und er erinnerte sich, wo er war. Ja, er musste diesen Polizisten sagen, dass er kein Verbrecher und Reverend Davis, sein Freund, eine angesehene Persönlichkeit in der Schwarzengemeinde war. Er würde den Polizisten klarmachen, dass sie es nicht mit einem herumlungernden Faulenzer zu tun hatten, den keiner kannte, der keine Familie, Freunde oder Verbindungen hatte …
»So ists richtig, Junge. Denk dir ein gutes Alibi aus«, sagte Lawson.
»Nein, Sir«, rief er schuldbewusst. Er hatte das Gefühl, Lawson hätte einen Röntgenblick und könnte in seinen Kopf sehen und seine Gedanken lesen. Dann jammerte er: »Mister, ich hab nichts getan. Bei Gott, ich habe nichts …«
Seine Stimme erstarb, während das Auto über den Asphalt heulte. Ihn einsperren zu wollen war so absurd, dass er am liebsten gelacht hätte, doch er hielt sich zurück. Er war so zuversichtlich, dass er das alles nicht ernst nehmen konnte. Bis jetzt hatten die Polizisten noch keine Anschuldigung gegen ihn vorgebracht.
»Sagen Sie, Mister«, begann er mit hoher, brüchiger Stimme, in der ein winziger Vorwurf mitschwang, »was wollen Sie von mir?«
»Was hast du mit dem Geld gemacht?«, entgegnete Lawson.
»Mit welchem Geld?«, keuchte er.
»Du weißt, wovon wir reden, Junge«, sagte Lawson mit lauter Stimme. »Das Geld, das du genommen hast, nachdem du sie umgebracht hast …«
Panik durchfuhr ihn. Seine Lippen bewegten sich mehrmals, bevor Worte über sie kamen.
»Umgebracht? Wen?«, rief er, und seine Stimme fuhr fort, ohne auf eine Antwort zu warten: »Mister, ich hab niemanden umgebracht. Warum fahren Sie nicht zurück und fragen Mrs Wooten …?«
»Mrs Wooten ist heute erst spät nach Hause gekommen, hä?«, fragte Johnson.
»Ja, Sir. Wie oft war ich bei der Arbeit allein, habe das Auto poliert, die Fenster geputzt, den Keller gestrichen …«
»Das wissen wir alles«, sagte Lawson.
Er hatte das entsetzliche Gefühl, dass diese Männer sogar wussten, was er in jedem zukünftigen Moment seines Lebens tun würde, ganz gleich, wie lange er lebte.
»Los, Junge, sitz gerade«, sagte Murphy.
Er drückte den Rücken durch, und Murphy zog die zusammengerollten Geldscheine aus seiner Tasche und zählte sie.
»Wo ist der Rest?«, fragte Murphy.
»Ich hab kein anderes Geld, Mister. Ich schwöre, ich hab keins!«
Während das Auto weiterfuhr, steckte Murphy das Geld in einen Umschlag und schob es in seine Tasche.
»Irgendwelche Blutflecken auf ihm?«, fragte Lawson.
Murphy und Johnson untersuchten jeden Quadratzentimeter seiner Sachen, inspizierten seine Hände, seine Schuhe und suchten sogar in seinen Haaren.
»Hast du dich heute umgezogen?«, fragte Johnson.
»Nein, Sir.«
Sie bogen in eine Einfahrt und blieben abrupt stehen, wodurch er heftig nach vorn geworfen wurde. Lawson stieg aus und knallte die Fahrertür zu. Murphy und Johnson zerrten ihn aus dem Auto und stießen ihn durch eine Gruppe Polizisten.
»Wen hast du da, Lawson?«
»Wir klären die Peabody-Sache«, sagte Lawson.
»Hat er schon gesungen?«
»Nein. Wir müssen ihm etwas Druck machen«, sagte Lawson.
Er versuchte sich umzudrehen und den Polizisten anzusehen, der die Fragen gestellt hatte, aber Murphy riss ihn weiter. Er gab sich Mühe, den grimmigen Ausdruck auf Lawsons Gesicht zu entschlüsseln, konnte es aber nicht. Sie führten ihn eine kurze Holztreppe in einen düsteren Korridor hinauf, führten ihn eine schmale Wendeltreppe hinauf und schoben ihn in einen kleinen schmutzigen, fensterlosen Raum. Er stand unsicher da, und sein Blick glitt über die Wände. Links gab es einen einzelnen Holzstuhl. An der Decke hing eine Glühbirne mit einem weiten grünen Schirm. Der Raum war von einem muffigen, schalen Geruch erfüllt. In einer Ecke sah er einen Porzellan-Spucknapf voll mit widerlichem Schleim. Zigaretten- und Zigarrenstummel lagen auf dem Boden.
Die Polizisten schlossen seine Handschellen auf und stießen ihn auf den Stuhl. Er sah, wie sie ihre Jacken auszogen und zusammen mit den Schirmmützen an Haken entlang der Wände hängten. Sie krempelten sich die Hemdsärmel betont langsam auf und bewegten sich schweigend durch den Raum. Eine lange Weile sagte keiner etwas zu ihm oder sah ihn an. Dann kamen alle drei und stellten sich vor ihn.
Murphy pulte sich mit einem dreckigen Zahnstocher zwischen den Zähnen herum.
»Ich habe nichts getan!«, sagte er und sah von Gesicht zu Gesicht.
»Komm schon. Hör auf, uns hinzuhalten«, sagte Lawson. »Raus mit der Sprache …«
»Mister, ich schwöre bei Gott …«
Lawson bleckte die Zähne, beugte sich unversehens vor und schlug ihm mit der bloßen Hand schallend ins Gesicht. Ein scharlachroter Blitz zuckte an seinen Augen vorbei, und alles in ihm wollte sich wehren. Seine Lippen fühlten sich erstarrt und taub an, und als sie sich wieder lockerten, schmerzten sie, stachen und bluteten.
»Vielleicht hilft das deinem Gedächtnis auf die Sprünge«, sagte Lawson.
»Mister, ehrlich, ich hab nichts getan«, murmelte er schluchzend.
»Wann hast du Mrs Wootens Haus verlassen?«, fragte Murphy.
»Kurz bevor Sie mit dem Auto gekommen sind und mich mitgenommen haben«, wimmerte er.
»Junge, du weißt, was wir meinen! Wir meinen, früher am Tag!«
»Ich bin heute über Tag nicht aus dem Haus gegangen, Mister …«
»Bist du doch! Du bist nach nebenan!«
»Nein, Sir. Ich war nicht nebenan.«
»Bist du nicht durch Mrs Peabodys Fenster geklettert?«
»Nein, Sir, Mister! Ich war nie bei denen drüben!«
»Bist du nicht rüber zu den Peabodys, gleich nachdem Mr und Mrs Wooten heute Morgen das Haus verlassen haben?«, fragte Johnson.
»Nein, Sir, Mister …«
Lawson wandte sich an die anderen.
»Er muss gegen zehn dort gewesen sein. Die Ärzte sagen, sie waren seit neun Stunden tot …« Lawson drehte sich wieder zu ihm hin. »Jetzt hör mal zu, Junge, du kannst es uns ruhig gestehen. Du bist um zehn rüber, richtig?«
»Nein, Sir! Bitte, Mister … Ich weiß nicht, von was Sie reden …«
»Um wie viel Uhr ist Mr Wooten heute Morgen aus dem Haus gegangen?«
»Kurz vor neun, Sir.«
»Und wann ist Mrs Wooten gegangen?«
»Etwa um halb zehn, Sir.«
»Nach halb zehn war keiner mehr mit dir im Haus?«
»Nein, Sir. Ich war allein. Aber ich bin nie rausgegangen.«
»Du bist ganz schön kaltblütig, was, Junge?«, sagte Lawson.
»Nein, Sir, Mister. Nein, Sir …«
Lawson schlug ihm auf den Mund. Er vergrub das Gesicht in den Händen und beugte sich vor, stöhnte und schluchzte. Johnson lehnte sich über ihn und schrie ihm ins Ohr.
»Womit hast du es gemacht, Junge. Mit einer Axt?«
»Ich habe nie niemanden umgebracht. Niemanden … Ich schwöre, Sie täuschen sich, Mister.«
Murphy griff über seinen Kopf, schaltete das elektrische Licht ein, und der helle Schein fiel ihm direkt in die Augen. Er blinzelte, und seine blutigen Lippen klafften auf.
»Nun, Junge«, sagte Lawson mit leiser, ernster Stimme, »wir werden dich hierbehalten, bis du uns sagst, was du getan hast …«
»Mister, ich sage Ihnen, ich habe nichts getan.« Er weinte, den Mund verzogen. Tränen strömten über seine schwarzen, nassen Wangen.
»Also gut«, sagte Lawson. »Es liegt ganz bei dir. Wenn du es so willst, kannst du es so haben. Bleib da sitzen und fang dir ein paar ein …«
Er starrte Lawson an und versuchte verzweifelt zu verstehen, was mit ihm geschah. Er träumte, ja, das war es, Lawson war ein Traum und er wollte, dass er etwas Unmögliches tat.
»Wen hast du zuerst umgebracht?«, fragte Lawson.
Er sprang auf die Füße und schrie mit aller Luft, die er in der Lunge hatte: »Ich habe niemanden umgebracht!«
Johnson stieß ihn zurück auf den Stuhl.
»Ganz ruhig, Junge.«
»Zuerst hast du Mr Peabody umgebracht, um dich anschließend an seiner Frau zu vergehen, richtig?«, fragte Lawson gelassen.
Entsetzen trat in seine Augen, während er sich die Finger knetete. Sein Kopf wackelte ziellos hin und her, als wäre er zu schwer für seinen Hals. Er zitterte am ganzen Leib, die Vernunft sagte ihm, alles von sich zu weisen, aber jede Faser seines Körpers wollte Ja sagen, damit er aus diesem Albtraum herauskam.
»Ich habe nie niemanden umgebracht«, sagte er mit klappernden Zähnen.
»Wo hast du das Geld versteckt?«, fragte Lawson.
Er hatte das seltsame Gefühl, dass diese Fragen die Kraft besaßen, ihn auf eine merkwürdige Bahn zu katapultieren, auf der er sich irgendwie schuldig fühlte, obwohl er es doch nicht war. Er kämpfte gegen diese alles erfassende Wirkung an.
»Mister, ich hab kein Geld.« Die Worte kamen verwaschen aus ihm heraus. »Bitte, rufen Sie Reverend Davis an …«
»Zum Teufel mit deinem gottverdammten Reverend Davis! Wir werden dir die Gedanken an diesen gottverdammten Prediger schon noch austreiben!«, schrie Lawson.
»Ich bitte Sie …«
»Beantworte unsere Fragen! Wann hast du die beiden Leute umgebracht!«
»Mister, ich hab niemandem nichts getan …«
Johnson packte seinen Stuhl und zerrte ihn in die Mitte des Raumes, dann liefen die drei wieder vor ihm auf und ab.
»Bitte, Mister …«, bettelte er, beugte sich vor und blinzelte, damit die Tränen seinen Blick nicht trübten. »Lassen Sie mich eine Nachricht an meine Frau schicken … Sie weiß nicht, wo ich bin …«
»Na. Soll sie sich ruhig Sorgen machen. Wenn du zur Vernunft kommst und redest, kannst du sie sehen«, sagte Lawson.
»Ich weiß nichts von dem, was Sie sagen, Mister. Ich schwöre bei Gott, ich weiß nichts.«
»Du hast es dir genau zurechtgelegt, wie, Junge?«, sagte Lawson.
Murphy trat ohne erkennbaren Grund hinter ihn, und obwohl er es sah, achtete er nicht weiter auf ihn. Dann, plötzlich, spürte er, wie er zu Boden ging, weil der Stuhl unter ihm weggezogen wurde.
»Nur ein kleiner Vorgeschmack, Junge«, schallte ihm eine harsche Stimme in die Ohren. »Steh auf!«
»Ja, Sir«, flüsterte er.
Er stand auf, und der Stuhl kam zurück.
»Setz dich.«
Er setzte sich, und sie fuhren mit ihrer Hin-und-her-Lauferei fort. Ihre Gummiabsätze machten hohle Geräusche auf dem Holzboden, die wie Trommelschläge in seinem Kopf nachhallten.
»Mister, bitte«, weinte er. »Ich weiß nichts …«
»Halts Maul!«
»Bitte, Mister …«
»Vielleicht versucht er Zeit zu schinden«, sagte Murphy. »Vielleicht will er ein Glas Wasser …«
Er sah, wie die drei Polizisten schnelle Blicke tauschten.
»Sicher, sicher«, sagte Lawson begütigend. »Der Junge hat Durst.« Lawson trat zu ihm und legte ihm eine Hand auf die Schulter. »Sag, Junge, möchtest du einen Schluck Wasser, etwas Kühles zu trinken …«
Er antwortete nicht.
»Sag was, gottverdammt! Uns ist es scheißegal, wenn du hier sitzt und schwitzt! Wenn du Wasser willst, sag es …«
»Ja, Sir«, flüsterte er.
Auch wenn sich seine Kehle trocken wie ein rotglühender Ofen anfühlte, wollte er eigentlich kein Wasser. Er wollte nach Hause. Murphy ging hinaus, und Lawson und Johnson lehnten sich an die Wand und steckten sich je eine Zigarette an. Schweiß stand ihnen auf der Stirn, und ihre Blicke schienen so gedankenverloren, dass es ihm vorkam, als sei er vielleicht nicht wirklich in einem Raum mit ihnen und dass das alles ein wirrer Traum sei, der bald vorbei sein müsse. Die Tür öffnete sich, und Murphy kam mit einem Glas Wasser in der Hand herein.
»Da sieh mal, Junge«, sagte Murphy und trat näher. »Wir sind nett zu dir, oder? Wir sind deine Freunde. Wir wollen dir nicht wehtun. Aber du musst reden, weißt du?«
»Aber ich hab Ihnen alles gesagt, was ich weiß, Mister …«
»Hier«, sagte Murphy freundlich und reichte ihm das Glas, »nimm erst einmal einen Schluck …«
Er griff nach dem Glas und hielt es ängstlich in der Hand. Eis klackerte gegen den Rand, und die Kälte des Wassers tat seiner Hand gut. Lawson und Johnson kamen näher. Die warme Luft im Raum ließ das Glas anlaufen, und langsam begannen seine Drüsen auf den Anblick der kühlen Flüssigkeit zu reagieren.
»Mach schon, trink, Junge. Ich muss das Glas zurückbringen«, sagte Murphy.
Er hob das Wasser an seine Lippen.
»Moment, Junge«, dröhnte Murphy. »Sag uns, was du mit dem Geld aus dem Schreibtisch der Peabodys gemacht hast.«
»Ehrlich, Mister, ich war nie in meinem Leben in dem Haus …«
»Oh, lass ihn trinken, Murphy«, sagte Lawson.
»Mach schon, trink, Junge«, sagte Murphy, schien nachzugeben und tat einen kleinen Schritt zurück.
Er füllte seinen trockenen Mund mit kaltem Wasser und war gerade dabei, es herunterzuschlucken, als er eine Faust auf sich zuschnellen sah. Sie traf in genau dem Moment voll in seinen Magen, als das Wasser in ihn hineinlief, und sein Zwerchfell hob sich, und das Wasser schoss hoch in seine Brust und spritzte ihm aus der Nase, Schmerzen hinter sich herziehend. Gleichzeitig sprang ihm das Glas aus der Hand und landete mit einem scheppernden Klirren in einer Ecke des Raumes. Hustend ging er zu Boden, mit dem Gesicht voran, und blieb zuckend liegen. Der Schmerz ballte sich in seinem Magen zusammen, und er hustete und würgte, wobei ihm weiteres Wasser aus Nase und Mund rann.
»Perfekt!«, sagte Lawson. »Ich habs hochzischen hören.«
»Das war auf den Bruchteil einer Sekunde genau abgepasst«, sagte Murphy mit einem ruhigen, bescheidenen Lächeln.
»Du wirst verdammt gut, Murphy«, sagte Johnson.
Zitternd erhob er sich, und sie schoben den Stuhl weiter vor. Graue und blaue Augen betrachteten ihn mit fragender Verachtung. Er neigte geschlagen den Kopf und seufzte durch die geöffneten Lippen. Das Husten hatte ihn durstig gemacht, und er leckte sich die Lippen und war dankbar für die paar Tropfen Feuchtigkeit, die er dort spürte. Er hob die Hand und fuhr sich über den Mund, und als er seine Finger betrachtete, stellte er fest, dass er kein Wasser geschmeckt hatte, sondern das scharfe Salz von seinem eigenen Blut. Was machen die mit mir?, fragte er sich verzweifelt.
»Wie lange arbeitest du schon für Mrs Wooten, Junge?«, fragte Lawson.
»Ungefähr ein J-j-jahr, Sir«, keuchte er.
»Wie bist du an den Job gekommen?«
»Die K-k-kirche hat m-m-mich geschickt.« Er rang immer noch um Luft. »Mrs Wooten h-h-hat Reverend Davis anger-r-rufen … Er g-g-gibt uns immer A-a-arbeit … Reverend Davis hat eine Arbeitsverm-m-mittlung in der K-k-kirche … Wenn Sie R-r-reverend Davis anrufen …«
»Schreib uns nicht vor, was wir tun sollen!«, bellte Lawson.
Er saß weinend und sabbernd da. Schweiß tropfte ihm vom Gesicht auf die Hände.
»In Ordnung«, sagte Lawson. »Wenn du die ganze Nacht hier sitzen willst, bitte. Wenn du redest, kannst du dich etwas ausruhen …«
»Ich habe nichts zu s-s-sagen, Mister.« Er schluckte. »Ich will nur nach Hause zu meiner Frau … Sie haben den falschen Mann …«
»Johnson«, rief Lawson, »fessel ihn, und mal sehen, was er macht.«
»Okay«, sagte Johnson.
Johnson kam mit seinen Handschellen und ließ sie ihm um die Handgelenke schnappen.
»Komm schon, Junge«, sagte Johnson. »Vielleicht hast du dein Hirn ja in den Füßen. Dann müssen wir es zurück in den Schädel holen.«
Johnson riss ihn auf die Beine und schloss eine Kette um seine Füße. Dann hob er ihn zusammen mit Murphy hoch, sie drehten ihn auf den Kopf und hievten seine Füße über einen Haken an der Wand. So hing er mit dem Kopf nach unten knapp über dem Boden. Das Blut pochte ihm in den Schläfen, und sein Herz und seine Lunge sackten schwer in seine Brust. Er konnte kaum atmen.
»Nun, wie fühlst du dich, Junge?«, fragte Lawson.
Er konnte nicht antworten. Sein Blick wurde trübe. Der Raum drehte und drehte sich. Er schluckte mehrere Male. Schlingen aus Feuer brannten um seine Füße, und die Augen drückten aus ihren Höhlen. Übelkeit erfüllte ihn, und er zog die Kehle zusammen, damit er nichts herauswürgte.
»Mister«, flüsterte er.
»Rede, du schwarzer Bastard!«
Der Raum und die Stimmen traten nach und nach in den Hintergrund. Obwohl seine Augen offen waren, konnte er nichts sehen. Sein Atem ging schwer, und er konnte seinen Körper wie ein riesiges Pendel mit jedem Herzschlag im Raum schwingen spüren. Feuer fuhr ihm von den Füßen in die Waden, die Knie, am Ende erfasste es seinen ganzen Körper, und eine große finstere Wolke drang in sein Hirn. Das Nächste, was er wusste, war, dass er auf dem Boden saß und ihm jemand ins Gesicht schlug.
»Wach auf, du Bastard!«, schrie Lawson ihn an.
Seine Augen öffneten sich, und sein Kopf fiel zur Seite. In seinen Schläfen pulsierte der Schmerz. Ein schweres Gewicht schien ihm auf den Kopf zu drücken. Er spürte ein warmes Blutrinnsal, das ihm aus dem Mundwinkel lief, und wie aus dichtem Dampf heraus hörte er die ferne Sirene eines Feuerwehrwagens. Törichterweise fragte er sich, wo das Feuer sein mochte. Dann füllte Rachel plötzlich seinen Kopf. Rachel … Er geriet außer sich.
»Ich will nach Hause! Ich will nach Hause!«, rief er wieder und wieder.
»Du bleibst hier, bis du redest, verstanden?«, sagte Lawson. »Steh auf und setz dich auf den Stuhl.«
Er erhob sich und wäre gestürzt, hätte Murphy nicht seinen Arm gepackt. Unsicher saß er auf dem Stuhl, sein Körper zuckte unmerklich mit jedem Herzschlag zusammen.
»Wie alt bist du, Junge?«
Die Stimme erreichte ihn von einem unbekannten Ort, und er hob ziellos den Blick.
»Neunundzwanzig«, sagte er zerstreut.
»Nur neunundzwanzig gottverdammte Jahre schon zu lange auf der Erde, hä?«
»Nein, Sir.«
»›Ja, Sir‹, heißt das, gottverdammt.«
»Ja, Sir«, murmelte er ohne Ton und Sinn.
»Bevor wir mit dir fertig sind, du Hurensohn von einem Drecksnigger, verpassen wir dir eine Lektion …«
Hin und her liefen sie vor ihm, die weißen Gesichter düster und zu Boden geneigt. Der Rauch ihrer Zigaretten brannte ihm in den Augen.
»Sag uns die Wahrheit, Junge. Du hast Mr und Mrs Peabody schon lange beobachtet, richtig?«, fragte Lawson.
»Nein, Sir«, murmelte er.
»Konntest du aus der Küchentür, wo wir dich heute Morgen beim Putzen gesehen haben, nicht in ihr Schlafzimmerfenster sehen?«
»Ich weiß es nicht, Mister«, flüsterte er.
»Du bist ein gottverdammter Lügner! Als wir in Mrs Peabodys Haus waren, konnten wir dich sehen …«
»Ich hab da nie rübersehen wollen, Mister …«
»Nachdem du sie umgebracht hast«, fuhr Lawsons Stimme fort, »hast du bewusst den ganzen Tag mit deiner Arbeit weitergemacht, als wär nichts geschehen, oder?«
»Ich weiß nicht, was dort drüben passiert ist, Mister«, schluchzte er.
»Du bist somit der abgebrühteste Nigger, mit dem ich je zu tun hatte«, sagte Lawson. »Du spielst ein Spiel, aber wir knacken dich, und wenn wir dich dafür umbringen müssen!«
Weiter ging es mit der Herumlauferei vor ihm, und ihre Schuhe machten immer noch die hohlen Geräusche auf dem Holzboden. Alle drei waren über einen Meter achtzig groß und schienen an die hundert Kilo zu wiegen. Ihre schiere Größe und Masse ängstigte ihn, denn er wog gerade mal sechzig Kilo und war eins siebzig groß. Im Raum war es stickig heiß, und er schien nicht genug Luft in seine Lunge zu bekommen. Sein Atem ging schnell und keuchend, sein ganzer Körper war schweißnass.
Die Zeit schleppte sich dahin, wie durch eine Kraft außerhalb von ihm angetrieben, der Schrecken der vor ihm herumgehenden Männer verblich, und er sah Rachel auf dem billigen Messingbett liegen, das er vor fast einem Jahr, nach ihrer Heirat und der Gründung ihres Hausstandes, gekauft hatte. In seiner Vorstellung sah er sie in der Hitze der Nacht liegen und sich Luft zufächeln, gereizt, rastlos bewegte sie ihren geschwollenen Körper auf dem Bettzeug hin und her, seufzte und wartete auf ihn … Großer Gott! Er musste nach Hause oder ihr irgendwie eine Nachricht schicken! Wenn sie nur Reverend Davis anrufen würden! Oder Mrs Wooten! Flehend sah er aus seinem Elend zu ihnen auf. Sie liefen immer noch vor ihm herum. Er wurde panisch, als er das Gefühl bekam, für sie nicht zu existieren.
»Bitte«, wimmerte er.
»Warum hast du sie umgebracht?«, fragte Lawson und blieb vor ihm stehen.
Er antwortete nicht. Die drei Polizisten versammelten sich um ihn, und die Fragen kamen eine nach der anderen.
»Wo ist die Axt? Du hast eine Axt benutzt, oder? Was hast du mit dem Geld gemacht, das du aus dem Schreibtisch genommen hast? Hat dir einer bei deinen Morden geholfen? Komm schon, Nigger, rede! Hattest du geplant, Mrs Peabody zu vergewaltigen? Als der Postbote um elf geklingelt hat, hat er dich von der Frau verscheucht, richtig? Und als du fertig warst, bist du zurück zur Arbeit bei Mrs Wooten? Du hast gedacht, keiner würde je auf den Gedanken kommen, dass du es warst, oder?«
»Ich weiß nicht, von was Sie reden«, ächzte er verzagt und verzweifelt.
Lawson packte den Kragen seines Hemdes und riss ihn vor, wieder lag er auf dem Boden. Er roch den beißenden Gestank eines Zigarrenstummels. Die Schläge kamen so fest, so schnell und so schmerzhaft, dass er begriff, sie bearbeiteten ihn mit einem Schlagstock. Er ächzte. Die Spitze eines Schuhs stach ihm wie ein heißes Eisen in den Nacken. Er ließ einen kurzen, unfreiwilligen Schrei hören. Wieder rissen sie ihn auf die Füße und stießen ihn auf den Stuhl. Er sah einen Blutfleck auf seinem Hemd.
»Wirst du jetzt reden, Junge, oder willst du noch mehr?«
Seine Lippen bewegten sich, aber es kamen keine Worte aus ihm heraus. Johnson legte ihm sanft eine Hand auf die Schulter.
»Hör zu, Junge, willst du zu deiner Frau?«
»Ja, Sir«, gelang es ihm zu flüstern.
»Dann sag uns, was du getan hast!«
»Ich … I-ich habe n-n-nichts getan …«
Eine Faust explodierte zwischen seinen Augen, er flog nach hinten und fiel mit seinem Stuhl um. Sein Kopf schlug gegen die Wand, zweimal, so heftig war er getroffen worden. Ein Halbdunkel umfing ihn, und es schien, dass er oben auf einer fahrenden Straßenbahn lag und viele blaue Funken der Hochspannungsleitung der Bahn auf sich herunterregnen sah. Die Welt drehte von links nach rechts. Dann war er ein kleiner Junge, der sich hinten auf einen dahinrasenden Lastwagen gestohlen hatte …
II
Stunden später spürte er kaltes Wasser auf seinem Gesicht. Er fuhr hoch und war hellwach. Sie setzten ihn auf den Stuhl, und sein Blick klärte sich. Er sah, dass sich jetzt vier Männer im Raum mit ihm befanden: Neben Lawson, Johnson und Murphy war da noch einer in einem grauen Geschäftsanzug. Er hielt ein weißes Stück Papier in der Hand und beugte sich zu ihm vor.
»Ich habe hier was, von dem ich möchte, dass du es unterschreibst, Junge«, sagte der Mann. »Ich bin der Bezirksstaatsanwalt. Hör zu. Ich will nicht, dass dich diese Männer noch weiter plagen, verstehst du? Also unterschreibe einfach …«
Wieder wollte er aus Gewohnheit eine Antwort geben, doch er konnte keine Worte formen.
»Möchtest du deine Frau sehen, Junge?«, fragte ihn der Mann im grauen Anzug.
Er antwortete nicht. Rachel schien jetzt unwichtig. Er wollte schlafen und dass seine Schmerzen aufhörten.
»Der Staatsanwalt fragt dich, ob du deine Frau sehen willst«, schrie ihm Lawson ins Ohr.
»Ja, Sir«, murmelte er benommen.
»Also dann«, sagte der graue Anzug mit schmeichelnder Stimme, »unterschreibe dieses Papier. Ich habe alles für dich notiert. Unterschreib es einfach, dann kannst du zu deiner Frau …«
Er starrte auf das weiße Blatt Papier voller verschwommener schwarzer Linien.
»Was steht auf dem Blatt?«, fragte der graue Anzug.
Er versuchte verzweifelt, die Buchstaben zu lesen, doch er schaffte es nicht, den Blick zu fokussieren. Und während er dasaß und auf das trübe Weiß starrte, hörte er das schwache Klappern von Pferdehufen unten auf dem Pflaster, dann das Scheppern von Metall auf Metall. Mein Gott! Das ist der Milchmann … Es ist vier Uhr morgens …
»Lassen Sie mich nach Hause«, stöhnte er.
»Unterschreibe das Papier, und du kannst gehen«, sagte der graue Anzug.
Seine Augen füllten sich mit Tränen. Sein Kopf schmerzte, und die Stimmen der Männer kamen aus einem Traum und wiederholten: »Lies das Papier und unterschreibe es …« Der graue Anzug schob ihm das Blatt in die Hand, und er hielt es einen Moment lang und sah auf die Schrift, die in undeutlichen schwarzen Wellen auf dem wogenden Weiß trieb. Dann flatterte ihm das Blatt aus den tauben Fingern und glitt auf den Boden.
»Hurensohn«, murmelte Lawson und schlug ihn wieder.
Er fiel vom Stuhl, und sein Körper rollte über den Boden, bis er an die Wand stieß. Bewegungslos lag er da, eingehüllt in ein Halbdunkel. Eine Hitzewelle erfasste ihn, und in einem verwirrten Traum glaubte er, zurück bei Mrs Wooten zu sein und mit dem elektrischen Rasenmäher über das helle, grüne Gras zu fahren. Hände zogen grob an seinen Kleidern, und er wurde zurück auf den Stuhl gehoben.
»Unterschreibe das Papier, Junge!«, hörte er Lawson rufen.
Er wollte antworten, hatte seine tauben Lippen aber nicht unter Kontrolle. Das schwache Rumpeln einer Straßenbahn erreichte ihn von weit her. Gott, wie spät ist es? Er sackte in Richtung Boden, doch die brennenden Schläge bloßer Hände auf seine Wangen hielten sein Bewusstsein in der Schwebe. Der weiße Papierfleck bewegte sich wieder vor seinen Augen.
»Unterschreibe und bringe es hinter dich«, sagte der graue Anzug.
Er wankte und stöhnte. Zahllose Male drangen die donnernden Stimmen in seine Ohren, sein Gehirn und sein Blut. Aber er machte keinen Versuch, das Papier zu lesen oder zu unterschreiben. Er fühlte sich hypnotisiert, im Griff einer Macht, die stärker war als er. Momente völliger Leere reihten sich aneinander, in denen er sich nicht bewusst war, was gesagt wurde. Er saß unsicher auf der Kante des Stuhls und seine Lider blinzelten hin und wieder, um das grell gleißende elektrische Licht auszublenden, das vor seinen Augen hin- und herschwang.
Heiße Tränen suchten sich ihre Wege über seine schwarzen Wangen. Er schluckte und lehnte sich vor, sehnte sich danach, sich ins Vergessen fallen zu lassen, und sagte sich doch, dass er dieses Papier unterschreiben musste. Der verschwommene weiße Fleck hielt ihn mit einer tiefen, schrecklichen Endgültigkeit in seinem Bann. Er versuchte sich erneut auf die Schrift zu konzentrieren, konnte es aber nicht. Die harten Stimmen begannen wieder: »Unterschreibe das Papier, Junge …«