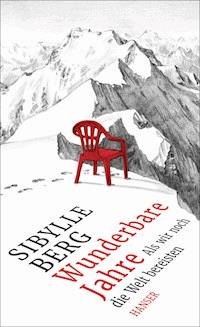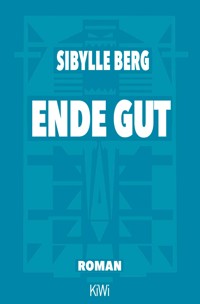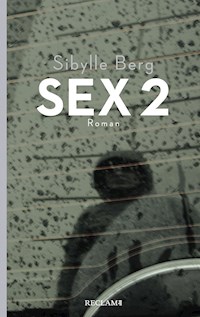Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Frau liebt einen Mann, weil der die Frau liebt. Was kann man sich Besseres wünschen in einer Welt, in der die Liebe nur noch ein Marketinginstrument ist? Ebendiese Welt kennt kein Pardon: Auf einer Reise nach China kommt der Mann gleich wieder abhanden, und man fragt sich, ob das mit rechten Dingen zugeht. Warum sucht man nach Veränderung, wenn man das Glück gefunden hat? Warum bleibt man nicht dort, wo man glücklich ist? Sibylle Berg erzählt eine moderne Liebesgeschichte und zeigt mit so melancholischen wie bösartigen Bildern eine Welt, in der man höchstens zu zweit überleben kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 336
Veröffentlichungsjahr: 2009
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sibylle Berg
Der Mann schläft
Roman
Carl Hanser Verlag
eBook ISBN 978-3-446-23454-3
© Carl Hanser Verlag München 2009
Alle Rechte vorbehalten
Satz: Gaby Michel, Hamburg
www.hanser.de
Datenkonvertierung eBook:
Kreutzfeldt digital, Hamburg
Damals. Im Winter. Vor vier Monaten.
Draußen war ein Winter gewesen, der den Bildern, die wir früher vom Winter gehabt haben, nicht einmal entfernt glich. Saubere, tiefgekühlte Dezember mit Reif und kleinen Häusern, in denen gepflegte Familien vor Bratäpfeln saßen, gab es schon lange nicht mehr.
Kein Schnee verdeckte die Unattraktivität der Welt, nur dunkelgrau war sie, klamm und verwaschen.
Während drei langer Monate würde das Licht sich kaum verändern; dem Winter würde ein verregneter Frühling folgen, der in einen trüben Sommer überging.
Nebel lag auf der Stadt, die noch nicht einmal eine Stadt war, und der Mensch hielt Winterschlaf. Die es sich leisten konnten, verließen ihre Häuser nicht, sie schlurften in Pyjamas herum, Speisereste im Haar, leere Pizzaschachteln unter dem Bett, und Spinnen mit neurotischen Gesichtern spannen ihre Netze zwischen den Läufen der Personen.
Die wenigen, die man auf öffentlichem Gelände sah, waren kaum dazu geeignet, einen mit kleinen, fröhlichen Sprüngen das Leben feiern zu lassen.
Ich war auf der Straße gewesen, hatte in hoffnungslose Gesichter gesehen und mich einen Moment lang gefühlt, als sei ich wieder eine von ihnen, die doch so warteten, dass etwas eintreten werde, durch das sie sich endlich wieder lebendig fühlten.
Ich hatte mich an jenem Morgen so stark an das Gefühl erinnert, bei aberwitzigem Wetter alleine zu sein, dass mir übel geworden war, für Sekunden, in denen ich aus der Wirklichkeit gefallen war. Ich hatte eine Zeitung kaufen wollen, und als ich, die Augen vor dem Elend halbverschlossen, das einzige im Winter geöffnete Café passierte, vermeinte ich darin Gespenster aus der Vergangenheit wahrzunehmen.
Eine füllige Frau mit Armprothese saß neben einem Mann, an den ich mich nur erinnerte, weil er so übertrieben unscheinbar wirkte wie eine Karikatur.
Als ich auf dem Rückweg vom Kiosk erneut an dem Café vorbeikam, waren beide verschwunden.
Da man sich, wie ich an diesem kleinen Schattenspiel meiner Erinnerung merkte, der Realität nie allzu sicher sein durfte, betrat ich wenig später unser Haus mit Sorge.
Man konnte nicht oft genug überprüfen, ob all das, was einen froh machte, noch an seinem Platz war.
Mir war schwindelig geworden vor Erleichterung, denn der Mann war da.
Er lag und schlief und sah wunderbar dabei aus, doch, anders als bei den meisten seiner Spezies, die nur im Schlaf entspannt und reizend wirken, kannte sein Ausdruck keine Veränderungen; auch nach dem Erwachen würde er wie benommen bleiben und seinen schweren Körper bewegen, als wäre er in einem anderen Element zu Hause als in der Luft. Vielleicht nähme sich der Mann unter Wasser gewandt aus; doch ich hatte ihn noch nie tauchen sehen, denn er war zu träge für die meisten Aktivitäten, mit denen Menschen, die keiner körperlichen Arbeit nachgehen, ihr Leben verstreichen lassen.
Da alles an seinem Platz war und es nicht aussah, als wäre das, was ich für mein Leben hielt, nur Phantasie, konnte ich weiter meinem Tagesplan folgen.
Fast alle Menschen lieben geregelte Abläufe, da muss man sich nichts vormachen. Routine macht, dass wir nicht ins All abgetrieben werden, ohne Verbindung zur Raumstation. Nach der Zeitung, dem Gebäck folgte der Kaffee. Ich beobachtete, wie im Nachbarhaus, in das ich durch die Palmen hindurch sehen konnte, Menschen an Küchentische schlurften, verschwommen von der Nacht, das Licht kaum vorhanden, sodass es sich durchaus auch um großgewachsene Insekten handeln konnte, die von der Stadt Besitz ergriffen hatten.
Jeden Morgen stand ich vor der Tür und freute mich, dass ich die Nacht überlebt hatte, dass alle Häuser sich noch am Ort befanden und der Mann im Bett lag. Vielleicht war ich der einzige Mensch, der daran ein Vergnügen hatte, denn der Mann entsprach kaum dem, was man gemeinhin als Kleinod bezeichnete.
Er war nicht auffallend schön oder reich, kein guter Redner oder charmant auf eine Art, die ihm Bewunderung einbrachte. Außer dass er mir das Gefühl gab, ich sei liebenswert, tat er sich in keinem Bereich mit Glanzleistungen hervor.
Früher, alleine, hatte ich befürchtet, so zu werden wie die meisten um mich herum: Immer fester in den Gewohnheiten, schneidend die Stimme, mit der ich reden würde, wenn nur einer fragen wollte, und ich wüsste es doch besser.
Vielen in den mittleren Jahren war jede Niedlichkeit abhandengekommen, und eine meiner großen Sorgen war es gewesen, gleichfalls zu einer unerfreulichen Person zu werden, mit schlechtem Geruch und gelber Ausstrahlung.
Es war so leicht, sich in einen verkommenen Zustand zu begeben, man brauchte nur einen Schritt, ein Loslassen, und schon saß man keifend vor dem Kaufhaus mit einer Flasche Brennspiritus in der Hand.
Ich blickte, auf der Schwelle stehend, in den Raum, ins Bett, auf die hundertzehn Kilo darin, die keine Geräusche machten. Manchmal hielt ich dem Mann die Nase zu, denn ich wollte sehen, ob er noch lebte. Normalerweise: ja.
Ich nannte ihn nur »der Mann«, damit er nicht verschwinden würde, da sich doch meist alles, dem man einen Namen gibt, entfernt.
Er war die Antwort auf alle Fragen, die ich mir, bevor wir uns trafen, nicht gestellt hatte. Sie waren unklar immer da gewesen, wie ein Hunger, und ich hatte sie Sehnsucht genannt, und Heimweh.
Dass alles, was das Leben an Großartigem für mich bereithalten würde, nur ein Mensch war, hätte mich beschämen können, doch es war mir völlig unwichtig, vor mir selber glänzend dazustehen.
Zum Glück! Denn sonst hätte ich den Tisch mit silbernen Kerzenleuchtern decken müssen, zu klassischer Musik, ich würde gut riechende Plunderteigstücke aus dem Umluftofen nehmen, sie mit selbsteingekochter biologischer Konfitüre bestreichen, und die Kinder rufen: Rainald, Beatrice, poschalista. Die Kinder würden multilingual aufwachsen und ausschließlich Sprachen beherrschen, die ich nicht verstand. Mein Mann käme zu Tisch, und er trüge einen Kaschmirschal um den Hals, unter dem er offene und sehr rare Geschwüre versteckt hielte.
Ich war froh, dass ich nicht dem Zwang unterlag, einem Bild entsprechen zu müssen, das ich mir von mir gemacht hatte.
An jenen Tag, der die Persiflage eines Winters war, erinnere ich mich, weil ich damals so glücklich war, dass ich fast traurig wurde, denn ich wusste, dass einem alles genommen wird, was Glück erzeugt.
Der Mann öffnete die Augen und war sofort anwesend. Da gab es kein langsames Zusichkommen – wo bin ich, was tue ich hier –, er wachte auf, sein Blick suchte mich, dann entspannte er sich, weil ich war da, und alles gut damit. Er rollte sich aus auf den Rücken wie ein Walfisch, der von weinenden amerikanischen Frauen ins Meer zurückbefördert wird. Alles an ihm war groß und rund, die Augen, die Füße, der Körper, er wirkte wie ein Spielzeug für Kinder, das man in die Badewanne legt und das über Nacht das Zehnfache seiner eigentlichen Größe erreicht.
Ich hatte keine Ahnung, was er dachte, was er vom Leben wollte, es interessierte mich nicht, ihm Fragen zu stellen, denn zum einen hatte ich schon alles gehört, was Menschen mir von ihren Plänen, Ideen, Projekten, Gefühlen, Verletzungen, Ängsten und Fähigkeiten zu berichten wussten, zum anderen würde er nur die Schultern zucken und antworten: »Keine Ahnung. Vielleicht sind wir morgen tot.«
Ich hatte ihn gerne, auf eine bedingungslose Art, und vielleicht empfand er dasselbe für mich, ich würde es durch Fragen nicht herausfinden. Ich misstraute den Worten. Und erfreute mich umso mehr daran, dass der Mann erschrak, wenn ich stolperte, dass er sofort aus seiner Lethargie erwachte, wenn mich scheinbar etwas bedrohte, und dass er mich trug, wenn ich müde war. Ich war alt genug zu wissen, dass es Glück ist, einen zu treffen, den man so gern hat, dass er einen nie stört.
Ich hatte zu viele befremdliche, kurze Liebesgeschichten hinter mir, und ich wusste, dass es sehr selten war, dass sich zwei mit der gleichen Müdigkeit und dem Wunsch, nicht allein zu sterben, erkannten.
Sicher konnte man es Resignation nennen, nicht mehr auf ein Wunder zu warten, doch für mich hatte Hoffen immer Ohnmacht bedeutet.
Draußen ging ein kleiner Regen; in eiskalten Fäden verschleierte er den Blick auf das Nachbarhaus, aus dem die Insekten verschwunden waren, die Lichter gelöscht, der Rauch verstummt. Ich ging nochmals zu Bett, einfach weil ich es konnte und weil da dieser Mann war, der mein Zubettgehen nicht allzu verzweifelt erscheinen ließ. Wir sollten verreisen, dachte ich, als ich auf den Bauch des Mannes kletterte, der wie ein Mittelgebirge war, um mich daraufzulegen. Verreisen. Und das war ganz sicher der dümmste Gedanke, den ich in meinem ganzen Leben gehabt habe. Damals im Winter, an diesem Morgen, der immer noch besser war als alles, was folgen sollte.
Heute. Nacht.
Es wird nie vollkommen dunkel im Raum, der Mond, die Laternen, die Läden machen das, die Luft ist immer ein wenig klamm und feucht, Reizklima, das Meer liegt zehn Meter von meinem Bett entfernt, ein schwarzes Loch, das sich ständig bemerkbar machen muss, mit Wellen und Wispern und Rauschen. Die Nacht ist mir noch mehr Feind als der Tag. Keine Rituale, keine Ruhe, nichts außer der halben Dunkelheit und den Geräuschen. Und ich, die ich mich zwinge, nach unten zu gelangen, wo die Ohnmacht wartet.
Ich schlafe jede Nacht, ohne es zu wollen, denn es scheint mir Verrat und verlogene Normalität in einer Kriegssituation, ich schlafe, ohne die REM-Phase zu betreten, mich beobachtend, wie ich liege und warte, und ich verabscheue mich dabei. Ich habe den Sieg des Körpers akzeptiert und packe ihn nun bei Nacht in das Bett, das zu klein für zwei Personen war, das zu groß ist für mich allein.
Seine Seite befindet sich noch, wie er sie verlassen hat, das Kissen mit einer Mulde, in der sein großer Kopf gelegen hatte, das Laken zerknittert.
Ordnung machen würde bedeuten, dass ich akzeptiere.
In den ersten Wochen hielt mich das Adrenalin wach, ich saß und starrte in die Nacht, bis es hell wurde, lief zur ersten Fähre, an den Häusern vorüber, in denen Familien von ihrer Unantastbarkeit träumten. Dann fing ich an, im Stehen einzunicken oder mit offenen Augen.
Nach den ersten Wochen, die in völligem Wahnsinn vergingen – weder hatte ich Kontrolle über meinen Körper, der sich im Schock befand, noch über meine Gedanken –, ist mir nun, als tauchte ich in einem schlammigen See tief nach unten, wo hässliche, nackte Moränen im Schlick weiden. Doch ehe ich mich zu ihnen setzen kann, reißt mich ein Geräusch wieder nach oben; ein Husten von der Straße, eine Welle, die an einer Ratte anschlägt, lässt mich auffahren. Dann beginnt alles von vorn. Die Augen zu, die Glieder entspannt, den Atem beobachten, die Gedanken verjagen und mich bewegen, auf die Seite, auf den Rücken, auf den Bauch, und die Hand auf die leere Seite des Bettes schieben, und da liegt sie und wartet auf ein Wunder, auf etwas anderes als den kalten Wind, der durch das Fenster dringt.
Ehe alles begann. Damals. Vor vier Jahren.
Mit weichen Socken glitt ich über das Parkett meiner Wohnung. Es war ein Wochenende mit schlechtem Wetter, was mir wenig bedeutete, denn es bestand keine Notwendigkeit, das Haus zu verlassen. Auf der Straße schwammen Menschen, die mich nichts angingen mit ihren Geschichten, durch den Regen.
Natürlich mochte ich die, die nicht ich waren, nur selten. Machten sie mir doch allein durch ihre Anwesenheit klar, dass ich nicht einzigartig war. Dass ich älter werden würde, schlaff, verrottet, vergessen. Bei jedem, der behauptete, Menschen zu lieben, vermutete ich einen Geistesdefekt, und der machte mir Angst. Wie ihre Stimmen tiefer wurden, wenn sie sagten: »Ich liebe meine Freunde und meine Familie und täte alles für sie.« Ihre überwältigende Liebe sehen wir täglich, sie liegt am Boden, mit einer Axt im Schädel, sie zerren sich gegenseitig vor Gericht, bestehlen sich, es genügt ein falscher Satz der Freunde, die einem so nahe sind, und man merkt, man hat mit keinem etwas gemein.
Ich misstraute der Liebe zutiefst. Ein Marketinginstrument, um Waschmittel zu verkaufen. Ich war, wie die meisten meiner Generation, mit nur einem Elternteil aufgewachsen, das auch bei mir weiblich war, und hatte darum keine Erfahrung mit Männern, sie blieben mir immer unvertraut und leere Projektionsfläche für kitschige Ideen.
Meine Versuche, Teil eines Paares zu werden, waren theoretisch geblieben und endeten ausschließlich mit dem Gefühl, allein unter Straßenlaternen gestanden und die Wohnungen junger Männer beobachtet zu haben, in denen sie mit jungen Frauen unbeschwert lachten. Über mich. Und über die anderen meines Alters, die sich die Freiheit gestatteten, Partner vornehmlich nach ihrem Aussehen zu wählen.
Wir wollten Knaben um uns wissen, denn wir langweilten uns mit Männern unseres Jahrgangs, deren ermüdendes Inneres sich in ihrem Äußeren manifestiert hatte. Wenige waren traurige Hippies geblieben, die anderen hatten sich zu etwas Grauem geformt, das schlechte Anzüge trug und zu laut telefonierte, allzu sehr die Angst vor dem Verfall ausdünstend, der nicht aufzuhalten war, den sie ahnten und gegen den sie anschrien, hatten sie doch immer nur nach oben gewollt und nie einen anderen Plan besessen.
Außer tiefer Verzweiflung gab es keinen Grund, mit einem dieser Männer sein Leben zu verbringen; das war letztes Jahrhundert, der schweigsame, rechtschaffene Vater, der sich zu Hause die Schuhe bringen lässt und eine Zigarre raucht. In dieser geflammten Holzverkleidung mochten wir uns nicht bewegen, doch die Jungen machten uns auch nicht glücklich.
Ich hatte, wie die meisten, die mich umgaben, kein Gefühl für mein Alter. Weil ich früher attraktiv gewesen war, hatte ich das unbestimmte Gefühl, dass mir etwas Besonderes zustünde. Und wenn es schon keinen außergewöhnlichen Partner gab, wobei mir nicht klar war, wodurch sich dieser auszeichnen würde, sollte es zumindest ein schöner sein. Also ging ich auf die Jagd, ohne zu überlegen, was ich mit den Beutestücken machen sollte, die dann, den meist nicht überragenden Verstand von Rauschgift vernebelt, in meiner großbürgerlichen Wohnung lagen. Je älter wir wurden, wir mutigen Frauen, umso verzweifelter wurden die Abenteuer, die wir hatten. Der Traum, sich jüngere Männer zu halten, scheiterte an der banalen biologischen Veranlagung des Mannes, der sich fortpflanzen wollte, und zwar mit jungen, gesunden Frauen mit breitem Becken und straffer Brust. Das Einzige, was Männer mehr schätzten als sehr junge Partnerinnen, waren sehr reiche Frauen, denn ihre Faulheit war noch stärker als ihr Drang nach repräsentativen Trophäen.
Hatte man beides nicht zu bieten, ließen sie sich wohl für eine Nacht verführen und zeigten darauf ihr Desinteresse in unentschlossener Art. Männer sind keine Meister der Zivilcourage, und ich hatte oft den Eindruck, sie würden es bevorzugen, eine ältere Frau, mit der sie ohne Nachdenken eine Beziehung begonnen hatten, stürbe möglichst unauffällig, denn dann könnten sie sich trösten lassen. Es gäbe ihnen etwas Interessantes, wenn sie sagen könnten: »Meine große Liebe ist bei Gott.«
Monate hatte ich damit verbracht, mir Gedanken über junge Männer zu machen. Ihnen Zeit zu geben, Verständnis zu zeigen, zu leiden, mich ungeliebt zu fühlen, hässlich und gedemütigt.
Ich hatte gesessen und gewartet, bis die jungen Freunde des Mannes, den ich erwählt hatte, nach langen Nächten voller Bier und Marihuana endlich gegangen waren, hatte mich mit dem jungen Mann in ein schmutziges Bett gelegt, um ihn für mich zu gewinnen, und hatte seinen schweren, nach Alkohol riechenden Kopf auf meinem Leib liegen lassen, nicht schlafen könnend unter dem Gewicht. Ich hatte neben DJ-Pulten gelehnt, neben dem jungen Mann, der dort schlechte Platten auflegte, und hatte mich von jungen Mädchen fragen lassen, ob er mein Sohn sei. Ich hatte auf Vernissagen gestanden, wo der junge Mann Kunst ausstellte und mit Kunststudentinnen flirtete, während ich am Rande stand und tat, als ob mir das alles nichts ausmachte. Ich hatte junge Männer nach Überdosen Drogen und Alkohol von Partys aufgelesen, sie hatten es gerade noch geschafft, mich anzurufen, ehe sie kollabierten, ich hatte sie gereinigt ins Bett gelegt, um am neuen Morgen von ihnen ignoriert zu werden. Ich hatte junge Männer getröstet, die unglücklich in Models verliebt waren, und manche hatten mich auch mit deren Namen angesprochen. Ich hatte mich so behandeln lassen, wie ich meinte, dass es mir zustünde, weil ich nicht mehr makellos war. Ich hatte die Fähigkeit verloren, mich selber amüsant zu finden. Und das nur, weil ich nicht wusste, was mir guttat, weil mir noch nie ein anderer Mensch gutgetan hatte.
Heute. Nacht. Fast Morgen.
Im Schlaf weinen. Und durch Nebel spüren, dass man weint. Und ahnen, dass es kein gutes Erwachen geben wird. Und wissen, dass es kein Albtraum ist. Nicht munter werden wollen, vom eigenen Schluchzen, das zu laut ist, in einem Raum, in dem man sich zu alleine aufhält.
Und geträumt habe ich wieder von ihm. Er war da, neben mir, und es fehlte nichts, weil ich nicht mehr brauchte, als ihn zu halten und atmen zu hören, seine Hand zu fühlen, die sich um meine schloss, manchmal im Schlaf mein Gesicht streichelte oder mich zudeckte, ohne Beifall zu erwarten.
Bald ist die Nacht vorbei, und vor mir liegt ein unendlicher Tag, der sein wird wie lebendig unter der Erde liegen, sich nicht bewegen können, keine Glocke da, um auf sich aufmerksam zu machen, wie in Poes Geschichten, nur starr in der Kälte begraben sein.
Warum will es atmen, pumpt es Sauerstoff in dieses System, das keinen Schritt mehr tun will, zur Arterhaltung nicht mehr imstande, zu großen wissenschaftlichen Leistungen nicht gemacht. Weiterträumen, nichts will ich mehr, als dass er wieder anwesend ist, und sei es auch nur im Schlaf.
Geschlafen wird nicht, gar geträumt. Nur gelegen und gefroren und solche Angst vor dem Erwachen.
Der unangenehmste Moment des Tages – wenn das Liegen zu schmerzen beginnt, weil Nervosität die Glieder zucken macht, und wieder nicht gestorben sein, über Nacht, keine Feuerwalze hat die Insel ergriffen, keine Springflut. Hell ist es und zu laut, als dass ich mich weiter tot stellen könnte.
Es war eingetreten, was ich am meisten befürchtet hatte. Beine ab. Er war noch so jung. Ein Laster ins Haus. Krebs in der Lunge. Ein Flugzeugabsturz, die unendlich langen Minuten bis zum Aufprall.
Es gibt kein Anrecht auf irgendetwas. Willkür, Biologie und Zufall bestimmen den Verlauf eines Lebens, ich habe mir umsonst schöne Momente verdorben durch den Gedanken an ihre Vergänglichkeit. Und bereits in den Zeiten meiner Angst vor der Angst ahnte ich, dass ich zu feige wäre, im entsprechenden Moment Hand an mich zu legen. Ich betrachte meine Hand. Nichts, vor dem man sich mit großem Respekt verneigen sollte.
Ich hatte nie verstanden, was schwierig daran sein sollte, an nichts zu denken, konnte ich doch früher stundenlang der Leere in meinem Kopf lauschen, frei von jedem Bild, das da hätte auftauchen können. Jetzt wird mir klar, dass meine scheinbar angeborene Gabe zur Kontemplation nur freundliche, zufällige Leere gewesen war und ein ausuferndes Desinteresse, mich oder etwas außerhalb von mir zu erforschen.
Ich weiß nicht, wie ich es vermeiden kann, zu denken, wie ich Bilder abwehren soll, außer mich zu bewegen, mit der Präzision eines technischen Geräts. Unmöglich ist es, im Liegen Gedanken zu vermeiden, wenn das Bett zu schwimmen beginnt, das Zimmer schwankt, das Haus bebt und sich die Welt vor dem Fenster rasend schnell entfernt.
Mein Selbstmitleid könnte mir peinlich sein, aber wer soll denn Mitleid mit mir haben, hier am anderen Ende der Welt, wo mich noch nicht einmal eine Kioskfrau verstünde; selbst wenn sie es wollte, verstünde sie mich nicht, ich gehöre nicht zu ihrer Rasse, ich bin kein Kind, ich bin nicht niedlich, warum soll man so jemanden streicheln.
Waschen, anziehen, die Sachen riechen noch nicht, ich hoffe, sie riechen nicht, Sonderaktionen wie das Reinigen meiner Kleidung haben keinen Platz in meinem organisierten Tagesablauf.
Ich wünschte, ich hätte ein Tier. Ich könnte es verhungern lassen, es würde zu mir sprechen, kurz vor seinem Tod: »Warum hast du mich benutzt, nur um mich sterben zu sehen?« würde er fragen, der kleine Beagle, und traurig schauen, und ich würde erwidern: »Tut mir leid, es ist nichts Persönliches, ich wollte nur wissen, um was ich trauere.« Dann würde er noch einmal kurz schnaufen, und ich könnte ihm am Strand ein Grab bereiten.
Ich habe keine Ahnung, was in der Welt gerade passiert. Vielleicht herrscht vor der Tür eine Choleraepidemie oder Europa wurde mit einem Atombombenteppich bedeckt, Rückzug ins Private nennt man das. Ich könnte beginnen, eine Heimatgeschichte zu schreiben oder einen Familienroman, aber da ist keine Familie, keine Heimat.
Jeden Morgen um sechs stehe ich auf. Ich wasche mich ohne jede Aufmerksamkeit.
Es gibt nichts, was mich an meiner Person interessiert. Ich bin sauber, mehr kann keiner erwarten.
Ich gehe nicht mehr jede Stunde zur ankommenden Fähre, schaue nicht mehr in chinesische Gesichter, ein paar Weiße, bei jedem hellen Fleck geht das Herz schneller, pumpt das Blut in den Kopf, die Venen dick, sie könnten platzen, platzt doch endlich, sondern ich verlasse die Wohnung, die steile Treppe hinab, nehme das Meer nicht wahr, es ist da wie der Himmel, und laufe dem Strom der Angestellten entgegen, die auf die Fähre wollen, sie wollen wenigstens irgendetwas, auch wenn sie es sich in den seltensten Fällen selbst ausgesucht haben. Ich nehme niemanden wahr. Keiner sieht mich, keiner interessiert sich für mich, man weicht mir aus, und das ist das Höchstmaß an Kontakt, das ich mir vorstellen kann.
Damals. Vor vier Jahren.
Ich lag auf einer Matratze, von der Straße her erhellte das Licht einer Laterne den Raum, in dem sich benutzte Kleidung zu Haufen schichtete, Verstärker unbegreiflich hintereinander standen, als wollten sie in den Krieg ziehen, und zwar gegen mich, zusammen mit der Artillerie, den Aschenbechern, die überall im Raum lauerten, die ich nur riechen konnte.
Neben mir ein Körper, den ich auf gar keinen Fall berühren mochte.
Mich in Anwesenheit anderer zu entspannen war mir beinahe unmöglich. Vielleicht lebte ich bereits zu lange ohne eine Person, zu der ich mich hätte reden hören können.
Da war ein Mensch, er war zu nah, er ließ mich die Geräusche, die meine Organe erzeugten, unangenehm laut wahrnehmen. Dieses Geatme und die Luft, wie sie fast obszön in meinen Körper floss, das unattraktive Innere durchblutete.
Eine wenig erfreuliche Situation, die nicht besser wurde, als der Mann sich aufstützte, mich mit einem Blick, dem jede Zuneigung fehlte, ansah und sagte: »Ich habe lange nachgedacht.«
Wie das ausgesehen haben sollte, vermochte ich mir nicht vorzustellen, denn Denken war keine herausragende Fähigkeit des jungen Mannes.
»Ich schaffe es nicht. Jede kleine Verbindlichkeit lässt mich die Deckung hochnehmen. Das macht mich traurig, das steuere ich nicht mit dem Kopf. Das liegt nicht an dir – wie du bist. Ich würde so gerne, du Großartige, nur reicht es irgendwie nicht – ich bin nicht frei für dich. Da ist so ein Besetztzeichen in mir.«
Warum musste es denn so albern sein, wenn sie denn schon einmal redeten? Vielleicht würde ich irgendwann über all die völlig unzureichend intelligenten Sätze, die ich von in die Ecke gedrängten Männern im Verlaufe der Jahre hatte hören müssen, lachen können, dachte ich und wartete, welche uninteressanten Informationen ich noch erhalten würde.
Ich wusste bereits seit Monaten, dass der junge Mann auf eine Gelegenheit hoffte, mir mitzuteilen, dass er mich nicht mehr sehen wollte. Nachdem er sich ein paar Wochen eingeredet hatte, dass eine unverbindliche körperliche Beziehung genau das war, was er suchte, hatte er irgendwann gemerkt, dass unsere Treffen nicht so unbeschwert waren, wie er es sich vorgestellt hatte. Er fühlte sich unklar unter Druck gesetzt, es gebrach ihm an geistiger Kapazität, dem Gefühl nachzugehen und es zu erforschen, und so wollte er nur noch weg. Nicht mehr vorhanden sein, und zwar ausschließlich für mich.
Doch das sagte er nicht, er wand sich weiter, und ich ließ ihn sich winden, eine winzige Genugtuung, da es nicht in meiner Macht stand, ihn anderweitig leiden zu machen. »Wir können unsere Beziehung nicht in dieser Form weiterführen, das wäre nicht fair. Ich merke doch, dass es dir nicht gutgeht. Und ich werde mich nie in dich verlieben können.«
Aber das musst du doch gar nicht, hatte ich erwidert, ganz starr vor Peinlichkeit. Natürlich hätte er müssen, denn wie so viele Frauen vermochte ich nur unzulänglich zwischen Geschlechtlichem und Liebe zu unterscheiden.
Ich lag auf einer Matratze in einem unaufgeräumten Knabenzimmer und war ratlos, weil ich nicht wusste, wie ich elegant aus diesem Raum verschwinden konnte. Der Junge blickte zur Decke, als gälte es dort interessante Erscheinungen festzumachen. Er hatte einen braunen Körper mit hervortretenden Sehnen und Muskeln, das Haar fiel ihm lang und schwarz auf die Schultern, und die Leere seiner Augen war nicht zu erkennen. Im Halbdunkel sah er ohne Zweifel gut aus. Ich ahnte in jenem Moment, dass für mich die Zeit, in der ich mich ohne Bezahlung an jungen Männern erfreuen konnte, vorüber war.
Aufgrund der Häufigkeit der Abweisungen, die ich erfahren hatte, war ich zu der Überzeugung gelangt, abstoßend unattraktiv zu sein. Lange war mir die banale Erkenntnis, dass ich für großartige Erfolge auf dem freien Markt der Geschlechter einfach zu alt geworden war, nicht vergönnt, denn das Altern fand so langsam statt, dass es schwerfiel, es wahrzunehmen, wenn das, was verfiel, man selber war.
Im Nachhinein ist mir die Nachlässigkeit unverständlich, mit der ich meiner Wirkung begegnet war. Hätte ich mir doch viele unerfreuliche Erlebnisse ersparen können mit der Gabe, mich so zu sehen, wie es jemandem außerhalb von mir erlaubt war.
»Es ist besser, wenn du jetzt gehst«, sagte der aktuelle junge Mann, »selbstredend«, erwiderte ich, er schaltete das Licht an, das mich wie ein Scheinwerfer ausleuchtete.
Ich hätte gerne etwas zu sagen gewusst, was dem jungen Mann Schmerzen zugefügt hätte, aber es fiel mir nichts ein, es gab nichts, was ihn verletzen konnte, denn er war Mitte dreißig, verfügte über straffes Fleisch, volle Haare und gesunde Zähne und dachte, dass die Welt auf ihn wartete, und vermutlich hatte er damit sogar recht. Ich kleidete mich an, eine ältere Frau, die in ihre Sachen stieg, und vor dem Haus stand ich dann, erstarrt vor Sehnsucht nach etwas, das ich mit dem jungen Mann in der Wohnung verwechselt hatte, und Scham.
Der junge Mann schaltete das Licht aus. Daran tat er gut, er brauchte seinen Schlaf, denn schon morgen konnte die Welt ihn als Star entdecken. Wieder einer, der meinte, er müsse allein aufgrund seiner Anwesenheit belohnt werden. All die jungen Männer, deretwegen ich mich in den letzten fünf Jahren schlecht gefühlt hatte, warteten auf ihre Entdeckung, als Künstler, Schauspieler, Literaten oder Sänger. Was jener dort, der in der Wohnung, zu der ich hinaufschaute, werden wollte, wusste ich nicht. Ich hatte ihn nie etwas gefragt, wusste weder von seiner Kindheit noch von seinen Träumen, denn ich ahnte, dass es Informationen waren, die ich schon zu oft erhalten hatte. Alle diese jungen Männer entstammten der unteren Mittelschicht, kamen aus unattraktiven Städten, das Verhältnis zu ihren Eltern war nach der Trotzphase ausnehmend gut, doch richtig verstanden sie den Sohn nie, der ausgezogen war, sein kreatives Potential auszuleben.
So wenig, wie sie mich zu überraschen vermochten, wusste ich mit etwas aufzuwarten, was einen jungen Mann interessieren konnte. Ich war weder reich, noch verfügte ich über blendende Kontakte zu irgendwem, mein Aussehen war ein schwaches Zitat früherer Attraktivität, und besonders unterhaltsam war ich auch nicht. Nicht für junge Männer, die in Bars herumlungerten und mit Ende dreißig in die Midlife-Krise kamen, weil ihre Schönheit verschwamm und der Erfolg sich nicht eingestellt hatte. Es war mir keine Genugtuung, dass ich bereits die Zukunft der Jungen kannte, die in wenigen Jahren Tränensäcke und Bauchansätze haben, nach zu viel Bier und Zigaretten riechen würden, einer fragwürdig werdenden Jugendkultur nachhängend. Im Moment war ich alleine und wollte es nicht mehr bleiben. Ich wollte bei jemandem liegen, der nicht am nächsten Morgen verschwand, ich wollte keine albernen Anstrengungen mehr leisten, um jung zu wirken, was ohne Zweifel ein erfolgloses Unterfangen bleiben würde. Ich wollte mich ausruhen, denn die Jahre alleine waren anstrengend gewesen. Sich täglich von der Wichtigkeit, das Bett zu verlassen, überzeugen zu müssen, machte müde. Ein Sturm hatte sich entwickelt in der feuchten Luft, Wolken jagten am Mond vorüber, die Laternen hatten gelbe Kreise um ihr Licht gezogen. Ich wollte heim.
Heute. Morgen.
Ich setze mich an den einen Tisch, der sich vor dem Café befindet, das von einem jungen Chinesen geführt wird und das ich jeden Morgen aufsuche, immer in Sorge, ich könnte bereits am Tisch sitzen, wenn ich das Café erreiche.
Der Chinese heißt Jack, der englische Name von den Eltern als eine Art Beschwörung gewählt, ein guter Chinese in der Verpackung der ehemaligen Unterdrücker, die das Land hatten reich werden lassen. Jack ist ein fleißiger Chinese geworden, der zwanzig Stunden am Tag arbeitet und vermutlich jetzt schon so viel Geld hat, dass er nie mehr arbeiten müsste, wäre da nicht die Gier des Menschen nach mehr. Jack bäckt Muffins und all diese aufgeblähten Mehldinger, die man bereits während des Essens als Brei im Magen sieht. Er stellt einen Kaffee und irgendein Gebäckstück vor mich hin, jeden Tag dasselbe, ich weiß nicht, warum er vermutet, dass ich diese Art von Frühstück bevorzuge. Wir haben das Thema nie besprochen. Wir haben noch nie etwas besprochen, was über die Wetteranalyse hinausgehen würde. Manchmal würde ich gerne wissen, warum Jack auf mich so befremdlich traurig wirkt. Aber ich wage nie, ihn anzusprechen, vermutlich interessiert es mich auch zu wenig.
Ich esse, weil verhungern zu lange dauern würde, ich habe darüber gelesen. Ich esse, weil etwas vor mir steht. Wenn nur das Schlucken nicht so mühsam wäre und das Starren dabei. Die kleinen Gassen der Insel, es sind ungefähr zehn, sind zu keiner Stunde des Tages leer. Immer läuft wer, rennt, hastet irgendwohin, einer Aufgabe hinterher. Eine schöne Sorte Menschen ist das hier, zart und elegant in den Bewegungen, und ich würde gerade mit jedem, der nicht ich ist, mein Leben tauschen. Statt meiner säße dann eine chinesische Angestellte der Kultur- und Bildungsabteilung vor Jacks Café, und ich ginge an ihrer Stelle in das Museum für Naturkunde in Hongkong. Ich käme eine Stunde vor Öffnung des Museums, das mir zu dieser Zeit am angenehmsten wäre, mit seinem Geruch aus Formaldehyd und Linoleumpflegemittel. Meine kleinen praktischen Schuhe quietschten auf dem sauberen Boden, wenn ich an interessanten Präparaten vorbeiginge, kontrollierend, ob sich keines der ausgestopften Tiere verabschiedet hatte über Nacht. Meinen Kaffee nähme ich neben meinem Lieblingssaurier ein, danach ginge ich in einen kleinen Raum aus Holz und Glas, der mich immer an eine Telefonzelle erinnern würde und in dem die Kasse stünde. Bis Mittag käme nur ein Rentner, er würde immer vor dem Skelett eines Tieres sitzen und weinen. Mittags dann Schulklassen, die ich mit liebevollem Argwohn beobachten würde, sie versuchten stets Knöchlein zu stehlen und wischten mit ihren fettigen Händen an den Glasvitrinen herum. Der Tag würde langsam vergehen, unter Ausschluss des Lichtes. Am Abend würde ich meinen Saurier einpacken und mit der Fähre nach Hause fahren, wo meine neunundneunzigjährige Mutter auf mich wartete.
Ich bin für einen Moment so glücklich in meinem ausgedachten Leben, dass es mir sehr widerstrebt, zurückzukehren. Und mich sitzen zu sehen als etwas, das keiner will.
»Lenk dich ab, geh ins Kino, geh mit Freunden aus, trink was, mach einen Volkshochschulkurs, lass dir die Haare abschneiden, unternimm doch mal eine Reise.« Der letzte Vorschlag war der verwegenste, und ihn hatte ein Bekannter am Telefon geäußert, vor Tagen, als ich dachte, mit Bekannten in der alten Welt zu reden brächte mir eine Erleichterung.
Ich hatte doch eine Reise unternommen. Mit mäßigem Erfolg. Ich sitze auf einer Insel im Südchinesischen Meer. Wohin soll ich da noch fahren, wenn es sonst überall ist wie irgendwo auf Feuerland, im Dauerregen.
Ich sitze mit dem Kaffee, der noch nicht einmal kalt wird, denn er war es schon vorher, und schaue auf das gegenüberliegende Haus. Studiere den Verfall der Regenrinne. Für etwa drei Stunden.
Damals. Vor vier Jahren.
Zu Hause war mir selten unwohl. Verspannt wurde ich allein, wenn ich auf die Straße musste oder wenn ich auf irgendeine Weise Kontakt mit dem gesunden Menschenverstand hatte.
Dass ich irgendwann eine so schlechte Meinung von der eigenen Rasse haben würde, überraschte mich, ich war davon ausgegangen, dass man gütiger würde, im Alter. Als junger Mensch hatte ich mich noch über Tierschützer erregt, verstand nicht, warum man seine Energie nicht dazu verwendete, Menschen zu retten, heute wusste ich es besser.
Es gab wohl nur wenige Tiere, die so von der Brillanz ihrer Meinung überzeugt waren wie der Mensch und die mit solcher Vehemenz ihre Dummheit verteidigten.
Die Menschen hatten ihre niedlichen Momente, doch das täuschte nicht darüber hinweg, dass die meisten von überwältigender Einfalt und Niedertracht waren. An mir konnte ich beobachten, wie überaus schnell der Wunsch entstehen konnte, andere mit Einkaufswagen zu rammen. Nach Momenten sinnloser Wut hatte ich jedoch immer noch Sekunden, in denen mir klar war, dass andere denselben Impuls bekamen, wenn sie meine Fesseln sahen: Wir mochten uns nicht besonders. Jeder fühlte sich dem anderen überlegen, und daraus bildete sich ein Dauerton der Aggression, der den Menschen wie ein Tinnitus im Ohr klang. Permanent.
Der Tag war mir vom Morgen an verleidet, denn ich hatte eine Verabredung. Außer zwei, drei ehemaligen Freunden, die über die große persönliche Freiheit verfügten, sich nicht wichtig zu nehmen, forderte mich seit geraumer Zeit keiner mehr zu Aktivitäten auf. Ich hatte zu oft abgesagt.
Doch auch die wenigen, die sich noch meldeten, setzten mir unangenehm zu. In monatlichen Abständen drangen sie über das Telefon in meine behagliche Wohnung, da standen ihre virtuellen Leiber, vorwurfsvoll die Augenbrauen nach oben gezogen, mit spitzen Mündern, und setzten mich unter Druck, indem sie keine Lügen akzeptierten. Andere bloßzustellen, die sich mit gepflegten Unwahrheiten aus den Sackgassen unseres Miteinanders wanden, war immer ein Zeichen miserabler Manieren. »Ach komm schon, du arbeitest doch abends nie«, intervenierten die Freunde, und ich wurde rot vor Scham, denn ich war ein schlechter Lügner. Ich hasste sie dafür, dass sie mich in die unerfreuliche Lage brachten, ihnen entweder zu erwidern: »Was ich euch schon immer einmal sagen wollte: Höre ich euch nur Guten Tag sagen, falle ich um vor bodenloser Müdigkeit. Ich habe zu viele eurer nahezu identischen Lebensläufe gesehen, und ohne sie werten zu wollen, langweilen sie mich tödlich. Ihr lest keine Bücher, ihr macht keine merkwürdigen Forschungen, von denen ihr mir berichten könntet, und ganz im Vertrauen: es interessiert mich nicht, zu hören, was ihr in den Nachrichten gesehen habt.« Oder eben doch hinzugehen, um einen Affront zu vermeiden.
Mein Tag war vergiftet von dieser Entscheidung, und das Alleinsein, das ich eigentlich hätte genießen können, war nur mehr Warten auf einen Zug, gefüllt mit einer Karnevalsgesellschaft, die ich bei mir beherbergen musste, vierzehn Tage lang.
Jeder ist so erstaunlich individuell, wurde uns in jungen Jahren erzählt, um uns vom Selbstmord abzuhalten. Auch so eine Unsitte. Menschen ihrer letzten Freiheit berauben. Selbstmordversuch und ab in die geschlossene Abteilung, gefesselt und überwacht, egal wie alt man ist, ohne Rücksichtnahme, ob einer seine evolutionäre Pflicht schon erfüllt hat oder nicht. Gelebt muss werden, da könnte ja sonst jeder kommen. Die Steuern, die Armee, der Nachwuchs, die Evolution. Dieses kollektive Zusammenzucken, wenn vom freiwilligen Abschied die Rede war, hätte man nicht das Gespräch suchen können, therapieren können, den Unglücklichen abhalten, ihn zwingen, die achtzig Jahre abzusitzen?
Da der Tag ohnehin verdorben war, ging ich zu den Freunden, die mich trotz meines Widerstands eingeladen hatten.
Ich schnallte mir meine beiden Prothesen an und überlegte, wie ein Mensch mit vier Gliedmaßenprothesen die wohl anlegen wollte. Der Abend war dunstig, und die Freunde lebten in einem Haus, das man spätestens in dreißig Jahren zu Recht abreißen würde. Im Moment verkörperte es das, was der Mensch unter modernem Wohnen verstand. Sichtbeton und quadratische Balkone. Innen gab es immer eine graue Küche, in der die Gastgeber standen und Wein tranken, wobei sie sich mit Tiernamen ansprachen, was vielen schon als ausreichender Grund erschienen wäre, mit beiden nicht mehr zu verkehren, für mich jedoch war es das Einzige, was mich den Abend überleben ließ.
Was mich wirklich aus der Fassung brachte, war, dass in ihrem Schlafzimmer ein riesiger Schrank mit verspiegelten Türen genau dem Bett gegenüber stand und ein weiterer Spiegel an der Decke hing.
Der Weg durch das Schlafzimmer war der einzige, um ins Badezimmer zu gelangen, das ich während der Abende mit dem Paar alle halbe Stunde aufsuchte, um mich mit kaltem Wasser vom Einschlafen abzuhalten. Ich möchte nicht wissen, wie fremde Menschen schlafen oder gar miteinander geschlechtlich werden und sich dabei in Spiegeln beobachten. Jeder Hausbesuch bringt ungewollte Bilder mit sich. Die Toilette, was da in den Schränken steht, die Fieberthermometer, das Toilettenpapier, die Küche mit Knoblauchgeruch, Fußmatten vor dem Bett, Hausschuhe mit durchgetretener Sohle – ich will das alles nicht erfahren, ich will niemanden an meinem Leben dergestalt teilhaben lassen, und auch im umgekehrten Fall weiß ich nicht, was ich mit derlei Informationen anfangen soll. Es verstörte mich, mit dem Paar, das gutgeputzten Mäusen glich, am Tisch zu sitzen, kleine Gurken zu essen und immer zu denken: der Spiegel. Was machen sie mit diesem Spiegel? Gegen weitergehende Gedanken war ich machtlos.
Ich sah ständig meterhohe Wassermassen, die über Häusern auftauchen, große Greifvögel mit Babys in den Krallen, die sie aus Kinderwagen entwendet hatten, oder kleine Menschenvölker, die in Ritzen zwischen Dielen leben. Ein Gehirndefekt vermutlich, dem ich hilflos ausgeliefert war.
Wir saßen an einem Esstisch aus poliertem Material, überall standen kleine Kommoden mit grotesk grünen Vasen, und es gab eine sehr große weiße Couchgarnitur, die wie ein grimmiger Albino-Elefant den Raum beherrschte; alles sah aus, wie wenig phantasiebegabte Kinder sich eine Erwachsenenwohnung einrichten würden. Menschen, selbst freundlich gesinnte, in seine Wohnung einzuladen ist ein sadistischer Akt. Vermeintlich ohne nachzudenken, aus reiner Zeigefreudigkeit, werden Fremde in Höhlen geschleppt und alles vorgewiesen, was einer im Laufe der Jahre gesammelt hat. Auf mich hat es stets die Wirkung, als müsste ich meinen Eltern bei einer Unterwäschemodenschau beiwohnen.
Das Paar redete wenig, worüber auch, vermutlich erfolgten ihre reflexartigen Einladungen ausschließlich aus Sentimentalität, eine gefälschte Erinnerungsmatrix gaukelte ihnen vor, dass wir vor zwanzig Jahren wunderbare Momente geteilt hatten, und die galt es wiederherzustellen.
Sie hatten ausnehmend neutral schmeckende Speisen zubereitet, und ich wurde mit jedem Bissen, den ich nahm, ein Stück tiefer in meinen Körper gezogen, an einen Ort, an dem ein Brunnen auf einer Lichtung stand und eine alte Frau mit einem Spinnrad saß und mit dem Kopf wackelte.
Ich hörte, vom Moos gedämpft, die Stimmen des Paares und war unterdes mit der alten Frau ins Gespräch gekommen, die mir erzählte, dass sie ihren Enkelkindern bei Magenweh immer Magenbitter auf Zucker träufelte. Dass aber die Enkelkinder vor fünfzehn Jahren gestorben waren.
Das Paar am Tisch war von mir unbemerkt zu Bett gegangen. Ich erhob mich, stellte meinen Teller in ihre Küche und machte mich auf den Heimweg durch eine angenehm diesige Nacht. Und als ob mein Bedarf an Gesellschaft nicht auf Wochen gedeckt gewesen wäre, saß auf den Stufen zu meinem Haus die seltsame Bekannte.
Heute. Nach dem Frühstück.
Asiaten fließen an mir vorbei wie leiser Regen. Die Ausländer sind gegen neun auf die Fähre verschwunden. Wie Kinder, in Uniformen gezwängt von hektischen Eltern, viel zu früh. Die Gesichter blass, die Uniformen kratzen, sie müssen aus einem Kinderschlafgesicht ein Erwachsenengesicht machen. Nicht zu spät kommen, nur nicht zu spät kommen. Solche Angst vor dem Zuspätkommen, dem Nichtgenügen, dem Ausgetauschtwerden. Von wem nur. Manche haben vielleicht noch einen Chef – lebendig, jung, dynamisch. Ein Idiot in jedem Fall. Oder einfach ein Vorgesetzter. Jung, dynamisch. Ein Idiot. Ein Alphatier. Aber mit Führungsqualität. Solche Angst. Sie lassen sich ausbeuten, und sie würden es doch nie so nennen. Ich arbeite gerne, würden sie sagen, was auch sonst. Es können ja nicht alle selbständig sein, Künstler oder Penner, einer muss ja arbeiten. Früher nannte man das Klassenkampf. Die da oben, die da unten. Heute nennt man es Angestelltenverhältnis, und keiner wundert sich. Den Tag verkaufen, eine Stunde Mittagspause, aber bitte nicht überziehen, nicht auffallen, sich ducken. Nach Dienstschluss in eine Bar. Den Stress wegsaufen. Trinken sollt ihr. Trinken, Freunde, um zu vergessen, was da passiert, mit euch und eurem Leben, aber wenigstens passiert etwas.
Nach meinem Kaffee, den drei Stunden Starren, gehe ich jeden Tag die gleiche Strecke über die Insel. Der Weg durch den Dschungel ist aus Betonquadern, sie erinnern mich an