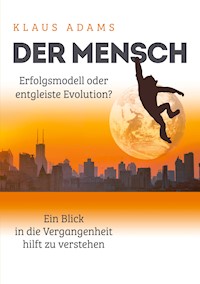
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Was hat den Menschen auf diesen Pfad geführt, wo wird er noch hinsteuern und welchen Einfluss hat China als neue Weltmacht dabei? Klaus Adams gibt in seinem Buch spannende und wissenswerte Einblicke in die Geschichte der Entstehung der Erde, Menschheitsentwicklung und der Ausbreitung des Homo sapiens über die Welt in all ihren Facetten. Historisch, geografisch und politisch erörtert er im Kontext der Weltgeschichte aktuelle Probleme und Konflikte der Welt und wirft dabei immer wieder einen Blick nach Asien. Gespickt mit eigenen Erfahrungen gibt er dem Leser wertvolle Denk- und Diskussionsansätze mit auf den Weg und umreißt mit fundiertem Wissen ganz nebenbei die Weltgeschichte. Und wagt am Ende einen Blick in die Zukunft.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 475
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über den Autor
Klaus Adams, Jahrgang 1938, lebt in Köln. Als Jungingenieur sammelt er 1965 in Johannesburg erste Jahre Berufserfahrung auf dem Gebiet Elektrische Energietechnik. Diese Erfahrung beeinflusste sein Leben und seine Liebe zum Export nachhaltig. Es folgten 40 Jahre intensiver Reisetätigkeit und Gründung vieler Vertriebsbüros in Europa, Amerika, Afrika, Singapur und China. Dadurch vertieften sich Erfahrungen und Einblicke in fremde Kulturen und auch in die Probleme unserer Welt. Nach seiner Pensionierung entdeckte er die Welt des Schreibens. Ihm liegt sehr daran, bei den großen Problemen unserer Welt weniger dem Mainstream zu folgen, sondern diese Themen mit eigener Erfahrung zu hinterfragen. Als Autor stören ihn die verzerrten, zielgerichteten Berichterstattungen der großen Machtblöcke und Politiker zu den Themen Klimawandel und Energiekrise, bei denen er als Basis wissenschaftliche Daten vorzieht.
Inhalt
Vorwort
1.
Die Evolution des Homo sapiens
Entstehung des Planeten Erde
Entstehung ersten Lebens
Menschenaffen
Vor 120.000 Jahren: Homo sapiens
Entwicklung zum modernen Menschen
Entwicklung des Kopf-Gehirns
Zeitablauf der Evolution
Homo sapiens wird sesshaft
Abschied aus dem Paradies
Der Mensch und seine Denkorgane
Unser Darm-Gehirn – System 1
Unser Kopf-Gehirn – System 2
Zusammenarbeit von System 1 und 2
Die Steinzeit in uns
Folgen unserer Ernährung
2.
Die weitere Entwicklung des Homo Sapiens
Die gute alte Zeit und der Fortschritt
Die Digitalisierung
Neue Entscheidungen
Die Welt der Arbeit und Familie heute
Die Hausfrau
3.
Entwicklung der Nationen
Geographie
Tier- und Pflanzenwelt
Landwirtschaft
Kolonialisierung und Unterwerfung
Erfindungen, welche die Kolonialisierung ermöglichten
Genozide
Demokratie – Autoritarismus
Schlussbetrachtung
4.
China
Historie
Erfindungen
Unterschiede Europa – China
Berichte in den Medien
China heute
Landflucht warum?
Alibaba
Unterdrückte Minderheiten
Xi Jinping
China in Afrika
China und die USA
Die neue Seidenstraße
Der asiatische Raum in der Zukunft?
Europas Chancen
Die neue Sicht auf Grund der Corona-Krise.
Meine Sicht
5.
Russland
Allgemeines
Der Gulag
Die Taiga
Menschenrechte
Das neue Russland
Der neue Krieg 2022
6.
Die Stärke Europas
Europas Probleme
Frankreich
7.
Afrika
Meine persönlichen Beziehungen
Wanderungen verschiedener Völker in Afrika
Kolonialisierung
Das postkoloniale Afrika
Afrika als Naturparadies
KAZA-Nationalpark
8.
Unsere Kultur und das Internet
Afrika in der Schuldenfalle
Der Informations-Tsunami
Das Internet und die Folgen
Qualitätsjournalismus
Verlust der Debattenkultur
Der Epochenbruch
Ängste
Die große Masse
Die Ungleichheit
9.
Fremde
Wie entstand Fremdenhass?
Rassismus
Terrorismus
10.
Frieden – Eine Illusion?
Kaschmir
Afghanistan
Pakistan
Indien
Iran
Irak
Kurdistan
Syrien
Israel
Schlussbetrachtung
11.
Überbevölkerung
Untergang des Römischen Reichs
Pandemien in der Zukunft.
Was bringt die Zukunft?
12.
Klimawandel
Die Zukunft des Individualverkehrs
Das Artensterben
Der Generationenkonflikt
Künstliche Intelligenz
Pandemien
Der Weltraum
Das Anthropozän
Wachstum der Weltbevölkerung
Was jetzt wichtig ist
Blick in die Zukunft
13.
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Vorwort
Als »Kriegskind«, 1938 geboren, möchte ich einen kurzen Rückblick der vergangenen dreiundachtzig Jahre wagen.
Bei Kriegsende war ich sieben Jahre alt und ich habe noch Erinnerungen an die letzten Jahre. Ich erinnere mich daran, dass in unseren Garten, zwanzig Meter vom Haus entfernt, eine Bombe einschlug, die einen tiefen Krater verursachte. Unvergesslich ist auch das Wohnen im Keller über viele Monate hinweg. Unvergesslich sind auch die zahllosen Fliegeralarme, bei denen wir das Haus verlassen und auf dem Feld in Schützengräben ausharren mussten.
Ich wurde 1945 eingeschult. In dieser Schule hatten wir anderthalb Jahre Unterricht in einem Gebäude ohne Fenster und ohne Heizung. Das kann sich heute niemand mehr vorstellen. In dieser Schule habe ich in den ersten Jahren noch mit einem dünnen Griffel auf eine Schiefertafel geschrieben.
Die Nachkriegsjahre waren in Deutschland ein ständiges positives Aufwärts, Wiederaufbau, alles wurde ständig besser. Im Jahr 1956 habe ich mein Studium als Elektroingenieur abgeschlossen. Und schon damals war mir völlig klar, dass Deutschland ein Exportland werden würde. Und was braucht man, abgesehen von einem abgeschlossen Ingenieursstudium, um in diesem Umfeld Erfolg zu haben: Auslandserfahrung. Die hatte ja logischerweise damals kaum jemand. Und als junger Mensch in diesem Alter überschlagen sich die Ideen und alles muss schnell gehen. Also habe ich 1965 schnell geheiratet und wir sind nach Südafrika ausgewandert mit dem Ziel: Auslandserfahrung.
Dieses Jahr in Südafrika hat mein weiteres Leben entscheidend beeinflusst. Und nach unserer Rückkehr nach Deutschland 1967 auch erfolgreich umgesetzt, und zwar mit rasch wechselnden Arbeitsverhältnissen bei den Firmen Siemens, AEG und ABB. Zunächst noch in Konstruktion und Entwicklung, später dann im Vertrieb von Energieverteilungsanlagen in alle Teile der Welt. Als Abschluss meiner Berufstätigkeit hatte ich das Glück, während meiner letzten 20 Jahre bei einem Mittelstandsunternehmen, der Firma SIBA in Lünen, mit völliger Entscheidungsfreiheit als Gesamt-Vertriebsleiter und Prokurist meine Ideen zu verwirklichen. In diesen 20 Jahren dort habe ich unter anderem neun Vertriebsbüros im Ausland eröffnet. Ein Erlebnis, das insbesondere viel Einfühlungsvermögen in fremde Kulturen erforderte, in zahlreichen Reisen rund um die Welt beruflich, aber auch mit privaten Urlauben, habe ich viel Erfahrung gesammelt, fremde Kulturen und deren Gewohnheiten kennengelernt.
Seit dem Jahr 2002 bin ich pensioniert. Also ist es mir jetzt möglich, mich nach einem engagierten Arbeitsleben mit Dingen zu beschäftigen, zu denen ich vorher keine Zeit gefunden hatte. Abgesehen von vielen Hobbys erinnerte ich mich an die Zeit meiner Berufstätigkeit, in der ich des Öfteren den Wunsch geäußert habe: Wenn ich nochmal auf die Welt komme, möchte ich Philosophie studieren, um zu verstehen, warum Menschen bisweilen so merkwürdige Entscheidungen treffen.
Und so habe ich mich mit Begeisterung in die Welt der Sachbücher vertieft. Sachbücher zu den verschiedensten Themen, meist geopolitischer Art, Klima, Bevölkerung, Philosophie. Parallel dazu interessierte mich mehr und mehr der Mensch, sein Ursprung und seine Evolution.
Da sich unsere Welt mit zunehmender Geschwindigkeit verändert, gibt es heute viele Dinge, die mir nicht gefallen und bei denen ich mich nicht dem Mainstream anschließen möchte. Also hatte ich begonnen, Notizen zu machen und sachbezogen zu Tagesthemen meine eigenen Meinungen zu notieren. Und diese Notizen wurden mehr und mehr, und es entstand dann nach kurzer Zeit die Entscheidung, ein Sachbuch zu schreiben.
Um ein Sachbuch zu schreiben, muss man sich in einer Sache auskennen oder versuchen, sie besser kennenzulernen. Dann lernt man während des Schreibens. So wie eine alte Geschichte erzählt: Ein Student fragt seinen Professor, ob er ihm zu einem bestimmten Thema einen Rat geben könne. Der Professor antwortet: »Davon verstehe ich auch nichts, aber ich schreibe gerade ein Buch darüber. Wenn ich damit fertig bin, sprich mich noch mal an.«
Und so sind natürlich auch in meinem Buch wesentliche Beiträge aus Literatur, Vorträgen, Berichten und Seminaren entstanden. Dazu am Ende meines Buches ein Literaturverzeichnis. Über die Erkenntnisse aus der Literatur hinaus habe ich weitere wertvolle Dinge im Internet gefunden, und zwar möchte ich in diesem Zusammenhang insbesondere auf folgende Beiträge, Vorträge und Symposien zu den verschiedensten Themen hinweisen:
Prof. Dr. Gerd Ganteför, Uni Konstanz. Beiträge zu Energie und Klima
Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Hans Werner Sinn, Uni Luzern: Wirtschaftswissenschaft, Klimapolitik und Elektromobilität
Prof. Dr. Harald Lesch, Uni München: Kosmos, Astrophysik, Klimawandel
Das Symposium 4pi, Uni Konstanz. Klima, Wirtschaft, Energie und Bevölkerung
Vieles, was und wie ich heute denke, ist Teil meiner Identität und Erfahrung. Meine Erfahrungen habe ich bereichert und ergänzt durch Literatur, Symposien, auch viele Gespräche mit ehemaligen Geschäftsleuten, die mich noch heute über die Entwicklungen in der operativen Berufswelt auf dem Laufenden halten. Dies alles hat sich zur Grundlage für mein Buch entwickelt und so spiegelt das Geschriebene immer wieder auch meine Sicht und meine persönlichen Gedanken wider.
Ich hatte oben bereits meinen Wunsch nach einem besseren Verständnis menschlicher Denkensweise angedeutet. Damit habe ich mich intensiv beschäftigt und dies im Kapitel 1, die Evolution des Homo sapiens beschrieben. Die neuesten Erkenntnisse unseres zweiten Gehirns, des »Darm-Gehirns«, haben mein eigenes Denken beeinflusst.
Mit den Erfahrungen aus meiner langjährigen Tätigkeit auf dem chinesischen Markt habe ich den einseitigen Berichten unserer Medien, die sehr tendenziell negative Schlagzeilen machen, widersprochen. Die gebetsmühlenartig geforderte Einhaltung von Demokratie und Menschenrechten ist sicherlich berechtigt, darf aber nicht das einzige Thema sein, das wir mit der kommenden Weltmacht Nr. 1 oder 2 besprechen möchten. Also habe ich hier meine Sicht im Kapitel 4 – China beschrieben.
So, jetzt aber endlich los.
1 Die Evolution des Homo sapiens
Schon seit Langem interessiert mich die Geschichte der Menschheit, unser Ursprung. Woher kommen wir? Die Frage nach unserer Vergangenheit interessiert ja viele, zum Beispiel wenn wir unserer Vorfahren gedenken und einen Stammbaum anlegen. Aber weiter zurück wird es sehr interessant. Wer waren die »ersten Menschen«? Und so gelangt man zum Homo erectus.
Die biblischen Hinweise auf die Schöpfung – die Geschichte, dass der erste Mensch aus einem Klumpen Lehm geformt wurde – waren mir nicht sonderlich vertrauenswürdig. Dass der Mensch vom Affen abstammt, löste in kirchlichen Kreisen natürlich einen Aufschrei aus, schien mir aber irgendwie logischer. Bischöfe bezichtigten damals Darwin der Ketzerei. Die hitzigen Debatten kühlten sich mit der Zeit ab, neue Erkenntnisse aus der Vererbungstheorie, der Chromosomenforschung und der späteren Entschlüsselung der Gene festigten das Konzept der Evolutionstheorie.
So viel zunächst einmal zu unserem biologischen Ursprung. Die natürliche Evolution, Darwins Erklärung des »Survival of the fittest«, ist auch für mich einleuchtend und logisch. Wenn man als Christ die Entstehungsgeschichte des Menschen deuten möchte, bedeutet dies doch nicht die Leugnung göttlicher Schöpfung. Denn immer noch habe ich Hochachtung vor dem »höheren Wesen«, das all diese komplexen Baupläne entworfen hat. Man redet heute viel von »schwarzen Löchern« und dem »Urknall«. Was war denn vor dem Urknall? Darauf hat niemand eine Antwort. Oder: »Unser Universum bewegt sich seit dem Urknall immer weiter auseinander.« Aber wohin bewegt es sich? Was ist das für ein unbekannter Raum, in den sich das Universum hineinbewegt? Da muss doch dieses »höhere Wesen«, das wir Gott nennen, einen Plan gehabt haben, wie alles zusammen in dieser entstehenden unendlichen Weite ablaufen soll. Also gehen wir einmal den neuesten Forschungen nach und versuchen zu ergründen, wo unsere Wurzeln zu finden sind. Ganz am Anfang, noch vor der Existenz der Affen.
Entstehung des Planeten Erde
Der Blaue Planet – das wunderschöne Foto, das beim ersten Flug des Menschen zum Mond entstand, haben wir alle im Kopf. Sieht ja wirklich paradiesisch aus. Und wir wundern uns, dass wir bei allen Forschungen in unserem Universum noch niemals auf einen ähnlichen Planeten mit einer ähnlichen Atmosphäre und einem ähnlichen intelligenten Leben gestoßen sind. Sind wir wirklich so einzigartig im Universum? Aber jetzt einmal der Reihe nach. Wie ist dieser Planet Erde entstanden und wie ist Leben auf diesem Planeten entstanden?
Vor 13,8 Milliarden Jahren gab es den berühmten Urknall. Dieser ging aus von einem sehr kleinen Punkt mit unendlicher Masse und unendlicher Energie. Es ereignete sich eine riesige Explosion. In der Folge wurde mit größter Energie eine unendlich große Masse in den noch unbekannten Raum geschleudert. Es blieb allerdings nicht bei einem ungeordneten Haufen, sondern es formierten sich Sternhaufen, Galaxien, und mit physikalischer Ordnung begannen die Sterne nach Gesetzen von Anziehungskraft, Masse und Geschwindigkeit zu kreisen. Hier muss sich natürlich der gläubige Mensch fragen: Da muss es doch jemanden geben, damit dies in halbwegs geordneten Bahnen verlaufen konnte. Es musste doch als Grundlage dazu ein Plan existieren, den irgendjemand erschaffen hatte. Und diesen Jemand nennen wir Gott.
Der Urzustand dauerte viele Milliarden Jahre. Und irgendwann vor 4,5 Milliarden Jahren entstand ein Planet, die Erde.
Die Erde war ursprünglich ein absolut unwirtlicher Ort, praktisch keimfrei, ausschließlich Materie in verschiedenen Zuständen. Das reinste Chaos. Sie wurde von anderen Himmelskörpern bombardiert. Wie war es möglich, dass sich in diesem Chaos Leben entwickelte? Also nicht nur Materie, Felsen, Lava, sondern Leben, das sich selbst auch vermehren konnte?
Welche Umstände haben Leben auf der Erde möglich gemacht? Könnte es auch auf anderen Planeten ähnliches Leben geben? Seit Jahrzehnten forschen wir auf den uns bekannten Sternensystemen und sehen aber nur lebensfeindliche Welten.
Es hat den Anschein, als sei das Leben auf unserer Erde die Folge vieler glücklicher Zufälle. Solche Zufälle können zum Beispiel auch Naturkatastrophen sein, die für Erde vorteilhaft waren. Auch ein Zusammenspiel mit den Planeten unseres Sonnensystems, wie zum Beispiel Jupiter und Saturn, haben die Existenz der Erde begünstigt. Das Zusammenspiel von hunderten glücklichen Umständen hat eine lebendige Erde geschaffen, die in dieser Form mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit einmalig im Universum ist. Eventuell gibt es oder gab es auch Leben auf anderen Planeten, aber dieses Leben kann eine völlig andere Form gehabt haben als das, was wir bei uns kennen.
Einer der glücklichen Zufälle: Die richtige Entfernung der Erde zur Sonne. Sie ist ein ausschlaggebendes Moment. Mit der geeigneten Entfernung ist unsere Erde weder zu heiß noch zu kalt, und flüssiges Wasser ist möglich. Die gesamte Architektur unseres Sonnensystems ist glücklicherweise so angelegt, dass unsere Erde bewohnbar ist.
Vor 4,5 Milliarden Jahren war unsere Erde noch vollkommen trocken. Woher kommt also das Wasser? Wir können es wahrscheinlich dem Planeten Jupiter verdanken. Jupiter sammelte dank seiner riesigen Masse wasserreiche Körper aus der Umgebung unserer Galaxie, Materie, die sich weit draußen außerhalb unseres Sonnensystems gebildet hatte, und katapultierte diese Materie ins Innere unseres Systems. Asteroiden und Kometen reicherten also die Erde unter anderem auch mit Wasser an.
Ereignisse in der frühesten Erdgeschichte haben unseren Planeten mit Wasser versorgt: Man vermutet, dass die Erde unter anderem von einem Planeten mit der Größe des Mars getroffen und dadurch fast zerstört wurde. Bei diesen Impakten wurden riesige Energiemengen frei, und die Erde verschmolz zusammen mit dem auftreffenden Planeten, der unter anderem riesige Mengen in Eis gebundenen Wassers mitführte. So wurde der neu entstandene Planet Erde in seinen Tiefen mit Wasser versorgt. Und dieses Eis-Wasser-Polster ermöglichte später die Plattentektonik. Des Weiteren entstand bei dieser riesigen Katastrophe auch unser Mond. Interessant ist, dass der Mond bei seiner Erschaffung nur 15.000 Kilometer von der Erde entfernt war. Er entfernte sich allerdings auf seiner Umlaufbahn stetig, auch heute noch circa drei Zentimeter pro Jahr, und ist jetzt 38.000 Kilometer von der Erde entfernt.
Dieser Mond ist ein weiterer glücklicher Zufall. Er hat großen Einfluss auf unsere Erde und stabilisiert die Neigung der Erdachse. Hätte die Erde keinen Mond, würde die Erdachse deutlich variieren und es käme zu wesentlich häufigeren, erheblich großen Klimaveränderungen. Der Mond ermöglicht also ein relativ konstantes Klima auf der Erde.
Aber es kam immer wieder zu neuen Veränderungen in diesem noch rauen Umfeld, die die weitere Entwicklung zu einem lebendigen Planeten ermöglichten.
Vor vier Milliarden Jahren waren vulkanische Aktivitäten riesengroß, und der Hauptbestandteil dieser Eruptionen war Wasser. In der Folge entwickelte sich um die Erde eine Atmosphäre aus Wolken, es regnete Millionen Jahre lang, und so bildeten sich Ozeane. Da die Einstrahlung der Sonne relativ schwach war, gefroren diese Ozeane. Aber gleichzeitig mit den Eruptionen wurde nicht nur Wasserdampf, sondern auch CO2 in die Atmosphäre geschleudert, und durch dieses CO2 kam es zum ersten Mal in der Erdgeschichte zu einem Treibhauseffekt. Die Temperatur auf der Erde stieg an und verhinderte, dass unsere Erde mit -60 °C zu kalt blieb. Der CO2-Anteil in der Atmosphäre wurde größer, der Treibhauseffekt vergrößerte sich, und so tauten dann vor vier Millionen Jahren die zunächst gefrorenen Ozeane auf. CO2 wurde jedoch in gewissem Maße von der Meeresoberfläche wieder absorbiert und sank auf den Meeresboden.
In der Folge gab es auf unserer Erde wiederum einen glücklichen Mechanismus, der das CO2 aus dem Meeresboden zurück in die Luft brachte. Die Plattentektonik. Unsere Erde hat eine Kruste aus kaltem und starrem Gestein. Diese Erdkruste ist aber nicht eine einzige, die Erde umfassende Kruste, sondern setzt sich aus vielen Teilen zusammen, welche sich gegeneinander und übereinander verschieben. Unter dem enormen Druck dieser Verschiebungen entsteht große Hitze. Dadurch steigt wieder Magma an die Oberfläche, die Eruptionen nehmen CO2 mit und es entweicht bei Eruptionen zusammen mit dem Wasserdampf wieder in die Atmosphäre.
Entstehung ersten Lebens
Bis zu diesem Zeitpunkt hatten wir immer noch einen toten Planeten. Ausschließlich Materie. Was fehlt sind organische Moleküle. Wie wir heute wissen, bestehen alle lebenden Organismen aus den gleichen Bausteinen. Forscher vermuten, dass diese Moleküle von außerhalb auf die Erde gekommen sind. Moleküle auf der Basis von Kohlenstoff. Diese Moleküle können aus Meteoriten stammen, welche die Erde umkreisen und auf die Erde auftreffen. Es gibt Meteoriten, die zu sechzig Prozent aus organischem Material bestehen.
Diese ursprünglichen organischen Moleküle, aus denen das Leben auf der Erde womöglich entstanden ist, stammen aus der kalten Zone des Sonnensystems. Forscher machen heute größte Anstrengungen, hier Klarheit zu schaffen. Mit der Entsendung von Sonden in das Weltall und mit erstaunlichen Landemanövern auf Kometen untersucht man heute mittels der Entnahme von Proben die Gesteine solcher Kometen. Und so weiß man, dass Kometen der Ursprung für organisches Material auf unserer Erde sind.
Diese organischen Moleküle unterlagen auf ihrer langen Reise durch den Kosmos in vielen Millionen Jahren natürlich vielen Veränderungen, und zwar durch Hitze, Kälte, Strahlung und andere Einflüsse.
Man hat versucht, solche Vorgänge im Labor nachzubilden und untersuchte, welche Veränderungen durch die extremen Belastungen im Orbit an organischem Material möglich sind. Als Ausgangsmaterial nahm man Wasser, Methanol und Ammoniak, also nur drei Materialien. Langzeituntersuchungen ergaben, dass allein mit Hilfe dieser drei Basismoleküle am Ende der Versuchsperiode Tausende neue Moleküle entstanden. Unter diesen neuen befinden sich Aminosäuren, die Grundlage für alle Proteine, die in jedem Lebewesen vorhanden sind. Auch Zuckermoleküle, die für den Aufbau unserer DNA unerlässlich sind.
Organische Materie allein ist jedoch nicht verantwortlich für die Bildung von Leben. Dazu ist eine ganz besondere Umgebung nötig. Und auf unserer Erde, in einem Umfeld von Wasser unterschiedlicher Temperatur und unterschiedlicher Zusammensetzung, vor allem unten am Meeresboden, in brodelnden Vulkanen, auch hydrothermalen Quellen oder Schlote genannt. In diesen Schloten steigen aus dem Innersten der Erde heißes Wasser und Gase auf. Und in diesem Netzwerk von Schloten in ewiger Dunkelheit und Hitze entstand vor 3,5 Milliarden Jahren das Element Luca, die Abkürzung für »last universal common ancestor«, sozusagen unser Urvorfahr. Er war der erste Anfang von etwas Lebenden. Allerdings war Luca kein Individuum, sondern eine Form im Übergang zum Leben. Forschungen vieler Mikrobiologen, Genetiker und Chemiker weltweit sehen in Luca die erste Basis für unser heutiges Leben.
Luca ernährte sich anfänglich lediglich von heißen Gasen. Forscher der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf haben sich in langjährigen genetischen Studien intensiv mit diesem Element befasst. Diese einfachen Einzeller benötigten keinen Sauerstoff und gediehen bei Temperaturen um 100 °C in den Hydrothermalquellen der Tiefsee. Als Nahrung diente den Einzellern Kohlendioxid, Wasserstoff und Stickstoff.
Luca bekam im Laufe der Zeit Probleme, wenn Schlote instabil wurden und kollabierten. Luca musste sich also eine schützende Hülle zulegen. So entstanden erste Zellen. Diese Entwicklung dauerte einige hundert Millionen Jahre. Und hier beginnt die Darwin’sche Evolution, das Prinzip von Veränderung und Auslese von Individuen.
Vor 2,5 Milliarden Jahren gelang den weiter entwickelten Nachfolgern von Luca die Photosynthese: die Umwandlung von Sonnenlicht in chemische Energie als Nahrungsquelle. Dies eröffnete völlig neue Lebensformen.
Mikroskopisch kleine Cyanobakteria genannte Organismen arbeiteten mit dieser Photosynthese und machten sich die Energie der Sonnenstrahlen zunutze, um weiter Gewebe aufzubauen. Das Abgas, das bei diesem Prozess entstand, nämlich Sauerstoff, verursachte eine Revolution. Es wurde zur standardmäßigen Nahrung für eine wesentlich effizientere Art der Energiegewinnung und ebnete den Weg für die Erschaffung jeder nachfolgenden komplexen Lebensform.
Bakterien konnten jetzt atmen, das bedeutete Energiestoffwechsel durch Verbrennung mithilfe von Sauerstoff. Dies war der entscheidende Schritt ins wirkliche Leben. Die Urbakterien entwickelten sich weiter. Es bildeten sich Zellkerne mit Chromosomen und damit begann vor zwei Milliarden Jahren ein völlig neues Kapitel, Leben konnte sich vermehren. Aber wir sollten festhalten: Alles Leben dieser Erde entstand im Wasser!
Und wir halten auch fest: Luca besaß bereits Gene, die aus den uns bekannten Bausteinen bestehen. Luca ist damit die erste Schnittstelle zwischen biochemischer Reaktion und sich selbst vermehrendem Leben. Aus Luca entwickelten sich alle heute existierenden Bakterien, Pilze, Pflanzen, Tiere und somit auch der Mensch. Dieses Leben beschleunigt sich in seiner Vielfältigkeit. Und dies ist dann die Basis für das gesamte Leben auf der Erde: Tiere und Pflanzen, alle haben gemeinsame Merkmale. Sie basieren auf der gleichen Biochemie und haben alle die gleiche DNA als genetisches Material. Wir sind also alle verwandt, angefangen vom kleinsten Lurch bis zur schönsten Giraffe.
Evolutionsbiologen haben das Genom des australischen Lungenfischs entziffert. Es handelt sich dabei um das bislang umfangreichste, vollständig sequenzierte Erbgut der Tierwelt mit 43 Milliarden DNA-Bausteinen. Dieser Lungenfisch entstieg als erstes Wirbeltier dem Wasser und eroberte sich eine neue Welt an Land. Zur Gattung Lungenfische gehören Schuppenmolche, ähnlich den Reptilien, alle möglichen Kriechtiere, auch Amphibien oder Reptilien. Lungenfische konnten also nicht nur im Wasser, sondern auch in der Luft atmen. Heutige Lungenfische unterscheiden sich nicht wesentlich von den Urtypen, die vor rund 420 Millionen Jahren an Land krabbelten. Und es entwickelten sich danach alle späteren Amphibien, Reptilien, Vögel und Säugetiere.
Da diese neuen Lebewesen sowohl im als auch über Wasser atmen konnten, ergab sich ein Überlebensvorteil in Zeiten, in denen das Süßwasser an Land wegen Trockenperioden wenig Sauerstoff hatte. Folglich entwickelten sich aus diesen Urtieren der Dinosaurier und auch der Mensch!
Hier beginnt das Geheimnis der Evolution: Es gibt keine gerade Linie, die von den Bakterien zum Menschen führt. Evolution folgt lediglich den Möglichkeiten der Biologie und geht in alle Richtungen. Eine permanente Bewegung, die am Ende die Einzigartigkeit und Diversität des Lebens auf unserer Erde geschaffen hat. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Evolution auf einem anderen Planeten ein ähnliches Ergebnis ergeben hat, ist sehr gering. Es gibt für unser Ökosystem nur ein Raumschiff und das ist die Erde. Es wird keine andere Erde geben, keinen Planeten B.
Auf der Ur-Erde waren vor vier Milliarden Jahren sehr viele verschiedene Bauteile verfügbar. Meteoriten stammen von Himmelskörpern, die vor Millionen von Lichtjahren auseinandergebrochen sind. Darin findet man sechzig bis achtzig Aminosäuren, wobei wir für die Weiterentwicklung unserer Natur auf unserem Planeten nur zwanzig Aminosäuren benutzen. Wiederum führte also eine Kombination aus Zufall und Umweltbedingungen dazu, dass nur eine begrenzte Zahl der verfügbaren Bausteine ausgewählt wurde. Und diese Auswahl von zwanzig Aminosäuren begründet unsere Tier- und Pflanzenwelt. Es wäre möglich, dass auf einem anderen Planeten, den wir nicht kennen, andere Aminosäuren zur Entstehung von Leben gewählt wurden. Das Leben auf solch einem Planeten würde sich schon allein optisch von unserem völlig unterscheiden.
Heute droht dies einzigartige Ökosystem der Erde unter den Angriffen des Menschen zusammenzubrechen und es bleibt zu hoffen, dass wir rechtzeitig mit aller Kraft gegensteuern, um diesen Zerfall aufzuhalten.
Hier die Zeitabläufe der ersten Milliarden Jahren der Erdgeschichte:
Vor 13,8 Milliarden: Urknall. Beginn von Materie, Energie, Physik und Chemie.
Vor 4,5 Milliarden: Entstehung der Erde.
Vor 4 Milliarden: Einschlag großer Himmelskörper. Eis und Wasser.
Vor 3,5 Milliarden: Entstehung von Organismen, Beginn der Biologie.
Vor 2,4 Milliarden: Beginn der Photosynthese und Atmung, echte Zellen.
Vor 1,5 Milliarden: Wasser und Luft enthält Sauerstoff. Pflanzliches Leben entsteht.
Es dauerte also ungefähr drei Milliarden Jahre, bis sich pflanzliches Leben auf der Erde entwickelte.
Jetzt möchte ich die weitere Evolution der Tier- und Pflanzenwelt nicht weiter betrachten, denn das würde den Rahmen meines Buches sprengen. Stattdessen machen wir jetzt einen großen Sprung, um uns die letzten 400 Millionen Jahre der Erdentwicklung näher anzusehen. Denn ab da wird es sehr interessant, und wir lernen so langsam unsere Ahnen kennen.
Menschenaffen
Vor 400 Millionen Jahren gab es bereits erste Landtiere. Der Beginn allen menschlichen Lebens liegt in Afrika. Erste Großsäuger gab es dort bereits vor sechzig Millionen Jahren. Daraus entwickelte sich vor 13 Millionen Jahren die Welt der Affen. Aber die große Frage: Wie geschah der Übergang von den Affen zu den Menschenaffen und danach zum modernen Menschen? Vor 13 Millionen Jahren können wir von einem unserer ersten Vorfahren sprechen. Im Jahr 2014 entpuppte sich ein Fund in der afrikanischen Steppe als handfeste Sensation. Westlich des Turkana-Sees im Norden Kenias fand man den bemerkenswert gut erhaltenen, fossilen Schädel eines Kindes, das dort vor 13 Millionen Jahren lebte. Und dieser Fund wird als der gemeinsame Vorfahr aller, auch heute noch lebender Menschenaffen angesehen. Die Entdeckung gelang einem internationalen Forscherteam unter der Leitung von Isaiah Nengo vom Turkana Basin Institute der Stony Brook University, zu dem auch Mitarbeiter vom De Anza College, USA, vom UCL in Großbritannien und Fred Spoor vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig gehörten. Die neue Art erhielt den Namen Nyanzapithecus alesi.
Dass die neue Art vom Verhalten her nicht »gibbonartig« war, konnten die Forscher anhand einer Untersuchung des Gleichgewichtsorgans im Innenohr belegen. Gibbons sind für ihr schnelles und akrobatisches Verhalten auf Bäumen bekannt, aber das Innenohr von Alesi zeigte, dass er sich vorsichtiger fortbewegte. Nyanzapithecus alesi gehörte einer Gruppe von Primaten an, die bereits seit mehr als zehn Millionen Jahren in Afrika lebten.
Alesi hatte ein relativ hohes Gewicht, sodass das Hanteln an den Zweigen schwierig wurde und er teilweise bereits mit aufrechtem Gang auf dickeren Ästen lief. Dies war also schon in frühester Zeit der erste Anfang des aufrechten Gangs. Es wird vermutet, dass diese frühe Affenart bereits eine Art Empathie für seinesgleichen hatte.
Alesi lebte immer noch auf dem Baum und baute Nester als Schlafplatz. So war er vor den meisten Raubtieren sicher, denn noch war er kein Jäger, sondern selbst ein Gejagter. Durch die Empathie und den längeren Schlaf des Nachts entwickelten sich das Kopf-Gehirn und das Gedächtnis. Man geht davon aus, dass bereits seinerzeit für die Partnerwahl nicht nur Größe und Stärke die ausschlaggebenden Argumente waren.
Aber schon diesen frühen Primaten zog es immer mehr auf den Waldboden. Der Gebrauch einfacher Werkzeuge war bereits vorhanden: Mit klebrigen Stöcken holte er Ameisen aus ihren Höhlen. Er lernte bereits damals den Gebrauch und die Vorzüge bestimmter Beeren oder Blätter zur Heilung von Krankheiten.
In der Folge der Evolution gelang der spannende Übergang von den Affen zu jenen Geschöpfen, die uns schon so nah verwandt sind, dass sie auch Menschenartige genannt werden: Gorillas, Schimpansen, Orang-Utans und Gibbons, die vor sieben Millionen Jahren lebten.
Vor 4,4 Millionen Jahren
Der Nachfahre des Alesi, der Sahel Anthropus, lebte an den Ufern des Tschad-Sees. Der Sahel Anthropus gebrauchte verstärkt Werkzeuge und veränderte auch seine Nahrungsaufnahme. Aufgrund der genauen Analyse des Schädels weiß man, dass dieser Affe fast ausschließlich auf dem Boden lebte. Sahel Anthropus erweiterte seinen Aktionsradius aufgrund des zeitweisen aufrechten Gangs, entdeckte Gewässer sowie das Fangen und Essen von Fischen. Zum ersten Mal traten kriegerische Elemente auf, indem eine fremde Sippe mittels Keulen und Steinen bekämpft und getötet wurde.
Vor fünf Millionen Jahren in der großen Eiszeit war ein großer Teil allen Wassers in Eis gebunden und es kam in Afrika zu einer großen Dürre. Die Wälder zogen sich mehr und mehr zurück. Im Norden Afrikas entstand die Wüste Sahara, die vor dieser Zeit eine fruchtbare Region darstellte. Große Savannen im Osten und Süden Afrikas vergrößerten sich. Jetzt lebten in den verbliebenen Urwäldern nach wie vor Schimpansen und Bonobos. Jedoch in den Savannen Ost- und Südafrikas kam es zur Entwicklung vieler ganz neuer Arten.
Vor 3,5 Millionen Jahren
Sahel Afarensis tauchte in Südafrika auf. Er nutzte die Vorteile der Savanne und lernte, sich gegen Konkurrenten durchzusetzen. Da er noch nicht die Fähigkeit besaß, als Jäger größere Beutetiere zu stellen, begann er Aas zu fressen. Sehr wahrscheinlich kam es dabei zum ersten Gebrauch von Steinwerkzeugen, um das Fleisch aus dem Aas herauszutrennen. Er wurde also zum Fleischfresser und könnte durchaus der erste Vertreter der Gattung Homo sein. Und ausgerechnet diese öde, trockene afrikanische Gegend gilt als Wiege der Menschheit. Sahel Afarensis lebte mehr auf der Erde und musste, um Nahrung zu finden, auch nach Wurzeln graben.
Vor zwei Millionen Jahren …
… entwickelte sich der Homo rudolfensis. Dieser erste Homo hatte noch ein kleines Kopfgehirn, doch war es mit circa 1.200 cm3 bereits sehr groß, verglichen mit den 50 cm3 des Gehirns der Affen. Die Frage ist natürlich, warum im gesamten Tierreich nur die Gattung Homo ein derart leistungsfähiges Gehirn entwickelte. Ein großes Gehirn braucht eine Unmenge an Energie: bereits im Ruhezustand circa 25 Prozent der gesamten Körperenergie. Bei den Affen sind es nur acht Prozent. Daher musste der Homo rudolfensis mehr Zeit mit der Nahrungssuche verbringen.
Vor einer Million Jahren …
… kam es endlich zum Homo erectus. Eine wesentliche menschliche Eigenart in der Entwicklung wurde der aufrechte Gang. Dadurch konnte Homo erectus in der Savanne besser nach Beute und Feinden Ausschau halten und die Arme zu komplexeren Zwecken nutzen, wie zum Beispiel um Werkzeuge einzusetzen. All diese neuen Entwicklungen hatten aber auch Nachteile. Das gesamte Skelett des Homo war ursprünglich für den Gang auf vier Beinen ausgelegt, und der einst relativ leichte Kopf war leichter zu tragen. Der aufrechte Gang stellte eine beachtliche Herausforderung dar, und die Folge waren Rückenschmerzen. Gleichzeitig wurde die Geburt für die Frauen problematisch. Der aufrechte Gang verlangte nach schmaleren Hüften und einen engen Geburtskanal, während gleichzeitig die Köpfe der Säuglinge wegen der größer werdenden Gehirnmasse immer größer wurden. Daher kam der Nachwuchs immer früher zur Welt, damit der Kopf bei der Geburt noch verhältnismäßig klein war. Folglich waren allerdings menschliche Säuglinge im Prinzip Frühgeburten und nicht allein überlebensfähig.
Durch das Essen von Fleisch war der Homo erectus nicht mehr so streng an die Vegetation gebunden, die mal mehr, mal weniger vorhanden war. Somit konnte er wandern und seinen Lebensraum erheblich weiter ausdehnen. Dies war nötig geworden, da sich wegen der großen Eiszeit die Trockensavannen weiter ausdehnten. Viele Tiere verließen Afrika. Und auch der Homo erectus wanderte aus, und zwar in Richtung Europa und Asien. Er passte sich allen klimatischen Verhältnissen an, und solange es Fleisch zu essen gab, war er überlebensfähig. Der Homo erectus war ein ausgezeichneter Läufer und großartiger Jäger aufgrund seiner neuen Werkzeuge: Speere sowie Pfeil und Bogen. Und da er vom Gejagten zum Jäger mutierte, wohnte er nicht mehr in Baumnestern, sondern auf dem Boden in Hütten mit einem schützenden Zaun gegen Feinde. Um bei schnellem Dauerlauf besser transpirieren zu können, verlor er sein Fell und begann, aus Tierfellen Kleidung herzustellen. Damit ergab sich ein großer Vorteil gegenüber vielen Tieren. Denn alle superschnellen Tiere, zum Beispiel Löwen, Leoparden und Geparde, können zwar erheblich schneller laufen als der Mensch, aber nur sehr kurze Zeit, da ihre pelzigen Körper sich nicht über die Haut kühlen können. Mit der Wanderung des Homo erectus aus Afrika hinaus in die Welt entstanden weltweit in den verschiedenen Erdteilen neue Arten:
in China der Peking-Mensch,
in Indonesien der Sono-Mensch,
in Zentralasien der Denisora-Mensch,
und in Europa mutierte der Homo erectus zum Neandertaler.
Betrachtet man den Stammbaum des Menschen, so stellt man fest, dass ursprünglich viele verschiedene Arten existierten, die jedoch im Laufe der Zeit ausgestorben sind. Großer Gewinner in der Vielzahl von Affenmenschen war der Homo erectus, und dieser Art sagt man seine großen Fortschritte nach, weil er erstmalig sowohl Fleisch als auch pflanzliche Nahrung zu sich nahm.
Vor 500.000 Jahren …
… unterschied sich der Homo erectus aufgrund des immer größer werdenden Gehirnvolumens so sehr von seinen Vorfahren, dass man ihm eine eigene Art, den Homo sapiens, zuschreibt. Damit sind wir im Jahr 300.000 v. Chr. angekommen. Lange Jahrtausende brachten das große Gehirn und der aufrechte Gang dem Homo sapiens jedoch kaum Vorteile. Vor 400.000 Jahren begannen Menschen größere Beutetiere zu jagen, und vor 100.000 Jahren schaffte der Mensch den Sprung an die Spitze der Nahrungskette.
Der wichtigste Schritt auf dem Weg an die Spitze der Nahrungskette war die Beherrschung des Feuers gewesen. Vor 300.000 Jahren gehörte das Feuer zum Alltag des Homo sapiens. Jetzt hatte man eine verlässliche Licht- und Wärmequelle, eine wirkungsvolle Waffe gegen lauernde Wildtiere. Außerdem wurde der Genuss von Fleisch vielfältiger. Viele Nahrungsmittel konnten besser und bekömmlicher zubereitet werden. Die Nahrung war leichter und schneller zu kauen. Während Schimpansen viele Stunden am Tag damit zubrachten, ihre Rohkost zu kauen, reichte dem Menschen für eine gekochte Mahlzeit eine Stunde.
Einen weiteren Sprung in der Evolution machte der Homo sapiens durch die Entwicklung einer komplexeren Sprache, die auch Verständigung und Kooperationen in Gruppen ermöglichte. Das größere Denkvermögen und die verbesserte Sprachfähigkeit gestatteten es dem Homo sapiens, sich Dinge auszumalen und über Dinge zu unterhalten, die erst in der Zukunft geschehen. Dies wurde ein wesentlicher Schritt zur Fähigkeit, flexibel in großen Gruppen und Entfernungen zusammenzuarbeiten. Es zeigte sich im Laufe der Forschungen, dass der Homo sapiens über große Teile des afrikanischen Kontinents ausgebreitet war und nicht nur in den Savannen Ostafrikas lebte: Jebel Irhoud in Marokko (vor 300.000 Jahren), Florisbad in Südafrika (vor 260.000 Jahren) und Omo Kibish in Äthiopien (vor 195.000 Jahren). Die Ähnlichkeit dieser fossilen Schädel spricht für frühe Wanderungsbewegungen innerhalb Afrikas. Lange bevor der Homo sapiens vor etwa 100.000 Jahren Afrika verließ, hatte er sich auf dem Kontinent ausgebreitet.
Für die frühe Ausbreitung innerhalb Afrikas sprechen die an all den verschiedenen Orten gefundenen steinernen Klingen und Speerspitzen. Die Homo-sapiens-Fossilien in Jebel Irhoud wurden gemeinsam mit Knochen von gejagten Tieren und Steinwerkzeugen aus der Epoche der afrikanischen mittleren Steinzeit gefunden. Vergleichbare Steinwerkzeuge wurden in ganz Afrika dokumentiert. Es scheint aus heutiger Sicht zweifelhaft, dass die Menschen der verschiedenen, weit voneinander entfernt liegenden Regionen Afrikas untereinander Kontakt hatten. Man muss allerdings berücksichtigen, dass die heutige Wüste Sahara aufgrund geänderter Umweltbedingungen am Ende der Eiszeit für viele Jahrtausende eine fruchtbare Savanne mit großer Tierpopulation war. Dies ermöglichte auch Wanderungen von Marokko aus bis nach Ostafrika. Diese Komplexität spielte für unsere Evolution eine wichtige Rolle.
Vor 120.000 Jahren: Homo sapiens
Vor 120.000 Jahren verließ der Homo sapiens Afrika und folgte den Spuren des Homo erectus nach Europa, nach Asien und über die Beringstraße nach Amerika und bis Südamerika. Der Homo sapiens erreichte vor 75.000 Jahren Asien und Europa.
Der Homo sapiens ist die einzige und erste Menschenart, die Australien (vor etwa 60.000 Jahren) und Amerika besiedelte (vor etwa 15.000 bis 11.500 Jahren). Vor 45.000 Jahren hatte er bereits ganz Asien und Europa besiedelt. Dabei vermischte sich der Homo sapiens mit seinen Vorgängern, die vom Homo erectus abstammten.
In Australien war der Homo sapiens vor 60.000 Jahren der erste Mensch. Vor ihm war niemand dort gewesen, also gab es keine Ureinwohner. Auf seiner Reise nach Australien musste er erstmalig das Meer überwinden. Der Ozean zwischen Indonesien und Australien war zu jener Zeit nicht so groß wie heute, denn in der Eiszeit waren erhebliche Mengen Wasser in Form von Eis gebunden, und die Ozeane hatten einen niedrigen Pegel. Insofern war die Meeresentfernung zu jener Zeit nicht riesig. Es gab eine günstige Verbindung China–Indonesien–Timor–Indonesische Inseln–Australien, die für den damaligen Schiffbau offensichtlich beherrschbar war. Nach dem Ende der Eiszeit stiegen die Meeresspiegel, und Australien wurde wieder vom Rest der Welt abgeschnitten.
Bei der Ankunft des Homo sapiens war Australien eine grüne fruchtbare Insel, ein wahres unbewohntes Paradies mit einer urtümlichen Tierwelt. In der großen Eiszeit vor 30.000 bis 40.000 Jahren, als immer mehr Wasser in Eis gebunden wurde, entstanden in der Folge die großen Wüsten der Erde. Australien wurde zum vollständigen Wüstenland, wodurch fast alle Tiere aufgrund von Nahrungsmangel starben. Lediglich der Homo sapiens überlebte diese Trockenperiode.
Auf seiner langen Wanderung traf der Homo sapiens vor 25.000 Jahren in Sibirien auf den Denisova-Mensch, mit dem er friedlich zusammenlebte.
In Europa traf er vor 40.000 Jahren auf den Neandertaler. Hier lebten beide, der Neandertaler und der Homo sapiens, lange Zeit friedlich zusammen und mischten sich sogar. Das bedeutet, dass die Nachfolgegenerationen des Homo sapiens auch DNA-Fragmente des Neandertalers in ihr Erbgut aufnahmen. Noch heute kann man in unserem Erbgut wenige Prozente Neandertalerspuren feststellen. Vor 30.000 Jahren ist der Neandertaler von der Bildfläche verschwunden, nachdem er etwa 250.000 Jahre gelebt hatte, davon 10.000 Jahre zeitgleich mit dem Homo sapiens. Was war die Ursache für dieses Verschwinden? War eine Klimaveränderung schuld? Forscher der Universität Oxford und des Naturkundemuseums London vermuten: Sein wuchtiger Körper könnte dem Neandertaler zum Verhängnis geworden sein. Möglich ist aber auch hier, wie im Übrigen fast überall im weltweiten Verlauf seiner Wanderung, dass der Homo sapiens der bereits existierenden Urbevölkerung überlegen war und sich außerdem sehr expansiv vermehrte.
Aber der frühe Homo sapiens war noch nicht der große Sprung nach vorn. Unverändert waren seine Werkzeuge sehr primitiv, es gab noch keine Höhlenmalereien, Häuser, Pfeil und Bogen. Solche Dinge wurden erstmalig im Alter von 100.000 Jahren gefunden.
Es folgte die Weiterentwicklung von Sprache und Gebrauch von Werkzeugen. Erst vor 40.000 Jahren beschleunigten sich kulturelle Innovationen. Sprache war schon vor 100.000 Jahren entstanden, aber erst vor 35.000 Jahren kann man von einer ausgebildeten Sprachfähigkeit reden. Langfristig verdrängte der Homo sapiens weltweit alle anderen archaischen Arten, einmal durch seine geistige Überlegenheit, aber auch durch seine explosive Vermehrung.
Die Eroberung der Welt durch den Homo sapiens lief wie folgt ab:
Auf einem Weg nach Osten:
Vor 300.000 Jahren – aus Afrika in die Welt.
Vor 100.000 Jahren – Arabische Halbinsel und Zweistromland.
Vor 60.000 Jahren – Australien.
Vor 25.000 Jahren – Eurasien.
Vor 15.000 Jahren – Alaska.
Vor 12.000 Jahren – Nordamerika.
Auf einem zweiten Weg nach Westen:
Vor 40.000 Jahren – Europa.
Der Homo sapiens konnte die Welt dank seiner einzigartigen menschlichen Fähigkeit erobern, nämlich Fiktionen zu schaffen und zu verbreiten. Der Homo sapiens war seinerzeit die einzige Art Säugetiere, die mit zahlreichen Fremden zusammenarbeiten konnte, weil nur er fiktionale Geschichten erfinden, sie verbreiten und Millionen andere davon überzeugen konnte. Und diese Bereitschaft, an Fiktionen zu glauben, ermöglichte gemeinsames Kooperieren in größeren Gemeinschaften.
Entwicklung zum modernen Menschen
Als Darwin 1859 behauptete, dass wir vom Affen abstammen, war es kein Wunder, dass die meisten Menschen seine Theorie erst einmal für absurd hielten und darauf bestanden, dass der Mensch eine Schöpfung Gottes sei.
Molekulargenetische Untersuchungen der letzten Jahre ergaben allerdings, dass über 98 Prozent unserer genetischen Anlagen mit dem Schimpansen übereinstimmen.
Was unterscheidet uns nun letztendlich von unseren Vorfahren, den Schimpansen? Der wesentliche biologische Erfolg des Menschen, der in seinen Anfängen auch unter die Gattung Tier fällt, beruht auf besonderen Merkmalen.
Von allen größeren Tierarten ist keine andere Art auf allen Kontinenten der Erde heimisch oder bevölkert sämtliche Lebensräume, von der Wüste und den Polargebieten bis zum tropischen Regenwald. Kein größeres Wildtier kann es diesbezüglich zahlenmäßig mit uns aufnehmen. Doch zu unseren Besonderheiten gehören zwei Dinge, die allerdings auch unser Überleben infrage stellen könnten: der Hang zum gegenseitigen Töten in Massen und die Zerstörung der Umwelt.
Das Töten kommt zwar auch bei einigen Tierarten vor: zum Beispiel bei Löwen. Auch andere Tiere töten Angehörige der eigenen Art. Doch beim Menschen nimmt die Bedrohung ein viel größeres Ausmaß an, und wir haben dazu technische Kampfmittel entwickelt. Schon oft wurde deshalb ein Weltuntergang für den Fall prophezeit, dass wir keine Einsicht zeigen und uns nicht zur Umkehr entschließen. Die schlimme Vorhersage dieser Katastrophe beruht auf zwei Dingen: Erstens haben wir Atombomben, mit denen die Menschheit erstmalig in ihrer Geschichte ein Mittel zur völligen Selbstvernichtung besitzt. Und zweitens eignen wir uns bereits heute vierzig Prozent der Nettoproduktion der Erde, das heißt der aus der Sonneneinstrahlung gewonnenen Nettoenergie an. Und da die Weltbevölkerung zurzeit exponentiell wächst, werden die biologischen Grenzen des Wachstums bald erreicht sein. Kriege um die begrenzten Ressourcen unseres Planeten an Nahrung und Wasser erscheinen dann unausweichlich. Zudem werden bei anhaltendem Tempo der Artenausrottung im Laufe des nächsten Jahrhunderts die meisten Pflanzen- und Tierarten ausgestorben oder bedroht sein, obwohl wir viele dringend zum Überleben brauchen.
Grundsätzlich wissen wir ja, was alles zu tun wäre, um eine Katastrophe zu verhindern: Eindämmung des Bevölkerungswachstums, was wohl das Wichtigste wäre, Begrenzung oder Abschaffung der Atomwaffen, Entwicklung friedlicher Methoden zur Beilegung internationaler Konflikte, Verhinderung der Umweltzerstörung und Erhaltung der Arten. Es bleibt die Hoffnung, dass wir diese Dinge erfolgreich angehen. Hier sind unsere Politiker voll gefordert. Aber wo sind kompetente Politiker, welche diese Herkulesaufgabe bewältigen könnten?
Und wie war das jetzt mit den Affen? Die Erkenntnisse der Molekularbiologie geben zwar Auskunft über den genetischen Abstand zum Schimpansen, sagen jedoch nichts darüber aus, worin wir uns im Einzelnen von Schimpansen unterscheiden und wie es zu den Unterschieden kam.
Die Größe unseres Gehirns war sicherlich eine wesentliche Voraussetzung für die Entwicklung unserer Sprache und unserer Innovationsfähigkeit. Obwohl das Wachstum des Gehirns lange Zeit weitgehend abgeschlossen war, blieben Steinwerkzeuge noch 100.000 Jahre lang sehr primitiv. Vor 40.000 Jahren besaßen die Neandertaler Gehirne, die mit denen des modernen Menschen vergleichbar sind, doch ihre Werkzeuge zeigten keine Spur von Neuerungen. Diese paradoxen Erkenntnisse sagen uns, dass ein geringer Prozentsatz von Genen vorhanden sein muss, durch die sich der Mensch vom Schimpansen unterscheidet, Gene, die nicht an der Formung des Skeletts beteiligt waren, sondern verantwortlich sind für die unverwechselbaren menschlichen Merkmale wie Innovationsfähigkeit, Kunst und die Anfertigung komplizierter Werkzeuge. Zumindest in Europa traten diese Merkmale unerwartet plötzlich auf, zu einer Zeit, als der Neandertaler dem Cro Magnon weichen musste. Dessen Erscheinung läutet das Ende der Epoche ein, in der wir eine Säugetierart unter vielen waren.
Die Frage ist natürlich unverändert, wo die entscheidenden Dinge liegen, die den Homo sapiens letztendlich über die Tierwelt erheben. Hier kommen wir zu den Erbelementen, die wir auch Gene nennen und die vor 150 Jahren entdeckt wurden. Deren Struktur wurde 1953 von James Watson erkannt und weltweit als Doppel-Helix-DNA vorgestellt. In dieser DNA finden wir die Sequenzen sämtlicher, von den Eltern an ihre Nachkommen weitergegebenen genetischen Informationen. In Zahlen ausgedrückt ergibt sich damit ein Bild, dass die DNA des Affen mit 93 Prozent der DNA-Struktur mit Menschenaffen übereinstimmen, das bedeutet, sie unterscheiden sich lediglich um sieben Prozent.
Von Fossilienfunden weiß man, dass Affen und Menschen sich vor 250.000 bis 300.000 Jahren auseinanderentwickelten. Und mit der Verdopplung der Evolutionszeit vergrößert sich dann auch der Prozentsatz der Abweichung der DNA.
Der Cro-Magnon-Mensch
Somit sind wir fast an das Ende der Entwicklung zum heutigen Menschen angekommen. Wir als Deutsche fühlen uns natürlich sehr mit dem Neandertaler verbunden. Insgesamt stammt die Mehrzahl der Fossilfunde von Neandertalern aus Frankreich, Italien und Spanien, Deutschland, Belgien und Portugal. Ihr Kerngebiet war demnach Süd- und Südwesteuropa. Aus der Verteilung der bislang bekannten Fossilien wurde abgeleitet, dass die Neandertaler erst im Verlauf der letzten Eiszeit ihr ursprünglich ausschließlich europäisches Siedlungsgebiet bis in den Nahen Osten, in Teile Zentralasiens und sogar bis in das Altai-Gebiet erweitert haben.
Der Homo sapiens erreichte vor rund 40.000 Jahren Europa, 10.000 Jahre später war der Neandertaler für immer verschwunden.
Die Theorie vom ersten Völkermord der Geschichte entstand, nachdem Forscher 1899 bei Krapina in Kroatien 800 Knochenteile fanden. Spekulationen über die letzte Schlacht eines Jahrtausende andauernden Krieges zwischen Neandertalern und modernen Menschen kamen auf. Im Mai 2010 präsentierte ein Leipziger Forscherteam um den Genetiker Svante Pääbo jedoch Erstaunliches: Nach Entschlüsselung des Neandertaler-Erbgutes stellten die Wissenschaftler fest, dass ein bis vier Prozent unserer DNA vom Neandertaler stammen. Neandertaler und moderner Mensch müssen sich also miteinander vermischt haben, als sie zur selben Zeit in Europa und im Nahen Osten lebten. Aber dies wird von anderen Experten bestritten, die sagen, dass die wesentlich größere Intelligenz des Homo sapiens sowie vor allem seine expansive Vermehrung den Neandertaler massiv verdrängt hätten.
Der Cro-Magnon-Mensch ist eine in der europäischen Tradition begründete Bezeichnung für den anatomisch modernen Menschen der letzten Kaltzeit, die Zeitspanne vom ersten Nachweis des Homo sapiens in Europa vor etwa 40.000 Jahren bis zum Holozän vor etwa 12.000 Jahren.
Die entscheidenden Skelettreste wurden 1868 in der Dordogne gefunden. Die ältesten gefundenen Fossilien stammen aus der Grotta del Cavallo in Apulien. Das Aussehen des Cro Magnon glich dem der Menschen von heute. Auch sein Gehirn hatte ungefähr dieselbe Größe. Der Cro-Magnon-Schädel zeigt alle klassischen Kennzeichen des Jetztmenschen. Der Gehirnschädel ist hoch und gewölbt, das Gehirnvolumen ist sehr groß (über 1.600 cm3), die Stirn verläuft steil nach oben, das Gesicht ist kurz und hat rechteckige Augenhöhlen, die Nasenöffnung ist hoch und schmal, der Gaumen gewölbt und das Kinn deutlich ausgeprägt. Auch soll er bereits religiöse Empfindungen gehabt haben. Gefundene Gräber lassen darauf schließen, dass Tote feierlich bestattet wurden.
Von da an wird der in archäologischen Stätten gefundene Abfall immer interessanter, und man erkennt, dass nicht nur biologisch, sondern auch vom Verhalten her moderne Menschen entstanden sind. Die vom Cro Magnon hinterlassenen Funde sind Werkzeugen nicht nur aus Stein, sondern auch aus Geweih, Knochen und Elfenbein, man fand Nähnadeln, Ahlen, Gravier-Werkzeuge. Leder wurde gegerbt und so weiter. Auch entstanden mehrteilige Waffen wie Harpunen, Speerschleudern und schließlich Pfeil und Bogen. Dies ermöglichte die Tötung von Tieren aus sicherer Entfernung und das Jagen gefährlicher Tiere. Gleichzeitig entstanden Seile und Netze, Angelschnüre und Schlingen. Auch fand man Überreste von Häusern und genähte Kleidung, was die Fähigkeit zum Überleben im kalten Klima ermöglichte. Sogar Schmuck gab es nun. Man bohrte Löcher in Muscheln, Schneckenhäuser oder Tierzähne und fädelte sie an einem Lederband oder einer Sehne auf.
Ähnliche Entwicklungen folgen kurz darauf auch im Nahen Osten, in Südosteuropa und in Ostafrika. Auch dort fand man wertvolleren Schmuck, Perlenketten aus Schalen von Straußeneiern und Muscheln.
Aufgrund der Fortschritte in der Waffentechnik wurden diese Menschen zu Großwildjägern. Viele Tierarten, welche frühere Eiszeiten überlebt hatten, starben gegen Ende der letzten Eiszeit aus, was vermuten lässt, dass menschliche Jäger mit ihrer neuen Geschicklichkeit die Todbringer waren. Hierzu zählen die nordamerikanischen Mammuts, in Europa das Wollnashorn und der Riesenhirsch, in Südafrika der Riesenbüffel und in Australien die Riesenkängurus. Die glanzvollsten Momente unseres Aufstiegs enthielten also bereits die Saat dessen, was sich heute als Grund unseres Niedergangs erweisen könnte.
Die bekanntesten Hinterlassenschaften des Cro Magnon sind grandiose Höhlenmalereien an Fundstellen wie Lascaux, Chauvet und Altamira. Man fand dort auch Statuen und Musikinstrumente, die heute noch als Kunst betrachtet werden. Somit ist die Entwicklung und Ausbreitung des Homo sapiens für mich jetzt genügend betrachtet. Sein großvolumiges Gehirn machte ihn letztendlich allen anderen Arten überlegen.
Entwicklung des Kopf-Gehirns
Die Beherrschung des Feuers ermöglichte eine bessere und schmackhaftere Zubereitung von Fleisch. Dadurch veränderte sich auch das Gebiss, und die nun gewonnene größere Energie war für Wachstum und Funktion des vergrößerten Gehirns ausschlaggebend. Also war die Fähigkeit, energiereiche Nahrungsquellen zu erschließen, ein entscheidender Faktor der menschlichen Evolution gewesen.
Schon vor anderthalb Millionen Jahren wurde das Feuer von den damaligen Menschen gebändigt und benutzt. Das zeigen verbrannte Knochen und pflanzliche Aschereste, die Forscher in der Wonderwerk-Höhle in Südafrika entdeckten. Hier wurden Überreste von Feuer, das von Menschen gezündet wurde, in einer Höhle gefunden. Es handelte sich also nicht um einen natürlichen Flächenbrand. Die Menschen hatten in der Höhle Zweige, Gräser und Blätter als Brennmaterial genutzt. Die relativ niedrige Temperatur und das verbrannte Material deuten außerdem darauf hin, dass die Menschen das Feuer in der Höhle kontrolliert unterhalten hatten.
Unser erstes ursprüngliches Gehirn aus grauer Vorzeit liegt in unserem Darm. Dies ist vielleicht für viele eine überraschende Feststellung. Auch für Naturwissenschaftler, Biologen und Mediziner handelt es sich hierbei um relativ neue Forschungsergebnisse. Fest steht aber inzwischen, dass unser Gehirn im Darm zum Beispiel verantwortlich ist für die Steuerung der wichtigsten Körperfunktionen wie Atmung, Herzfrequenz, Verdauung, Selbsterhaltungstrieb und vieles andere. Im Darm gibt es reizempfindliche Rezeptoren und Nervenzellen, welche chemische Signale erzeugen. Mit diesem Organ konnten auch einfache Lebewesen aus Urzeiten bereits wichtige Abläufe und lebenserhaltende Funktionen steuern, die Umwelt registrieren, Gefahren erkennen, Beute erspähen, das eigene Überleben sichern. Auch die einfachen Lebewesen wie Fische, Reptilien und Vögel besaßen diese einfachen Darm-Gehirne. Es ist wichtig zu wissen, dass die Natur auf dem weiteren Weg zum Menschen dieses Darm-Gehirn beibehalten, weiterentwickelt und an uns weitergegeben hat. Auch heute ist das Darm-Gehirn einer unserer wesentlichen Entscheidungsträger! Dazu später noch mehr.
Im weiteren Laufe der Evolution entwickelte sich bei fortschrittlicheren Lebewesen auch im Kopf ein Gehirn. Die ersten Wirbeltiere hatten bereits eine Schädelkapsel, die dieses empfindliche Gehirn schützte. Der Verzehr von Fleisch und die damit verbundene größere Energiezufuhr begünstigte das schnellere Wachstum des Kopf-Gehirns, das sehr viel Energie benötigt.
Erst vor zwei Millionen Jahren beschleunigte sich das Wachstum des Kopf-Gehirns rasant. Von ursprünglich 400 cm3 brachte es der Homo sapiens vor 200.000 Jahren schon auf 1.400 cm3. Diese Entwicklung ließ den Menschen zu dem werden, was er heute ist.
Während sich unser Darm-Gehirn im Laufe der Evolution relativ langsam, mit gleicher Geschwindigkeit wie unser Körperbau und unsere inneren Organe veränderte, beschleunigte die Natur die Entwicklung des Kopf-Gehirns erheblich. Hier wurde ständig erweitert und ausgebaut. Die Großhirnrinde ist der am stärksten entwickelte Teil des Kopf-Gehirns. Unser Fortschritt hin zu mehr Leistung, Lernbereitschaft und komplexeren Fähigkeiten ist in erster Linie der Entwicklung der Großhirnrinde zu verdanken. Dieser jüngste Teil wird Neokortex genannt und existiert nur bei Säugetieren. Bei Menschen macht er knapp die Hälfte des Hirnvolumens aus.
Warum das menschliche Kopf-Gehirn derart rapide wuchs, ist in Expertenkreisen noch nicht völlig erforscht. Es gibt wohl verschiedene Gründe. Mehr dazu lesen wir noch später im Abschnitt »Unser Darm-Gehirn«. Es bleibt allerdings festzuhalten: Die Entwicklung des menschlichen Kopf-Gehirns verläuft schneller als die »normale« biologische Evolution des menschlichen Körpers. Dies ist bis heute eines der Kernprobleme geblieben. Eines dieser Probleme ist zum Beispiel, dass heute praktisch alle Geburten Frühgeburten sind. Dies wurde nötig, weil die Größe des Kopfschädels des Neugeborenen für den Geburtskanal der Frau zu groß geworden ist. Und der menschliche Körper hilft sich auf diese Weise mit einer Frühgeburt. Wir kommen später noch darauf zurück, welche unangenehmen Eigenschaften diese zu schnelle Entwicklung des Kopf-Gehirns hat.
Zur Verdeutlichung:
Vor fünf Millionen Jahren maß das Kopf-Gehirn unserer Vorfahren 500 ml. Vor zwei Millionen Jahren 700 ml. Vor einer Million bereits 900 ml. Und unser Homo sapiens von vor 300.000 Jahre besaß ein Hirn von 1.500 ml. Also exponentielles Wachstum. Aber nicht ausschließlich die Verbesserung der Ernährung ist der Grund für diese rasante Vergrößerung des Kopf-Gehirns. Forscher an amerikanischen Universitäten kommen zu dem Schluss, dass ein Gen mit dem Namen NOTCH2NL die Teilung von Stammzellen stark anregt und damit auch die Anzahl von Nervenzellen vergrößert. Und damit vergrößert sich das Gehirn. Bemerkenswert dabei ist, dass NOTCH2NL-Gene sich nur in menschlichen Zellen finden, nicht aber im Erbgut von Schimpansen, Gorillas und Orang-Utans.
Allerdings hatte diese rasche Entwicklung nicht nur Vorteile für den Menschen. Der Mensch zahlt einen hohen Preis für die beschleunigte Gehirnentwicklung. Und zwar in Form eines genomischen Kompromisses: Einerseits ermöglichen mehrere Kopien von NOTCH2NL einen Zugewinn in der Entwicklung des Gehirns, zugleich aber auch die Wahrscheinlichkeit unerwünschter Erbgutveränderungen. Und dies macht uns für neuropsychiatrische Entwicklungsstörungen anfällig.
Das Entscheidende dieser Entwicklung der beiden »Denkorgane« des Menschen ist jedoch: Unser ursprüngliches Darm-Gehirn, mit dem wir von Beginn des Lebens an alle wesentlichen Dinge regeln, ein System, das niemals schläft, veränderte sich im Lauf der Evolution nur sehr langsam wie die übrigen Teile des Menschen sich langsam weiterentwickelten. Nur das Kopf-Gehirn erlebte eine rasant schnelle Entwicklung. Diese Entwicklung ermöglichte unsere Erfolge und Fortschritte in Medizin und Technik. Wir werden später in Kapitel 3 noch lesen, welchen Entwicklungsschub und welche Folgen dies der Menschheit gebracht hat.
Zeitablauf der Evolution
Zum Schluss eine abschließende Betrachtung des Zeitablaufs der Evolution.
Vor 4,5 Milliarden Jahren: Entstehung der Erde.
Vor 3,9 Milliarden Jahren: Entstehung von Organismen, Beginn der Biologie.
Vor 2,4 Milliarden Jahren: Beginn der Photosynthese und Atmung, echte Zellen.
Vor 1,5 Milliarden Jahren: Wasser und Luft enthalten Sauerstoff. Pflanzliches Leben entsteht.
Jetzt wird es erst richtig interessant:
Vor 400 Millionen Jahren: Erste Landtiere.
Vor 250 Millionen Jahren: Die Saurier entstehen.
Vor 200 Millionen Jahren: Erste Säugetiere.
Vor 60 Millionen Jahren: Erste Großsäuger.
Vor 2,5 Millionen Jahren: Erste Frühmenschen: Homo erectus.
Vor 300.000 Jahren: Homo sapiens entwickelt sich in Afrika.
Vor 100.000 Jahren: Homo sapiens verlässt Afrika.
Vor 40.000 Jahren: Homo sapiens erreicht Australien und Europa.
Vor 30.000 Jahren: Homo sapiens verdrängt den Neandertaler.
Vor 12.000 Jahren: Der Mensch wird sesshaft.
Wenn wir versuchen, diese Evolution von 4,5 Milliarden Jahren bis heute auf einem Lineal von zehn Metern darzustellen, so spielt sich die Entwicklung des Menschen erst auf den letzten Millimetern ab. Wir erkennen daraus, welche Bedeutung unsere Anwesenheit auf dem Planeten Erde hat. Wir sehen, dass der Aufenthalt des Menschen auf dieser Erde, gemessen an der Länge eines Zehn-Meter-Maßstabs nur wenige Millimeter gedauert hat. Allerdings hat unser bisher sehr kurzer Aufenthalt, trotz seiner kurzen Dauer, dramatische Formen angenommen.
Abbildung 1.1 Geraffte Zeitdarstellung der Erdentwicklung
Die erste Linie zeigt die gesamte Zeit der Erdentwicklung - 13,4 Milliarden Jahre an.
Die zweite Linie den Ausschnitt 300.000 Jahre.
Homo sapiens wird sesshaft
Hier an dieser Stelle möchte ich das Kapitel der Evolution des Homo sapiens abschließen.
Die Frage ist, warum der Mensch sesshaft wurde. Hier gibt es, wie nicht anders zu erwarten wäre, verschiedene Theorien. Eine besagt, dass nach Ende der Eiszeit im Nahen und Mittleren Osten furchtbare Landschaften entstanden, in denen nutzbare Pflanzen wie zum Beispiel Getreide wild wuchsen. Und damit war es für den Mensch einfacher, Kräuter und Pflanzen nicht mehr langwierig zu suchen, sondern im eigenen Garten anzubauen. Und so entstand im Nahen Osten eine blühende Kulturlandschaft. Dieser Länderbereich, angefangen im Nildelta, weiter über das Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris und hinunter bis zum Arabischen Golf hat die Form eines sichelförmigen Halbmonds und wird daher der »fruchtbare Halbmond« genannt. Und diese fruchtbare Region, gelegentlich auch »Wiege der Menschheit« genannt, ist heute zerrissen und krisengeschüttelt.
Zunächst – als Jäger und Sammler – lebte der Mensch in einer Welt des Überflusses. Es folgte der Schritt in die Welt des Ackerbaus. Dies war ein entscheidender Wendepunkt der Evolution, der Mensch wurde sesshaft. Die Menschen der Urzeit kannten noch kein Brot zum Essen und keine Kleidung.
Die absolut längste Zeit der Menschheitsgeschichte lebte der Mensch als nomadischer Jäger und Sammler. Eine verschwindend kleine Anzahl von Völkern lebt heute noch annähernd so wie unsere frühen Vorfahren. Jäger und Sammler lebten zu mehreren Familien in kleinen Gruppen. Jagen und sammeln erforderte große Territorien. Nur von Zeit zu Zeit kamen Mitglieder verschiedener Gruppen zusammen. Innerhalb der Gruppe lebten die Menschen im engen persönlichen Kontakt. In warmen Regionen waren sie unbekleidet. Materieller Besitz war klein. Allenfalls individuelle Fähigkeiten sorgten für Rangunterschiede. Ausgeprägte Hierarchien existierten genauso wenig wie Macht. Man teilte alle Ressourcen, insbesondere die Jagdbeute. Das Leben spielte sich weitgehend demokratisch ab. Entscheidungen fällte eine Gruppe gemeinsam.
Abschied aus dem Paradies
Die Bibel erzählt von der Vertreibung aus dem Paradies. Vielfach ist man heute der Ansicht, dass die Zeit, in der der Mensch als Jäger und Sammler lebte, dieses Paradies darstellt. Und es hat den Anschein, als stimmte das sogar. Schätzungen sagen, dass der Homo sapiens etwa zwei bis vier Stunden am Tag damit beschäftigt war, die Nahrung für sein Überleben zu ergattern. Es gab wohl auch Tage, an denen das nicht gelang, dann hatte man eben Hunger.
Im Gegensatz dazu jetzt der Wechsel zur Landwirtschaft. Wir erinnern uns an die Worte der Bibel anlässlich der Vertreibung aus dem Paradies: Im Schweiße des Angesichts sollst du dein Brot beschaffen. Das allein deutet die Vertreibung aus dem Paradies an. Und in der Tat müssen Bauern zumeist zehn Stunden am Tag hart arbeiten. Die Landwirtschaft war also wirklich ein schlechter Tausch. Der Autor Wolfgang Schmidbauer schreibt dazu: »Beim Erwachen hatte der Jäger und Sammler keine Angst zu verhungern. Aber er hatte Hunger. Der Bauer in späteren Zeiten dagegen hatte keinen Hunger, aber er hatte Angst, seinen gut gefüllten Kornspeicher zu verlieren.« Das bedeutet, der moderne Mensch tauschte Hunger gegen Angst, und das war ein schlechter Tausch, denn Angst ist heute ein weit verbreitetes Phänomen. Aber leider ist zusätzlich auch Hunger in weiten Teilen der Menschheit geblieben.
Natürlich können wir heute nicht mehr zurück in diese ehemals paradiesischen Zustände, dazu ist die Erde mit acht Milliarden Menschen einfach überbevölkert. Aber als Jäger und Sammler wären wir allerdings wohl nie auf die große Masse von acht Milliarden Menschen gewachsen. Diese Vermutung ist wie folgt begründet:
Während die meisten Jäger und Sammler auf der Nahrungssuche häufig von einem Ort zum anderen ziehen mussten, konnten Bauern stets in der Nähe ihre Felder und Obstgärten bestellen. Die daraus resultierende Sesshaftigkeit trägt zu höherer Bevölkerungsdichte bei, da sie kürzere Abstände zwischen zwei Geburten erlaubte. Bei Jägern und Sammlern konnte die Mutter beim Umzug zu einem anderen Lagerplatz außer ihrer spärlichen Habe nur ein Kind tragen. Den nächsten Spross konnte sie sich erst leisten, wenn der vorige schon schnell genug laufen konnte, um mit den Erwachsenen Schritt zu halten. Dies führte bei Jäger-und-Sammler-Kulturen in der Regel zu einem Abstand von mindestens vier Jahren zwischen zwei Geburten. Und folglich zu einem langsamen Anwachsen der Bevölkerung.
Die landwirtschaftliche Revolution
Ein Hauptmerkmal unserer Kultur ist die Landwirtschaft. Keiner unserer Verwandten unter den Primaten praktiziert etwas auch nur entfernt Vergleichbares. Ausnahme im Tierreich sind lediglich die Ameisen, die nicht nur die Domestikation von Pflanzen, sondern auch von Tieren pflegen. Ameisen verwenden bestimmte Pilze, die sie in Beeten im Inneren ihrer Nester anbauen. Statt normaler Erde verwenden sie dazu eine Art Kompost, bestehend aus Raupenkot und abgestorbenen Pflanzenteilen. Bei der Domestikation von Tieren verschaffen sich Ameisen den Honigtau, ein zuckerhaltiges Sekret von diversen Insekten, darunter Raupen, Blatt- und Schildläusen. Als Gegenleistung für den Honigtau schützen die Ameisen ihre »Milchkühe« vor natürlichen Feinden und Parasiten.
Aber wenn man Revolution sagt, hofft man meist, dass sich etwas zum Besseren ändert.
Vielfach ist man der Ansicht, dass der Mensch selbst aufgrund seiner Intelligenz die Landwirtschaft erfunden und entwickelt hat. Bei genauer Betrachtung ist es jedoch genau umgekehrt: In Wirklichkeit waren es die Pflanzen, die den Homo sapiens domestizierten. Vor 10.000 Jahren war der Weizen nur eines der vielen Wildgräser, die nur im Nahen Osten vorkamen. Innerhalb weniger Jahrtausende breitete er sich von dort über die gesamte Welt aus.





























