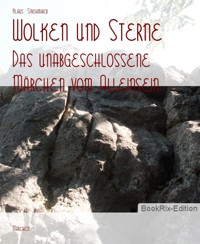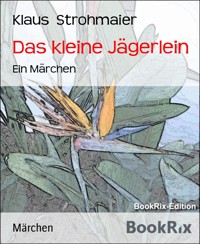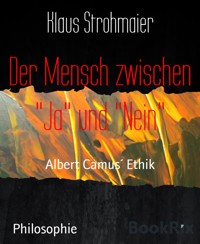
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wie kann ich in einer areligiösen nachchristlichen Welt leben? Soll oder muß ich überhaupt leben? Nihilismus und die Entdeckung des Absurden, dann auch deren Überwindung durch die Bewegung der Revolte sind die Themen, die Albert Camus zeitlebens umtrieben. Dieses kleine Büchlein möchte einen kurz gefassten Einstieg in Camus Denken bereitstellen, verbunden mit der Hoffnung, dem einen oder der andern Lust auf mehr Camus zu machen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Der Mensch zwischen "Ja" und "Nein"
Albert Camus´ Ethik
BookRix GmbH & Co. KG81371 München0. An Stelle eines Vorworts
"Die Vorstellung, pessimistisches Denken sei zwangsläufig mutlos, ist kindisch ... Die Schriftsteller ... haben bewiesen ..., daß in Ermangelung einer optimistischen Philosophie ihnen zumindest der Begriff Menschenpflicht nicht fremd war. Ein unvoreingenommener Geist würde also die Feststellung erlauben, daß eine negative Philosophie in der Praxis nicht unvereinbar ist mit einer Ethik der Freiheit und des Mutes. ... die Tatsache, daß bei ein paar Menschen eine Philosophie der Verneinung mit einer positiven Moral zusammenfällt, bildet in Wahrheit das große Problem, das unsere ganze Epoche schmerzlich erschüttert ... Wenn die Epoche an Nihilismus leidet, finden wir die Moral, die wir brauchen, nicht, indem wir den Nihilismus unter den Tisch wischen. Es läßt sich wahrhaftig nicht alles auf Verneinung oder Absurdität zurückführen. Das wissen wir wohl. Aber zuerst müssen die Probleme der Verneinung und der Absurdität gestellt werden, denn auf sie ist unsere Generation gestoßen und mit ihnen müssen wir fertigwerden."
(VdF, 29-31)
1. Einleitung
"Er wollte schlicht schildern,
daß es an den Menschen mehr
zu bewundern als zu verachten
gibt."
(DP, 251)
In dieser kleinen Studie soll der Frage nachgegangen werden, ob sich im Werk des humanistischen Schriftstellers Albert Camus, der nicht selten in die Reihe der Existenzphilosophen eingeordnet wird, eine (zumindest) implizite Ethik auffinden läßt, und was deren Gehalt darstellt.
Indem wir die drei (bzw. vier) berühmten Kant´schen Fragen (KrV, 677), welche die gesamte Philosophie umgreifen, als erkenntnisleitende Folie benutzen, wird sich zeigen, daß die Frage WAS KANN ICH WISSEN? pessimistisch eingeschätzt wird und in den Begriff des Absurden einmündet. Kants dritte Frage WAS DARF ICH HOFFEN? erhält einen durchweg negativen Bescheid, - in einer als gott-los gedachten Welt ist begründete Hoffnung nicht länger möglich. Mit diesen beiden Antworten - hoffnungslose Absurdität - umschreibt Camus die conditio humana (Kants vierte Frage WAS IST DER MENSCH?) und all sein Denken zielt auf die Frage ab: WAS SOLL ICH TUN?
"Für Camus kann es gar nicht so etwas wie einen sicheren Boden des Moralischen geben; eben darum kreist sein Denken immer wieder um die zentrale (ethische) Frage, wie man praktisch sein Leben führen kann angesichts der erfahrenen Absurdität der Welt." (GgP, 136)
2. Das Absurde als Ausgangspunkt
Albert Camus´ Philosophieren hebt an mit der Frage nach einem Sinn des Lebens überhaupt. Kann man, soll man, muß man leben als Mensch? Warum, wie und wozu? - Es gebe "nur ein wirklich ernstes philosophisches Problem: den Selbstmord" und "die Entscheidung, ob das Leben sich lohne oder nicht, beantwortet die Grundfrage der Philosophie." (Sis, 10)
Es ist also unabgemacht, ob der denkende Mensch überhaupt leben und nicht vielmehr sich töten solle, - eine ethische Fragestellung liegt noch in weiter Ferne.
Wie kommt Camus dazu, was veranlaßt ihn, so radikal und grundsätzlich zu fragen?
Im Vorwort zu DER MYTHOS VON SISYPHOS spricht er davon, daß er das Absurde betrachte, und zwar als Ausgangspunkt. Was er das Absurde nenne, sei die "Beschreibung eines geistigen Übels im Reinzustand." (Sis, 8)
Im Daseinsgefühl der Absurdität, das Camus auf den Begriff bringen will, erhebt sich für ihn die Sinnfrage - und in ihm muß sie auch beantwortet werden können.
Für das den Menschen ergreifende Gefühl der Absurdität, das dann auftauche, wenn die Warum-Frage gestellt und Überdruß am bisherigen, unreflektiert gebliebenen Leben als Bewußtseinsregung konstatiert werde (vgl. Sis, 19f), führt Camus mehrere Motivzusammenhänge an:
Einmal die Fremdheit des Einzelnen der sozialen Umwelt gegenüber (so thematisch in DER FREMDE), dann die Nichtigkeit des Menschen angesichts der übermächtigen Natur ("diese Dichte und diese Fremdartigkeit der Welt sind das Absurde." Sis, 22), die Unfähigkeit zu umfassender Erkenntnis, und nicht zuletzt das Bewußtsein des Todes, welches die Nutzlosigkeit allen Lebens erweise (vgl. Sis, 23).
Dies letztere, "die Konfrontierung mit dem Tod ... (sei, d.V.) ... die konzentrierteste Form der Begegnung mit dem Absurden." (Sis, 174)
Dieses übermächtige Gefühl des Absurden lokalisiert Camus im uneinlösbaren und nicht zu stillenden Verlangen des menschlichen Geistes nach gänzlichem Weltverstehen, nach Klarheit, nach Einheit, nach dem Absoluten (vgl. Sis, 24).
Einer begrifflichen Fassung dessen, was im Gefühl des Absurden gegeben ist, nähert er sich an, wenn er sagt: "Das Absurde entsteht aus dieser Gegenüberstellung des Menschen, der fragt, und der Welt, die vernunftwidrig schweigt ..." (Sis, 35); es ist evident aus dem "Zwiespalt zwischen dem sehnsüchtigen Geist und der enttäuschenden Welt ..." (Sis, 56).
So versucht er zum Ausdruck zu bringen, das, was er das Absurde nenne, sei weder im Menschen noch in der Welt enthalten, sondern ergebe sich erst durch die Gegenüberstellung dieser beiden Elemente (vgl. Sis, 37), durch deren "Zwiegespräch" (Sis, 35), und sei im Wesentlichen ein Konflikt.
Dieser Konflikt (das Absurde), notwendig gegeben in der Unvereinbarkeit des geistigen Verlangens nach Einheit bei gleichzeitigem Unvermögen, die Welt auf ein rationales Prinzip zurückzuführen, beruhe einzig auf dem Bewußtsein, das der Mensch von ihm habe (vgl. Sis, 57f).
Wenn Camus weiterhin formuliert: " Außerhalb eines menschlichen Geistes kann es nichts Absurdes geben. ,,, Es kann aber auch außerhalb dieser Welt nichts Absurdes geben. Und aus diesem grundlegenden Kriterium schließe ich, daß der Begriff des Absurden etwas Wesentliches ist und als meine erste Wahrheit gelten kann. ... Das einzig Gegebene ist für mich das Absurde" (Sis, 38), so dürfte Josef Speck nicht falsch liegen, wenn er das Absurde als "Apriori" und "Ausgangspunkt" des Camus´schen Denkens bezeichnet (GgP, 135). Und wenn er fortfährt: "Die fundamentale Bedeutung des Absurden liegt darin, daß es nach Camus die Bedingung menschlicher Existenz ist" (GgP, 141), so wird man ihm nach dem bisher Festgestellten zustimmen dürfen.