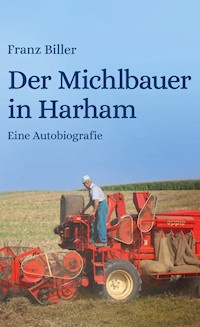
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Mitten im Zweiten Weltkrieg wird Franz Biller auf dem Michlbauerhof im niederbayerischen Landkreis Passau geboren. Seine Kindheit endet abrupt, als der Vater überraschend stirbt. Franz wird mit 14 Jahren Bauer. Er erzählt von einer entbehrungsreichen Zeit, dem Einmarsch der Amerikaner, kindlichem Leichtsinn und Entscheidungen, die den Jahrhunderte alten Hof bis heute bewahren. Seine beeindruckende Sammlung antiker Motoren, Traktoren und bäuerlicher Gerätschaften sucht ihresgleichen. Die Autobiografie des Michlbauers behütet wertvolles Wissen für nachfolgende Generationen und macht deutlich: Das Glück liegt in den kleinen Dingen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 115
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALTSVERZEICHNIS
Wie alles begann
Kriegsjahre und der frühe Tod des Vaters
Inflation und Schwarzmarkt
Von Beichtzetteln und strengen Pfarrern
Abschied vom Vater
Mit 14 plötzlich Bauer
„Im Krankenhaus sterben die Leute“
Surfleisch, Kraut und Rohrnudeln
Ein typischer Junggeselle
Antonies Erinnerungen „Mein Leben mit Franz“
„Alle dei manta!“
Antonie
Moderne Zeiten brechen an
Zukunftsweisende Entscheidungen
Motoren & viele alte Sachen
Mit Sturzhelm und Dachrinne
Raritäten und allerlei Besonderheiten. Ein kleiner Rundgang durch meine Sammlung
Nicht ganz ungefährlich: Wissenswertes über alte Motoren
Über die Imkerei
Renovierung des alten Hauses
Die Lourdesgrotte
Familie & Co. Was andere über Franz sagen
Die Gegenwart
Chronik Michlbauerhof
Die heutige Generation
WIE ALLES BEGANN
Schon bei meiner Geburt hat es lustig angefangen. Ich bin an einem 29. Februar im Schaltjahr 1940 zur Welt gekommen, hier auf dem Michlbauerhof, an einem Tag, der nur alle vier Jahre vorkommt. Ein Freund erzählte mir, es sei damals Gesetz gewesen, dass die Vormittagsgeburten einen Tag zurückdatiert und die Nachmittagsgeburten auf den 1. März vorverlegt werden. Ob es tatsächlich so war, weiß ich nicht – nur, dass ich meinen Geburtstag seit jeher am 28. feiere. Heute kann das sowieso niemand mehr bezeugen, denn es wurde nichts dazu aufgeschrieben. Meine Mutter erzählte mir aber, die Hebamme habe den 28. Februar befürwortet. Sie meinte, der Bub hätte sonst nur alle vier Jahre Geburtstag, das wäre ja nichts. Mir persönlich ist das Datum ziemlich egal. Ich bin nicht abergläubisch oder so, mir darf man gerne einen Tag vor meinem eigentlichen Geburtstag gratulieren. Ich habe deswegen in meinem Leben kein Unglück gesehen.
Wie damals üblich, erblickte ich in keinem Krankenhaus das Licht der Welt, sondern als Hausgeburt, genauso wie meine beiden Schwestern Resi und Helga. Die Hebamme, Frau Meyer aus Malching, war in der Region sehr angesehen und hat viel gegolten. Sie ist immer mit dem Radl gefahren, ihre große, schwere Tasche hatte sie hinten auf den Gepäckträger geschnallt. Im Winter, wenn viel Schnee lag, wurde sie von den Bauern mit Ross und Schlitten abgeholt.
Mein Geburtshaus, den Michlbauerhof, habe ich nie verlassen. Ich war zu keiner Zeit länger weg und auch nicht beim Barras. 1960 musste ich zwar in den Räumen der Grundschule in Pocking zur Musterung antreten, habe mich jedoch zurückstellen lassen, da zu dieser Zeit der Vater schon nicht mehr gelebt hat und ich mich um den Hof kümmern musste. Außer mir war ja kein Bauer da, wir hatten keinen Schlepperfahrer oder andere Helfer. Keine Ahnung, wie das ohne mich gegangen wäre. Ich erinnere mich noch gut, dass die Musterungsärzte sehr streng waren und keinen Spaß verstanden. Als ich an eine Schultafel schrieb: „1940 brachte uns der Storch, 1960 holte uns der Strauß1“, wurde einer der Ärzte richtig narrisch und drohte: „Wir werden euch schon noch was beibringen!“ Das war wirklich eine andere Welt für mich.
Ein Jahr später bekam ich die Nachricht, ich müsse mich jetzt für den Wehrdienst bereithalten. Na gut, dachte ich mir, dann komme ich wenigstens mal weg und sehe was anderes. Aber ich hörte nie wieder etwas. Bis heute habe ich die Briefe vom Kreiswehrersatzamt Deggendorf aufbewahrt.
Den Michlbauerhof haben meine Großeltern väterlicherseits im Jahr 1906 für 30.000 Mark gekauft. Kreszenz und Johann Biller kamen beide aus der Landwirtschaft und hatten bereits ein eigenes Anwesen in Rotthalmünster. Doch der Hof war viel zu klein, um die fünf Kinder Maria, Anna, Theresia, Johann und Franz mit Arbeit zu versorgen, denn zu dieser Zeit gab es für die Menschen kaum eine gute Anstellung. Also verkauften sie das alte Gehöft für 15.000 Mark und zogen auf den Michlbauerhof. Sie schafften sich etwas Größeres an, damit ihre Söhne und Töchter eine Arbeit hatten. So war das damals.
Zu dieser Zeit waren Rösser, die als Zug- und Arbeitstiere eingesetzt wurden, sehr wichtig für die Bauern. Ich selbst habe schon mit 14 Jahren mit dem Pflug geackert. Wir hatten insgesamt vier Pferde zum Einspannen, Kaltund Warmblüter, und meist noch zwei Jährlinge im Stall. Wenn ich mich heute mit anderen Bauern am Stammtisch unterhalte, sind wir uns einig, dass die Arbeit mit den Rössern viel schöner war als heute mit dem Bulldog – da kann jemand sagen, was er mag. Wir haben den Pflug ja nicht selbst ziehen müssen, sondern gingen hinter den Pferden her. Es war absolut still und wenn der Pflug die Wurzeln abriss, hörte ich es knacken. Dabei ließ ich meinen Blick in die Ferne schweifen und sah mir die Gegend an. Es war gut und ganz anders als heute.
Natürlich stand ich für diese Arbeit immer sehr früh am Morgen auf, meist gegen halb 4 Uhr. Die Rösser mussten vor der Arbeit erst einmal gefüttert und eingespannt werden, das hat gedauert. An manchen Nachmittagen, wenn alles erledigt war, bin ich auch mal ein paar Stunden ausgeritten. Was hätte ich sonst auch unternehmen können? Es gab ja keine Freizeitbeschäftigungen, wir hatten kein Fahrzeug und kein Geld. Wenn er noch gelebt hätte, wäre der Vater bestimmt dagegen gewesen, denn ein Tier sollte sich genauso wie der Mensch von der Arbeit ausruhen können. Aber ich war jung und habe davon nichts verstanden.
Als Kind und Jugendlicher war das Weggehen kein großes Thema bei mir, denn es gab viel zu viel Arbeit, um sich darüber Gedanken zu machen. Freizeit hatten wir nur am Sonntag nach der Kirche bis um halb fünf Uhr am Nachmittag. Manchmal bin ich dann mit Gleichaltrigen zum Wirt nach Halmstein gefahren. Teuer war es dort nicht, eine Knacker hat 20 Pfennig und eine Semmel ein Fünferl gekostet. Wir haben nicht viel gebraucht damals. Oft sind wir auch nur in der Gegend rumgerannt und haben leider auch Sachen angestellt, die nicht gut waren. Ich weiß noch, dass es auf dem Weg nach Rotthalmünster viele große Birnbäume mit Vogelnestern gab. Wer am meisten Schneid hatte, ist hochgekraxelt, hat die jungen Vögel aus den Nestern geholt und sie an die Katzen verfüttert. Das war so eine Art Mutprobe unter uns. Manchmal haben wir auch Fußball gespielt.
Freilich musste ich schon als Bub während der Schulzeit bei der Ernte mitarbeiten. Ich war dafür zuständig, die vielen Helfer auf dem Feld, etwa sieben bis acht Frauen und Männer, mit Wasser zu versorgen. Meistens war es sehr heiß und die Leute hatten Durst. Mit einem großen Krug schöpfte ich lange im Brunnen, bis das Wasser kalt war, dann schleppte ich den vollen Krug aufs Feld. Es passten etwa fünf Liter hinein, er war dementsprechend schwer und ich musste mich anstrengen. Ich lief barfuß über das abgemähte und stoppelige Feld und habe die Zehen eingezogen, damit es nicht so sticht, denn meine Schuhe durfte ich für diese Arbeit nicht anziehen. Rasch war der Krug leergetrunken, ich lief wieder zurück zum Brunnen, füllte ihn auf, brachte ihn wieder aufs Feld – so habe ich ganze Nachmittage verbracht.
Mit Vater und Mutter sowie meinen beiden Schwestern Resi und Helga, um 1946.
Auch beim Auflegen der Garben, also wenn die zusammengebündelten Rollen aus Getreide oder Heu auf den Wagen gepackt und nach Hause in den Stadl gefahren wurden, musste ich mithelfen. Ich führte die Rösser am Zaum, so dass sich die Erntehelfer nur ums Auflegen kümmern mussten. Natürlich war das Kinderarbeit und ich hätte lieber was anderes gemacht.
1 Gemeint ist der CSU-Politiker Franz Josef Strauß, von 1956 bis 1962 Bundesminister der Verteidigung.
KRIEGSJAHRE UND DER FRÜHE TOD DES VATERS
Als ich 14 war, starb der Vater – mit gerade mal 59 Jahren. 1895 geboren, hat Franz Biller zwei Kriege miterlebt und musste schon als 19-Jähriger in den Ersten Weltkrieg ziehen. Die Strapazen und schlimmen Erlebnisse an der Front haben ihn sehr mitgenommen und geprägt. Ich glaube, deswegen ist er so früh gestorben. Er hatte eine schlimme Verletzung erlitten – von hinten wurde ihm unter den Helm in den Kopf geschossen. Über seine Zeit im Ersten Weltkrieg hat der Vater Tagebuch geführt. Ich habe alles gelesen. Als Hitler später an der Macht war und der Zweite Weltkrieg vor der Tür stand, wurde bestimmt: „Für den Polen-Feldzug2 nehmen wir die Alten her.“ Und so musste der Vater, er war damals schon 44 Jahre, wieder an die Front. Doch dieser „Blitzangriff“ dauerte nur wenige Wochen und so konnte er bald wieder heimkehren und während des gesamten Zweiten Weltkrieges den Hof selbst bewirtschaften.
Ich erinnere mich noch gut an Maria und Pollek, zwei junge polnische Gefangene, die von 1940 bis 1945 bei uns als Vollarbeitskräfte eingesetzt waren. Wie viele Hunderttausende Zwangsarbeiter wurden die beiden von deutschen Soldaten aus ihrem Land verschleppt und den Bauernhöfen zugeteilt, um die zur Wehrmacht eingezogenen Männer zu ersetzen. Die Landwirtschaft hatte damals oberste Priorität und war äußerst wichtig für die Versorgung der Soldaten und der Bevölkerung. Besonders mit Maria, die damals etwa 16 Jahre alt war, hatten wir Kinder ein freundschaftliches Verhältnis und eine große Gaudi, was natürlich von den Nazis nicht erlaubt war.
Als die Amerikaner 1945 einmarschierten und in unser Haus kamen, wurden Maria und Pollek gefragt, wie es ihnen bei uns ergangen ist und wie sie all die Jahre behandelt wurden. Ein Dolmetscher übersetzte und ich weiß noch genau, wie ich als kleiner Bub staunend danebenstand. Ich war zutiefst beeindruckt von den Amerikanern. Sie waren geschniegelt und gebügelt und hatten perfekte Falten in den Hosen. So etwas hatte ich vorher noch nie gesehen! Danach gingen Maria und Pollek weg. Sie heirateten und zogen nach Australien. In den 1970er-Jahren hat uns Pollek noch einmal auf dem Michlbauerhof besucht. Er erzählte, dass er nach dem Krieg nicht zurück nach Polen wollte, da ihm der Kommunismus nicht gefallen habe. Auch in Deutschland wollte er nach all den Erlebnissen mit den Nazis nicht bleiben. Das konnte ich gut verstehen. Ich möchte nicht wissen, was Maria und Pollek bei ihrer Verschleppung alles erleiden mussten. Das prägt natürlich.
Für uns Kinder war der Krieg dagegen nicht schlimm. Als Bauern hatten wir immer genug zu essen und die Geschehnisse rund um den Hof fanden wir abenteuerlich. Direkt bei uns hat es keine Bombeneinschläge gegeben, wohl aber ein paar Kilometer weiter in Kirchham-Waldstadt. Wir beobachteten, wie die Flugzeuge über das Inntal geflogen kamen, es plötzlich laut krachte und Rauch nach oben stieg. Natürlich wussten wir Kinder nicht, was da genau vor sich ging. Als ich meinen Vater fragte, gab er mir zur Antwort: „Die Flugzeuge machen diesen Lärm, damit die Schafe lieber heimgehen.“ Das habe ich geglaubt und nicht weiter nachgefragt.
Die Erwachsenen verboten uns zwar, ins Freie zu gehen, wir schlichen uns aber trotzdem raus. Wir Kinder hatten keine Angst und die Eltern haben uns auch keine Angst gemacht. Warum das so war, weiß ich nicht. Zur Hitlerzeit wurde nicht viel gesprochen, man hat ja nichts Falsches sagen dürfen, denn Gegner des Nazi-Regimes wurden verhaftet und eingesperrt. Hätten die Kinder kritische Äußerungen der Eltern weitererzählt, wären Vater und Mutter abgeholt worden. Es war ein völlig anderes Klima als heute und es gab viele Regeln, an die man sich halten musste, wie zum Beispiel die Anordnung der Verdunkelung3: Wenn es Abend wurde und die Leute das Licht in der Stube anmachten, befestigten sie mit Nägeln blickdichte Holzmatten oder eine Art steifes Butterpapier im Fensterrahmen – jeder hatte hier seine eigene Technik entwickelt. Natürlich wurde kontrolliert, ob die Vorschrift auch befolgt wurde: Von der Gemeinde beauftragte Personen schlichen in der Nacht herum. Sie lauschten auch an den Türen, denn es hätte ja sein können, dass jemand über Hitler schimpft und der wäre dann hingehängt worden. Ich glaube aber, dass es hier bei uns nicht ganz so genau zuging. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als wir unser erstes Radiogerät bekamen, einen kleinen Volksempfänger. Ein befreundeter Elektriker brachte ihn abends mal vorbei. Er wurde auf ein Kastl in der Küche gestellt und leise eingeschaltet. Alle standen um ihn herum und schüttelten über das Gehörte den Kopf, so in der Art: „Krampf da!“ Was genau gesagt wurde, weiß ich nicht mehr. Aber ich dachte mir: „Was sie da hören, passt ihnen nicht.“
Hier in der Gegend gab es schon viele Hitler-Anhänger. Sie genossen ihre Rechte und Vorteile, denn für die normalen Bürger war alles genau reglementiert. Für uns Bauern gab es eine Ablieferungspflicht bei der Molkerei in Rotthalmünster. Es wurde exakt aufgeschrieben und kontrolliert, wie viele Liter Milch unsere Kühe geben, wie viel davon unserer Familie zusteht und wie viel wir abgeben müssen. Doch wir hatten eine schlaue Magd, die hat die Kontrolleure ausgetrickst. Sie molk die Kühe nicht ganz aus, so dass weniger erfasst wurde. Auf diese Weise hatten wir selbst mehr Milch zur Verfügung. Die Mutter hat daraus Butter gemacht und dann hieß es: „Jetzt essen wir gscheid!“
Solche Kontrolleure hatten große Macht. Man musste sie jederzeit ins Haus und in jedes Zimmer lassen. Sie brauchten nicht mal einen Ausweis zeigen. Doch die Leute wussten sich zu helfen und haben Nahrungsmittel und andere wichtige Sachen vor ihnen versteckt. Meine Eltern hatten jede Menge Schmalzvorräte, die sie in großen Blechgefäßen an einer trockenen Stelle vergruben. Ich habe das erst nach dem Krieg mitbekommen, als sie wieder ausgebuddelt wurden. Als es nach dem Krieg zur Entnazifizierung4 kam, wurden auch einige mir bekannte Leute eingesperrt. Dabei ist mir aufgefallen, dass viele von ihnen später Mitglied bei der CSU waren. Ich denke, dass viele Leute die Anschauung haben: „Recht ist, was mir nützt!“ Sie sind für diese oder jene Partei, weil sie sich einen Vorteil davon versprechen.





























