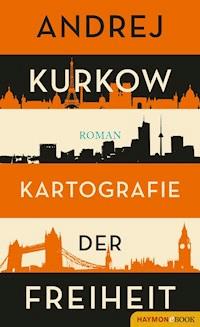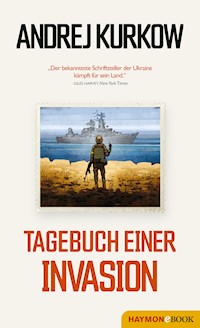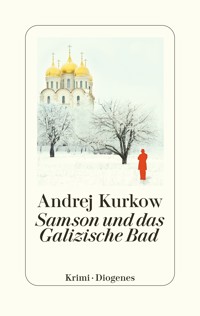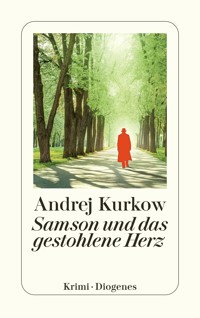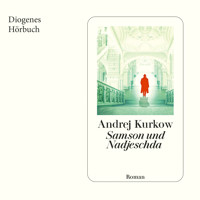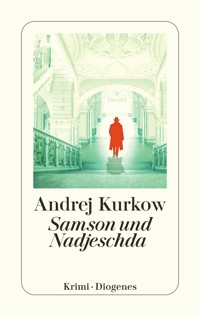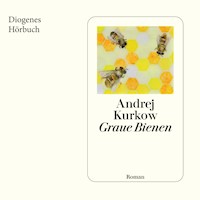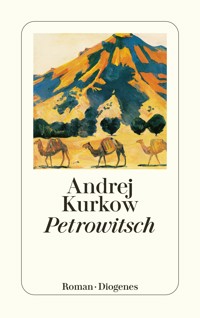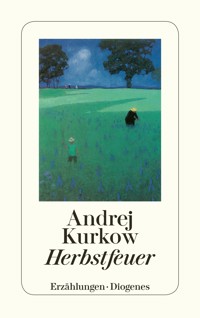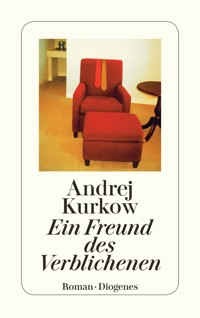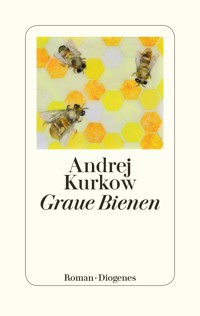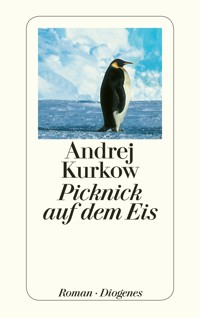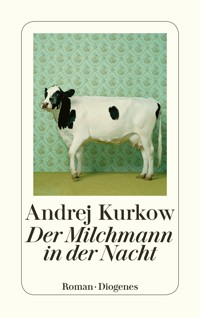
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
›Der Milchmann in der Nacht‹ ist dreifache Liebesgeschichte, schwarze Komödie, Krimi und politische Satire zugleich – ein Roman mit so vielen Pointen, Wendungen und Geschichten wie Sterne in der Milchstraße.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 597
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Andrej Kurkow
Der Milchmannin der Nacht
Roman
Aus dem Russischenvon Sabine Grebing
Titel der 2009 im Folio-Verlag, Charkow,
erschienenen Originalausgabe:
›Nočnoj Moločnik‹
Die deutsche Erstausgabe erschien 2009
im Diogenes Verlag
Umschlagillustration von Catherine Ledner
Copyright © Catherine Ledner/Stone+/Getty Images
All rights reserved
Alle Rechte vorbehalten
Copyright © 2014
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 257 24056 6 (3.Auflage)
ISBN E-Book 978 3 257 60602 7
Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.
[5] 1
Kiewer Gebiet. Makarower Bezirk. Dorf Lipowka.
Am Winterhimmel hing einsam die von den Menschen unbeachtete Milchstraße. Die Nacht war ungeheuer still, kein Hund bellte, als hätte der tiefhängende Sternenhimmel sie alle eingeschläfert. Nur Irina schlief die ganze Nacht nicht und lauschte auf ihre seit dem Abend schmerzende Brust. Still lag sie da und lauschte auf den Schmerz, wollte aber keinen stören und stieg nicht aus dem Bett, damit es bloß Jasja mit seinem Knarren nicht weckte. Kurz nach vier stand sie auf, wie gewöhnlich, brachte Wasser im Kessel zum Kochen, rührte die Fertigmilchmischung ›Malysch‹ im Literglas an und ließ es oben auf dem leise summenden alten Heizkessel in der kleinen Heizkammer stehen. Von der Decke wehte der süßliche Geruch der schon getrockneten, am Vorabend dort aufgehängten Babykleidung und Stoffwindeln.
Ehe sie ging, küsste Irina ihre drei Monate alte Tochter, die selig in der Ecke der gemütlichen Schlafkammer schlummerte, direkt unter der Ikone des heiligen Gottesknechtes Nikolaj. Dann sah sie noch bei der Mutter herein und flüsterte: »Ich gehe!«, worauf die Mutter nickte und die Hand zum Nachttischchen mit der Lampe ausstreckte.
Draußen blickte Irina zurück auf ihr Elternhaus: ordentlich, einstöckig, aus Stein, mit eigenen Händen vom [6] kürzlich erst an der kranken Leber gestorbenen Vater gebaut. In einem der Fenster zur Straße brannte gedämpftes Licht. Ächzend und vor sich hinbrummelnd suchte Irinas Mutter ihre alten Pantoffeln unterm eisernen Bettgestell. Das Drahtgeflecht knarrte, aber von alldem hörte und sah Irina schon nichts mehr.
Früher hatten sie das Haus mit Holz beheizt, und als kleines Mädchen hatte sie furchtbar gern dem in den Abendhimmel aufsteigenden grauen Rauch nachgesehen. Doch als sie den Heizkessel bekamen, hatte der Vater den Ofen auseinandergenommen. Im Haus war nun mehr Platz, aber der Schornstein auf dem Dach war tot. Und auch jetzt, an dunklen Wintermorgen, fehlte dem Häuschen so sehr dieser in den Himmel aufsteigende Rauch!
Der Schnee knirschte unter den Füßen. Irina eilte zur Straße, um den ersten Bus nach Kiew nicht zu verpassen. Alle darin kannten sich und den Fahrer Wassja und wussten, dass seine Frau ihn verlassen hatte. Sie war zum Nachbarn gegangen, der war Schweißer, Baptist und trank nicht.
Auf der Straße tauchten die warmen, gelben Scheinwerferkreise des Kleinbusses auf, kaum dass Irina sich hingestellt hatte. Der Bus bremste, dafür brauchte Irina nicht mal die Hand zu heben.
Drinnen war es warm und still. Pjotr Sergejewitsch, Wächter auf irgendeiner Kiewer Baustelle, schlief einfach, den Kopf auf die Schulter gelegt. Die übrigen Passagiere saßen da und dösten vor sich hin. Irina nickte den Mitfahrern zu, die den verschlafenen Blick zu ihr hoben, und setzte sich an die Tür. Die Brust tat immer noch weh, doch Irina versuchte, es nicht weiter zu beachten.
[7] In einer Stunde würde der Kleinbus sie alle an der Metrostation Schitomirskaja absetzen, und dann würde sie auf die erste U-Bahn warten, um weiterzufahren. Dorthin, wo man auf sie wartete und wo man sie bezahlte.
2
Kiew. Winternacht.
Es gibt Geschichten, die beginnen eines Tages und gehen nie zu Ende. Sie können einfach nicht enden, weil sie mit ihrem Beginn Dutzende einzelner Geschichten hervorbringen, von denen jede ihre Fortsetzung hat. Wie wenn ein Stein in eine Windschutzscheibe schlägt: Die Risse laufen nach allen Seiten, und mit jedem Schlagloch in der Straße wird mal der eine Riss, mal der andere länger. So begann auch diese Geschichte in einer Winternacht und setzt sich bis heute fort. Jetzt kennen wir nur ihren Anfang. Und bis Sie die Geschichte zu Ende lesen, erweist sich ihr Ende gerade als ihre Mitte. Wir holen die Geschichten nicht ein, dafür ist das Leben nicht lang genug.
Womit jedoch alles anfing, ist bekannt. Es geschah nachts in Kiew, an der Ecke Streletzkaja-Straße und Jaroslaw-Wall, direkt am Hotel ›Radisson‹, an eben der Ecke, an der ein Unbekannter noch immer jede Nacht seinen rosafarbenen Hummer-Jeep abstellt. Eigentlich begann es genau in dem engen Durchgang zwischen dem halb auf dem Gehweg geparkten Hummer und der Wand des kürzlich erst, letztes Jahr vielleicht, eröffneten Eckcafés ›Schkwarotschka‹.
[8] Zu dieser Ecke kam in tiefer Nacht über den Jaroslaw-Wall vom Goldenen Tor her der Apotheker und leidenschaftliche Pilzesammler Eduard Iwanowitsch Sarwasin. Er war in merkwürdiger Verfassung, trug herbstliche Kleidung, Regenmantel und Hut. Im Licht der nächtlichen Laternen glänzten spitze Lackschuhe an seinen Füßen. Dabei war es nicht Herbst, sondern Winter, Mitte Januar! Und im nächtlichen Laternenlicht glitzerte alles, besonders aber Eis und Schnee. Eduard Iwanowitsch ging ohne Eile, als hätte er kein anderes Ziel, als in der ruhigen Kiewer Winternacht durch die menschenleeren, das Auge mit ihrer Reglosigkeit erfreuenden Straßen des sogenannten ›stillen Zentrums‹ zu spazieren.
Zur selben Zeit näherte sich auf der Streletzkaja ebendieser Ecke mit ziemlich eiligen, nervösen Schritten eine dreißigjährige Frau im langen, doch leichten, zwei Jahre zuvor im Sommerschlussverkauf von einem inzwischen längst vergessenen Liebhaber gekauften Fuchspelzmantel. Ihr goldenes Haar reagierte zart mit einem ganz eigenen, kaum merklichen Glanz auf die sanfte nächtliche Beleuchtung. Ihre zierliche, gerade Nase war vom leichten Frost gerötet, vielleicht aber auch von einem leichten Schnupfen. Doch nein: Schöne Frauen haben keinen Schnupfen, wenigstens nicht auf der Straße und dazu nachts.
Die junge Frau blieb einen Augenblick vor der Norwegischen Botschaft stehen und las die Bekanntmachung für die Annahmezeiten von Visa-Anträgen. Sie brauchte übrigens gar kein norwegisches Visum. Sie gehörte nur zu jenen verträumten Gestalten, die gern die Namen von Straßen, Läden, Cafés und Restaurants lesen, noch länger aber [9] bei handgeschriebenen Anzeigen der Sorte »Kätzchen entlaufen« verweilen.
Als sie weiterging, überquerte gerade ein durchtrainierter, etwa vierzigjähriger Mann in dunkelblauer Jacke, Jeans und Turnschuhen die Streletzkaja von der Seite des Hotels Radisson her. Sein Blick fixierte die winterliche Straße mit dem Gleichmut einer Webcam. Selbst der ihm entgegenkommende Mann in Hut und Regenmantel weckte bei ihm nicht das geringste Interesse. Der Mann mit Hut aber blieb stehen, als hinter dem rosafarbenen Hummer an der Ecke die Frau mit dem goldenen Haar hervortrat. Ein Messer glänzte in seiner Hand.
Die Frau bemerkte diesen Glanz, erstarrte zwei Schritte vor dem Menschen im Regenmantel und schrie. Der Mann in der blauen Jacke sprang hin, um die zu Tode erschrockene Frau im Pelz in letzter Sekunde, wie ihm schien, zu retten. Die Unbekannte drückte sich fassungslos mit dem Rücken an die Wand des Cafés, als der Blaubejackte sie bei der Hand nahm und mit sich fortzog. Sie konnte sich nur noch umdrehen und auf dem verschneiten Gehweg zwischen dem Hummer und dem Café den reglos liegenden Körper sehen, daneben das Messer, das nicht mehr glänzte. Der Mann in der Jacke eilte die Iwan-Franko-Straße hinunter und zog die Frau hinter sich her. Er presste ihre Hand fest, sah sich von Zeit zu Zeit um und drängte sie vorwärts, mit Blick und Lippen, die stumm riefen: »Los!«. Die hohen Absätze ihrer italienischen Stiefelchen behinderten sie beim Laufen. Der offene Pelzmantel umwehte sie wie die Flagge eines geheimnisvollen winterlichen Landes, und in ihren Augen stand, wie eingefroren, das Erstaunen.
[10] 3
Flughafen Borispol. Morgen.
Muntere Menschen gibt es immer. So summte auch Zollhundeführer Dmitri Kowalenko, als er mit seinem Schäferhund Schamil die Reihen des registrierten Gepäcks abging, das zur Tageszeit völlig unpassende Liedchen Not gonna get us der beiden Mädchen aus dem Fernsehen vor sich hin. Seit vier Uhr morgens schnüffelte Schamil an Koffern und Taschen. Bei Schichtbeginn hatten seine Augen geleuchtet, geglänzt, gebrannt vor Diensteifer, doch nach drei Stunden Arbeit war der Eifer verschwunden. Schamil wartete nur auf das Ende der Hundeschicht.
Wie zum Trotz erwiesen sich die Flugpassagiere an diesem Morgen als ungeheuer gesetzestreu. Nach Drogen roch es in ihrem Gepäck nicht mal von fern. Und wie gern hätte der Schäferhund seinem Herrchen eine Freude gemacht, dessen Blick das Wort ›Eifer‹ gar nicht zu kennen schien. Wie gern wollte er, dass er zu gähnen aufhörte.
Aber sein Herr gähnte an diesem Morgen nicht aus dienstlicher Langeweile, sondern aus einem echten Bedürfnis heraus. Letzte Nacht hatte er nicht ausschlafen können, er war direkt von der Festtafel zur Arbeit gekommen. Seine kleine Schwester Nadja war fünfundzwanzig geworden, das hatten sie nach Kräften und bis zum Morgen gefeiert. Etwa zwanzig Gäste waren es gewesen, alles eigene Leute, Verwandte. Sie hatten getrunken, gegessen und sich mit Karaoke vergnügt. Und wegen dieses Karaoke hatte sich auch das Liedchen in ihm festgesetzt – darüber, dass man sie ›nicht kriegte‹.
[11] ›Wer will euch denn auch, zum Teufel?‹, dachte Dima erbost über die beiden kleinen Sängerinnen, doch er schaffte es einfach nicht, das Liedchen aus dem Kopf zu vertreiben.
Schamil sog weiter mit feuchter Nase Gerüche aus Koffern und Taschen, und plötzlich weckte ein völlig neuer, ungewohnter Duft seine Aufmerksamkeit.
Er kam von einem schwarzen Plastikkoffer auf Rollen. Der Koffer war neu, auch das schwang mit im Geruch, doch außer durch Neuheit hob sich sein Duft durch eine seltsame, schwere, ungute Fröhlichkeit ab. Schamil bellte nicht munter und anfeuernd, wie sonst in solchen Fällen, sondern sah sich bestürzt nach seinem Herrchen um, das ebenfalls stehengeblieben war, aber zum anderen Ende der Gepäckabteilung blickte. Dorthin, wo am offenen Tor bei dem schon mit Koffern beladenen Karren die beiden Gepäckträger Boris und Schenja in ihren grünen Overalls warteten. Sie standen da, rauchten und unterhielten sich friedlich über irgendwas.
Boris, mit bis ans Kinn herunterhängendem buschigem Schnauzbart, warf einen Blick auf den an Ort und Stelle erstarrten Hundeführer und seinen Hund. Er verstummte und beobachtete. Der zweite, Schenja, drehte sich ebenfalls um.
»O Mann! Er hat was erwischt«, sagte Schenja.
»Ohne uns, der Reibach«, nickte Boris traurig und seufzte. »Einmal so einen Koffer schnappen, und man könnte die Arbeit für immer sausenlassen.«
Sie warfen ihre Kippen auf den Boden, traten sie mit den Spitzen ihrer schweren schwarzen Schuhe nach allen Regeln des Brandschutzes aus und gingen hinüber zu Dima.
»Na, und jetzt?«, fragte der schnauzbärtige Boris den [12] Hundeführer. »Übergibst du die Beute wieder deiner bescheuerten Chefetage, damit sie von ihren BMWS auf Lexus umsteigen können?«
Beide starrten Dima mit schweren, fragenden Blicken an. Beide waren solide Männer jenseits der fünfzig.
»Was soll ich denn sonst machen?«, sagte Dima achselzuckend.
»Der Hund erzählt nichts«, bemerkte Boris versonnen. »Wir helfen ihm, das bewachte Gelände zu verlassen.« Er nickte Richtung Koffer.
»Und seinen Besitzer retten wir vor dem Gefängnis«, ergänzte der zweite. »Noch eine gute Tat!«
Dima wurde nervös. Sein Körper hatte es schon schwer, nach der schlaflosen Nacht, und jetzt begann auch die Seele noch dumpf zu schmerzen. Und das Lied darüber, dass man sie ›nicht kriegte‹, drängte sich ihm immer noch auf die Zunge.
»Also, was ist jetzt?«, verlangte der Schnauzbart Klarheit von ihm.
Dima beschloss, sich auf einen Rutsch aller Probleme zu entledigen, und winkte entschlossen Zustimmung.
Gepäckträger Boris nickte, zog ein Stück Kreide aus der Overalltasche und malte ein Häkchen auf den Koffer.
Schamil spürte etwas Ungutes und sah seinen Herrn von unten herauf an.
»Was guckst du so? Weiter!«, befahl Dima ärgerlich. »Du bist zum Schnüffeln da, nicht zum Gucken!«
Doch Schamil begriff nicht, wieso sein Herrchen den Koffer nicht herausnahm. Gewöhnlich zog er in solchen Fällen ein Funkgerät aus der Brusttasche und sagte Worte [13] hinein, die nicht in den Bestand der Hundekommandos gehörten und Schamil daher unverständlich waren. Aber sonst eilten dann immer ein paar Männer herbei, von denen einer mit dem Scanner den Strichcode des Gepäckschildchens ablas und die anderen schnell den Koffer nahmen und forttrugen.
»Was ist, hast du nicht verstanden?«, schrie Dima den Hund an. »Los, an die Arbeit!«
Schamil verstand, dass er weitermusste, die nächsten Gepäckreihen entlang. Er schnüffelte an ein paar Reisetaschen, einem braunen Koffer und einem in Folie gepackten riesigen Beutel. Er roch den Duft von recht annehmbarer Dauerwurst, Tabak, Speck, und Hungerspeichel hing ihm aus dem Maul bis zum Boden. Er blieb stehen und sah sich nach seinem Herrn um.
»Schon wieder was gefunden?«, erschrak Dima und sah sich seinerseits um, hinüber zu den Gepäckträgern, die auf dem Weg zu ihrem am offenen Tor geparkten Karren waren. »Ach, zum Teufel!«
»Platz!«, befahl Dima dem Hund.
Er zog eine Zigarette heraus und ging ebenfalls zum offenen Tor, eine rauchen.
4
Kiewer Gebiet. Makarower Bezirk. Dorf Lipowka.
Die ganze Nacht heulte vor dem Fenster der Schneesturm. Gegen vier beruhigte er sich, nachdem er den Schnee vom Vortag mit neuem überzogen hatte.
[14] Irina eilte hinaus zur Straße und band sich im Laufen das graue Wolltuch fest. Am Straßenrand blieb sie stehen, starrte in die Finsternis und wartete, dass sie in dieser Finsternis die zwei Eidotter der Scheinwerfer auftauchen sah.
Lange nahm Irina die Augen nicht von der Straße. Der Frost zwickte und stach sie mit kleinen Nadeln in Wangen und Nase.
Irina wurde nervös. Zu spät kommen durfte sie auf keinen Fall, die Chefin war streng, sagte am Ende gar: ›Du brauchst nicht mehr kommen!‹ Und was dann? Wo das Geld hernehmen?
Da holten endlich zwei orangene Lichter sie aus den besorgten Gedanken. Sie trat einen Schritt vor, auf die Fahrbahn, und sah genauer hin. Es waren andere, unbekannte Lichter.
›Ist wohl ein anderer Bus‹, überlegte sie und hob für alle Fälle die Hand.
Ein roter Mazda hielt neben ihr. Der Fahrer, ein etwa vierzigjähriger Mann in schwarzer Lederjacke mit hochgestelltem Kragen, beugte sich herüber und öffnete Irina die Tür.
»Wohin wollen Sie denn so früh?«, fragte er verwundert.
»Fahren Sie nach Kiew?«
»Steigen Sie ein!«
Im Auto war es warm. Irina nahm ihr Tuch ab.
»Es steht Ihnen nicht«, sagte der Mann kopfschüttelnd. »So sind Sie viel schöner!«
»Schönheit lenkt ab«, antwortete Irina darauf.
Er warf ihr einen erstaunten Blick zu. »Wen?«
»Sie, von der Straße, zum Beispiel! Das ist gefährlich… und mich von…«
[15] Der Fahrer lachte. »Sie werden von Ihrer eigenen Schönheit auch abgelenkt?«
»Wieso lachen Sie über mich!«, empörte Irina sich ganz ernsthaft. »Denken Sie, weil ich vom Dorf bin, kann man mir alles an den Kopf werfen?«
»Ich bin auch vom Dorf.« Der Fahrer zuckte die Achseln. »Sie können mir auch alles an den Kopf werfen!«
»Meine Tochter ist drei Monate alt«, sagte Irina gekränkt. »Ich bin nicht irgendsoeine…«
»Entschuldigen Sie.« Der Mann hörte auf zu lächeln.
Irina war tief gekränkt, was ihr selbst unverständlich und dumm vorkam. Da erblickte sie plötzlich, wie das Licht in der Finsternis, vor ihnen am Straßenrand den vertrauten Kleinbus. Daneben ein paar altbekannte Weggenossen und den Fahrer, der auf allen vieren am Vorderrad kauerte.
»Oh! Mein Bus!«, rief Irina. »Lassen Sie mich aussteigen!«
»Aber er hat doch eine Panne«, wunderte sich der Fahrer. »Und Sie wollen nach Kiew! Sie werden hier am Straßenrand erfrieren, bis die Ihren Bus repariert haben!«
»Halten Sie an! Das ist mein Bus«, wiederholte Irina störrisch.
Der Mann zuckte die Achseln und hielt.
Irina vergaß sogar, ihm zu danken, und eilte zum Fahrer Wassja.
»Wieso haben Sie mich nicht mitgenommen?«, fragte sie vorwurfsvoll.
Der Fahrer hob den Blick zu ihr. »Sie haben den Fahrplan verschoben. Jetzt fahre ich früher los…«
[16] »Und wenn ich Sie nicht eingeholt hätte?«
»Hören Sie«, schnaubte Fahrer Wassja böse. »Es hat geheißen, fünf Minuten früher losfahren, also hab ich das gemacht! Da«, er nickte hinüber zu den übrigen Fahrgästen, »sind ja alle mitgekommen! Weil sie eine Viertelstunde vorher an der Straße stehen und sich’s morgens nicht noch im Bett gutgehen lassen. Aber Sie schlafen lang, da sind Sie eben nicht mitgekommen! Und jetzt stören Sie mich nicht!«
Irina sah den Fahrer an und konnte nicht glauben, dass er so gefühllos war. Wie konnte ein Mensch, von dem sie so viele Einzelheiten seines privaten Lebens kannte, sich ihr, seinem Stammfahrgast, gegenüber so gleichgültig verhalten?
Seufzend erhob der Fahrer sich aus der Hocke.
Er rief zum Einsteigen, alle nahmen schweigend ihre Plätze ein. Auch Irina setzte sich auf ihren üblichen Platz an der Tür. Der Kleinbus fuhr los, und alles kam wie von selbst in Ordnung. Der Tag begann im gewohnten Rhythmus zwischen den gewohnten verschlafenen Gesichtern.
Irina fuhr mit der Metro zur Station Arsenalnaja, stieg aus dem halbleeren Waggon, zog ihr Kopftuch zurecht und sah sich um. Sie bemerkte, dass sie auf dem langen Bahnsteig völlig allein war. Sie fuhr die Rolltreppen nach oben, erst die eine, dann die andere. Auch das in völliger Einsamkeit. Auch abwärts, ihr entgegen, kam niemand gefahren. Es fühlte sich komisch an. Dabei war das doch jeden Tag so, es war einfach eine ›tote‹ Station. Hierher kamen erst später Fahrgäste, nur sie war immer so früh dran.
Die Brust schmerzte wieder, es drückte. Langsam kroch die Rolltreppe aufwärts, die hatte es eben nicht eilig.
[17] Irina dachte an den Fahrer, der sie auf der Straße aufgelesen hatte. Dabei seufzte sie erst über ihr dummes Benehmen, dann lächelte sie. Er war irgendwie lustig gewesen! Aber über das Tuch hatte er natürlich die Wahrheit gesagt. Die Farbe stand ihr nicht. Sie musste es umfärben.
5
Kiew. Rejtarskaja-Straße. Wohnung Nummer 10.
»Wo warst du? Sag mir, wo du warst?«, drang die Stimme seiner Frau schrill in sein Ohr.
Semjon schlug die Augen auf. Sein Kopf dröhnte. Die Beine taten ihm weh, wie nach einem langen Marsch in schlechten Schuhen.
»Was ist mit dir, hörst du mich nicht?« In Veronikas Stimme klangen die aufsteigenden Tränen mit.
Semjon hob den Kopf und sah seine Frau an, die im Frotteemorgenmantel vor ihm stand.
»Nirgends war ich«, wehrte er ab. »Wieso gehst du so auf mich los?«
»Ich gehe auf dich los?!«, empörte sie sich. »Du bist um ein Uhr nachts irgendwo hingegangen, um vier zurückgekommen und hier in voller Montur im Sessel eingeschlafen! Du warst nirgends? Und was hast du da am Ärmel?«
Semjon senkte den Kopf und besah sich den Ärmel seines Hemdes. An der rechten Manschette war tatsächlich Schmutz, irgendein Fleck. Vor seinen Füßen lag die dunkelblaue Winterjacke, die er für die nicht zustande gekommene [18] Reise nach Alaska gekauft hatte. Eine befreundete Gesellschaft reicher Reisender hatte ihn mitnehmen wollen, als Masseur und einfach netten, kräftigen Kerl mit Leibwächter-Erfahrung. Sie hatten ihm gesagt: »Du brauchst eine Ausrüstung für minus fünfzig!«, und er hatte eine aufgetrieben, doch die Expedition war auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Dafür war ihm die Jacke geblieben. Und jetzt lag sie aus irgendeinem Grund auf dem Boden…
Semjon sah sich um und streifte seine Turnschuhe von den Füßen.
»Du antwortest mir also nicht?«, erklang es wieder quälend über seinem Kopf.
»Was soll ich dir antworten?« Er hob den Blick zu seiner Frau. Sie wich zurück, als sie bemerkte, dass der Blick ihres Mannes trüb war und nichts Gutes verhieß. »Verzeih! Ich hab wohl heute Nacht mit jemandem getrunken…«
»Mit wem willst du denn nachts trinken? Du trinkst doch auch tagsüber nicht!«
Semjon zuckte die Achseln, und dabei spürte er einen Schmerz im linken Schlüsselbein. Er rieb sich die schmerzende Stelle und sah wieder zu seiner Frau. Sie weinte, Gott sei Dank stumm.
Veronika wischte ihre Tränen fort, ging in den Flur und blieb vor der schweren, eisernen Wohnungstür stehen. Dann öffnete sie sie entschlossen und knallte sie kräftig hinter sich zu. Der Donner verbreitete sich durchs ganze Treppenhaus.
Als er verstummt war, erklangen Schritte von unten. Veronika zog ihren Morgenmantel fester zu und spähte hinunter. Auf der Treppe kam Nachbar Igor herauf.
[19] »Hast du dich ausgesperrt?«, erkundigte er sich mitfühlend.
»Ein Luftzug«, erklärte sie dem Nachbarn. »Gleich macht Semjon mir auf!« Dabei drückte sie auf den Klingelknopf.
Wie zum Trotz blieb der Nachbar stehen und wartete auch, als wollte er sichergehen, dass seine Hilfe nicht noch gebraucht würde. Als Veronika weiter den Klingelknopf drückte, schlug Igor mit dem Handrücken an die Tür. Donner erfüllte wieder das Treppenhaus.
»Gehen Sie schon!«, bat Veronika den Nachbarn. »Er ist wahrscheinlich auf dem Klo…«
Igor nickte, ging zu seiner Tür direkt gegenüber, blieb stehen und sah sich noch mal um.
»Heute Nacht haben sie hier nebenan den Apotheker umgebracht«, sagte er. »War ein anständiger Kerl. Ein echter Pilzkenner! Hat seine Bekannten mit eigenen Medikamenten behandelt, besser als der berühmte Kaschpirowski!«
Seine Schlüssel klapperten hinter Veronika, und im Rücken spürte sie die Luftbewegung der Tür, die sich öffnete und wieder schloss.
Eine Minute später ging auch ihre Tür auf.
»Du gehst… du kommst…« Verwirrt sah Semjon seine Frau an. Sein Blick war noch immer schläfrig und erschöpft.
»Lass mich rein!« Veronika stieß ihn zur Seite und lief schnell in den Flur.
Sie blieb vor dem Spiegel stehen und besah kummervoll den gestern neuerworbenen Haarschnitt, den ihr Mann noch gar nicht bemerkt hatte.
[20] ›Noch ein bisschen kürzer, und es wäre ein Bubikopf‹, dachte Veronika. ›Aber die Länge ist grad gut so! Noch muss ich mich nicht mit Kurzhaarfrisur jünger machen!‹
6
Stadt Borispol. Straße des 9.Mai.
»Murik! Murik!«, hörte der halb eingeschlafene Dima die Stimme seiner Frau Walja. »Murik! Wo bist du?«
Gleichzeitig kam vom Garten das vertraute, scheußliche Knurren des nachbarlichen Bullterriers. Der Hund hörte auf den Namen King und war genauso widerlich wie sein Herr. Manchmal schickte der Nachbar ihn einfach raus, anstatt mit ihm Gassi zu gehen, und schon war er auf Dimas und Waljas Grundstück, wo er sein Geschäft erledigte, den Kater Murik jagte – falls der in der Gegend war – und dann befriedigt auf sein Territorium zurückkehrte.
Dima hob den Kopf vom Kissen und überflog mit müdem Blick das Zimmer. Wegen der dicht verhängten zwei kleinen Fenster war es dämmrig.
»Soll der Teufel sie alle holen, diesen Hund und diesen Murik!«, flüsterte Dima. Er sah auf den offenen Multi-Media-Turm mit den drei Etagen für Video- und sonstiges Zubehör, das in ihrem Haushalt bis jetzt nicht vorhanden war. Gerade dort, auf der obersten Etage unter dem Fernseher, liebte ihr grauer Kater auszuruhen. Walja nannte ihn Murik, und er, Dima, rief ihn Murlo. Der Kater, der mindestens zehn Kilo wog, hörte auf beide Namen und fraß alles, was man ihm ins Schälchen legte.
[21] »Murlo! Kss, kss!«, flüsterte Dima, als er den Kater auf seinem Lieblingsplatz entdeckte.
Der Kater eilte zu seinem Herrn und neigte das Schnäuzchen, im Glauben, jetzt kraulte man ihn gleich hinterm Ohr.
»Walja!«, rief Dima. »Hier ist er!«
Die Tür ins Zimmer ging auf. Walja kam herein, flauschige Pantoffeln an den Füßen, eine Schürze über dem fliederfarbenen Flanellmorgenrock.
Sofort roch es nach zerlegtem frischem Fisch. Der Kater schoss wie der Blitz in die Küche, die Tür ging zu. Dima machte sich wieder ans Einschlafen. Doch der Fischgeruch war penetrant, und ständig drang der Lärm vorbeifahrender Laster herein; ihr Haus stand direkt an der Straße, auf der sie Stahlbetonteile aus der nahen Fabrik abtransportierten.
›Vielleicht bringt ein kräftiger Schluck endlich Schlaf?‹, überlegte Dima und sah zum Buffet hinüber, wo hinter der Glastür die obligate Halbliterflasche stand, für den Fall, dass Überraschungsgäste kämen. Für geladene Gäste wurden im selben Buffet, aber unten, in der ersten Etage, ein paar Flaschen Selbstgebrannter aufbewahrt, angesetzt mit jungen Brennnesselblättern. Dima liebte es, Wodka mit Gräsern und Beeren anzusetzen. Es trank sich angenehmer, und außerdem war es anscheinend gesünder.
Er erhob sich vom Sofa, schenkte sich ein Gläschen Selbstgebrannten ein und kippte es hinunter. Jetzt kam auch der Fischgeruch gerade recht: Wenn man nichts zu beißen zum Wodka hatte, konnte man es sich wenigstens vorstellen!
Er legte sich wieder hin und schlief gleich ein, als hätten [22] dem müden Körper zum gesunden Schlaf nur die hundert Gramm Wodka gefehlt.
Der Kater, der sich an Fischinnereien satt gefressen hatte, wollte sich zurück ins Zimmer drücken, in dem der Hausherr schlief und wo es warm und gemütlich war. Doch die verschlossene Tür hielt ihn auf. So musste er in der Küche bleiben und unterm eisernen Heizkörper hervor der Hausfrau zusehen. Die machte sich, nachdem sie den Fisch in den Ofen geschoben hatte, an die Schweinshaxen. Auf der Herdplatte stand ein riesiger Topf. ›Es gibt Sülze!‹, begriff der graue Kater.
Draußen an der Haustür klopfte jemand, und die Hausherrin ließ ihr scharfes Messer auf das Schneidbrett fallen und lief in den Flur hinaus.
»Wir sind vom Flughafen«, erklärte ihr einer der Männer vor der Tür. »Wir brauchen Dima…«
»Aber er schläft doch, nach der Schicht«, versuchte Walja die Erholung ihres Mannes zu retten.
»Es ist sehr wichtig«, sagte der zweite Mann hartnäckig. »Wir brauchen ihn bloß für fünf Minuten. Was besprechen, geht ganz schnell!«
Ins Haus ließ Walja sie nicht. Sie ließ die beiden vor der Tür stehen, lief ins Zimmer und rüttelte ihren Mann wach.
»Da sind welche von der Arbeit, vom Flughafen. Draußen vor der Tür. Kommst du?«
Dima seufzte schwer und schwang die Beine vom Sofa.
»Wer ist es denn?«, fragte er, wobei ihm völlig klar war, dass sie von denen, die mit ihm arbeiteten, niemanden kennen konnte. Erstens, weil er bei der Arbeit mit keinem befreundet war. Und zweitens, weil Walja selbst kein einziges [23] Mal in ihrem Leben am Flughafen Borispol oder irgendeinem anderen Flughafen gewesen war.
Als er vor die Tür trat, betrachtete er die Besucher mit verschlafenem Blick und erkannte sie gleich: die Träger Boris und Schenja aus der Gepäckabteilung. Eben jene, die ihn dazu gebracht hatten, den schwarzen Plastikkoffer zu ›übersehen‹, der das Interesse seines Schäferhundes Schamil geweckt hatte.
»Wir haben ihn hier!« Boris nickte hinüber zu einem hinter dem Zaun stehenden braunen Volkswagen Passat.
»Hättet ihr doch allein reingeschaut«, seufzte Dima müde.
»Nein.« Boris schüttelte den Kopf. »Ohne dich machen wir ihn nicht auf. Es muss alles ehrlich zugehen. Zusammen machen wir ihn auf, zusammen wird geteilt, und zusammen vergessen wir dann das Ganze. Klar?«
Dima nickte.
»Komm, wir gehen in deine Garage«, schlug Schenja vor.
Dima gähnte und kehrte in den Flur zurück, um den Garagenschlüssel zu holen.
»Hierher, hier gibt’s eine Lampe«, rief Dima ihnen zu, während er in die Garage vorausging und zwischen der Rückwand und seinem alten BMW haltmachte.
Er knipste die Stehlampe an.
Die Gepäckträger stellten den Koffer vorsichtig auf den Betonboden. Am Griff des Koffers baumelte noch immer das Gepäckschildchen mit dem Zielflughafen-Code: Wien.
»Hast du ein Stemmeisen?«, erkundigte sich der schnauzbärtige Boris beim Hausherrn.
[24] »Sehen wir gleich nach!« Dima ging hinüber in die Ecke, in der die Holzkiste mit dem Werkzeug stand.
Er holte Stemmeisen und Hammer heraus.
»Eigentlich schade, ihn kaputtzumachen«, seufzte er, als er in die Hocke ging.
»Macht nichts. Mit dem kannst du sowieso nicht mehr ins Flugzeug: Der Geruch bleibt, und dann bellt jeder Zollhund ihn an!«
Dima setzte das Stemmeisen mit der Kante an das Ziffernschloss, schlug mit dem Hammer zu, und das Schloss zersprang in zwei Hälften.
Boris und Schenja lächelten in Vorfreude auf die Enthüllung des Geheimnisses.
Kaum hob Dima den Deckel des Koffers, stieg ihm gleich ein entfernt bekannter, süßlicher Geruch in die Nase.
Obenauf lag ein Pappkarton, darunter Packpapier, und weiter kamen dicht an dicht liegende, identische Schächtelchen zu Tage, jedes von der Größe einer Zigarettenpackung. Eine der Schachteln war durchgeweicht. Er öffnete sie, zog vorsichtig eine zerbrochene Ampulle heraus und legte sie auf den Boden. Dann holte er aus der Schachtel noch eine heile, mit trüber Flüssigkeit gefüllte Ampulle und reichte sie Boris.
Der hielt sie gegen das Licht der Stehlampe.
»Ohne Aufschrift!«, wunderte er sich laut und reichte sie seinem Partner.
Auch Schenja drehte die Ampulle in den Händen, zuckte die Achseln und gab sie Boris zurück.
»Weiß der Teufel, was das sein soll!«, sagte Boris [25] nachdenklich und blickte von der Ampulle zum Herrn der Garage. »Hast du unter deinen Bekannten einen Arzt?«
Dima dachte nach. Er kannte einen Krankenpfleger und einen Tierarzt. Der hatte gerade im letzten Jahr ihre Katze von Verstopfung befreit.
»Nein, keinen normalen Arzt.«
Boris brach vorsichtig ein Ende der Ampulle ab, hob sie an die Nase und roch daran.
»Riecht wie Baldrian«, sagte er.
»Das überprüfen wir!« Dima verließ die Garage und kam gleich darauf mit Kater Murik unterm Arm zurück. Er setzte ihn auf den Boden und stellte einen Teller mit einem steinharten Stück Speck vor Murik hin. Den Speck schnippste er in die nächste Garagenecke und schüttete den Inhalt der Ampulle an seine Stelle.
Boris öffnete eine weitere Ampulle, und die Menge trüber Flüssigkeit im Teller verdoppelte sich. Die Männer starrten auf den Kater.
Murik sah sich um, beugte sich über den Teller, schleckte von der trüben Flüssigkeit und setzte sich im nächsten Moment abrupt auf die Hinterbeine. In dieser seltsamen, unkatzenhaften Pose erstarrte er, wie ein dressierter Hund auf das Kommando »Sitz!«. Kurz darauf knickten ihm die Vorderbeine ein, er kippte um und schloss die Augen.
»Etwa wirklich Baldrian?«, sagte Boris enttäuscht.
Plötzlich erhob sich Murik, blickte trunken um sich und lief ohne Eile zum offenen Garagentor.
»Das ist kein Baldrian«, erklärte Boris. »Baldrian macht Katzen fröhlich!«
Er wollte noch etwas hinzufügen, doch da drang von [26] draußen ein Ruf herein, metallisches Krachen und das Schreien einer Katze.
Dima stürzte hinaus, die Gepäckträger ihm nach.
Direkt vor der Garage lag ein Fahrrad, zwei Meter weiter, neben Boris’ Passat, bäuchlings und reglos ein Mann in wollenem Trainingsanzug, mit Skimütze auf dem blutigen Kopf. Und Kater Murik versuchte mit merkwürdig nachschleifenden Hinterbeinen durch den schmalen Spalt zwischen Zaun und Boden in den Garten zu kriechen.
»In die Garage mit ihm!«, kommandierte Boris.
Sie zogen den Radfahrer und sein Rad herein.
»Lebt er?«, fragte Dima und sah Boris dabei an, der sich über den Verunglückten beugte.
»Weiß der Teufel.« Boris untersuchte den Radfahrer gerade und zog ihm eine Brieftasche aus den Trainingsanzughosen. In der Brieftasche steckte, außer ein paar kleinen Geldscheinen, eine gerichtliche Vorladung. Aufmerksam studierte der schnauzbärtige Gepäckträger das Papier, und ein listiges Lächeln erschien auf seinem Gesicht. Er schob die Brieftasche wieder in die Hosen zurück und behielt die Vorladung. Dann öffnete er noch eine Ampulle und goss die trübe Flüssigkeit dem Radler direkt in den Mund. Der röchelte und öffnete ein wenig die Augen.
»Guck mal, er atmet! So, kein Problem, seine Adresse haben wir schon«, Boris zeigte Dima die Vorladung. »Morgen gehe ich bei ihm vorbei und sage, ich hätte sie auf der Straße gefunden. Nebenbei bringe ich in Erfahrung, wie es ihm geht, nach dem heutigen Verkehrszwischenfall.«
›Was für ein kluger Kopf! Da schau her!‹, sagte sich Dima, von der Findigkeit des Gepäckträgers begeistert.
[27] Kurz darauf trugen Boris und Schenja den Radfahrer nach draußen, setzten ihn auf die Erde, mit dem Rücken an den Zaun des Nachbarn gelehnt. Daneben legten sie sein Fahrrad, versprachen, am nächsten Abend wiederzukommen, und fuhren weg.
Dima schloss die Garage. Er war unruhig, es war ihm nicht wohl in seiner Haut, und er ging nachsehen, wo Murik steckte. Auf dem Schnee am Zaun fand er den Körper des Katers – reglos. Dima beugte sich über ihn, hob Murik hoch und überzeugte sich davon, dass der Kater tot war. Er legte ihn wieder in den Schnee. Und da wurde ihm klar, was der Tod dieses grauen Katers für ihn bedeutete: Seine Frau liebte dieses Tier mehr als alles auf der Welt. Mit Murik unterhielt sie sich öfter und mehr als mit ihm, ihrem Mann! Was würde geschehen, wenn sie erfuhr, dass es Murik nicht mehr gab?
Dima erschrak. Er fand in der Garage einen Kartoffelsack, steckte dort den verendeten Kater hinein, ging rasch und nervös die Straße entlang und überlegte im Gehen, wo man diesen Kadaver verstecken konnte, und zwar so, dass niemand ihn fand! Eine Viertelstunde später hielt er vor den Ruinen eines alten Hauses, das vor ein paar Jahren abgebrannt war. Hierher kamen zwar die Kinder zum Spielen, doch Erwachsene interessierte das verwahrloste Grundstück nicht. Nur Betrunkene gingen mal hinein, zum Kotzen oder um sich zu erleichtern. Und dort, im Garten, gab es ja auch einen Brunnen!
Dima sah sich um, und als er niemanden auf der Straße bemerkte, huschte er auf das Grundstück. Er spähte sofort in den Brunnen: kein Wasser, alles war voller Müll, doch bis zum Rand blieben wohl noch drei Meter.
[28] »Adieu, Murlo!«, sagte Dima und warf den Sack mit dem Kater hinab.
»Hast du Murik gesehen?«, fragte Walja gleich, als er nach Hause kam.
»Nein, hab ich nicht«, sagte Dima kopfschüttelnd und ging schnell an ihr vorbei.
7
Kiewer Gebiet. Makarower Bezirk. Dorf Lipowka. Abend.
Vor dem Fenster rieselte der Schnee. Manchmal packten ihn plötzliche Windstöße und wirbelten ihn hoch, wovon er das Dach des einstöckigen Hauses überflog und auf der anderen Seite heruntersank, vorm Fenster des Zimmerchens, in dem Irina und ihr drei Monate altes Töchterchen Jaroslawa schliefen. Die Großmutter, die den ganzen Tag bei der Kleinen war, nannte das Kind zärtlich Jasja, und genauso zärtlich überredete sie es, mehr von der Milchpulvermischung zu trinken, dass es möglichst schnell groß wurde, sein erstes Wort sagte und den ersten Schritt tat.
»Jasja, Jasjenka! Noch ein bisschen!«, bat Oma Schura die Kleine, während sie ihr das Fläschchen mit der Milchpulvermischung an den Mund hielt. Doch Jasja schlug es hartnäckig zur Seite, ohne den Blick ihrer Glasperlenaugen vom Fernseher zu wenden, der eine neue Folge ›Kriminelles Petersburg‹ zeigte.
»Na? Was sag ich denn dann deiner Mama?« Die ältere Frau wiegte den Kopf. »Da verdient sie Geld für dich in der Stadt, und du?«
[29] Während die Helden der Serie einander beschossen, klingelte es an der Haustür. Doch Oma Schura hörte es nicht. Erst als die Schießerei vorüber war, sprang sie auf, legte Jasja aufs Bett und eilte zur Tür.
»Oh! Da bist du ja!«, freute sie sich über die Ankunft der Tochter.
Irina stellte die schwere Einkaufstasche auf den Boden und zog das Tuch vom Kopf.
»Geh in die Küche, iss was, es steht ein Hühnchen auf dem Herd!«, sagte die Mutter friedlich und kehrte in ihr Zimmer zurück, ohne die verweinten Augen der Tochter zu bemerken.
In der Küche holte Irina die Lebensmittel aus der Tasche. Wurst und Hering räumte sie in den Kühlschrank, die Konserven in den kleinen Schrank neben der Spüle. Sie setzte sich an den Tisch, vergrub das Gesicht in den Händen und weinte ganz leise, fast ohne zu schluchzen. Die schreckliche innere Leere machte ihr Angst. Oder war es nur die Müdigkeit, die weder ein kurzer Schlaf noch Kartoffelbrei mit Hühnchen auf dem Herd wiedergutmachen konnten?
Jeden Morgen eilte sie mit von Muttermilch übervoller Brust nach Kiew, wo eine Frau im weißen Kittel mit unbewegter Miene ihre Milch mit einer kleinen Pumpe absaugte und sie dann in die Küche schickte. Dort tat ihr die Helferin der Einrichtung, eine eigentlich liebe Frau, eine volle Schale Haferbrei auf und sah zu, wie Irina alles bis zum Letzten aufaß. Manchmal setzten sich ein oder zwei andere milchgebende Mütter mit Irina an den Tisch, und dann verteilte ebendiese Helferin Vera ihre strenge [30] Aufmerksamkeit gleichmäßig auf alle Essenden. Nach dem Brei musste Irina zwei, drei Stunden im Marinski-Park spazieren gehen. Er lag genau gegenüber diesem Haus, in dem es in einer ganz normalen, großen Wohnung diese private Einrichtung gab, die einer Milchküche, oder eigentlich ihrem Gegenteil, glich. Denn hier nahm man Müttern die Milch ab und gab ihnen dafür Geld, das für Milchpulver für die eigenen Kinder und das billige Leben im Dorf reichte, den Weg nach Kiew und zurück miteingerechnet.
Irina kannte nun schon ein paar solcher alleinstehender Mütter wie sie.
»Das ist für die Abgeordneten-Mamas«, hatte ihr einmal Nastja aus der Byschewer Gegend erzählt. »Sie nehmen gleich nach der Geburt Spezialtabletten, dass es keine Milch gibt und ihr Busen schön bleibt, und ihren Babys geben sie dann unsere Milch.«
Irina glaubte das. Sie dachte aber nicht schlecht von solchen Müttern. Sie hatte noch nie schlecht von anderen denken können, nicht mal von wirklich schlechten Menschen. Das Einzige, was sie sich wünschte, war, einmal nur einen Blick auf das Kleine zu werfen, das ihre Milch zu trinken bekam.
Doch heute hatte sie auf dem Rückweg im Kleinbus über eine Stunde stehen müssen. Vielleicht hatte dieses Stehen, noch dazu mit gebeugtem Kopf, sie so müde gemacht, dass sie sich den ganzen Weg über leidtat und ihre Tochter Jasja bedauerte, die, obwohl sie eine gesunde Mutter hatte, den ganzen Tag bei der Oma bleiben musste.
Irina weinte sich aus und beruhigte sich dann. Sie aß zu Abend, fasste sich an die Brust, und ihr schien, dass sich die [31] drei Stunden zuvor geleerte Brust langsam wieder füllte. Sie ging ins Zimmer zu ihrer Mutter, nahm Jasja auf den Arm und legte sie an. Die Kleine begann zu saugen und gierig die Lippen zu bewegen, wovon es Irina schon kitzelte. Auf Irinas Gesicht erschien ein Lächeln.
»Pass auf, verwöhn sie nicht!«, hörte sie ihre Mutter sagen. »Sonst merken sie morgen, dass du weniger Milch hast, und dann wollen sie dich nicht mehr…«
»Ich esse später halt noch mal etwas«, antwortete Irina der Mutter, aber sie war ihr nicht böse.
Vor dem Schlafen, nachdem sie Brot mit Speck und noch einen Teller Kartoffelbrei gegessen hatte, löste Irina in einer Schüssel die in Kiew gekaufte grüne Stoff-Farbe auf und weichte darin ihr graues Wolltuch ein. Damit das Tuch nicht zu dunkel wurde, gab sie noch Wasser dazu.
8
Kiew. Rejtarskaja-Straße. Wohnung Nummer 10. Mittag.
Morgens zog Veronika gern ihren Skianzug an. So frisch und graziös sah sie in diesem Anzug aus, dass schon der Gedanke an Morgengymnastik oder einen Gang ins Fitness-Studio auf ihrem hübschen Gesicht ein ironisches Lächeln hervorrief. Heute war es ihr gelungen, bis halb elf im Bett zu liegen. Und jetzt, als sie endgültig wach geworden war, hatte Veronika Lust, dem Haushalt ein wenig Kraft zu widmen.
Als sie alles Weiße in die Waschmaschine gesteckt hatte, fiel ihr plötzlich Semjons Hemd wieder ein. Sie beugte sich [32] noch mal zu der Maschine, öffnete das runde Plastikfenster und zog das Hemd ihres Mannes am Ärmel heraus. Der eine Ärmel war halbwegs sauber, doch der andere! Sie trat mit dem Hemd ans Fenster und vertiefte sich in den braunen Fleck. Sie roch daran, fuhr mit zarten Fingerspitzen darüber, und allmählich wurde ihr klar, dass der Ärmel mit Blut befleckt war. Sie dachte nach. Und von ihren eigenen Gedanken lief ihr eine Gänsehaut den Rücken hinunter. Lieber sich mit der Vorstellung abfinden, dass der Ehemann eine Affäre hat, als nach zwölf gemeinsamen Jahren herausfinden, dass er ein Mörder ist!
Sie stopfte das Hemd zurück in die Maschine, drückte den Startknopf und begab sich nachdenklich und beunruhigt in die Küche.
In der Wohnung war es still. Semjon war frühmorgens von seinem ständigen Arbeitgeber, Gennadi Iljitsch, angerufen worden und hatte sich gleich aufgemacht. Letzte Nacht war er nirgendwohin verschwunden. Sie hatte, auch wenn es unbequem war, die Hand die ganze Nacht nicht von seiner Schulter genommen.
Als sie am Küchentisch am Fenster saß, hinter dem Schneeflocken zur Erde schwebten, fiel Veronika der Mord an dem Apotheker wieder ein. ›Vielleicht frage ich den Nachbarn?‹, überlegte sie. ›Er weiß vielleicht noch mehr! Er liest Zeitungen, sieht Nachrichten auf allen Kanälen. Am Ende haben sie den Mörder schon?‹
Der Tee mit Honig nahm die Anspannung von ihr und besänftigte die erregten Gedanken. Sie hätte noch ewig so sitzen können. Aber Fragen kann man nur mit Antworten beruhigen, sonst zwicken und jucken sie wie [33] Mückenstiche. Also ging Veronika hinaus ins Treppenhaus und klingelte beim Nachbarn. Sie wartete ein paar Minuten, dann kehrte sie in ihre Wohnung zurück.
»Schicksal!«, entschied sie.
Und versank gleich darauf in Nachdenken über das Schicksal.
Was war das Schicksal? Über ihr eigenes durfte sie sich nicht beklagen: einziges Kind eines Fliegers beim Militär und einer Geographielehrerin. Im Haus immer viele Süßigkeiten, den besten Fisch und einen großen Globus auf dem Buffet, von dem Mama von Zeit zu Zeit den Staub abwischte. Eine dumme erste Ehe mit achtzehn. Ein halbes Jahr später die Scheidung. Die zweite Ehe überhaupt nicht dumm, und die hielt jetzt schon dreizehn Jahre. In dieser Zeit war Semjon vom Händler mit Videokassetten am Straßenmarkt auf der Petrowka zum Chef einer kleinen, doch robusten Firma geworden, die die Bewachung verschiedener seriöser Zusammenkünfte und Geschäftsausflüge organisierte. Eigentlich war das auch keine Firma, es gab nur zwei alte Freunde: Semjon und Wolodja, plus, bei Bedarf, noch drei, vier körperlich kräftige Bekannte auf Abruf. In vier Jahren Arbeit im Bewachungssektor hatte Semjon das Geld für eine schöne Zweizimmerwohnung auf der Streletzkaja verdient, mitten im Zentrum. Ein Büro brauchte er nicht, alles ging übers Telefon. Sein Hauptauftraggeber, Gennadi Iljitsch, war Parlamentsabgeordneter, und das hieß, sein ganzes Abgeordnetenleben bestand aus Geschäftstreffen und anderen Unternehmungen zu allen Tages- und Nachtzeiten, die Geheimhaltung und Bewachung erforderten. Semjon kannte er seit langem, von der [34] Petrowka. Damals trug Gennadi Iljitsch den Spitznamen ›Krokodil Gena‹ und befasste sich mit dem täglichen Eintreiben der Gebühren beim Händlervolk. »Brüder, zur Sonne, zur Freiheit, Brüder, zum Lichte empor«, sang Krokodil Gena auch heute manchmal noch ganz gern, und jedes Mal, wenn Semjon in diesem Moment anwesend war, erinnerte er sich an seinen Platz Nummer siebenundvierzig in der dritten Marktreihe. Das Lied löste sich wie eine Klette vom Abgeordneten, ging auf Semjon über und lag ihm dann bis zum Abend auf der Zunge. Manchmal sang er es noch, wenn er nach der Arbeit die Wohnung betrat. Veronika, die das Auftreten dieses Liedes im ›häuslichen Radiosender‹ studiert hatte, lächelte nur.
Damals hatte sie von Semjon viel über die Wechselfälle des Marktlebens erfahren. Mehr als einmal hatte ihn die Miliz verhaftet, und dabei war es ihm gelungen, viele nützliche Kontakte zu knüpfen. Die früheren Sergeanten waren heute Majore und Oberste geworden, nahmen bedeutende Posten ein und verhielten sich Semjon gegenüber als dem Freund ihrer Jugend und Zeugen ihrer beruflichen und karrieremäßigen Vervollkommnung. Schicksal? Natürlich, Schicksal!
Doch plötzlich fuhr Veronika zusammen, sie stürzte wie in einen Abgrund, ihr war mit einem Mal eiskalt. Sieben Jahre zuvor war etwas geschehen, das ihr, den Versprechungen ihres Psychotherapeuten nach, nie mehr im Leben hätte einfallen sollen.
Verzweifelt sah sie durchs Fenster in die abwärtsschwebenden Schneeflocken hinaus. Ihre rechte Hand fuhr über die Tischplatte und klammerte sich an die Tasse mit dem [35] nicht ausgetrunkenen Tee. Im nächsten Augenblick flog die Tasse zu Boden. Der Klang des zerspringenden Porzellans lenkte Veronika ab. Sie drehte sich um und warf einen Blick auf den Boden, auf die weißen Scherben der Tasse. Ihr wurde ein wenig leichter zumute. Doch plötzlich wurde die seelische Kälte körperlich. Schüttelfrost packte sie. Veronika ging ins Schlafzimmer, holte aus dem Schrank einen warmen Norwegerpullover und zog ihn über das Adidas-Sportjäckchen, ging weiter ins Bad, hüllte sich in den bordeauxroten Frotteemantel, Semjons Geschenk zum letzten Valentinstag, und zog ihn fest um sich. Das ganze Treiben zur Erwärmung von Seele und Körper brachte sie in die Wirklichkeit zurück.
Die großen Scherben der Tasse sammelte sie mit den Fingern ein, die kleinen fegte sie mit dem Handbesen in die Schaufel. Sie wischte den Boden auf und beschloss, in den Schnee hinauszugehen. Das weiße Licht beruhigte sie immer, brachte sie dazu, sich klein, neugierig und schutzlos zu fühlen. Sie erinnerte sich daran, wie sie sich im Alter von vier, fünf Jahren vor allem gefürchtet hatte. Sie fürchtete sich, allein mitten auf dem verschneiten Feld zu sein, wenn sie mit den Eltern zu den Bekannten aufs Dorf im Kiewer Umland fuhr. Sie fürchtete sich, nah an die Straße zu treten, auf der gewaltige, laute Lastwagen vorbeiflogen. Und das Interessanteste war, dass das Gefühl der Angst ihr gefiel, wie vielen Kindern schreckliche Geschichten gefallen, die abends erzählt werden und das Kind dann nicht schlafen lassen, es zwingen, unters Bett zu schauen oder zu versuchen, bei Licht einzuschlafen, damit die Ungeheuer und Monster aus den Geschichten nicht ins Kinderzimmer vordringen.
[36] Veronika tauschte den Frotteehausmantel gegen ihren langen braunen Lammfellmantel und schlang einen Ziegenwollschal um den Hals.
Jetzt spazierte sie gleich an der hohen, mächtigen Rückwand des Sophienklosters entlang. Sie würde bis zur Stretinskaja gehen, dann zur Rylski-Gasse und zurück. Denn wenn Schnee vom Himmel fiel und sie an der hohen, weißen Klostermauer entlangging, dann kam die ganze Welt in Ordnung. Ihre innere Welt. Die übrige Welt lag nicht in ihrer Macht.
9
Stadt Borispol. Straße des 9.Mai.
Nach Muriks Verschwinden wurde das Leben in Dimas Haus grabesduster. Walja streifte tagelang durch die Stadt und befragte alle untätigen Alten nach dem vermissten grauen Kater. Und ihren Dima schickte sie fünfmal am Tag in verschiedene Ecken von Borispol, in denen, Gerüchten und unbestätigten Angaben zufolge, ein großer grauer Kater gesehen wurde, der nach Beschreibung und Foto dem Vermissten glich. Ganz Borispol war schon beklebt mit Kopien von Muriks Foto und der flehentlichen Bitte darunter, doch »gegen Belohnung finden zu helfen«. Den Vorschlag ihres Mannes, »gegen vernünftige Belohnung« zu schreiben, hatte Walja rundweg abgelehnt. Dima war selbst nicht glücklich, dass er mit seinen Ratschlägen an der undankbaren Suche nach dem vermissten Kater mitwirkte. Undankbar natürlich deshalb, weil keiner Murik finden [37] und heimbringen konnte. Seine Überreste mochte man zwar finden, doch Walja würde ein solcher Ausgang der Suche wohl kaum beglücken.
So wartete Dima einfach geduldig, dass das Frauenherz sich beruhigte. Er ging zur Arbeit, überwachte das Durchschnüffeln des Gepäcks der abfliegenden und ankommenden Passagiere, achtete auf Schamil. Und traf, wenn er heimkam, auf eine Atmosphäre grenzenloser Trauer. Der Bitte seiner Frau zuvorkommend, sagte er immer selbst schon gleich: »Ich gehe Murik suchen!«, und eilte in die Garage, wo er sich das Eckchen zwischen der Rückwand und dem alten BMW gemütlich eingerichtet hatte. Sogar eine Heizspirale brachte er an, damit es wärmer war.
Dort in der Garage fanden ihn auch Boris und Schenja. Erst waren sie natürlich zum Haus gegangen. Walja erklärte ihnen, dass Dima unterwegs sei, auf der Suche nach Murik. Die Männer waren nicht dumm und steuerten, kaum wieder draußen, die Garage an.
»Hör zu, das war ja was!«, sagte Boris erregt, als sie sich in dem gemütlichen Garagenwinkel neben dem Heizöfchen eingerichtet hatten. »Drei Tage ist er nicht nach Hause gekommen!«
»Wer?«, fragte Dima, in dessen Gedanken der ›vermisste‹ Murik den ersten Platz einnahm.
»Na, dieser Radfahrer!«, rief Boris. »Seine Frau war ganz hysterisch! Drei Tage bin ich mit dieser Vorladung zu ihm gegangen und habe nur immer die Frau beruhigt, ihr erzählt, dass er sich vielleicht versteckt, um diese Vorladung nicht in Empfang zu nehmen! Und heute morgen kommt er heim, mager wie der Teufel!«
[38] »Er war doch so schon mager!«, erinnerte sich Dima.
»Er ist noch magerer geworden, ein Gesicht wie nach Buchenwald, die Backenknochen stehen nur so raus. Und weißt du, was er ihr gesagt hat? Er sei mit dem Fahrrad bei dem Neffen in Tschernigow gewesen!«
»Wieso das denn?«, fragte Dima.
»Habe ich ihn auch gefragt, aber er hat nur die Achseln gezuckt!«
»Nein«, sagte Schenja gedehnt, der bis zu diesem Moment geschwiegen hatte. »Dann hat er was von fehlender Müdigkeit gesagt… Er hat gesagt, er habe sich völlig aufgekratzt gefühlt und deshalb ein bisschen weiter weg radeln wollen…«
»Vielleicht trinken wir was?«, schlug Dima vor.
Boris schüttelte den Kopf, aber Schenja nickte erfreut.
Dima stellte einen Teller mit Salzgurken auf das Hockerchen, das als Tisch diente, und füllte zwei Gläschen. Doch ehe sie tranken, musste er sich noch über seine Frau beklagen, die über dem verschwundenen Kater verrückt wurde.
»Das vergeht!«, beruhigte ihn Boris.
»Wann? Ich halte es schon nicht mehr aus! Im Haus ist die reinste Staatstrauer, als wären fünf unbeweinte Tote in jedem Zimmer.«
»Dann finde doch einen ähnlichen Kater«, sagte Boris. »Und gib ihn für diesen Murik aus! Er war doch ein ganz gewöhnlicher Grauer! Solche laufen zu Hunderten durch die Straßen…«
»Das Herz wird ihr sagen, dass es ein anderer Kater ist«, zweifelte Dima.
»Das Herz? Das sind doch alles Märchen! Die Frauen [39] erfinden über sich selbst solche Märchen, um besser dazustehen! Dabei…« Schenja redete nicht zu Ende, griff zum Glas und trank es nervös aus. Dann ließ er eine Salzgurke im Mund zerkrachen.
»Jetzt aber genug von dem Kater!«, sagte Boris, entschlossen, das Gesprächsthema zu wechseln. »Hast du einen Arzt gefunden?« Sein Blick bohrte sich in Dimas Augen.
»Was für einen Arzt? Ich suche doch den Kater…«
»Hör endlich auf mit deinem Kater. Such einen Arzt. Oder einen Apotheker! Apotheker kennen sich mit Ampullen besser aus.«
»Ich sag dir jetzt, was du machst!« Schenja hob den Zeigefinger und lenkte die Aufmerksamkeit auf sich. »Du nimmst eine Ampulle und gehst in eine Apotheke. Sag, du hast sie gefunden und weißt nicht, was das ist!«
»Das kannst du doch auch machen!«, antwortete der Herr der Garage auf den Vorschlag. »Wieso soll ich durch die Apotheken ziehen?«
»Stimmt«, nickte Boris, strich sich über den Schnauzbart und musterte Schenja aufmerksam. »Kümmer du dich darum!«
»Na gut«, stimmte Schenja nach kurzer Bestürzung schließlich zu. »Gebt mir drei Ampullen, und ich… geh dann also.«
Dima zog drei Ampullen aus dem an die Wand geschobenen Plastikkoffer. Schenja steckte sie in die Jackentasche, verabschiedete sich mit einem Kopfnicken und verschwand.
Boris und Dima sahen sich an.
»Ist er jetzt beleidigt?«, fragte Dima.
[40] Boris winkte schweigend ab.
»Gieß mir auch ein Gläschen ein«, bat er.
Dima schenkte ein. »Mit uns zusammen hättest du trinken sollen, zu dritt«, bemerkte er.
»Zu dritt trinke ich nicht mehr«, erklärte Boris düster. »Zu dritt trinken ist das zweite Anzeichen von Alkoholismus.«
»Und das erste?«
»Das erste ist: allein trinken…«
»Weißt du, mir ist scheißegal, was drin ist, in diesen Ampullen, ob Drogen oder ein Mittel gegen Krebs«, teilte Boris nach einem Gläschen Wodka mit. »Hauptsache, wir verkaufen es gut. Dann schicke ich meine Tochter auf die Universität, auf eine private. Und du, such dir wirklich einen ähnlichen Kater, wälz ihn im Dreck, und bring ihn nach Hause. Du sagst, er ist den Katzen nachgelaufen und ganz verändert… Sie wird sich beruhigen! Überhaupt braucht sie keinen Kater, sondern ein Kind!«
»Das ist unsere Sache!«, verteidigte Dima seine Frau.
»Natürlich, eure Sache«, stimmte Boris zu und erhob sich von dem selbstgebauten Holzbänkchen. »Aber der Koffer ist unsere Sache. Und die bringen wir lieber möglichst schnell zu Ende!«
10
Kiewer Gebiet. Makarower Bezirk. Dorf Lipowka.
Der nächste Morgen begann für Irina eine Viertelstunde früher als sonst. Sie trug die Schüssel mit dem immer noch [41] in der Farbe schwimmenden Wolltuch in die Heizkammer hinüber und hängte das Tuch über ebendieser Schüssel auf die Leine. Jetzt konnte ruhig Farbe heruntertropfen!
Fröhlich machte sie sich fertig. Sie trank Tee, ließ dazu ein kaltes Stück Quarkauflauf im Mund zergehen und rührte für Jasja die Milchmischung an. Erst als sie den Mantel anhatte, geriet sie kurz in Verwirrung: Und was zog sie nun auf den Kopf? Ihr Blick fiel auf das Wolltuch der Mutter, schwarz mit roten Rosen, einst in Fastow auf dem Markt bei Zigeunern gekauft. Die Mutter hatte damals drei Stück genommen, also lagen noch irgendwo zwei davon. Irina band das Tuch um, nahm ihre Tasche und ging hinaus.
Unter ihren Füßen knirschte vor der Tür der Schnee.
Der Kleinbus kam pünktlich. Als sie auf ihrem Platz saß, verließen Irina die Kräfte, und sie schlief ein. Und statt im Traum etwas zu sehen, hörte sie wie aus bläulicher Dunkelheit eine Stimme: »Glaube es, er kommt zurück! Er kommt auf jeden Fall zurück!«
»Wer kommt zurück?«, fragte sie im Traum.
Und die Stimme antwortete: »Er.«
»Aber wer ist er?«, fragte sie wieder. Was, wenn dieser ›er‹ der Vater von Jasja war? Einen solchen ›er‹ brauchte sie überhaupt nicht! Ja, irgendein anderer ›er‹, der ein liebender Papa für das Töchterchen werden könnte, und ein guter Ehemann für sie selbst! So einen zu finden wäre ein Glück! Doch der kam kaum von selbst. Und die Stimme hatte gesagt: »kommt zurück«, nicht: »taucht auf«! Zurück kamen ja aber nur die, die vorher fortgegangen waren.
So fuhr die dösende Irina im Kleinbus die dunkle Straße [42] entlang. Kiew wartete auf sie, das ihre übervolle Brust von Milch befreien und noch mehr Milch verlangen würde. Dieses Kiew würde wieder ihre Brust leersaugen, alles bis zum letzten Tropfen, und sie nach Hause schicken, nachdem es dafür bezahlt hatte; nicht völlig ungenügend, doch auch nicht großzügig, nur gerade so, dass sie, Irina, genug Kraft und Willen behielt, diese tägliche Routine fortzusetzen, bis die Milch in ihrer Brust versiegt wäre.
»He! Wir sind da!«, ertönte über ihrem Kopf die Stimme des Fahrers Wassja. »Los, sonst kommen Sie noch zu spät!«
Die verschlafene Helferin im weißen Kittel öffnete ihr die Tür. Anscheinend übernachtete sie in dieser privaten Milchküche auch.
Irina entblößte den Oberkörper und setzte sich an den Tisch. Gleich hatte sie Gänsehaut an Schultern und Armen. Die alte Vera bemerkte, dass Irina kalt war, und schloss die Lüftungsklappe. Dann setzte sie ihr den tassenförmigen Plastiksauger an die linke Brust, schaltete die Pumpe ein, und die summte los wie ein batteriebetriebenes Kinderspielzeug. Von dem Sauger zur Flasche am anderen Ende eilte die Milch durch den Schlauch.
»Lilia Petrowna haben sie entlassen«, klagte Vera. »Jetzt muss ich mich mit der Technik herumschlagen.« Dabei nickte sie in Richtung Pumpe.
Irina versuchte sich abzulenken und dachte an ihren Traum im Bus. In Gedanken passte sie den von der Stimme erwähnten ›er‹ allen ihr bekannten Männern an. Davon gab es nicht viele, wie sich herausstellte. Rechnete man die Alten im Dorf nicht dazu, dann reichten die Finger einer Hand, um zu erkennen: Wer von diesen fünfen auch [43] zurückkehren mochte, besonderes Glück würde ihr das nicht bescheren.
Der Sauger wechselte an die rechte Brust. Das Summen der kleinen Pumpe war Irina vertraut wie Jasjas Weinen.
Nachdem sie reichlich Haferbrei gefrühstückt hatte, ließ Irina ihre Tasche am Haken im Flur und begab sich auf ihren Spaziergang durch den Marinski-Park.
Es war bald acht Uhr morgens. An der Haltestelle fuhren große und kleine Busse vor, und Dutzende ordentlich und warm angezogener Menschen quollen heraus. Keiner von ihnen ging in den Park. Alle überquerten die Straße zur anderen Seite hin und verschwanden.
Irina gefiel das. Sie fühlte sich beinah als Herrin hier, in diesem Park, der ans Parlament und den zarten türkisfarbenen Palastbau angrenzte. Vielleicht kam es von dem guten Haferbrei, dass sie sich, trotz Frost, so warm und wohlig fühlte? Vielleicht kam es davon, dass die hier eintreffenden Menschen erst zur Arbeit gingen und ihre, Irinas, erste Schicht schon zu Ende war. Nun hatte sie eine so lange Pause, wie sie gewöhnlichen Angestellten oder selbst Sekretärinnen ganz unmöglich war!
Ein Lächeln erhellte Irinas Gesicht. Sie schob das Zigeunertuch der Mutter zurecht und ging ohne Eile die Allee entlang.
»Auch dieses Tuch steht Ihnen nicht!«, erklang ganz nah eine Männerstimme, die ihr bekannt vorkam.
Sie drehte sich um und erkannte den Mann mit dem schelmischen Funkeln in den leicht auseinanderstrebenden Augen. Er hatte sie in seinem roten Wagen mitgenommen, als ihr Bus zu früh durchgefahren war.
[44] »Das ist nicht meins, es gehört meiner Mutter«, antwortete Irina.
»Ja«, nickte er. »So eines kann man tragen, wenn die Enkel geboren sind!«
»Das tut meine Mama. Eine Enkelin hat sie nämlich schon…«
Der Mann trug einen langen, schwarzen Ledermantel mit hohem Pelzkragen. Doch Pelzmütze hatte er keine auf dem Kopf, er trug überhaupt keine Mütze.
»Ist Ihnen nicht kalt?«, fragte Irina, ohne den Blick von seinem kurzgeschnittenen Haar zu wenden, als suchte sie kahle Stellen, die der Frost am ungeschützten Kopf vielleicht schon verursacht hatte.
»Nein, mir ist nicht kalt«, antwortete er ruhig. »Ich heiße übrigens Jegor. Und Sie?«
»Irina.«
»Kommen Sie, ich lade Sie auf einen schlechten Kaffee ein!«, schlug der Mann vor.
Irina sah ihn misstrauisch an.
»Guten Kaffee findet man erst ab zehn Uhr. Jetzt gibt es leider keine Wahl.«
Sie nickte, und Jegor führte sie zur Straße, zur Haltestelle, dorthin, wo immer weiter kleine und große Busse hielten.
Sie überquerten die Straße, kamen in eine Seitenstraße, bogen an der Ecke rechts ab und betraten fünf Minuten später ein Feinkostgeschäft.
»Zweimal ›Drei in einem‹«, sagte er zur Verkäuferin.
Sie tranken den süßen Milchkaffee aus Einweg-Plastikbechern, innen am Schaufenster des Ladens stehend.
[45] »So schlecht ist der gar nicht!«, sagte Irina achselzuckend.
»Man muss zu vergleichen wissen«, bemerkte Jegor lächelnd. »Sie arbeiten hier irgendwo in der Nähe?«
»Ja«, nickte Irina. »Und Sie?«
»Ich auch. Nicht weit von der Stelle, wo ich Sie getroffen habe.«
»Im Palast?«, erkundigte sich Irina.
»Sozusagen im Palast«, antwortete er nach einer kurzen Pause.
Eine plötzlich fast direkt zwischen ihnen erklingende mechanische Stimme erschreckte Irina. Sie sah sich um, doch da legte Jegor sanft seine Hand auf ihre und bedeutete ihr mit den Augen, dass alles in Ordnung war.
»Ich komme«, sagte er zu irgendwem.
Irina entdeckte, dass aus dem hohen Pelzkragen seines Mantels ein schwarzes Kabel zu seinem Ohr lief und direkt neben der Ohrmuschel in einem kleinen schwarzen Stecker von der Größe einer Mücke endete. Sie hatte solche Dinger im Fernsehen gesehen, bei den Leuten, die gewöhnlich den Präsidenten bewachten.
›Jetzt geht er‹, begriff Irina, und auf einmal war ihr zum Weinen zumute. Nicht, weil er fortging und ihr ›schlechter‹ Kaffee im Becher noch nicht ausgetrunken war. Nein, sondern weil er ihr, mit diesem schwarzen Ding im Ohr, als Mensch, der seinen Traum verwirklicht hatte, erschien. So ruhig, sympathisch, selbstsicher…
»Sie gehen doch immer im Park spazieren«, sagte Jegor lächelnd.
Sie nickte und lächelte zurück.
[46] »Ich finde Sie. Vielleicht auch heute noch. Dann kriegen Sie von mir einen guten Kaffee!«
»Der hier ist auch gut«, sagte sie leise.
Jegor lachte und verließ den Laden.
›Er ist fast einen Kopf größer als ich‹, dachte Irina und wunderte sich gleichzeitig über diese Erkenntnis.
»He, gib mir eine Griwna!«, flüsterte ein bärtiger Obdachloser in abgewetztem grauem Umhang und Schuhen ohne Schnürsenkel, der sich vor sie hingestellt hatte. »Mir ist kalt!«
Irina fuhr in die Tasche, holte Kleingeld heraus, zählte eine Griwna ab und ließ die Münzen in die ausgestreckte Hand des Obdachlosen fallen.
»Gut!«, sagte er statt »danke«, sah sich um und ging zu der Frau im teuren Pelzmantel hinüber, die gerade den kleinen Laden betrat.
Irina wurde es auch langsam kalt. Sie trank den Kaffee aus und beschloss, in die Wärme ihrer Milchküche zurückzukehren. Die Wohnungstür war offen, und Irina trat ein. Im selben Moment drängten zwei Männer in identischen blauen Jacken sie zur Seite und brachten eine große, metallene Milchkanne herein. Sie trugen sie den Flur entlang, öffneten die Flügeltür an seinem Ende und verschwanden in einem anderen, viel prunkvolleren Flur dahinter; ein roter Läufer lag dort auf dem Boden, und an den Wänden hingen Gemälde. Was auf diesen Gemälden war, konnte Irina nicht mehr erkennen. Schon schlossen sich beide Hälften der Flügeltür gleichzeitig.
»Irotschka, auf dem Herd steht noch Brei«, sagte Helferin Vera freundlich. »Leg ab und komm!«
[47] Irina nickte, ohne den Blick von der hölzernen Flügeltür zu wenden.
»Was ist denn dort, hinter dieser Tür?«, fragte sie dann in der Küche.
»Dorthin kommen die Kunden vom Haupteingang. Ein Arzt empfängt dort in seiner Praxis. Der vorige war ein Chinese, der jetzige ist aus Moskau, heißt es«, flüsterte die alte Vera. »Du und ich gehören hier nur zur Küche. Wir dürfen da nicht rein.«
Irina nickte verstehend. Und kaum aß sie ihren Haferbrei, wurde ihr wieder so warm und wohlig zumute, dass alle Fragen, die beantworteten und die nicht gestellten, sich irgendwohin verflüchtigten. Und auch ihr Gehör kippte im selben Moment um, wie ein Kristallglas. Es kippte nach innen. Und sie hörte, wie im Mund der Haferbrei durchgekaut wurde, wie Milch in die Brust lief und das Herz laut und zuverlässig schlug.
11
Kiew. Rejtarskaja-Straße. Wohnung Nummer 10.
Der Winter blieb weiter sanft und unaufdringlich. Mal fiel Schnee, mal taute er in irgendeinem unverständlichen warmen Windhauch, fror gleich wieder und wurde zu Glatteis. Und dann tappte man schon vorsichtig über den holprigen Gehweg und wartete auf neuen Schnee, damit er den rutschigen Pfad überpuderte.
Semjon war früh, noch im Dunkeln, fortgefahren und hatte versprochen, gegen fünf zurück zu sein. Veronika [48] ging gleich morgens zum Einkaufen. Sie verbrachte ein Stündchen am Telefon mit ihrer Bekannten Tanjetschka, erfuhr vieles über deren neuen, schon dritten Mann, der, wie sich herausstellte, drei Jahre jünger war als Tanjetschka, sich aber, in ihren Worten, durch erstaunliche Lebenserfahrung auszeichnete. Was Tanjetschka unter ›Lebenserfahrung‹ verstand, wollte Veronika bei einem persönlichen Treffen herausfinden, das sie am Ende ihres Telefongesprächs auch vereinbarten.