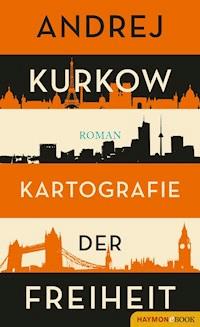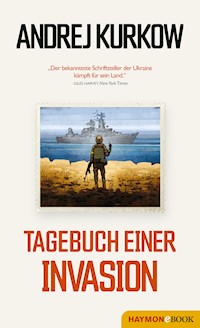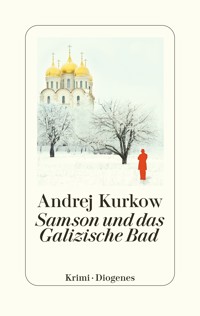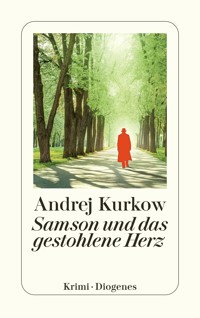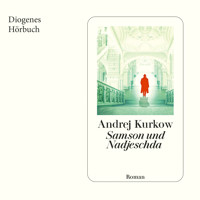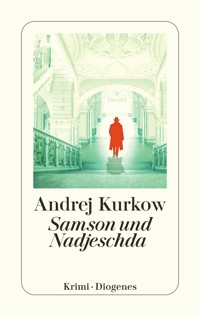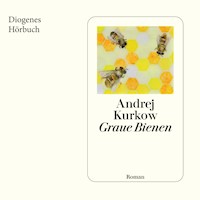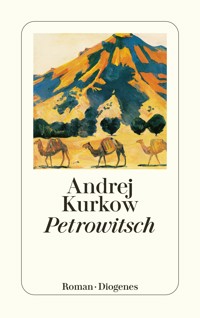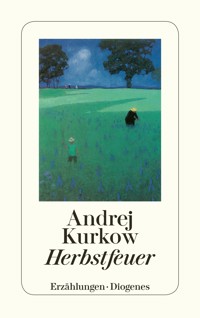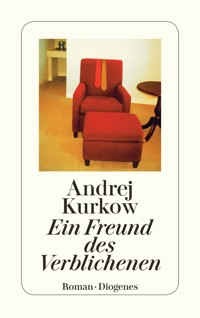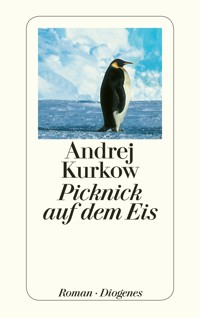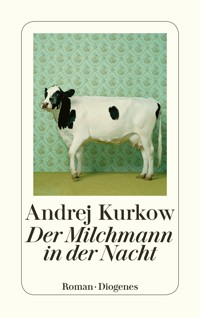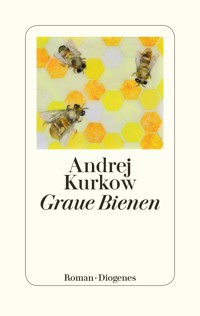
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Bienenzüchter Sergej lebt im Donbass, wo ukrainische Kämpfer und prorussische Separatisten Tag für Tag aufeinander schießen. Er überlebt nach dem Motto: Nichts hören, nichts sehen – sich raushalten. Ihn interessiert nur das Wohlergehen seiner Bienen. Denn während der Mensch für Zerstörung sorgt, herrscht bei ihnen eine weise Ordnung. Eines Frühlings bricht er auf: Er will die Bienen dorthin bringen, wo sie in Ruhe Nektar sammeln können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 520
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Andrej Kurkow
Graue Bienen
Roman
Aus dem Russischen von Johanna Marx und Sabine Grebing
Diogenes
1
Die Kälte brachte Sergej Sergejitsch gegen drei Uhr nachts auf die Beine. Der von ihm eigenhändig nach dem Bild aus der Zeitschrift Geliebte Datscha gebaute kleine Kaminofen, mit der Glastür und den zwei runden Kochplatten obendrauf, schenkte keine Wärme mehr. Die Blecheimer, die danebenstanden, waren leer. In der Dunkelheit griff Sergejitsch in den nächsten von ihnen und stieß mit den Fingern auf ein paar Kohlekrümel.
»Na dann!«, brummte er verschlafen. Er zog Hosen an, stieg mit nackten Füßen in die alten Filzschuhe und warf den Mantel über. Er nahm die Eimer und ging nach draußen.
Hinter dem Schuppen blieb er vor dem Kohlehaufen stehen und fand mit dem Blick sofort die Schaufel, auf dem Hof war es viel heller als im Haus. Laut schlugen die ersten Kohlen auf dem Boden der Eimer auf. Aber bald fielen sie gleichsam geräuschlos.
Irgendwo in der Ferne feuerte ein Geschütz. Eine halbe Minute später wieder ein Schuss, nur kam er anscheinend von der anderen Seite.
»Können die Dummköpfe nicht schlafen? Oder wollen sie sich aufwärmen?«, brummte Sergejitsch unwillig.
Er kehrte in sein dunkles Haus zurück und zündete eine Kerze an. Ihr angenehmer, warmer Honigduft stieg ihm in die Nase. Und er hörte das leise, gewohnte und beruhigende Ticken des Weckers, der auf dem schmalen Holzfensterbrett stand.
Im Ofen war noch ein wenig Glut übrig, aber trotzdem brauchte es Späne und Papier, bis die kalte, aus dem Frost geholte Kohle Feuer fing. Als hinter der rußigen Scheibe schon blaue lange Flammenzungen tanzten, ging Sergejitsch noch einmal auf den Hof hinaus. Ferner Geschützdonner, der im Haus kaum zu hören war, kam von Osten her. Aber da erregte ein anderes, näheres Geräusch seine Aufmerksamkeit, und er lauschte angespannt: Durch die Straße nebenan fuhr eindeutig ein Auto. Bis es irgendwo stehenblieb. Es gab ja nur zwei Straßen im Dorf: die Lenin- und die Schewtschenkostraße, dazu den Mitschurinweg von der einen zur anderen. In der Leninstraße wohnte er selbst, in nicht sehr stolzer Einsamkeit. Das Auto war also durch die Schewtschenko gefahren. Dort war auch nur ein einziger Bewohner übrig geblieben – Paschka Chmelenko, ebenfalls Frührentner, fast gleich alt, Sergejitschs Kindheitsfeind von der ersten Klasse der Dorfschule an. Paschkas Gemüsegarten blickte Richtung Horliwka, das hieß, er war Donezk um eine Straße näher als Sergejitsch. Sergejitschs Garten lag zur anderen Seite, Richtung Slowjansk. Sein Gemüsegarten ging zum Feld hinunter, das sich erst abwärts erstreckte und dann wieder anstieg, nach Schdaniwka. Schdaniwka war vom Garten aus nicht zu sehen, es versteckte sich gleichsam hinter dem Buckel. Aber die ukrainische Armee, die sich mit Unterständen und Schützengräben in diesen Buckel hineingegraben hatte, konnte man von Zeit zu Zeit hören. Und wenn er sie nicht hörte, dann wusste Sergejitsch trotzdem, dass sie dort in ihren Unterständen und Schützengräben saß, links von dem Wäldchen, an dem früher Traktoren und Lastwagen auf dem Feldweg entlanggefahren waren. Drei Jahre saß sie nun schon da. So, wie hinter Paschkas Schewtschenkostraße die lokale Bande in ihren Unterständen Tee und Wodka mit der russländischen militärischen Internationale trank, hinter den Gemüsegärten, hinter den Resten des alten Aprikosenhains, den man noch zu sowjetischen Zeiten gepflanzt hatte, und hinter dem Feld, dem durch den Krieg genauso die Bauern fehlten wie dem Feld zwischen Sergejitschs Garten und Schdaniwka. Ruhig war es hier seit etwa zwei Wochen! Zurzeit schossen sie nicht aufeinander. Vielleicht hatten sie es satt? Vielleicht sparten sie Granaten und Munition für die Zukunft? Vielleicht wollten sie auch die letzten beiden Bewohner von Malaja Starogradowka nicht stören, die sich fester an ihre Häuser klammerten als ein Hund an seinen Lieblingsknochen? Bei den übrigen Malostarogradowkern war gleich zu Beginn der Kriegshandlungen der Wunsch aufgekommen wegzuziehen. Und das hatten sie getan. Weil sie mehr Angst um ihr Leben bekommen hatten als um ihre Besitztümer und von zwei Ängsten die stärkere wählten. In Sergejitsch hatte der Krieg keine Angst um sein Leben ausgelöst. Dafür eine Art Verständnislosigkeit und plötzliche Gleichgültigkeit gegenüber allem, was ihn umgab. Es war, als wären alle Gefühle verschwunden, außer einem – dem Verantwortungsgefühl. Auch dieses Gefühl, das ihn zu jeder Tages- und Nachtzeit in Unruhe versetzen konnte, empfand er nur seinen Bienen gegenüber. Aber jetzt hielten sie Winterruhe, die Wände der Bienenstöcke waren dick, auf den Rähmchen und unter den verschlossenen Deckeln lagen Filze, außen schützten ringsum Metallplatten. Auch wenn die Bienenstöcke im Schuppen standen, konnte doch von überall her eine verirrte Granate geflogen kommen, und dann würden die Splitter zuerst ins Metall schneiden. Vielleicht hatten sie danach nicht mehr die Kraft, die hölzernen Wände der Bienenstöcke zu durchschlagen und den Bienen den Tod zu bringen?
2
Paschka kam am Mittag zu ihm. Sergejitsch hatte gerade einen zweiten Eimer voll Kohlen in den Ofen geschüttet und oben den Teekessel aufgesetzt. Er hatte vorgehabt, in aller Stille einen Tee zu trinken, aber daraus wurde nichts.
Bevor er den ungebetenen Gast ins Haus ließ, verbarg er sein »Schutzbeil«, das an der Wand lehnte, hinter dem Reisigbesen. Am Ende hatte Paschka zu seiner Selbstverteidigung eine Pistole oder eine Kalaschnikow, wer wusste das schon! Sähe er dann das Beil im Flur, würde er grinsen, wie immer, wenn er zeigen wollte, dass er sein Gegenüber für einen Trottel hielt. Sergejitsch hatte zur Selbstverteidigung eben nur ein Beil. Sonst nichts. Nachts legte er das Beil unters Bett, und deshalb war sein Schlaf tief und ruhig. Nicht immer, natürlich.
Sergej Sergejitsch öffnete Paschka die Tür. Dabei brummte er nicht besonders freundlich, weil in seinem Geist über den Nachbarn von der Schewtschenkostraße plötzlich all die alten Vorwürfe hereinbrachen, deren Verjährung wohl niemals eintrat.
Er musste daran denken, wie gemein Paschka oft gewesen war, wie er sich heimlich geprügelt, bei den Lehrern gepetzt und nicht hatte abschreiben lassen. Man könnte meinen, im Lauf von vierzig Jahren hätte schon alles vergeben und vergessen werden können! Vergeben – ja. Aber wie sollte man vergessen, wenn sie in ihrer Klasse sieben Mädchen und nur zwei Jungen gewesen waren: er und Paschka. Das hieß, Sergejitsch hatte in der Schulklasse keinen Freund gehabt, nur einen Feind! Obwohl »Feind« auch schon zu schwer und zu ernst klang.
»Grüß dich, Sersch!«, grüßte Paschka etwas angespannt, als er ins Haus trat.
»Heute Nacht gab es Strom!«, teilte er mit und sah sich nach dem Reisigbesen um, mit dem er sich den Schnee von den Stiefeln fegen wollte.
Er griff sich den Besen und grinste beim Anblick des Beils.
»Stimmt nicht!«, entgegnete Sergejitsch ruhig. »Hätte es Strom gegeben, dann wäre ich davon aufgewacht. Bei mir sind alle Lichtschalter an, damit ich nicht verpasse, wenn er kommt!«
»Du hast sicher fest geschlafen! Du schläfst doch so, dass dich auch eine Explosion nicht weckt. Und er war auch nur eine halbe Stunde lang da. Hier, schau.« Er zeigte Sergejitsch sein Handy. »Ich konnte es sogar ein Stück weit laden. Vielleicht willst du jemanden anrufen?«
»Ich habe niemanden zum Anrufen. Willst du einen Tee?«, fragte Sergejitsch, ohne einen Blick auf das Handy zu werfen.
»Woher hast du denn Tee?«
»Woher?! Von den Baptisten!«
»Da schau an!« Paschka staunte. »Meiner ist schon lang aus.«
Sie setzten sich an den Tisch, Paschka mit dem Rücken zum Ofen. Vom Ofen und seinem Eisenrohr, das wie eine Säule zur Decke aufstieg, kam Wärme.
»Wieso ist der so dünn?«, brummelte der Gast, als er in seine Tasse sah. Und fragte gleich darauf schon freundlicher: »Hast du vielleicht etwas zu essen?«
Sergejs Blick wurde böse. »Mir bringt man nachts keine humanitäre Hilfe!«
»Mir auch nicht.«
»Was denn sonst?«
»Gar nichts!«
Sergejitsch schnaubte und trank von seinem Tee. »Und diese Nacht war wohl auch niemand da?«
»Wieso, hast du etwas gesehen?«
»Ja, ich habe draußen Kohlen geholt, als es kalt wurde.«
»Ach, das waren Unsere, von drüben!«, bestätigte Paschka. »Aufklärer.«
»Und, was haben sie aufgeklärt?«
»Sie haben geschaut, ob Ukros im Dorf sind.«
»Wirklich?« Sergejitsch fixierte Paschkas hin- und herhuschenden Blick.
Paschka, als wäre er in die Enge getrieben, ergab sich sofort.
»Nein«, gestand er. »Es waren irgendwelche Typen. Sagten, sie wären aus Horliwka. Haben einen Audi ohne Papiere für dreihundert Dollar angeboten.«
»Und, hast du ihn gekauft?«, fragte Sergejitsch mit einem schiefen Grinsen.
»Bin ich verrückt?« Paschka schüttelte den Kopf. »Wäre ich ins Haus gegangen, um Geld zu holen, wären sie mir nach und, zack, ein Messer in den Rücken. Ich weiß doch, wie das abläuft.«
»Warum sind sie denn bei mir nicht vorbeigekommen?«, fragte Sergejitsch mit einem weiteren skeptischen Grinsen.
»Ich habe ihnen gesagt, dass ich allein im Dorf bin. Und es gibt ja auch keinen Weg mehr von der Schewtschenko zur Lenin. Dort ist doch der Krater von dem Einschlag bei den Mitkows. Bloß ein Panzer kommt da durch!«
Sergejitsch schwieg. Er sah nur Paschka weiter an, mit seiner schlauen Visage, die gut zu einem alten Taschendieb gepasst hätte, den man viele Male geschnappt und verprügelt hatte und der davon schreckhaft geworden war. Paschka, der mit seinen neunundvierzig Jahren gut und gern zehn Jahre älter als Sergejitsch erschien. Vielleicht wegen der fahlen Farbe seines Gesichts, vielleicht wegen der abgeschabten Wangen. Als hätte er sich das Leben lang mit einem stumpfen Rasierer rasiert und seine Haut ruiniert. Sergejitsch sah ihn an und dachte dabei, dass er, wären sie beide nicht hier im Dorf als Einzige zurückgeblieben, nie mehr mit ihm geredet hätte. Sie hätten so, parallel, jeder in seiner Straße sein Leben gelebt. Er, Sergejitsch, in der Lenin und Paschka in der Schewtschenko. Bis zum Tod hätten sie nicht miteinander geredet. Wäre nicht der Krieg gewesen.
»Sie haben lange nicht mehr geschossen hier bei uns«, seufzte sein Gast. »Bei Gatnaja haben sie früher nur nachts geballert, aber jetzt auch schon am Tag! – Sag mal«, Paschka beugte sich plötzlich ein wenig nach vorn. »Wenn Unsere dich um etwas bitten würden, würdest du es tun?«
»Was für ›Unsere‹?«, fragte Sergejitsch unwirsch zurück.
»Na, Unsere, aus Donezk! Was spielst du den Dummen?«
»Meine ›Unseren‹ sind im Schuppen, und sonst kenne ich keine ›Unseren‹. Du bist für mich auch nicht besonders ›Unserer‹!«
»Hör mal, was bist du so griesgrämig? Hast du nicht ausgeschlafen?« Paschka zog eine unzufriedene Grimasse. »Oder sind deine Bienen erfroren, dass du deinen Ärger an mir auslässt?«
»Ich werd’s dir geben, erfroren!« Sergejitschs Stimme klang ernsthaft drohend. »Wenn du etwas gegen meine Bienen sagst –«
»Aber ich achte doch deine Bienen! Im Gegenteil, ich mache mir Sorgen!«, unterbrach ihn Paschka schnell und schwenkte um: »Ich verstehe nur nicht, wie sie über den Winter kommen. Ist ihnen im Schuppen etwa nicht kalt? Ich würde dort vor Kälte eingehen!«
»Solange der Schuppen heil ist, ist es nicht kalt!« Sergejitsch ließ sich besänftigen. »Ich passe auf! Ich schaue jeden Tag nach.«
»Und wie schlafen sie in den Bienenstöcken?«, fragte Paschka. »Wie die Menschen?«
»Ja, wie die Menschen! Jede in ihrem Bettchen.«
»Aber du hast doch dort keine Heizung. Oder hast du eine eingebaut?«, fragte Paschka verwundert.
»Sie brauchen keine! Bei ihnen drin sind es 37 Grad plus. Sie machen es sich selbst warm.«
Jetzt, wo sie über die Bienen sprachen, wurde das Gespräch freundschaftlicher. Paschka erkannte, dass man bei so friedlicher Stimmung auch gut gehen konnte. Sogar das Verabschieden würde gelingen, nicht so wie beim letzten Mal, als Sergejitsch ihn fluchend hinausgeworfen hatte.
»Hast du dir übrigens mit der Rente etwas überlegt?«, fragte Paschka zum Abschluss.
»Was gibt es da zu überlegen?« Sergejitsch zuckte die Achseln. »Sobald der Krieg zu Ende ist, bringt die Postbotin sie mir für drei Jahre auf einmal! Dann fängt das wahre Leben an!«
Paschka grinste und wollte ein wenig sticheln, hielt aber den Mund.
Bevor er ging, sahen er und Sergejitsch sich noch einmal an.
»Hör mal, solange es noch geladen ist …«, Paschka hielt Sergejitsch noch einmal das Handy hin. »Vielleicht rufst du deine Witalina an?«
»Was heißt da ›meine‹?«, fragte Sergejitsch verwundert. »Seit sechs Jahren ist sie nicht mehr meine. Nein, ich rufe nicht an.«
»Und deine Tochter?«
»Jetzt geh schon! Ich habe doch gesagt, ich habe niemand zum Anrufen!« Dann schlug er hinter dem Gast die Tür zu.
3
»Was kann das nur sein?«, überlegte Sergejitsch laut.
Er stand am Rand seines Gemüsegartens vor dem weißen Feld, das sich wie eine breite Zunge den Hügel hinunter erstreckte und dann ebenso sanft wieder anstieg, Richtung Schdaniwka. Dort, am verschneiten Horizont, versteckten sich die Stellungen der ukrainischen Armee. Erkennen konnte Sergejitsch sie von hier aus nicht. Es war weit weg, und um seine Augen stand es auch nicht zum Besten. Rechts zog sich ein mal dichter, mal lichter Waldstreifen dort hinauf, der als Windschutz diente. Bergauf ging das Wäldchen allerdings erst nach der Senke, und bis zur Abzweigung nach Schdaniwka waren die Bäume in einer geraden Linie am Feldweg entlang gepflanzt, der jetzt still unter dem Schnee lag, weil seit Beginn der Kriegshandlungen niemand auf ihm fuhr. Vor dem Frühling 2014 waren sie auf diesem Feldweg auch bis nach Swetloje und nach Kalinowka gekommen.
Gewöhnlich brachten Sergej Sergejitsch die Füße wie von selbst hierher zum Rand des Gemüsegartens, ohne dass er darüber nachdachte. Er wanderte oft über seinen Hof, sah auf seinem Besitz nach dem Rechten. Mal ging er in den Schuppen zu den Bienen, mal in die Garage zu seinem grünen Lada Schiguli, mal zu dem Haufen lang brennender Kohlen, der mit jedem Tag kleiner wurde, aber dennoch Zuversicht in die Wärme von morgen und übermorgen gab. Manchmal trugen seine Füße ihn auch in den Obstgarten, dann blieb er bei den schlafenden Apfel- und Aprikosenbäumen stehen. Seltener fand er sich am äußersten Rand des Gartens wieder, wo die endlose Schneekruste knirschte und unter den Füßen brach. Aber die Stiefel sanken nie tief ein, weil der Winterwind den Schnee immer aufs Feld hinunter zur Senke blies. Und das hieß, oben und in Sergejitschs Gemüsegarten blieb nur wenig von ihm übrig.
Es war bald Mittag, eigentlich Zeit, nach Hause zu gehen, aber dieser Fleck dort, wo sich das Feld hinauf nach Schdaniwka, zu den ukrainischen Schützengräben zog, bestürzte Sergejitsch und ließ ihn nicht los. Vor ein paar Tagen, als er das letzte Mal am Rand des Gartens gestanden hatte, war kein Fleck auf dem schneeweißen Feld gewesen. Nur Schnee, in dem man, wenn man hineinsah, weißes Rauschen zu hören begann, eine Stille, die mit kalten Händen die Seele packte und lange nicht losließ. Natürlich war das hier eine spezielle Stille: Geräusche, an die Sergejitsch sich gewöhnt hatte und denen er keine Aufmerksamkeit schenkte, waren ebenfalls Teil der Stille geworden. Wie zum Beispiel der Nachhall von fernem Artilleriefeuer. Auch jetzt, er zwang sich zu lauschen, wurde irgendwo rechts, vielleicht fünfzehn Kilometer entfernt, geschossen und irgendwo links anscheinend auch, falls das nicht das Echo war.
»Vielleicht ist das ein Mensch?«, fragte Sergejitsch sich wieder laut, während er hinstarrte.
Einen Augenblick lang schien es, als wäre die Luft durchsichtiger geworden.
›Was kann denn sonst dort sein?‹, überlegte er. ›Hätte ich ein Fernglas, dann würde ich alles erkennen! Und würde schon zu Hause im Warmen sitzen … Vielleicht hat ja Paschka ein Fernglas?‹
Diesmal folgten seine Füße seinen Gedanken und brachten ihn zu Paschka. Der Granattrichter neben dem Haus der Mitkows, um den er am Rand entlang einen Bogen gemacht hatte, blieb hinter ihm zurück. Weiter ging er durch die Schewtschenko, in der Spur des kürzlich durchgefahrenen Autos, über das Paschka am Ende vielleicht die Wahrheit gesagt hatte, aber auch gelogen haben konnte, das kam bei ihm vor!
»Hast du ein Fernglas?«, fragte Sergejitsch ohne Gruß seinen Kindheitsfeind, der ihm die Tür öffnete.
»Ich hab eins, aber wozu brauchst du es?« Paschka hatte offenbar auch beschlossen, nicht zu grüßen: Wozu überflüssige Worte machen?
»Da liegt etwas im Feld auf meiner Seite. Vielleicht eine Leiche!«
»Ich komme!« In Paschkas Augen leuchtete ein fragender Funke auf. »Warte!«
Der Krater beim Haus der Mitkows blieb hinter ihnen zurück. Im Gehen sah Sergejitsch hinauf zum Himmel – es kam ihm vor, als würde es bereits dunkel, obwohl selbst die kürzesten Wintertage nicht um halb zwei zu Ende waren! Dann warf er einen Blick auf das massive alte Fernglas, das an einer braunen Lederschnur auf Paschkas vorgewölbter Mantelbrust baumelte. Natürlich hätte sich der Pelzmantel nicht so gewölbt, wenn Paschka nicht die langen Enden seines Schaffellkragens hineingestopft hätte. Der Kragen selbst stand wie ein Zaun um seinen dünnen Hals und beschützte ihn zuverlässig vor dem eisigen Wind.
»Und wo?« Paschka setzte das Fernglas an die Augen, kaum hatten sie am Rand des Gemüsegartens haltgemacht.
»Schau dort rüber, geradeaus und ein bisschen nach rechts, am Hang!« Sergejitsch wies mit der Hand hin.
»So, so, so«, murmelte Paschka. »Ja! Ich sehe es!«
»Und was ist da?«
»Eine Soldatenleiche. Aber zu wem gehört er? Wo sind denn seine Abzeichen? Nein, man sieht es nicht. Er ist blöd gefallen!«
»Lass mich durchschauen!«, bat Sergejitsch.
Paschka nahm das Fernglas herunter und reichte es ihm.
»Da, Imker! Vielleicht hast du ein schärferes Auge!«
Das, was aus der Ferne dunkel ausgesehen hatte, war aus der Nähe grün. Der Tote lag auf der rechten Seite, den Hinterkopf zu Malaja Starogradowka gewandt, also mit dem Gesicht zu den ukrainischen Schützengräben.
»Was siehst du?«, fragte Paschka.
»Was ich sehe? Da liegt einer. Tot. Soldat. Weiß der Teufel, von welcher Seite! Vielleicht von diesen, vielleicht von jenen!«
»Verstehe.« Paschka nickte, und sein Kopf, der in dem hochgestellten Schaffellkragen wackelte, brachte Sergejitsch, der das Fernglas schon abgesetzt hatte, zum Lächeln.
»Was ist?«, fragte Paschka misstrauisch.
»Du siehst aus wie eine umgedrehte Glocke mit deinem Kragen. Dein Kopf ist zu klein für diesen Luxus!«
»Er ist, wie er ist«, sagte Paschka bissig. »Einen kleinen Kopf trifft eine Kugel dafür schwerer. Einen großen wie deinen verfehlt man auch aus einem Kilometer Entfernung nicht!«
Gemeinsam stapften sie durch den Obstgarten, den Gemüsegarten, den Hof bis ans Tor zur Leninstraße. Schweigend, ohne sich anzusehen. Hier bat Sergejitsch Paschka, ihm das Fernglas für ein paar Tage dazulassen. Paschka ließ es ihm. Dann ging er zum Mitschurinweg, ohne sich noch einmal umzudrehen.
4
In der Nacht wurde Sergej Sergejitsch nicht von der eigenen Kälte wach, sondern von einer fremden, geträumten. Genauer: Er träumte, er sei ein Soldat. Erschossen und auf dem Schnee liegengelassen. Und ringsum war es schrecklich kalt. Der tote Körper war schon erstarrt, aber nun wurde er gleichsam zu Stein und begann, selbst Kälte auszustrahlen. Sergejitsch lag schlafend im Inneren dieses steinernen Körpers und fühlte, im Traum und außerhalb, im eigenen Körper, kaltes Entsetzen. Er ertrug es, bis der Traum ihn losließ. Sobald der Traum schwächer wurde, stand er vom Bett auf. Er wartete, bis seine Finger aufhörten, von der im Traum durchlebten Kälte zu zittern, dann schüttete er Kohlebröckel aus dem Eimer in den Ofen und setzte sich in der Dunkelheit an den Tisch.
»Warum lässt du mich nicht schlafen?«, flüsterte er.
Wohl eine halbe Stunde saß er so da, während seine Augen sich an die Dunkelheit gewöhnten. Die Luft im Zimmer teilte sich in horizontale Schichten auf, den Fußknöcheln wurde es kalt, den Schultern und Wangen warm.
Sergejitsch seufzte, zündete eine gelbe Kerze an und ging zum Schrank, öffnete die linke Tür und hielt die Kerze vor das Schrankinnere. Da hing zwischen leeren Kleiderbügeln ein Kleid seiner Frau, seiner Exfrau Witalina. Sie hatte es absichtlich zurückgelassen, als eindeutigen Hinweis. Als einen der Gründe, warum sie gegangen war.
Im zitternden Halbdunkel der kleinen Flamme war das Muster des Kleides nicht besonders gut zu sehen, aber das brauchte Sergejitsch auch nicht. Er kannte es in- und auswendig, sein ganzes simples Sujet: Über den hellblauen Stoff liefen große rote Ameisen, die einen aufwärts, die anderen abwärts, dicht an dicht, vermutlich Tausende von Ameisen! Wie konnte einem Kleidererfinder nur so etwas in den Kopf kommen! Konnte es nicht einfach und schön wie bei allen sein, ein Kleid mit Punkten oder Margeriten, oder mit Veilchen?
Sergejitsch löschte die Kerzenflamme nach alter Gewohnheit zwischen rechtem Daumen und Zeigefinger, sog den süßen letzten Rauchfaden der Kerze in die Nase und legte sich wieder ins Bett. Unter der Decke war es warm. Bei einer solchen Wärme mussten auch wärmende Träume kommen, keine, die einen mit kaltem Grauen durchdrangen!
Die Augen fielen ihm zu, und im Halbschlaf sah er wieder das vertraute Kleid mit den Ameisen. Nur dieses Mal nicht im Schrank, sondern an ihr, an Witalina. Es war lang, bis über die Knie. Die roten Ameisen rannten förmlich über den Stoff, weil Witalina im Dorf die Leninstraße entlangging und ein leichter Wind den Saum des Kleides hin- und herwehte. Witalina ging nicht, sie schwebte. Genau so, wie sie das erste Mal aus dem Hof auf die Straße getreten war. Man konnte sagen, sie war hinausgegangen, um sich der Straße und dem ganzen Dorf zu zeigen wie irgendeinen bedeutenden Ausweis, bei dessen Anblick alle den Weg freigeben mussten. An jenem ersten Tag nach ihrer Ankunft aus Winnyzja hatte sie noch nicht alle Taschen und Koffer ausgepackt, aber sofort aus ihren Sachen das Ameisenkleid herausgeholt, es gebügelt, angezogen und sich zur Kirche aufgemacht, die am Ende der Straße stand. Er hatte versucht, sie aufzuhalten, sie angefleht, etwas anderes anzuziehen, aber ach wo! Mit Witalinas Charakter und ihrer Liebe zum »Schönen« war schwer auszukommen gewesen. Unmöglich sogar.
Sie dachte damals, Sergejitsch würde gemeinsam mit ihr durch die Straße spazieren, aber er begleitete sie nur bis zum Tor. Er schämte sich, weiterzugehen mit seiner Frau, die sich mit roten Ameisen herausgeputzt hatte.
Sie war allein losgegangen, mit mutigem, geradezu herausforderndem Gang, hatte Nachbarn und Nachbarinnen an ihre Zäune, Fenster und Gartentore gelockt. Damals lebte das Dorf ja noch, fast aus jedem Hof drang Kinderlachen!
Natürlich zerriss sich in den nächsten paar Tagen das ganze Dorf das Maul über sie …
Dabei hatte er sich ja nicht wegen des Kleides in sie verliebt und sie zur Frau genommen! Ohne das Kleid war sie viel besser und gehörte ihm allein! Leider nicht so lange, wie er es sich gewünscht hatte.
Seltsamerweise war in Sergejitschs Traum jener erste Gang Witalinas durch das Dorf anders, als es sich in Wirklichkeit abgespielt hatte. Im Traum ging er neben ihr und hielt sie an der Hand. Er grüßte die Nachbarn und Nachbarinnen, er nickte ihnen zu, auch wenn ihre Blicke an dem Kleid mit den Ameisen klebenblieben wie Fliegen im Sommer an dem Fliegenpapier über dem Tisch.
In seinem Traum gingen sie bis zu der Kirche, aber sie traten nicht durch die offene Tür dort ein, sondern gingen um die Kirche herum zum Friedhof, wo die stummen Kreuze und Grabsteine den Menschen die Lust nahmen, zu lächeln oder laut zu reden. Dort führte Sergejitsch Witalina zum Grab seiner Eltern, die keine fünfzig geworden waren, dann zeigte er ihr seine anderen Verwandten: die Schwester des Vaters mit ihrem Mann, seinen Cousin mit den beiden Söhnen, die im Suff bei einem Autounfall umgekommen waren, auch seine Nichte vergaß er nicht, obwohl man sie am äußersten Rand des Friedhofs hatte verschwinden lassen, oberhalb der Schlucht. Das Ganze nur, weil ihr Vater sich mit dem Vorsitzenden des Dorfsowjets gestritten hatte und der sich, wo er eben konnte, an ihm gerächt hatte.
Wenn man lange an einem Ort lebt, dann hat man mehr Verwandtschaft auf dem Friedhof als solche, die sich nebenan wohlbefindet.
Hier erinnerte Sergejitsch sich im Schlaf, dass sie tatsächlich am zweiten oder dritten Tag nach Witalinas Ankunft auf den Friedhof gegangen waren, nur war sie da passend gekleidet gewesen, ganz in Schwarz. Das Schwarz stand ihr sehr gut, so erschien es ihm damals.
Vor dem Fenster krachte es plötzlich laut. Sergejitsch fuhr zusammen und verlor den Faden seines Traums. Der Friedhof verschwand, auch Witalina in ihrem Ameisenkleid und er selbst, als wäre im Kino während der Filmvorführung der Streifen im Projektor gerissen.
Der Krach brachte Sergejitsch allerdings nicht dazu, die Augen zu öffnen.
›Irgendwo hat es eingeschlagen‹, dachte er. ›Und nicht besonders nah, bloß ein großes Kaliber! Wäre es nahe gewesen, dann hätte es mich aus dem Bett geschleudert.‹ Und hätte das Geschoss das Haus getroffen, dann wäre er für immer in diesem Traum geblieben, in dem es gemütlicher und wärmer war als im Leben. Obendrein ärgerte ihn auch das Ameisenkleid nicht mehr, es begann ihm eher schon zu gefallen!
5
»Er liegt doch direkt vor ihren Füßen!« Paschka war böse und verbarg seine Empörung nicht. »Sie hätten ihn schon mal holen können!«
Von der zerbombten Kirche her wehte ein kalter, stechender Wind. Paschka hatte den Kopf zwischen die Schultern geklemmt im Versuch, sich hinter dem hochgeklappten Kragen seines Schaffellmantels vor diesem Wind zu schützen. Sein unfrohes Profil erinnerte Sergejitsch an irgendein Revolutionsbild aus dem sowjetischen Geschichtsbuch.
Sie standen wieder am Rand des Gemüsegartens. Paschka schaute an diesem Morgen finster drein. Finster hatte er auch vor etwa einer Stunde auf Sergejitschs Klopfen hin die Tür geöffnet, ohne ihn hereinzubitten. Allerdings hatte er sich schnell fertiggemacht und nichts dagegen gehabt, mit seinem alten Kindheitsfeind an den Rand des Gartens zu kommen.
»Vielleicht lässt er dich ja nicht schlafen«, brummte er im Gehen. »Aber ich habe mit ihm nichts zu tun! Er liegt da eben, na und! Irgendwann werden sie ihn verscharren und beerdigen!«
»Aber das ist doch ein Mensch!«, versuchte Sergejitsch, seinen Standpunkt zu erklären, und stolperte dabei, weil er nicht auf den Boden sah. »Ein Mensch muss entweder leben oder im Grab liegen!«
»Da wird er schon noch landen.« Paschka winkte ab. »Eines Tages landet jeder unter der Erde.«
»Aber vielleicht steigen wir runter und ziehen ihn wenigstens in das Wäldchen, damit man ihn nicht sieht?«
»Ich steige da nicht runter! Sollen das die machen, die ihn dort hingeschickt haben!«
Paschkas Stimme klang so entschlossen, dass Sergejitsch begriff, dass dieses Gespräch sinnlos war. Trotzdem redete er weiter.
Er redete auch noch, als sie auf dem festgetretenen Schnee vor dem Feld standen, das sich den Hügel hinunterzog.
»Gib mir das Fernglas«, verlangte Paschka.
Er sah eine Weile hindurch und verzog das Gesicht. Was er sah, gefiel ihm genauso wenig wie Sergejitsch, nur brachte es ihn offenbar auf ganz andere Gedanken als seinen Nachbarn.
»Wenn er von ihnen heruntergekommen ist, dann ist er einer von den Ukros«, begann Paschka, laut zu überlegen, nachdem er das Fernglas abgesetzt hatte. »Wenn er zu ihnen wollte, dann ist er von uns! Wenn wir wüssten, dass es Unserer ist, könnte man es den Jungs in Karusselino sagen, dann könnten sie ihn nachts wegschleppen. Aber er liegt ja quer! Und es ist nicht klar, wo er hinwollte. Sersch, hast du übrigens heute Nacht den Flieger gehört?«
»Ja«, nickte Sergejitsch.
»Anscheinend haben sie den Friedhof getroffen.«
»Und wer?«
»Weiß der Teufel. Hast du ein bisschen Tee für mich?«
Sergejitsch biss sich auf die Lippen. Nein zu sagen war unpassend, schließlich war Paschka ja doch auf seine Bitte hin mitgekommen, obwohl er nicht gewollt hatte!
»Ich gebe dir welchen, gehen wir.«
Der von den Sohlen ihrer schweren Stiefel zermahlene Schnee knirschte trocken unter den Füßen wie gefrorener Sand.
Sergejitsch ging voraus. Dabei überlegte er, in was er den Tee für Paschka hineinfüllen konnte. In eine Streichholzschachtel – das war wenig, dann wäre er gekränkt, in ein Mayonnaiseglas – das war viel.
Vor seiner Haustür trampelten beide auf dem Beton und klopften den Schnee ab.
Am Ende schüttete Sergejitsch den Tee für Paschka doch in ein Mayonnaiseglas, er füllte es bloß nicht ganz, sondern zu etwa zwei Dritteln.
»Soll ich dir das Fernglas noch dalassen, oder hast du genug gesehen?«, fragte Paschka und versuchte, dankbar auszusehen.
»Ja, lass es hier«, bat Sergejitsch.
Dieses Mal trennten sie sich freundschaftlich.
Als er allein war, ging Sergejitsch beim Schuppen vorbei und besuchte seine überwinternden Bienen, überprüfte, ob alles in Ordnung war. Dann schaute er in die Garage und betrachtete seinen grünen Schiguli-Kombi. Er überlegte, den Motor anzulassen, fürchtete aber, dass es die Bienen aufschrecken würde. Sie befanden sich ja nebenan hinter der Holzwand, der Schuppen und die Garage waren wie Zwillinge und auch nahezu unter einem Dach.
Vor dem Fenster begann schon die frühe Winterabenddämmerung. Sergejitsch versorgte sich für die Nacht mit Kohle, er schüttete einen halben Eimer davon in den Ofen, schloss die Ofentür und stellte oben einen Topf mit Wasser auf. Heute gab es bei ihm zum Abendessen Buchweizengrütze. Dann würde er bei Kerzenschein ein Buch lesen, Kerzen hatte er jetzt viele. Mehr als Bücher. Die Bücher waren alle alt und sowjetisch, sie standen im Büfett hinter Glas, links vom Service. Sie waren alt, aber lasen sich leicht, die Buchstaben waren groß und deutlich, und alles war verständlich, weil sie einfache Geschichten erzählten. Die Kerzen standen in zwei Kisten in der Ecke. Darin lagen sie in dichten Schichten, jede Schicht von der anderen durch ein Wachspapier getrennt. Dieses Wachspapier allein war bereits eine Kostbarkeit! Damit konnte man selbst im Regen und auch bei echtem Sturm ein Feuer anzünden. Wenn es einmal brannte, dann konnte nichts es löschen. Als ein Geschoss ihre Lenin’sche Kirche traf – Lenin’sche nannten alle sie deshalb, weil sie am äußersten Ende der Leninstraße stand – und sie, aus Holz gebaut, abbrannte, war Sergejitsch am nächsten Morgen hingegangen und hatte in dem steinernen Anbau, den die Explosion aufgerissen hatte, zwei Kisten mit kleinen Kirchenkerzen gefunden. Er hatte sie mitgenommen, zuerst eine und dann auch die zweite nach Hause getragen. So wurde am Ende Gutes mit Gutem vergolten, wie es in der Bibel stand. Wie viele Jahre lang hatte er sein Wachs dem Priester für die Kirche geschenkt, eben für die Kerzen! Er hatte es immer geschenkt, und dann hatte er von Gott zum Geschenk die Kerzen erhalten. Genau zur rechten Zeit, als der Strom ausblieb. So dienten sie ihm jetzt anstelle der Glühbirne. Es war doch auch eine heilige Sache, einem Menschen in schwerer Zeit das Leben zu erhellen!
6
Nach ein paar ruhigen, windstillen Tagen kam ein Abend, der dunkler war als gewöhnlich. In einem Aufruhr am Himmel, der in der winterlichen Dunkelheit von unten nicht zu sehen war, hatten schwere Wolken die leichten fortgeschoben, und plötzlich fielen aus ihnen weiche Flocken auf den alten, im trockenen Wind hart gewordenen Schnee.
Gähnend warf Sergejitsch eine neue Ladung lang brennender Kohle in den Ofen und löschte mit zwei Fingern die gelbe Kirchenkerze. Damit hatte er schon alles, was vor dem Schlaf zu tun war, vollbracht. Blieb nur noch, sich die Decke über die Ohren zu ziehen und zu schlafen, bis der Morgen oder die Kälte kam. Aber wegen des Schneefalls schien die Stille nicht vollkommen zu sein. An das ferne Geschützfeuer hatte Sergejitsch sich längst gewöhnt, daher war es Bestandteil seiner Stille geworden. Doch der Schneefall, ein viel seltenerer Gast, überdeckte es mit seinem Rascheln vor dem Fenster.
Stille ist natürlich etwas Relatives, und als persönliche Klangerscheinung stimmt jeder Mensch sie nach sich selbst. Früher war Sergejitschs Stille genau wie die aller anderen gewesen. Das ferne Brummen eines Flugzeugs am Himmel oder das Zirpen der Grillen, das nachts durchs offene Fenster hereinflog, wurde mühelos Teil von ihr. Jedes leise Geräusch, das einen nicht ärgert oder zwingt, sich nach ihm umzudrehen, wird letztlich Teil der Stille. So war es früher mit der Stille in Friedenszeiten. So wurde es dann auch mit der Stille in Kriegszeiten, in der die Geräusche des Krieges die friedlichen unterdrückten, die Geräusche der Natur verdrängten, mit der Zeit aber selbst uninteressant und alltäglich wurden, sich dann gleichsam ebenfalls unter die Flügel der Stille legten und keine Aufmerksamkeit mehr erregten.
Jetzt lag Sergejitsch da, durch den Schneefall, der ihm zu laut schien, von einer seltsamen Unruhe gepackt. Und statt einzuschlafen, dachte er nach.
Wieder fiel ihm der auf dem Feld liegende Tote ein. Aber diesmal kam ihm schnell der erfreuliche Gedanke, dass er jetzt schon sicher nicht mehr zu sehen war! Denn ein solcher Schnee deckte alles zu, bis zum Frühling, bis zum Tauwetter! Im Frühling würde alles anders, die Natur würde erwachen, und die Vögel würden lauter singen, als die Geschütze feuerten, weil die Vögel in der Nähe sangen, die Geschütze aber dort in der Ferne blieben. Nur manchmal würden die Artilleristen aus unbegreiflichem Grund, vielleicht weil sie betrunken oder müde waren, ein, zwei Geschosse zufällig auf ihr Dorf, auf Malaja Starogradowka, abfeuern. Einmal im Monat, nicht öfter. Die Geschosse würden dort hinfallen, wo es schon kein Leben mehr gab: auf den Friedhof oder den Kirchenvorhof oder das seit langem leer und ohne Fenster dastehende Gebäude des alten Kolchosebüros.
Er aber würde, wenn der Krieg weiterging, das Dorf Paschka überlassen und seine Bienen, alle sechs Stöcke, dorthin bringen, wo kein Krieg war. Wo es auf den Feldern keine Explosionskrater, sondern Blumen oder Buchweizen gab, wo man unbeschwert und furchtlos durch den Wald, das Feld, die Dorfstraße gehen konnte. Wo viele Menschen waren und einem das Leben allein wegen ihrer Menge und ihrer Sorglosigkeit wärmer vorkam, auch wenn sie einen im Vorübergehen nicht anlächelten.
Die Gedanken an seine Bienen versetzten Sergejitsch in friedliche Stimmung und brachten den Schlaf schon näher. Er dachte an jenen Tag, der in seinem Herzen und seiner Erinnerung einen besonderen Platz einnahm: als ihn zum ersten Mal der Herr des Donbass und beinahe des ganzen Landes, sein ehemaliger Gouverneur, besucht hatte, ein Mensch, der in jeder Hinsicht verständlich und vertrauenerweckend gewesen war wie ein alter Abakus. Er kam in einem Jeep mit zwei Leibwächtern. Das Leben war damals ganz anders, ruhig. Bis zur Stille des Krieges waren es noch zehn Jahre oder mehr! Die Nachbarn kamen herausgelaufen und sahen neidisch und neugierig zu, wie der Hüne von einem Mann durch Sergejitschs Tor trat und ihm mit seiner Riesenpranke die Hand schüttelte. Vielleicht hörten auch manche, wie er damals fragte: »Du bist also Sergej Sergejitsch? Bei dir kann man ein Nickerchen auf Bienen machen? Hast du dir das selbst ausgedacht?« – »Nein, die Idee ist von einem anderen, ich habe es in der Imkerzeitung gesehen. Aber den Liegeplatz habe ich selbst gemacht!«, hatte Sergejitsch ihm damals geantwortet. »Na dann zeig mal!«, hatte der Gast mit seiner tiefen Stimme und ernstem, aber freundlichem Lächeln gesagt. Sergejitsch führte ihn in den Garten, wo sechs Bienenstöcke paarweise mit den Rücken aneinanderstanden. Darauf lagen ein Holzbrett und eine dünne, mit Stroh gefüllte Matratze.
»Soll ich die Schuhe ausziehen?«, fragte sein Gast.
Sergejitsch sah auf die Schuhe und erstarrte ungläubig: Sie liefen spitz zu, waren äußerst präzise geformt und schillerten perlmuttfarben wie in einer Pfütze schwimmendes Benzin im hellen Sonnenlicht, nur war das Perlmutt edler als die Benzinmuster. Das Perlmutt der Schuhe leuchtete so, als würde die Luft über ihnen schmelzen, wie es bei großer Hitze vorkam, und ließ Farbe und Form der Schuhe noch plastischer und flirrender aussehen.
»Nein, wozu ausziehen?!«, sagte Sergejitsch kopfschüttelnd.
»Gefallen sie dir?«, fragte sein Gast lächelnd und brachte den Hausherrn mit seinen Worten dazu, den Blick von den Schuhen loszureißen.
»Ja, natürlich! So etwas Schönes habe ich noch nie gesehen«, gestand Sergejitsch.
»Was für eine Schuhgröße hast du?«, erkundigte sich unerwartet der Gouverneur. –
»Zweiundvierzig!«
Der Gast nickte und trat zu der mittleren Kiste, unter der ein hölzerner Hocker als Stufe stand. Er stieg hinauf und setzte sich behutsam auf die dünne Matratze. Er legte sich auf die rechte Seite, streckte vorsichtig die Beine aus und sah Sergejitsch kindlich wie ein Schüler den strengen Lehrer an. »Besser auf den Rücken oder auf den Bauch?«, fragte er. »Auf dem Rücken ist es besser«, riet Sergejitsch ihm. »Mehr Berührungsfläche zwischen Körper und Bienenstöcken.« – »Du kannst gehen, ich schlafe ein Weilchen. Man wird dich rufen!«, sagte der Gast und warf einen Blick zu den Bodyguards hinüber, die ein wenig abseits von der Bienenliegebank standen. Einer von ihnen nickte zum Zeichen, dass er verstanden hatte.
Sergejitsch kehrte ins Haus zurück und schaltete den Fernseher ein – damals gab es Strom. Er versuchte, sich abzulenken, aber konnte sich in Gedanken von dem hohen Gast und seinen Schuhen nicht losreißen. Etwas ließ ihm keine Ruhe: Wenn nur die Füße der Bienenstöcke unter dem Gewicht des auf ihnen liegenden Riesen nicht einknickten! Sergejitsch kochte sich einen Tee und trank, aber die Besorgnis über die möglicherweise fehlende Stabilität seiner selbstgebauten Bienenstöcke verschwand nicht. Denn beim Bauen hatte er nur auf den Komfort der Bienen geachtet; dass der Schlaf auf den Bienen nützlich und heilsam war, hatte er noch nicht gewusst.
Damals ließ der hohe Gast aus Dankbarkeit dreihundert Dollar und eine Literflasche Wodka zurück. Von dem Tag an hatten alle, die ihn, Sergejitsch, nicht mochten oder nicht beachteten, zu grüßen begonnen, als hätte ihn ein Erzengel mit dem Flügel gestreift!
Ein Jahr später, wieder im frühen Herbst, war der Gouverneur erneut zu ihm gekommen. Zu der Zeit hatte Sergejitsch auch schon die Laube um die Liegebank gebaut. Sie war leicht und zerlegbar, so dass man sie in einer Stunde auf- und in einer Stunde wieder abbauen konnte. Die Matratze hatte er noch dünner gemacht, damit das Stroh nicht die leiseste Vibration der hunderttausend Bienen dämpfte.
Sein Gast sah müde aus. Er hatte etwa zehn Männer als Wachen dabei, und wohl genauso viele Autos standen in der Leninstraße an seinem Zaun aufgereiht. Wer darin saß und warum sie nicht ausstiegen, begriff Sergejitsch nicht. Dieses zweite Mal lag oder schlief der Herr des Donbass fünf oder sechs Stunden auf den Bienenstöcken. Zum Abschied schenkte er Sergejitsch nicht nur tausend Dollar im Umschlag, sondern umarmte ihn auch kräftig wie ein Bär. Als würde er sich von einem ihm lieben Menschen verabschieden.
›Das war’s‹, hatte Sergejitsch gedacht. ›So ein Glück wiederholt sich nicht!‹ Gründe, so zu denken, gab es mehrere. Einer davon war vollkommen banal: Für das Schlafen auf Bienen wurde jetzt in jeder größeren Stadt geworben. Die Konkurrenz war sehr groß. Und er, Sergejitsch, machte für sich überhaupt keine Werbung. Im Dorf wussten sie, dass der Exgouverneur eigens aus Kiew hergefahren war, um auf seinen Bienen zu schlafen. Und sie erzählten es ihren Freunden, Verwandten und Bekannten aus anderen Dörfern und Städtchen. So, dass mit einer für die anderen Imker beneidenswerten Regelmäßigkeit Menschen an Sergejitschs Gartentor auftauchten, die auf den »Gouverneursbienen« schlafen wollten. Den Preis erhöhte Sergejitsch nicht, für besonders nette Kunden brachte er Tee mit Honig und redete mit ihnen bereitwillig über das Leben. Im Haus gab es ja niemanden mehr, mit dem er über das Leben reden konnte: Seine Frau hatte ihn mit der Tochter verlassen, sie waren davongelaufen, als er in Horliwka auf dem Großmarkt gewesen war. Sie hatten ihn mit verwundetem Herzen zurückgelassen. Aber er hatte standgehalten. Hatte sich zusammengerissen und die Tränen, die ihm in die Augen stiegen, nicht übers Gesicht laufen lassen. Und das Leben war weitergegangen. Er freute sich im Sommer am Summen der Bienen und im Winter an der Stille und Sorgenfreiheit, den schneeweißen Feldern und dem grauen, reglosen Himmel. So hätte er das ganze Leben verbringen können, aber daraus war nichts geworden. Etwas im Land ging zu Bruch, dort in Kiew, wo immer irgendetwas nicht in Ordnung war. Es ging derart zu Bruch, dass schmerzhafte Risse durch das Land liefen wie durch Glas, und aus diesen Rissen floss Blut. Der Krieg begann, dessen Sinn nun schon seit drei Jahren für Sergejitsch schleierhaft blieb.
Das erste Geschoss hatte die Kirche getroffen. Und schon am nächsten Morgen begannen die Bewohner, Malaja Starogradowka zu verlassen. Zuerst schickten die Väter die Mütter mit den Kindern zu Verwandten: die einen nach Russland, die anderen nach Odessa oder nach Mykolajiw. Dann gingen die Väter selbst: Die einen wurden »Separatisten«, die anderen wurden Flüchtlinge. Als Letzte brachten sie die alten Männer und Frauen fort. Unter Geschrei, Weinen, Flüchen. Es war ein schrecklicher Lärm. Und plötzlich war es eines Tages so still geworden, dass Sergejitsch, als er auf die Leninstraße hinaustrat, von der Stille fast taub geworden wäre. Jene Stille lastete so schwer, als wäre sie aus Gusseisen. Damals bekam er Angst, dass er als Einziger allein im ganzen Dorf zurückgeblieben war! Vorsichtig ging er die Straße entlang und spähte über die Zäune. Nach einer Nacht voller Geschützsalven lastete diese Stille auf ihm, als schleppte er einen Sack Kohlen auf dem Rücken. Die Türen der Häuser waren schon mit Brettern vernagelt, vor den Fenstern waren Bretter angebracht. Er ging bis zur Kirche, das war ein knapper Kilometer, dann hinüber in die Schewtschenko, und in dieser Parallelstraße zurück, schon mit weichen Knien. Plötzlich hörte er ein Husten und freute sich. Er trat an den Zaun, hinter dem das Husten hergekommen war, und da war Paschka, saß im Hof auf der Bank, in der linken Hand eine Flasche Wodka, in der rechten eine Papirossa.
»Und was ist mit dir?«, fragte Sergejitsch ihn. Sie grüßten sich seit der Kindheit nicht.
»Wieso? Was soll sein? Soll ich etwa hier alles aufgeben? Ich hab einen tiefen Erdkeller, da setze ich mich rein, wenn nötig!«
Das war im ersten Frühling des Krieges gewesen. Jetzt war schon sein dritter Winter. Seit fast drei Jahren hielten er und Paschka hier zu zweit das Leben im Dorf aufrecht! Man konnte das Dorf doch nicht ohne Leben lassen. Wenn alle weggingen, dann kam auch niemand mehr zurück! Aber so würden sie auf jeden Fall wiederkommen. Wenn entweder der Unsinn in Kiew aus war oder die Raketen und Granaten.
7
Zwei Nächte und zwei Tage verstrichen nach dem Schneefall. Sergejitsch ging nur, um Kohlen zu holen, auf den Hof hinaus. Der Schnee unter den Füßen knirschte jetzt anders. Die Füße versanken weich im frischen Schneeteppich, der nicht besonders tief war. Aber Sergejitsch wunderte sich, dass er im Neuschnee einige kahle Stellen bemerkte, durch die die alte harschige Kruste herausschaute. Seltsam, dass nicht einmal ein halber Meter zusammengekommen war! Aber es hatte ja keinen Schneesturm gegeben. Der Schnee war einfach nur gefallen, leicht und ungezwungen. Dann hatte er sich irgendwohin entfernt, war davongeflogen. Oder der Talwind hatte ihn weggetrieben, hin zu natürlichen Hindernissen, wo er sich zu einer Schneewehe ansammeln konnte. Nur kam in Sergejitsch nicht der Wunsch auf, diese Schneewehen zu suchen.
Auf dem Ofen kochte der Teekessel. Einen Ofen schaltete man nicht wie einen Gasherd aus. Deshalb musste der Kessel vor sich hin kochen, bis Sergejitsch den heißen Griff mit einem alten Küchentuch packte, um sich nicht zu verbrennen, und ihn herunternahm. Er goss von dem kochenden Wasser in den Porzellanbecher mit dem MTS-Mobilfunk-Logo, würzte das Wasser mit einer Prise Tee und hob ein Literglas Honig vom Boden auf den Tisch.
›Ich hätte Paschka dazuholen können‹, dachte er und gähnte. Dann sagte er zu sich selbst: ›So ist es auch gut! Ich werde ihn ja nicht vom anderen Ende des Dorfes holen!‹
Dass das ›andere Ende des Dorfes‹ von Sergejitschs Haus vielleicht drei-, vierhundert Meter entfernt war, änderte nichts daran.
Er hatte seinen ersten Becher noch nicht ausgetrunken, als irgendwo in der Nähe eine Explosion krachte. Die Fensterscheiben klirrten so laut, dass es in den Ohren schmerzte.
»Ach, ihr Idioten!«, entfuhr es ihm verbittert. Hastig stellte er den Becher auf den Tisch, so dass der Tee herausspritzte, und lief ans nächste Fenster, überprüfte, ob keine Risse durchliefen. Nein, es war heil geblieben.
Sergejitsch sah nach den übrigen Fenstern, auch sie waren alle heil. Er überlegte, ob er vielleicht gehen und nachsehen sollte, wo es eingeschlagen und ob es nicht irgendein Nachbarhaus zerstört hatte.
›Ach, zum Teufel damit! Hauptsache, es war nicht meines!‹, beschloss er nach einer Weile und setzte sich wieder an den Tisch.
Wenn es nach der ersten Explosion eine zweite gegeben hätte, wäre das etwas anderes gewesen. Dann wäre er sofort in den Keller gelaufen, wie vor drei Jahren, als auf Malaja Starogradowka und seine Umgebung plötzlich Raketen und Granaten niedergeprasselt waren!
Bis es dunkel wurde, blieben noch zwei Stunden. Auch das war seltsam, dass die Rakete am hellen Tag auf das Dorf gefallen war. In der Dunkelheit wäre es klar gewesen, ein Fehlschuss. Aber am Tag? Waren sie betrunken, oder langweilten sie sich in der Stille? Und welche waren es überhaupt: die in Karusselino oder die, die zwischen seinem Dorf und Schdaniwka standen?!
Sergejitsch vermischte seine bitteren Gedanken mit Honig, und ihm wurde leichter zumute. Er goss noch heißes Wasser in den Becher und lächelte beim Blick auf das MTS-Logo. Auch er hatte den russischen Anbieter bei seinem Handy. Sonst hätte er natürlich auch diesen Becher nicht. Nur lag das Handy unbenutzt in der Schublade des Büfetts, zusammen mit dem Ladegerät. Wenn der Strom ins Dorf zurückkehrte, dann konnte er es laden und prüfen, ob es eine Verbindung gab oder ob es damit dasselbe war wie derzeit mit dem Strom. Wenn sowohl Verbindung als auch Strom wiederkamen, dann stellte sich noch eine andere Frage: Wen anrufen? Paschka? Zu dem war es, wenn nötig, billiger, zu Fuß zu gehen. Er hatte seine Nummer auch gar nicht. Um seine Exfrau Witalina anzurufen, musste er im Voraus die richtigen Worte wählen, noch besser, sie auf ein Blatt Papier schreiben und dann vom Blatt ablesen, damit sie den Hörer nicht auflegte! Er könnte sie anrufen und sich wenigstens nach der Tochter erkundigen. Und wenn das Gespräch glückte, dann konnte er auch nach dem Leben in Winnyzja fragen. Wie war es nur dazu gekommen, dass er seine Schwiegereltern kein einziges Mal besucht hatte und überhaupt in den neunundvierzig Jahren seines Lebens fast nirgendwohin gefahren war? Nirgendwohin außer nach Horliwka, Jenakijewe, Donezk und noch in drei, vier Dutzend Bergarbeiterstädte und -siedlungen, in die man ihn, vor der Zuerkennung der Arbeitsunfähigkeit, auf Dienstreisen geschickt hatte. Er hatte ein wichtiges Amt ausgeübt, als Inspektor für Sicherheitstechnik. In manchen Gruben war er zwanzigmal oder häufiger gewesen. Von ihrer Sicherheit hatte er so ausgiebig eingeatmet, dass er mit zweiundvierzig Invalide und Frührentner geworden war. Silikose, Staublunge, war eine ernste Sache. Dass von denen, die unter der Erde arbeiteten oder gearbeitet hatten, viele sie hatten, machte sie irgendwie der Grippe ähnlich. Die Leute husteten eben, das war alles.
Da klopfte jemand mit der Faust an seine Tür.
Sergejitsch schrak zusammen und musste gleich über seinen Schreck lachen: Wer außer Paschka konnte hier auftauchen?
Er öffnete die Tür und sah vor sich Paschkas totenbleiches und von Erbitterung erfülltes Gesicht.
›Doch nicht etwa sein Haus …?‹, dachte Sergejitsch erschrocken.
»Bei Krasjuks hat es das halbe Haus und den Schuppen weggerissen!«, berichtete sein Kindheitsfeind mit zitternder Stimme.
»Hm«, brummte Sergejitsch teilnahmsvoll und ließ Paschka herein.
Er wies ihn zum Tisch, schenkte ihm Tee ein und reichte ihm einen Löffel, damit sein Gast sich Honig gönnte.
Sergejitsch verstand Paschkas Schreck. Krasjuks waren seine übernächsten Nachbarn. Das hieß, wenn es dort gekracht hatte, dann hatte Paschka jetzt keine Fenster mehr. Das stand fest!
»Sersch, ich übernachte heute bei dir, ja? Okay?« Sein Gast sah ihm direkt in die Augen.
»Bleib hier, ja! Hat es dich denn auch getroffen?«
»Die Fensterscheiben«, seufzte Paschka. »Alle! Ich hatte Glück, ein Splitter ist mir am Gesicht vorbeigeflogen und im Büfett steckengeblieben. Ich saß gerade beim Abendessen, Kartoffelbrei mit Speck.«
Paschka verstummte plötzlich und warf Sergejitsch einen vorsichtigen Blick zu. Der begriff den Grund dieser Pause, denn sein Gast hatte soeben ausgeplaudert, dass mit dem Essen bei ihm alles in Ordnung war. Dabei hatte er sich vor kurzem erst beklagt, dass er nichts zu essen hatte! In Gedanken lächelte Sergejitsch. Sein Kindheitsfeind tat ihm jetzt aber trotzdem leid, mit einem kalten Haus und draußen zwölf Grad minus! Wenn das Haus vierundzwanzig Stunden ohne Fenster blieb, musste man es hinterher drei Tage lang aufheizen.
»Gut.« Er nickte. »Du schläfst hier, aber Scheiben müssen trotzdem eingesetzt werden, sonst ziehst du noch ganz hier ein!«
»Wo nehme ich die jetzt her?«, fragte Paschka verwundert.
»Du bist wahrlich kein heller Kopf«, sagte Sergejitsch gutmütig. »Bist zu faul zum Denken! Wenn bei einem Menschen das Herz versagt, dann begräbt man ihn entweder oder sucht schnell einen Spender! Hast du denn nie Zeitungen gelesen?«
»Wieso sagst du das?« In der Stimme seines Gastes schwang Misstrauen. »Was für einen Spender?«
»Also, das Werkzeug habe ich«, überlegte Sergejitsch jetzt laut. »Komm, wir denken nach, welches Haus noch heil ist, aber keine Besitzer mehr hat.«
Paschka freute sich, dass er Sergejitschs Gedanken begriff.
»Klawa Schiwotkina! Sie ist doch noch vor dem Krieg gestorben!«, erinnerte er sich, und im selben Moment erlosch der Enthusiasmus in seinen Augen. »Aber ihr Haus ist alt, die Fenster sind klein. Wir brauchen größere! Vielleicht das Haus von Arsamjan?«
»Ist er denn tot?«, stutzte Sergejitsch.
»Weiß ich nicht.« Paschka zögerte verlegen. »Er ist weggezogen, das ist sicher. Anscheinend nach Rostow! Er ist doch kein Russe, und auch kein Ukrainer! Er ist Armenier!«
»Na und? Er hat hier gelebt, also gehört er zu uns! Überleg weiter! Wie soll ich ihm sonst in die Augen sehen, wenn er zurückkommt?«
»Dann die Serows!« Paschka freute sich. »Sicher! Sie wurden doch von einer Granate getötet! Alle, mit den Kindern!«
»Ja.« Sergejitsch nickte, wurde finster, seufzte schwer. Er erinnerte sich daran, wie die Serows als Erste aus dem Dorf geflohen waren, sie hatten nicht einmal das Ende des Beschusses abgewartet. Und auf der Abreise, schon außerhalb des Dorfes, hatte eine Granate sie erwischt. Sie war direkt auf ihren Wolga gefallen. Der Wolga lag dort noch immer umgekippt auf dem Feldweg hinter dem Dorf.
»Gut.« Sergejitsch sah seinen Gast an. »Wir trinken den Tee aus und gehen! Ich glaube, bis zum Abend schaffen wir es. Mein Glasschneider ist gut.«
8
Paschkas Dankbarkeit für die eingesetzten Fensterscheiben und die eine in Sergejitschs Haus verbrachte Nacht hatte ihre Grenzen. Er überließ ihm sein Fernglas noch für eine Weile. Aber von dem Speck, den er versehentlich erwähnt hatte, als er Hilfe suchte, bot er Sergejitsch nichts an. Nicht ein Stückchen. Sergejitsch sehnte sich nach Speck. Nicht furchtbar natürlich, und hätte Paschka die Kartoffeln mit Speck nicht erwähnt, hätte er auch gar nicht daran gedacht. Aber in kalter Kriegszeit, beim Licht von Kirchenkerzen und ohne Strom, weckte jede Erwähnung früherer kleiner Freuden Sehnsucht und Begierde. Wenn Paschka statt des Specks eine Plötze oder irgendeinen anderen Dörrfisch erwähnt hätte, würde Sergejitsch sich jetzt mit Gedanken über Fisch plagen, genauer, über den Mangel an Fisch. Mangel herrschte in Sergejitschs Haus an fast allem und ständig. Endlos hätte man all das aufzählen können, was um ihn herum und im Keller fehlte. Das Vorhandene hingegen war schnell benannt: Honig, Wodka, verschiedene selbst angesetzte Schnäpse, Arzneien aus Pollen und anderen Bienenschätzen. Irgendwo war noch eine Flasche Kognak »Oktjabrski« versteckt, Sergejitsch wusste nur nicht mehr, wo. Er hatte sie auch schon ein paarmal gesucht, aber nicht gefunden. Wäre er so geschwätzig wie Paschka gewesen, dann hätte er schon längst alle Vorräte mit seinem Kindheitsfeind teilen müssen. In Gedanken wollte er ihn ja gar nicht mehr als »Feind« sehen. Mit jedem neuen Treffen, selbst wenn sie sich stritten, erschien Paschka ihm immer näher und verständlicher. Sie waren jetzt in mancher Hinsicht Brüder, wenn auch, Gott sei Dank, keine echten!
Es klopfte leise an der Tür.
›Oh! Man braucht ihm nur zu helfen, schon ist er auch höflicher‹, dachte Sergejitsch lächelnd.
Er nahm die brennende Kerze vom Tisch und ging hinaus in den Flur.
Er stieß die Tür auf und sah dahinter abendliche Dunkelheit und eine Gestalt, die nicht das Gesicht von Paschka hatte. Es war jünger, mit angespannten Augen, in denen sich die Flamme der Kerze spiegelte.
Das kam so unerwartet, dass Sergejitsch erstarrte. Gleichzeitig erkannte er, dass der Unbekannte, dem er die Tür geöffnet hatte, im Kampfanzug war und über seiner Schulter eine Kalaschnikow mit dem kurzen Lauf nach unten hing.
»Entschuldigen Sie, dass ich so spät … und ohne Vorwarnung«, sagte der Unbekannte verlegen.
Sergejitsch begriff, dass er wohl kaum gekommen war, um ihn zu erschießen oder auszurauben. Wieso hätte er sich sonst entschuldigt! Er holte tief Luft und streckte die linke Hand mit der Kerze etwas näher zu dem ungebetenen Gast. Er sah, dass der noch ganz jung war, zweiundzwanzig, dreiundzwanzig Jahre alt vielleicht.
»Darf ich reinkommen?«, fragte der Unbekannte.
»Wenn du dir die Schuhe ausziehst und das Eisen im Flur lässt!«, sagte Sergejitsch gespielt streng, obwohl er spürte, dass seine Stimme gleich vor Furcht zittern würde. Er hatte einem Soldaten sozusagen befohlen, die Waffe abzugeben!
»Die Schuhe kann ich ausziehen«, sagte der junge Mann im Kampfanzug. »Die Waffe ablegen darf ich nicht.«
»Gut, dann eben so.« Sergejitsch atmete erleichtert auf.
Er schloss die Tür hinter seinem Besucher und legte den eisernen Riegel und den Haken vor. Er warf einen Blick auf die hohen Stiefel, die jetzt an der Wand standen.
Im Zimmer lud er den Unbekannten ein, sich an den Tisch zu setzen.
»Vielleicht einen Wodka?«, fragte er aus Höflichkeit und schimpfte sich gleich im Stillen für die unnötige Gastfreundlichkeit.
»Nein danke!« Der junge Mann schüttelte den Kopf. »Einen Tee würde ich nehmen!«
»Gleich gibt’s Tee.« Sergejitsch nickte.
Ihm schien, als wäre eine Kerze nicht ausreichend für zwei Personen am Tisch. Er holte noch zwei dazu und zündete sie an, verdreifachte sozusagen die Beleuchtung.
»Gleich gibt’s Tee«, wiederholte er und sah dem Unbekannten aufmerksam ins Gesicht, prüfte, ob er beim Licht der einen Kerze in dessen Gesicht nichts übersehen hatte. »Wie heißt du?«
»Ich bin Petro«, sagte der junge Mann.
»Und woher kommst du?«
»Aus Chmelnyzkyj.«
»Hmm«, machte Sergejitsch, als hätte er etwas Wichtiges verstanden. »Von der ukrainischen Armee also?«
Der Junge nickte.
»Artillerie?«, fragte Sergejitsch vorsichtig.
Petro schüttelte den Kopf. »Und wie heißen Sie?«, fragte er.
»Sergej Sergejitsch, oder einfach Sergejitsch. Du heißt wahrscheinlich auch Pjotr, nicht Petro?«
»Nein, Petro! So steht es in meinem Pass.«
»Ich heiße im Pass Serhij Serhijowitsch und im Leben Sergej Sergejitsch. Was für ein Unterschied!« Sein Pass sprach ukrainisch, während seine, Sergejitschs, Sprache Russisch war.
»Sie sind wahrscheinlich mit Ihrem Pass nicht einverstanden?«, vermutete Petro.
»Mit dem Pass bin ich einverstanden, nur nicht damit, wie ich darin heiße!«
»Ich bin sowohl mit dem Pass einverstanden als auch damit, wie ich darin heiße«, sagte der Gast lächelnd. Er lächelte heiter, geradezu entwaffnend. Obwohl die Kalaschnikow jetzt über der Stuhllehne hing.
»Vielleicht bist du eben deshalb einverstanden, weil bei dir der Name im Pass und im Leben derselbe ist!«, sagte Sergejitsch nachdenklich. »Wäre es bei mir so, würde ich auch nicht auf den Pass schimpfen. Also, warum bist du denn zu mir gekommen, Petro? Brauchst du vielleicht etwas?«
»Ja.« Der junge Mann nickte. »Ich wollte Sie kennenlernen. Ich sehe Sie doch schon über ein Jahr, aber Ihren Namen kenne ich nicht!«
»Wo siehst du mich?«, fragte Sergejitsch erstaunt.
»Im Fernglas.« Der junge Mann stockte. »Ich soll das Dorf beobachten. Ich wäre schon früher gekommen, aber tagsüber ist es gefährlich, und im Dunkeln ist es im Prinzip auch verboten, aber es ist weniger gefährlich.«
»Was für eine Gefahr geht denn am Tag von uns aus?«, fragte Sergejitsch verwundert.
»Von Ihnen persönlich keine, aber von den Scharfschützen, die uns die Nerven und das Leben kosten. Vor drei Tagen haben sie zum letzten Mal geschossen, von der Kirche aus!«
»Aber hier kommt doch niemand her!«, erklärte Sergejitsch überzeugt. »Ich hätte die Spuren gesehen! Ich sitze doch nicht bloß im Haus!«
»Vier Tote in einem Jahr und drei Verwundete«, sagte Petro ruhig. Er kratzte sich hinterm Ohr. Dann legte er etwas linkisch seine grüne, wollene Sturmmütze auf den Tisch.
Der Tee war fertig, und Sergejitsch schenkte dem unverhofften Gast und sich selbst ein.
»Wie sieht es denn bei euch dort aus, in der Ukraine?«, fragte er. »Haben alle genug Speck?«
»Ja.« Der junge Mann musste lächeln. »Ich bekomme hin und wieder auch welchen ab. Freiwillige bringen ihn. Und im Land ist alles wie immer! Es wird gestohlen, es werden Straßen und Städte umbenannt. Aber nach dem Krieg soll es besser werden! Dann reisen wir ohne Genehmigung ins Ausland.«
»Ja, die, die dann noch am Leben sind.« Sergejitsch hatte das Gesicht verzogen, fing sich aber sofort wieder. Es hatte so geklungen, als würde er irgendjemandem den Tod wünschen! Er beschloss, das Thema zu wechseln. »Was benennen sie denn um?«
»Sind Sie denn nicht auf dem Laufenden?« Petro machte große Augen und lächelte, so dass man seine kräftigen Zähne sah. »Ach ja! Sie haben keinen Strom! Also können Sie nicht fernsehen!«
»Strom gibt es seit langem keinen, das stimmt«, bestätigte Sergejitsch traurig. »Vielleicht wird das mal in Ordnung gebracht?«
»Zurzeit wohl kaum. Es ist gefährlich. Und für Sie ist es doch besser, nicht fernzusehen, Sie schonen Ihre Nerven!«
»Ich habe eiserne Nerven, die kann man nicht ruinieren!«, prahlte Sergejitsch. »Ich habe als Inspektor für Arbeitssicherheit in den Gruben gearbeitet! Weißt du, was das bedeutet?«
Im Blick des jungen Mannes erschien Respekt.
»Und du, mit was hast du dich beschäftigt?«, erkundigte sich Sergejitsch.
»Mit Tourismus. Ich wollte auf die Krim übersiedeln, ein kleines Hotel bauen.«
»Damit bist du zu spät dran!« Sergejitsch winkte ab. »Ich bin nie auf der Krim gewesen. Dabei wollte ich immer ans Meer, am Strand in der Sonne liegen … Ich habe dort einen Bekannten, wir haben uns auf einem Bienenzüchterkongress kennengelernt. Ein Tatare, Achtem Mustafajew. Auch ein Bienenzüchter. Er hat mich eingeladen, aber bisher hat es nicht geklappt …«
»Irgendwann klappt es noch!«, versuchte der junge Mann, Sergejitsch zu trösten.
»Vielleicht«, stimmte der zu. Plötzlich verdüsterte sich sein Blick, ihm war etwas Unerfreuliches eingefallen. »Wieso holt ihr denn den Toten nicht vom Feld? Er ist doch ganz in eurer Nähe.«
»Welchen? Den im Kampfanzug?« Petro war angespannt.
»Ja! Vielleicht hat ihn schon der Schnee zugedeckt. Ich habe gestern nicht geschaut.«
»Nein.« Der junge Mann seufzte. »Der Wind hat den Schnee fortgeweht. Das ist keiner von uns. Und Leute hinzuschicken, um ihn zu holen, ist gefährlich. Dort auf dem Feld unter dem Schnee sind Stolperdrahtminen, und auch die Leiche selbst kann vermint sein. Sollen die Separos ihn holen! Der gehört zu ihnen.«
»Sie kommen ihn holen, und ihr beschießt sie aus Maschinengewehren?«, fragte Sergejitsch sarkastisch.
»Wenn sie ohne Waffen und mit weißer Fahne kommen, dann können sie ihn holen!«
»Ach so ist das. Aber sie sagen ja, dass das nicht ihr Kämpfer ist!«, bemerkte Sergejitsch und bereute das Gesagte sofort.
»Wann haben Sie denn mit denen geredet?« Petro runzelte die Stirn, und sein Blick wurde kalt und feindselig.
»Nicht ich, das war Paschka, mein Nachbar aus der Schewtschenko! Sie sind zu ihm gekommen, da hat er gefragt.«
»Hmm«, brummte der junge Mann, als würde er daraus seine Schlüsse ziehen. »Wenn er weder zu ihnen noch zu uns gehört, dann ist er also von der ›dritten Kraft‹!«
»Was ist denn das für eine ›dritte Kraft‹?«, erkundigte sich Sergejitsch.
»Niemand weiß das! Bei uns heißt es, da kämpft jemand anonym auf unserer Seite gegen sie. Und bei ihnen sagen sie das Gegenteil – dass jemand auf ihrer Seite gegen uns kämpft. Vielleicht irgendein Spezialkommando, das gegen uns und gegen sie ist. Deshalb freuen sie sich bei uns, wenn von ihnen einer draufgeht, und bei ihnen wird gefeiert, wenn in unserem Rücken plötzlich jemand mit dem Granatwerfer unsere eigenen Schützenpanzer beschießt …«
»Vielleicht nimmst du etwas Honig mit?«, bot Sergejitsch dem Soldaten an.
»Ich gehe ja noch nicht.« Petro lächelte angespannt. »Honig brauche ich nicht. Höchstens hier, zum Tee.«
»Ja, ja, natürlich!« Sergejitsch wurde geschäftig, beugte sich schnell hinunter und hob ein Literglas vom Boden hoch.
Erneut trat Schweigen ein, aber Sergejitsch wollte es nicht mehr brechen. Nach ein paar Minuten fragte er dann allerdings doch wieder nach der Straßenumbenennung.
»Wie nennen sie sie denn jetzt?«, fragte er fast flüsternd.
»Na, wenn es vorher Marx oder Engels war, dann jetzt nach Bandera oder irgendeinem Schriftsteller«, sagte der Soldat.
»Schriftsteller sind besser«, bemerkte Sergejitsch. »Wir sitzen hier übrigens in der Leninstraße.«
»Wenn der Krieg vorbei ist, wird sie ganz sicher umbenannt«, erklärte der junge Mann fest.
»Und wenn ich den neuen Namen selbst aussuchen möchte?«
»Das geht, aber es muss mit den übrigen Bewohnern der Straße gemeinsam entschieden werden. Danach muss man sich an den Ortsrat wenden.«
»Das wird nicht so bald sein«, seufzte Sergejitsch. »Gar nicht bald.«
»So, ich gehe doch mal.« Petro nahm seine Kalaschnikow von der Stuhllehne und hängte sie sich über die Schulter. Mit der linken Hand nahm er die Sturmmütze vom Tisch, und mit der rechten fuhr er in die Tasche seiner warmen Jacke und zog eine RGD5-Handgranate heraus. Er legte sie neben die Tasse.
»Die ist für Sie«, sagte er und sah Sergejitsch respektvoll an. »Es ist doch irgendwie unangenehm, ohne Geschenk in ein fremdes Haus zu kommen. Mit leeren Händen …«
»Ja, also …« Sergejitsch war ratlos. »Was soll ich damit?«
»Zur Selbstverteidigung. Wenn sie nicht gebraucht wird, vergraben Sie sie nach dem Krieg im Garten! Wenn Sie wollen, kann ich Ihr Handy aufladen! Wir haben einen starken Generator, er treibt sogar eine Waschmaschine an!«
Zunächst war Sergejitsch sprachlos, aber nur einen Augenblick lang. Dann zog er das Handy mit dem Ladegerät aus der Büfettschublade und reichte es Petro.